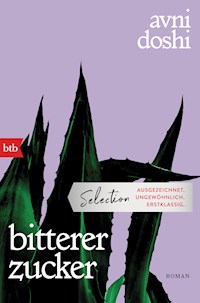
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Bitterer Zucker« ist eine Liebesgeschichte. Aber nicht zwischen zwei Liebenden, sondern zwischen Mutter und Tochter. Und stellt die Frage, was wir wirklich von jenen wissen, die uns am nächsten stehen – und damit letztlich über uns selbst.
Tara erinnert die Vergangenheit auf ihre Art, ihre Tochter Antara auf eine ganz andere. In ihrer Jugend war Tara, Tochter aus gutem Haus, eine eigenwillige Frau, die keine Rücksicht nahm: Sie brach aus ihrer unglücklichen Ehe aus, ging in einen Ashram, wurde die Geliebte des Gurus. Danach lebte sie als Bettlerin auf der Straße – und alles immer mit ihrer Tochter Antara im Schlepptau. Jetzt ist sie eine alte Frau, die Dinge vergisst und über Nacht das Gas anlässt. Und Antara muss sich um eine demente Mutter kümmern, die sich nie um ihre Tochter gekümmert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Tara erinnert die Vergangenheit auf ihre Art, ihre Tochter Antara auf eine ganz andere. In ihrer Jugend war Tara, Tochter aus gutem Haus, eine eigenwillige Frau, die keine Rücksicht nahm: Sie brach aus ihrer unglücklichen Ehe aus, ging in einen Ashram, wurde die Geliebte des Gurus. Danach lebte sie auf der Straße – und alles immer mit ihrer Tochter Antara im Schlepptau. Jetzt ist sie eine alte Frau, die Dinge vergisst und über Nacht das Gas anlässt. Und Antara muss sich um eine demente Mutter kümmern, die sich nie um ihre Tochter gekümmert hat.
»Bitterer Zucker« ist eine Liebesgeschichte. Aber nicht zwischen zwei Liebenden, sondern zwischen Mutter und Tochter. Und stellt die Frage, was wir wirklich von jenen wissen, die uns am nächsten stehen – und damit letztlich über uns selbst.
Zur Autorin
AVNI DOSHI wurde 1982 in New Jersey geboren, heute lebt sie in Dubai. Sie studierte Kunstgeschichte am Barnard College in New York und am University College London. Texte von ihr erschienen in »Vogue«, »Granta« und »The Sunday Times«. Ihr Debütroman »Bitterer Zucker« war ein sensationeller internationaler Erfolg: Er stand auf der Shortlist für den Booker-Preis und erscheint in mehr als 25 Ländern.
Avni Doshi
BITTeRER ZUCKER
Roman
Aus dem Englischen von Frauke Brodd
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Burnt sugar« bei Hamish Hamilton, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe November 2021
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2020 by Avni Doshi
By agreement with Pontas Literary & Film Agency.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von © Penguin Random House UK
Covermotiv: Getty Images/Stanislas Augris/EyeEm
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MK ∙ Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-27965-3V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Nishi, Naren und Pusha the Brave
Ma, ami tumar kachchey aamar porisoi diti diti biakul oya dzai.
Mutter, ich bin so müde, so müde, mich dir immer wieder vorzustellen.
Rehna Sultana, »Mutter«
Zu behaupten, ich hätte mich niemals über das Leid meiner Mutter gefreut, wäre eine glatte Lüge.
Durch ihre Hände habe ich als Kind gelitten, und jeglicher Schmerz, den sie später durchlebte, kam mir wie eine Art Wiedergutmachung vor – eine ausgleichende Gerechtigkeit des Universums, mit der das Prinzip von Ursache und Wirkung austariert wurde.
Nur ist es jetzt so, dass ich die Strichliste nicht mehr angleichen kann.
Aus einem einfachen Grund: Meine Mutter ist dabei zu vergessen, und ich kann nichts dagegen tun. Es gibt keine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass sie sich an die Dinge erinnert, die sie in der Vergangenheit getan hat, keine Möglichkeit, sie mit Schuldgefühlen zu überschütten. Früher habe ich immer mal wieder Beispiele für ihre Grausamkeit erwähnt, ganz beiläufig, bei einer Tasse Tee, um zu beobachten, wie sie missbilligend das Gesicht verzieht. Mittlerweile erinnert sie sich die meiste Zeit nicht einmal mehr daran, worüber ich da rede; sie wirkt abwesend, mit einem Ausdruck beständiger Heiterkeit in den Augen. Jeder, der Zeuge davon wird, wird daraufhin meine Hand berühren und flüstern: Gut jetzt, es reicht. Sie erinnert sich nicht, das arme Ding.
Das Mitgefühl, das sie in anderen weckt, sorgt dafür, dass mir die Galle hochsteigt.
Das erste Mal wurde ich vor einem Jahr argwöhnisch, als sie anfing, nachts durchs Haus zu wandern. Kashta, ihre Hausangestellte, rief mich immer wieder verschreckt an.
»Ihre Mutter sucht nach Matratzenschonern aus Plastik«, sagte Kashta bei einem dieser Anrufe. »Falls Sie Ihr Bett einnässen.«
Ich hielt das Telefon weit weg von meinem Ohr und suchte auf dem Nachttisch nach meiner Brille. Neben mir lag mein Ehemann im Tiefschlaf, seine Ohrstöpsel leuchteten neonfarben im Dunkeln.
»Sie träumt bestimmt nur«, erwiderte ich.
Das schien Kashta nicht zu überzeugen. »Ich wusste ja gar nicht, dass Sie als Kind ins Bett gemacht haben.«
Ich legte auf und konnte den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Selbst in einem Zustand geistiger Umnachtung gelang es meiner Mutter noch, mich zu demütigen.
Eines Tages klingelte die Straßenfegerin, und Mutter wusste nicht, wer sie war. Es gab andere Vorfälle – etwa als sie vergaß, die Stromrechnung zu bezahlen, oder als sie das Auto in der Tiefgarage am falschen Platz abstellte. Das war vor sechs Monaten.
Manchmal glaube ich, das Ende vorherzusehen, wenn nichts weiter von ihr übrig sein wird als eine verrottende und dahinvegetierende Hülle. Die vergisst, wie man spricht, wie man die Blase kontrolliert, und die irgendwann vergisst, wie man atmet. Der menschliche Verfall geht stockend und stotternd vonstatten, aber rückgängig machen lässt er sich nicht.
Mein Mann Dilip meint, ihr Erinnerungsvermögen benötige vielleicht hin und wieder einen Probedurchlauf. Also schreibe ich Anekdoten aus der Vergangenheit meiner Mutter auf kleine Zettel und verteile sie überall in ihrer Wohnung. Ab und zu wird sie fündig und ruft mich dann lachend an.
»Ich kann es nicht fassen, dass mein Kind so eine miese Handschrift hat.«
An dem Tag, an dem sie den Namen der Straße vergaß, in der sie seit zwanzig Jahren wohnte, rief Ma mich an, um mir von ihrem Kauf einer Packung Rasierklingen zu berichten, und dass sie keine Angst davor hätte, sie zu verwenden, sollte sich die Situation noch weiter verschlechtern. Dann fing sie an zu weinen. Durchs Telefon hörte ich blökende Hupen, brüllende Menschen. Den Sound der Straßen von Pune. Sie musste husten und verlor den Faden. Ich konnte die Abgase der Autorikscha, in der sie saß, förmlich riechen, den schwarzen Qualm aus dem Auspuff des Gefährts, so als würde ich direkt neben ihr stehen. Einen Augenblick lang fühlte ich mich schlecht. Es musste die schlimmste Form des Leidens sein – das Bewusstsein für den eigenen Verfall, die Buße, dabei zusehen zu müssen, wie die Dinge einem entgleiten. Andererseits wusste ich auch, dass es eine Lüge war. Meine Mutter würde niemals so viel Geld ausgeben. Eine ganze Packung Rasierklingen, wo eine einzige bereits ihren Zweck erfüllte? Sie neigte tatsächlich schon immer dazu, ihre Gefühle in der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Ich beschloss, dass die beste Art, mit dieser Situation umzugehen, so was Ähnliches wie ein Kompromiss war: Ich bat meine Mutter nicht zu übertreiben, notierte mir die Sache aber, um zu einem späteren Zeitpunkt nach irgendwelchen Rasierklingen zu suchen und sie zu entsorgen.
Ich habe mir viele Notizen über meine Mutter gemacht: die Uhrzeit, zu der sie abends einschläft, wenn ihre Lesebrille über den fettigen Nasenrücken nach unten rutscht, oder die Anzahl der Marz-O-Rin-Teigteilchen, die sie zum Frühstück isst – all das habe ich detailliert aufgeschrieben. Ich kenne die umschifften Untiefen, und weiß, an welchen Stellen eine Geschichte glattpoliert wurde.
Manchmal bittet sie mich während meiner Besuche darum, Freunde anzurufen, die längst tot sind.
Meine Mutter war eine Frau, die sich Kochrezepte ein einziges Mal durchlas und sich dabei alles einprägte. Sie konnte Teemischungen abrufen, die bei anderen Leuten zu Hause zubereitet worden waren. Beim Kochen griff sie nach verschiedenen Fläschchen und Masala-Gewürzmischungen, ohne einmal aufzublicken.
Ma erinnerte sich genau an die Handgriffe, mit denen ihre Nachbarn, die zur muslimischen Memon-Gemeinde gehörten, auf der Terrasse oberhalb des ehemaligen Apartments ihrer Eltern die Ziegen zum islamischen Opferfest Bakra Eid töteten, sehr zum Entsetzen des Hausbesitzers, der Jain war, und wie der muslimische Schneider mit den drahtigen Haaren ihr einmal einen verrosteten Waschzuber gab, um das Blut aufzufangen. Sie beschrieb mir den metallischen Geschmack und wie sie sich ihre roten Finger abgeleckt hatte.
»Meine erste nicht-vegetarische Kostprobe«, sagte sie. Wir saßen am Ufer in Alandi. Pilger wuschen sich, und Trauernde verteilten Asche im Wasser. Der schmutzige Fluss, der die Farbe von Gangrän hatte, bewegte sich unmerklich vorwärts. Ma hatte unbedingt aus dem Haus abhauen wollen, weg von meiner Großmutter, weg vom Gerede über meinen Vater. Wir befanden uns in einer Zwischenphase, nach unserem Weggang aus dem Ashram und bevor sie mich aufs Internat schicken würden. Zwischen meiner Mutter und mir herrschte für einen Moment Waffenstillstand, da ich noch daran glauben konnte, dass das Schlimmste hinter uns lag. Sie sagte mir nicht, wohin wir in der Dunkelheit unterwegs waren, und ich konnte den Zettel, der vorne auf den Bus, in den wir einstigen, geklebt war, nicht entziffern. Mein Magen knurrte, aus Angst, wir würden aufgrund einer weiteren Laune meiner Mutter wieder einmal abtauchen, aber wir blieben in der Nähe des Flusses, wo der Bus uns abgesetzt hatte, und als die Sonne aufging, zauberte das Licht Regenbögen in die Benzinpfützen, die sich auf der Wasseroberfläche gebildet hatten.
Sobald tagsüber die Hitze einsetzte, fuhren wir nach Hause. Nani und Nana waren außer sich, aber Ma meinte nur, wir hätten das Gelände der Anlage, in der wir lebten, nicht verlassen. Sie glaubten ihr, weil sie ihr glauben wollten, obwohl ihre Geschichte unglaubwürdig war. Denn das Areal, auf dem die Gebäude standen, war nicht groß genug, um darauf verschüttzugehen. Ma lächelte beim Reden – Lügen kamen ihr leicht über die Lippen.
Es beeindruckte mich, dass sie eine derartig gewiefte Lügnerin war. Eine Zeit lang wollte ich ihr in dieser Eigenschaft nacheifern; sie schien mir ihr einziger nützlicher Charakterzug zu sein. Meine Großeltern befragten den Wachmann, aber er konnte nichts zu der Sache beisteuern – er schlief oft bei der Arbeit ein. Und so verharrten wir in dieser Pattsituation – wie wir es noch so oft tun würden –, wo alle an ihren Lügen festhielten, in der festen Überzeugung, dass ihr ureigener Egoismus sich durchsetzen würde. Ich wiederholte die Geschichte meiner Mutter, als ich später noch einmal ausgefragt wurde. Noch hatte ich nicht gelernt, was Widerspruch bedeutete. Noch war ich gefügig wie ein Hund.
Manchmal spreche ich über Ma in der Vergangenheitsform, obwohl sie noch am Leben ist. Es würde sie verletzen, wenn sie noch in der Lage wäre, sich daran zu erinnern. Dilip ist momentan ihr Lieblingsmensch. Er ist ein idealer Schwiegersohn. Wenn sie sich begegnen, brauen sich keine Wolken aus Erwartungen um sie herum zusammen. Er erinnert sich nicht daran, wie sie war – er akzeptiert sie, wie sie ist, und er stellt sich ihr immer wieder gerne vor, wenn sie seinen Namen vergessen hat.
Ich wünschte, ich wäre genauso, aber dann taucht die Mutter, an die ich mich erinnere, vor mir auf und entschwindet wieder, eine von einer Batterie angetriebene Puppe, deren Mechanismus fehlerhaft ist. Die Puppe ist auf einmal leblos. Der Bann ist gebrochen. Das Mädchen weiß nicht, was real ist oder worauf man sich verlassen kann. Vielleicht wusste sie das noch nie. Das Mädchen weint.
Ich wünschte, Indien würde die Beihilfe zum Suizid ermöglichen wie die Niederlande. Nicht nur im Namen der Würde des Patienten, sondern im Namen aller Betroffenen.
Ich sollte betrübt sein statt wütend.
Manchmal, wenn niemand sonst in der Nähe ist, weine ich – ich trauere, aber es ist zu früh, den Leichnam zu verbrennen.
Die Wanduhr in der Arztpraxis nimmt meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Stundenzeiger steht auf der Eins. Der Minutenzeiger ruht zwischen acht und neun. Diese Anordnung hat dreißig Minuten lang Bestand. Die Uhr ist ein vergängliches Relikt aus einer anderen Zeit, kaputtgegangen, nie ersetzt.
Der teuflischste Teil ist der zweite Zeiger, der, wie der Zauberstab einer Hexe, das Einzige an der ganzen Uhr ist, das sich bewegt. Nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts, vor und zurück, gänzlich unberechenbar.
Mein Magen knurrt.
Als der zweite Zeiger ganz aufhört, sich zu bewegen, kommt von den anderen im Wartezimmer ein hörbarer Seufzer der Erleichterung, dabei hat er sich nur für einen Moment tot gestellt, bis er wieder von Neuem loslegt. Ich beschließe, nicht mehr hinzusehen, aber das Ticken hallt durch den ganzen Raum.
Ich blicke zu meiner Mutter. Sie döst auf ihrem Stuhl.
Ich spüre, wie das Ticken der Uhr durch meinen Körper wandert und meinen Herzschlag modifiziert. Es ist kein Tick-tack. Ein Tick-tack ist allgegenwärtig, ein Puls, ein Atemzug, ein Wort. Ein Tick-tack birgt ein biologisches Echo in sich, etwas, das ich verinnerlichen und ignorieren kann. Das hier ist ein Tick-tick-tick, gefolgt von einer länger andauernden Stille, und dann ein Tock-tock-tock.
Mas Mund steht leicht offen, konturlos wie eine Papiertüte.
Durch die Fensterscheibe aus gewelltem Glas sehe ich ein paar Tagelöhner, die sich um einen schmalen Tisch versammelt haben, um die Berichterstattung eines Spiels zu verfolgen. Sie klatschen und sonnen sich in der Übertragung des Ruhms, der aus den Lautsprechern strömt. Das Ticken verändert sich noch einmal.
Im Behandlungszimmer des Arztes bekommen wir es mit einer anderen Art Uhr zu tun. Diese hier malt der Arzt auf ein weißes Blatt Papier und lässt die Zahlen weg.
»Malen Sie das aus, Mrs Lamba«, bittet er meine Mutter.
Sie nimmt ihm den Stift aus der Hand und fängt mit der Eins an. Als sie bei fünfzehn ist, stoppt er sie.
»Wissen Sie, welches Datum heute ist?«
Ma sieht mich an, dann wieder den Arzt. Als Antwort zieht sie die Schultern hoch, eine Seite etwas höher als die andere, angesiedelt irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Zusammenzucken.
Jedes einzelne Anzeichen ihres Verfalls löst Abscheu in mir aus. Ich glotze die cremefarbenen Wände an. Die Diplome des Arztes hängen schief.
»Oder welches Jahr?«
Meine Mutter nickt bedächtig.
»Fangen Sie mit dem Jahrhundert vor dem Jahr an«, sagt er.
Sie öffnet den Mund, und ihre Mundwinkel hängen herab wie ein Fisch. »Neunzehn …«, fängt sie an und blickt in die Ferne.
Der Arzt neigt den Kopf zur Seite. »Ich denke, Sie meinen zwanzig.«
Sie nickt und lächelt ihn an, als sei sie stolz auf ihre Leistung. Der Arzt und ich suchen im Blick des anderen nach einer Antwort.
Der Arzt redet weiter, dass sie in besonderen Fällen Flüssigkeit aus dem Rückenmark entnehmen, er aber noch nicht entschieden habe, ob Ma ein besonderer Fall sei. Stattdessen macht er Scans, nimmt Blut ab, untersucht die Körperöffnungen und Drüsen und klemmt die Kartierung ihres Gehirns vor eine Leuchttafel. Er analysiert Schatten und Muster und sucht nach schwarzen Löchern. Sie hat das Gehirn einer jungen Frau, darauf beharrt er, ein Gehirn, das tut, was es tun soll.
Ich frage, was ein Gehirn denn tun solle. Neuronen abfeuern und knistern vor lauter elektrischen Strömen?
Er kneift missbilligend die Augen zusammen und antwortet mir nicht. Seine Kiefermuskeln sorgen dafür, dass er einen Quadratschädel und einen leichten Überbiss hat.
»Aber meine Mutter ist dabei, alles zu vergessen«, fahre ich fort.
»Ja, das stimmt«, erwidert er, und ich bemerke ein Lispeln. Der Arzt malt ein Bild auf ein jungfräuliches Blatt Papier, eine fluffige Wolke, die ein Gehirn darstellen soll. Er löst seinen Kuli zu früh vom Papier, und die gewellten Linien berühren sich an den Enden nicht, als wäre die Wolke undicht. »Wir müssen mit einer kognitiven Verschlechterung rechnen, die sich in Gedächtnisverlust und Persönlichkeitsveränderungen manifestiert. Es wird sich nicht allzu sehr von dem unterscheiden, was uns bereits aufgefallen ist.«
»Was Ihnen bereits aufgefallen ist«, korrigiert er sich. »Es ist unklar, wie viel Ihre Mutter mitbekommt.«
Mit einem Bleistift markiert er die Bereiche, in denen die Funktionsfähigkeit der Synapsen schwindet, in denen die Neuronen absterben. Die reinweiße Wolke wirkt langsam überfüllt. Nun scheint es, als wäre die Öffnung, die er nicht vollständig geschlossen hat, ein Segen, eine Möglichkeit, Luft in das Gebilde hineinzulassen. Der Neokortex, das limbische System und die subkortikale Region werden mittels eines unschönen Durcheinanders aus Linien abgebildet. Ich sitze einfach da und tue nichts.
Der Hippocampus ist die Speicherbank, und bei dieser Krankheit werden die Tresore geleert. Das Langzeitgedächtnis ist nicht mehr imstande, sich auszubilden, das Kurzzeitgedächtnis verschwindet im Äther. Die Gegenwart wird ein fragiler Zustand, den es wenige Augenblicke später niemals gegeben zu haben scheint. Während der Hippocampus schwächer wird, nimmt man Zeiträume womöglich anders wahr, verzerrt.
»Wissen Sie etwas von einer schwereren Kopfverletzung? War sie jemals, soweit Ihnen bekannt, irgendwelchen Giften ausgesetzt. Schwermetalle vielleicht? Hatte irgendjemand sonst in der Familie jemals irgendwelche Probleme mit dem Erinnerungsvermögen? Oder irgendwelche Probleme mit Immunität? Es tut mir sehr leid, aber wir müssen nach HIV und AIDS fragen.«
Die Fragen entströmen seinem Mund, bevor ich die Zeit finde, darauf zu antworten, und ich begreife, dass das, was ich sage, letztendlich kaum von Bedeutung ist. Eine sorgfältige Offenlegung der Informationen wird rein gar nichts daran ändern, worüber wir uns in diesem Arztzimmer austauschen, und Mas Geschichte wird keinen Einfluss haben auf ihre Diagnose.
Mitten hinein in die kurvigen Linien der Wolke zeichnet er ein Sternchen. Daneben schreibt er »amyloide Plaque«. Die Plaques sind Protein-Anordnungen, die normalerweise im Gehirn eines Alzheimer-Patienten zu finden sind.
»Haben Sie eins dieser Dinger in dem Scan entdeckt?«, frage ich.
»Nein, zumindest noch nicht. Aber Ihre Mutter ist dabei, alles zu vergessen.«
Ich teile ihm mit, dass ich nicht verstehe, wie das möglich sein kann, und als Antwort schreibt er eine Liste mit einigen auf dem Markt erhältlichen Medikamenten. Donepezil ist das gängigste. Er kringelt es dreimal ein.
»Welche Nebenwirkungen hat es?«
»Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Magenprobleme, Depression.« Er blickt kurz hoch zur Decke und blinzelt bei dem Versuch, sich an weitere zu erinnern. In seiner Zeichnung sieht die amyloide Plaque gar nicht so schlimm aus. Sie hat etwas Magisches an sich, ein einzelnes desorganisiertes Garnknäuel. Ich spreche den Gedanken laut aus und bereue es kurz darauf.
»Strickt sie?«, fragt er.
»Nein. Sie hasst alles, was mit häuslicher Tätigkeit zu tun hat. Außer Kochen. Sie ist eine wunderbare Köchin.«
»Tja, das wird nichts nützen. Rezepte sind bekanntermaßen schwer im Kopf zu behalten. Stricken kann, sobald es ins Muskelgedächtnis eingespeist ist, Teile des Gehirns überbrücken.«
Ich zucke mit den Achseln. »Ich kann es ja mal versuchen. Sie wird die Idee hassen.«
»Bei ihr kann man sich mit nichts mehr sicher sein«, entgegnet er. »Vielleicht ist sie morgen ein völlig anderer Mensch.«
Auf dem Weg nach draußen fragt mich der Arzt, ob wir mit einem Doktor Vinay Lamba verwandt seien, Chefarzt an einem bedeutenden Bombayer Krankenhaus. Ich verneine, und er wirkt enttäuscht, wie bedauerlich für uns. Ich frage mich, ob das Erfinden einer verwandtschaftlichen Beziehung hilfreich gewesen wäre.
»Lebt Ihre Mutter mit jemandem zusammen, einem Ehemann oder einem Sohn?«, will er wissen.
»Nein«, antworte ich, »sie lebt allein. Momentan.«
»Kau nicht an deinen Fingernägeln«, rügt Ma mich auf dem Nachhauseweg.
Ich lege meine rechte Hand zurück aufs Lenkrad und bemühe mich, es nicht zu umklammern, aber da bewegt sich meine linke Hand schon automatisch zum Mund.
»Eigentlich kaue ich nicht die Fingernägel ab, sondern die Nagelhaut.«
Ma sagt, dieser Unterschied sei ihr völlig egal und es sei ein Jammer, dass meine Finger so aussähen, wo ich doch so viel mit den Händen arbeiten würde. Ich bleibe stumm, während sie die ganze restliche Fahrt über weiterredet, und höre weniger auf das, was sie sagt, sondern eher darauf, wie sie es sagt, auf Rhythmus und Zaudern in ihrer Stimme, sobald sie nicht das sagt, was sie meint, sobald sie sich verspricht und einen Rüffel einbaut, um ihre eigene Unsicherheit zu überspielen. Sie entschuldigt sich, sagt, ich allein sei schuld an meinen Fehlentscheidungen, dankt mir und massiert seufzend ihre Schläfen. Ihre Lippen sinken dort ein, wo ihr seitlich zwei Zähne fehlen, und sie sieht aus, als hätte sie etwas Bitteres gegessen.
Ich frage meine Mutter, mit wem sie sich gerade unterhält, aber sie gibt mir keine Antwort. Ich werfe kurz einen Blick nach hinten auf die Rückbank, sicher ist sicher.
In ihrem Apartment trinken wir Tee und essen Vollkornkekse, weil das Mas Lieblingskekse sind und es ein anstrengender Tag war. Ich bitte Kashta, mir eine Paste aus Ingwer und Honig gegen das Kratzen in meinem Hals zuzubereiten. Meine Mutter schweigt, während ich die Anweisungen gebe.
»Tu noch ein bisschen frisches Kurkuma dazu«, sagt sie schließlich doch noch. »Nur ein kleines Stück, so groß wie die Vorhaut eines Babys, das reicht.«
Sie presst den Nagel ihres Daumens gegen die Spitze ihres Mittelfingers, als sie das sagt, um die exakte Größe abzumessen. Dann wirft sie einen Blick in ihre Teetasse und rührt ein Oval in deren Firmament.
»Bitte keine Gespräche über Vorhäute.« Ich teile die Kekse in zwei Hälften.
»Was gibt’s denn gegen ein kleines Stück Vorhaut einzuwenden? Sei nicht so prüde.« Wie sie mich beleidigen kann, weiß sie immer noch ganz genau.
In ihrem Apartment herrscht ziemliches Chaos. Ich kippe das Salz aus drei Salzstreuern in einen. Ein Stapel ungelesener Zeitungen liegt auf dem Esstisch für vier Personen. Ma besteht darauf, sie zu behalten; sie meint, sie würde sie eines Tages alle lesen.
Ich schütte eine kleine Tüte Mungo-Bohnen vom Markt auf einen stählernen Thali und trenne die Hülsenfrüchte von den Steinchen. Kashta will mir den Teller wegnehmen, aber ich schubse sie zur Seite. Als ich fertig bin, sortiere ich die Mungo-Bohnen nach ihren Farbschattierungen – Tarnfarben-Grün, Taupe, Beige. Meine Mutter mustert die getrennten Häufchen und schüttelt den Kopf. Ich lasse die Fingerknöchel knacken und mache mit dem Sortieren weiter. Ich weiß, dass es keinen Unterschied macht, wenn sie erst mal alle im Topf verschwinden, aber ich habe nun mal angefangen, und jetzt kann ich nicht mehr aufhören, ich kann einfach nicht aufhören, nach Unterschieden zu suchen, bis sie alle da liegen, wo sie hingehören, kodiert, umgeben von ihresgleichen, ihrer eigenen Familie.
Ma macht auf dem Sofa ein Nickerchen, und für einen Moment kann ich mir vorstellen, wie sie aussehen wird, wenn sie stirbt. Wenn ihre Gesichtszüge schlaff werden und die Atemluft aus ihrer Lunge weicht. Um sie herum befinden sich lauter Dinge, Unterlagen, gerahmte Fotos von Menschen, die sie seit Jahren nicht mehr getroffen hat. Zwischen all dem wirkt ihr Körper leblos und allein gelassen, und ich frage mich, ob Auftritte vor der ganzen Welt etwas Lebenserhaltendes freisetzen, ob der Druck, vor einem Publikum zu stehen, das Weiterpumpen des Blutes erzwingt. Man gerät leicht ins Wanken, wenn niemand mehr zuschaut.
Mein ehemaliges Zimmer passt nicht zum Rest der Wohnung, wie ein Transplantat aus fremder Haut. Ich habe eine Ordnung, eine Symmetrie hinterlassen – und ihr ist es nicht gelungen, diesen Zustand zunichtezumachen. An der Wand habe ich Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Gesichtern aufgehängt, identisch gerahmt und im Abstand von fünf Zentimetern. Das Bett ist gemacht, und ich streiche mit der Hand über die Laken, um die Falten herauszukriegen, die beim Bügeln in den Stoff gepresst wurden.
Seit den letzten Wahlen schreit Ma jedes Mal, wenn der Premierminister auf dem Bildschirm erscheint, den Fernseher an. Er trägt seinen safrangelben Überwurf wie das Attribut einer Hindu-Gottheit – mit stilisierten Falten, die immer an derselben Stelle knitterig sind. Er sei der Grund, sagt sie, warum sie nie die wahre Liebe kennenlernen durfte.
Als ich aufwache, ist es bereits dunkel. Mein Handy leuchtet – ein Dutzend verpasster Anrufe von Dilip. Aus dem Wohnzimmer blitzen Lichter auf. Meine Mutter scheint stumm geschalteten, aber sich bewegenden Mündern im Fernsehen zuzuschauen.
Der Himmel ist düster, aber das fünfzehn Kilometer entfernte Industriegebiet schenkt uns pinkfarbenes Licht als ein Präludium zur Sonne. Als ich mein Zimmer verlasse, ist sie nicht auf dem Sofa, und zuerst entdecke ich sie nicht, denn sie steht hinter den durchsichtigen Vorhängen und presst ihren Körper gegen die Fensterscheibe. Die schweren Vorhänge mit dem grau-weißen Paisley-Muster verbergen sie zum Teil und werfen Schatten auf ihren Körper. Durch den Gardinenstoff erkenne ich ihr dunkles Muttermal, eine störende ovale Erhebung auf ihrem Schulterblatt, eine Zielmarke auf ihrem Rücken. Ihr Brustkorb bewegt sich nicht, als würde sie nicht atmen.
Sie ist nackt, und sie tritt einen Schritt zurück, um ihr Spiegelbild in der Scheibe zu betrachten. Ihr Blick wandert zu meinem, als es neben ihrem auftaucht, dann hin und her, als erkenne sie den Unterschied nicht. Gegensätze ähneln sich oft.
Ich berühre Mas Ellbogen, und sie zuckt zurück. Dann zeigt sie auf den Fernsehbildschirm, auf den Mann, den sie mit der Fernbedienung mundtot gemacht hat.
»Ihr steckt da alle mit drin«, flüstert sie.
»Ma.« Ich versuche, sie zu beruhigen, sie vom Fenster wegzuziehen, aber sie will wieder zurück, mit einem düsteren, wilden Ausdruck in den Augen, und ich bin mir nicht sicher, ob sie mein Gesicht erkennt. Sie erholt sich schnell, aber dieser Blick reicht aus, um mir die Luft zum Atmen zu nehmen. Einen Augenblick lang wusste sie nicht, wer ich war, und in diesem Augenblick bin ich niemand.
Ich rede ihr gut zu, zurück ins Bett zu gehen, und rufe den Arzt an. Seine Stimme klingt abweisend. Woher ich seine Nummer hätte, will er wissen. Unser Gespräch fühlt sich plötzlich vertraulich an, als hätte ich eine Grenze überschritten. Seine Frau liegt mit Sicherheit neben ihm, aus dem Schlaf gerissen. Ich male mir aus, was sie im Bett anhaben, wie ihre Nachtwäsche beim Schlafen verrutscht. Ich spüre, wie ich zwischen den Beinen feucht werde.
»Meine Mutter hat mich für einen Moment nicht erkannt«, sage ich.
»Das kann passieren. Sie sollten sich damit vertraut machen, wie die Krankheit voranschreiten wird.« Seine Zunge hört sich für seinen Mund zu groß an, seine Stimme verrät seine Verärgerung, und ich fühle mich, als würde ich gerade durch eine Prüfung rasseln.
Den Tag verbringe ich damit, Ideen in meinem Kopf hin und her zu wälzen. Naturwissenschaft hat mich noch nie interessiert, aber ich öffne mich für diese Sintflut von Fachausdrücken.
Ich schlage die chemische Zusammensetzung der Medikamente meiner Mutter nach, eine Reihe formschöner Hexagone, an denen ein Molekül aus Hydrogen-Chlorid wie ein Schweif hängt. Ich fördere Tierstudien zutage, Diagramme von Rattengehirnen, die man geöffnet hatte, um deren Aktivität grafisch darzustellen. Die kleinen Tabletten, die sie einnehmen muss, hemmen die Cholinesterase, ein Enzym, das den Neurotransmitter Acetylcholin zersetzt. Das wiederum begünstigt Abläufe, die Symptome im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf der Krankheit verbessern.
Im Körper angereichertes Acetylcholin kann toxisch sein.
Acetylcholin findet man in Pestiziden und in Komponenten chemischer Kriegswaffen, vulgo Nervengas.
Eine niedrige Dosis von etwas kann ein Wundermittel sein. Eine hohe Dosis tödlich.
Ich öffne ein anderes Fenster. Helicobacter pylori verursacht Magengeschwüre und Krebs, wenn es sich unkontrolliert vermehrt; ist es hingegen in den Körpern von Kindern nicht vorhanden, steigt die Häufigkeit von Asthma.
Wenn doch nur Mäßigung ein Wohlfühlfaktor wäre.
Die Liste mit den Nebenwirkungen ist länger, als der Arzt angedeutet hat. Ich möchte ihn sofort erneut anrufen, aber ich scheue davor zurück. Mein Verhältnis zu ihm ist angespannt. Kann man es überhaupt ein Verhältnis nennen? Ich kreide es mir schwer an, dass ich viel zu lange darüber nachdenke.
Es gibt Chat-Gruppen, die sich den Todesfällen in Verbindung mit Donepezil verschrieben haben; sie führen Wirkungslosigkeit an, nebst anderen Missständen. Krill-Öl wird durch die Bank für ein gesundes Gehirn empfohlen. Die Struktur dieses winzigen Krebstieres, dieser Kreatur, die ihren Körper mit nichts weiter als fadendünnen Beinen fortbewegen kann, grenzt an Vollendung. Krill ist besser als Fisch, und ein Diagramm zeigt auf, warum: Das Gehirn bevorzugt die Phospholipiden-Struktur, die Krill-Öl einnimmt.
Ich kopiere den Aufbau und die chemischen Formeln des Öls per Hand auf einen Schreibblock, aber meine Zeichnung weicht vom Original ab und sieht eher nach einem Krill aus als nach einem Molekül. Der Außenpanzer ist ein zierliches Ethylester, und drei fetthaltige Säuren bilden seine strampelnden Gliedmaßen. Als ich meine Versuche fortsetze, das Öl zu bestellen, erhalte ich eine Warnung, dass die Firma nicht für Verzögerungen bei der indischen Zollabfertigung verantwortlich ist.
Sie erinnern mich daran, dass das Öl lichtempfindlich ist und bei hohen Temperaturen ranzig wird.
Mein Ehemann Dilip ist in Amerika aufgewachsen, und er bricht sein Roti mit beiden Händen. Ich lernte ihn vor ein paar Jahren kennen, nachdem er der Arbeit wegen nach Pune gezogen war. Der Wechsel war eine Degradierung, aber das erwähnte er nicht, als er in der deutschen Bäckerei auf der North Main Road mit seiner Anmache loslegte. Ich hatte nicht erwartet, außer mir noch jemanden dort anzutreffen, da es Sonntagmorgen war und kaum mehr Leute herkamen seit dem Anschlag im Jahr 2010, als in dem dazugehörigen Café eine Bombe explodiert war.
Ich ließ mich gerade mit meinem Laptop auf einem roten Plastikstuhl nieder, als er auf den Platz neben mir rutschte. Er lächelte. Seine Zähne waren gerade weiße Kacheln. Er fragte mich nach dem WiFi-Kennwort und ob er mir einen Kaffee spendieren dürfe. Ich sagte, Kaffee mache mich hibbelig, manchmal geschwätzig. Er fragte mich, woran ich gerade arbeiten würde, und obwohl ich ihm nichts über meine Zeichnungen erzählen wollte, räsonierte ich darüber, dass Künstler keine Angst davor haben dürften, mit Fremden Geheimnisse zu teilen.
Er atmete beim Zuhören tief ein und beugte sich vor. Der rote Plastikstuhl verformte sich unter seinem Gewicht, und sein Knie rückte in einem spitzen Winkel näher. Wir starrten uns eine Weile an, und er fragte mich, ob ich Lust hätte, mit ihm am Wochenende eine Mahlzeit einzunehmen. Bei dem Ausdruck »Mahlzeit einnehmen« kniff ich kurz die Augen zusammen, bis ich kapierte, dass er ein Abendessen meinte. (Seitdem habe ich viele seiner Sprachmuster übernommen.)
Er fragte mich, ob ich von den Restaurants rund um den Ashram welche kennen würde.
»Ja, ich habe einen Teil meiner Kindheit im Ashram verbracht. Ich kenne die Gegend gut«, sagte ich.
Das Date verlief angenehm. Wir teilten uns Spaghetti, als kleine Nester zubereitet und angerichtet: außen dekoriert mit grünen Basilikumblättern und in der Mitte geröstete rote und gelbe Kirschtomaten, die hineingelegt waren wie unbebrütete Eier. Die hohen Banyanbäume warfen ihre Schatten über den in Flutlicht getauchten Innenhof, und die Gesichter der anwesenden Gäste waren nicht zu erkennen. Wir saßen an einem in einer Ecke versteckten Tisch, der perfekt gewesen wäre für ein Paar, das eine Affäre hat, so perfekt, dass sie sich Nachrichten mit nur einem Zeichen hätten schicken können – und zwar einer Zahl, um die Zeit festzulegen –, denn der Ort könnte derselbe bleiben.
Ich sagte laut, was ich da gerade gedacht hatte, und er fand es amüsant, ja sogar kreativ und fragte mich, ob ich mir gerne Geschichten ausdachte. »So effizient wie möglich miteinander zu kommunizieren hat mich schon immer interessiert«, sagte ich. Ich wollte ihn fragen, ob wir gerade ein Date hätten. Normalerweise schlief ich mit Männern, mit denen ich befreundet war oder die ich über Freunde kennengelernt hatte, und wir blieben dann irgendwas auf der Skala zwischen Freunde und Lover, aber da war nie ein Teller voller Essen oder das Bezahlen einer Rechnung dabei.
Dilip erzählt die Geschichte anders. Oder aber die Geschichte klingt mit seiner Stimme anders, mit den gerundeten Vokalen und den zerkauten Wörtern. Er beschreibt das Gefühl, das er hatte, als er mich gesehen hat, sagt, ich hätte ausgesehen wie eine unkonventionelle Künstlerin, und erinnert sich, dass auf dem Hemd, das ich trug, Farbe war. Das ist gelogen – ich trage die Klamotten, in denen ich arbeite, niemals außerhalb meines Ateliers. Und ich bin keine Malerin.
Dilip neigt zu Übertreibungen. Er sagt, seine Schwester sei eine Schönheit, was sie eindeutig nicht ist. Er hält eine Menge Leute für nett, die das nicht verdient haben. Ich führe es darauf zurück, dass er selbst sowohl gut aussehend als auch nett ist. Dilip redet auch gerne über seine Millionen Freunde, die er zu Hause hat, von denen aber nur vier zu unserer Hochzeit nach Pune kamen. Nicht, dass es mir etwas ausgemacht hätte. Unsere Hochzeitsfeierlichkeiten dauerten nur zwei Tage, auf mein Drängen, was laut seiner Mutter nicht lang genug sei, damit die Reise sich lohne. Seine Eltern und seine Schwester kamen aus den Staaten, ein halbes Dutzend weitere Verwandte im Schlepptau. Meine Großmutter sagte, dass Gujarati aus Amerika einen enttäuschenden Hochzeitszug abgäben.
Im Vorfeld nannte Dilips Mutter ihrem Astrologen mein Geburtsdatum und die Uhrzeit, um sicherzugehen, dass meine Sterne zu denen ihres Sohnes passten. In Wahrheit hatte meine Mutter bereits vor Jahren meine Geburtsurkunde verloren, während der Zeit, als wir obdachlos waren, und weil es ein riesiger Aufwand gewesen wäre, den offiziellen Geburtseintrag anzufordern, erfanden wir einen angemessen wirkenden Annäherungswert.
»Ich weiß, dass es dunkel war«, sagte Ma.
»Das grenzt das Ganze ein auf früh am Morgen oder spätabends«, erwiderte ich.
Wir berichteten Dilips Mutter, ich sei um 20 Uhr 23 abends geboren, 2023 Militärzeit. Für die Dreiundzwanzig haben wir uns entschieden, weil alles, was mit null oder fünf endet, vielleicht wie ausgedacht angemutet hätte. Vier Monate vor der Hochzeit rief mich Dilips Mutter zu Hause an.
»Der Pandit hat mich angesprochen«, sagte sie. »Er ist sehr besorgt.«
Man hatte für mich ein Geburtshoroskop erstellt, ein Horoskop, um den Himmel in dem Augenblick abzubilden, in dem ich geboren wurde. Mangal, der rote Planet, befand sich wohl in einem gefährlichen Aspekt, platziert mitten im Haus der Hochzeit.
»Du bist eine Manglik. So nennt man Leute wie dich«, sagte sie. Die Verbindung war schlecht, und ich verpasste den Rest der Anschuldigung. Bei einer Heirat mit ihrem Sohn, erklärte sie mir, könnten meine bösen Kräfte ihn töten. Ich schwieg erst mal und überlegte, ob das ein abgekartetes Spiel war: Hatte Dilip seine Mutter gebeten, mich anzurufen und unsere Verlobung zu lösen? Ich konnte hören, wie sie atmete, wie sie ihre feuchten Lippen dicht am Hörer öffnete und wieder schloss. Vielleicht erwartete sie eine Entschuldigung. Ich bot keine an.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie, als das anhaltende Schweigen allmählich unangenehm wurde. »Der Pandit kennt ein Heilmittel.«
Am Tag darauf stand ein Pandit vor der Tür. Es war nicht der Priester meiner Schwiegermutter, sondern ein hiesiger Gesandter, um die Dinge zurechtzurücken.
»Was ist das?«, fragte Ma, während wir ihm dabei zusahen, wie er eine Flechtmatte auf dem Fußboden des Apartments ausbreitete.
»Zu viel Planet Mars«, sagte der Pandit. »Das ist schlecht für ihren Ehemann.«
»Abergläubischer Quatsch.« Ma nahm ihm ein Räucherstäbchen aus der Hand und wedelte damit um seinen Kopf herum.
Der Mann fuhr unbeirrt mit seinen Vorbereitungen fort. Er richtete Früchte auf Blechtellern an. Dann Blumen. Milch. Saris und kunstvoll bestickte rote Stoffe. Anschließend ließ er sich vor einem Tontopf nieder und entfachte mit Ghee, Holzspänen und Zeitungspapier ein Feuer.
Der Torpor des Sommers zehrte an uns, und im Inneren des Apartments fühlte man sich wie in einem Dampfkochtopf. Ich nieste, und ein Klumpen dunkler Rotz landete in meiner Handfläche, dick und blutig wie ein Tumor. Ich war überzeugt, dass das ein schlechtes Omen war, und zerrieb ihn auf der Haut unter meiner Tunika. Der Pandit breitete rote und orangefarbene Stoffe über mehrere Holzblöcke aus. Seine Hände bewegten sich flink, formten Swastiken aus ungekochten Reiskörnern, platzierten ganze Betelnüsse hierhin und dorthin, als Repräsentanten der Planeten im Weltall, und salbten sie mit Segnungen, die sich meiner Kenntnis entzogen.
Ich setzte mich vor vier kaum mehr als zehn Zentimeter große Götzen aus Bronze, die umwickelt und umkränzt waren.
»Heute ist das dein Ehemann«, sagte der Pandit.
Ich betrachtete die Götter. Ihre Gesichter sahen fast gleich aus, außer dem von Ganesha, dessen Stoßzähne sich zu einem Lächeln nach oben bogen.
»Wie? Alle?«
»Nein, nur dieser hier. Vishnu.« Der Pandit lächelte. »Er wird deine schädlichen Kräfte in sich aufnehmen, indem er dich als Erster heiratet, damit dein nächster Ehemann nicht leidet.«
Vishnu wirkte zierlich, hatte eine Adlernase und ein fliehendes Kinn.
»Muss ich das hier tun?«, fragte ich den heiligen Mann. »Können wir nicht einfach allen sagen, dass ich es getan habe?«
Der Pandit antwortete mir nicht.
Die Zeremonie dauerte lang, länger als meine Vermählung mit Dilip ein paar Monate später, mit viel Gesang. Ich umkreiste das Feuer, mit der kleinen Gottheit im Arm, deren Gesicht ich unablässig betrachtete. Meinen Hals schmückte eine schlichte Mangalsutra, und meine Scheitellinie war mit Sindur zinnoberrot markiert, als Zeichen dafür, dass ich jetzt eine verheiratete Frau war. Nach der Zeremonie wurde die Halskette weggerissen und die rote Paste auf meiner ganzen Stirn verschmiert.
»Verheiratet und geschieden«, sagte der Pandit. Ich blickte in den Spiegel und entdeckte einen Abdruck, den der Verschluss der Kette auf meiner Haut hinterlassen hatte. Mein Gesicht war rot gesprenkelt. Das Ganze war eine brutale Angelegenheit. Der Priester schüttelte mir die Hand. Dann bat er um eine Spende und eine Tasse Tee.
Einen Monat vor unserer Hochzeit begleitete ich Dilip auf der vierstündigen Fahrt zum Flughafen in Bombay, um seine Mutter abzuholen. Er engagierte einen Fahrer und für ihr ganzes Gepäck einen riesigen klimatisierten Van, einen Toyota Innova. Als wir ankamen, stand sie bereits mit einem Gepäckträger vor dem Gebäude, fächelte sich mit einer Broschüre Luft zu und verscheuchte die Taxifahrer. Sie war keine groß gewachsene Frau, aber sie nahm da, wo sie stand, Raum ein, indem sie Vorbeigehende mit dem Ellbogen anrempelte und ihnen ausladend im Weg stand. Ihr Sonnenhut aus Stoff, die Sandalen, ihre Hose und das T-Shirt hatten alle denselben pinken Farbton. Ich meinte, in ihrem Gesicht einen mürrischen Ausdruck wahrzunehmen, bis sie ihren Sohn erblickte. Der Sonnenhut verrutschte ein bisschen, als sie ungestüm in unsere Richtung winkte.
»Ich war seit zehn Jahren nicht mehr hier!«, rief sie zur Begrüßung. Auf der Rückfahrt vorbei am imposanten Westghat-Gebirge war sie hellwach und zeigte mit dem Finger kopfschüttelnd auf jeden Müllhaufen am Rand des Highways. Ich erzählte ihr, dass die Berge im Monsun wunderschön seien, dunstig und nass vom Regen, obwohl der Sommerhimmel in diesem Moment ein unscheinbares strahlend weißes Laken war. Ihre Skepsis stieg sprunghaft vor jedem Mauthäuschen an, die, wie sie erläuterte, ohne Berücksichtigung der durchschnittlichen Höhe eines Autos oder der Länge eines menschlichen Arms gebaut worden waren, sodass man zwei Personen als Mittelsmänner benötigte, um dem Mautpersonal das Geld zu überreichen.
»Dieses Land«, sagte sie mit einem Seufzer. »Ich vermute, das Ganze dient dazu, jedem eine Arbeit zu geben. Stell drei Leute ein, wo nur einer gebraucht wird.«
Als wir Pune erreichten, löste sich der breite, mit bunten Werbetafeln dekorierte Highway in lauter enge Sträßchen mit kleinen Geschäften auf – Motels, Restaurants und Motor- sowie Fahrradläden lagen dicht an dicht nebeneinander. Während wir an einer Ampel warteten, tauchten zwei Jungs aus den Baracken eines Slums in der Nähe auf. Beide gingen in die Hocke, rieben sich die Augen und gähnten.
»O Gott«, sagte Dilips Mutter, »sieh dir diese Jungs an. Können sie nicht hinters Haus gehen? Da ist doch gleich ein Toilettenschild.«
Ich nahm an, dass die Toiletten alles andere als annehmbar waren, sagte aber nichts und hoffte stattdessen, dass das Auto vor uns losfahren würde. Was es nicht tat, und die zwei Jungs bekamen Gesellschaft von einem dritten Freund, der sich noch näher an den Bordstein kauerte.
»Das ist verrückt!«, kreischte sie.
Dilip lachte. »Lass sie doch in Ruhe.«
»Schamlos«, erwiderte sie, zog ihr Handy aus der Tasche und filmte die drei. Ich verschränkte die Arme, in der Hoffnung, sie würden nichts mitkriegen, merkte aber, als alle drei aufstanden und sich unserem Auto zuwandten, dass dem nicht so war.
Glücklicherweise sprang die Ampel um. Dilips Mutter lachte, als wir losfuhren, und sah sich auf der verbleibenden Fahrt das Video mehrmals an. Ich versuchte, sie davon abzulenken – es war ihr erstes Mal in Pune –, und hob die ausgedehnten Grünflächen des Militärstützpunktes hervor, die tiefen Schatten, als wir unter einigen sehr alten Banyanbäumen entlangfuhren. Pune lag im Binnenland, und die Luft war trocken, kalt im Winter und staubig im Sommer, aber niemals feucht und faulig, wie man es aus Bombay kannte. Ich schlug eine Reihe von Orten vor, die wir besuchen könnten – die historische Shaniwarwada-Festung, die der Sitz der hiesigen Peshwa-Dynastie war, einen kleinen, aber wunderschönen Shiva-Tempel und meinen Lieblingsladen für Süßigkeiten auf der Main Street, falls sie Lust hätte zu sündigen. Wir fuhren am Poona Club vorbei, wo unsere Hochzeit und der Empfang stattfinden würden, und ich versuchte, ihr zu vermitteln, wie besonders es für mich sei, dort meine Vermählung zu feiern, dass meine Großeltern über vierzig Jahre lang Mitglieder waren, und auch wenn meine Mutter niemals Interesse gezeigt hatte, würden auch Dilip und ich bald die Mitgliedschaft bekommen. Es sei außerdem noch der erste Ort, an dem Dilip und ich bei einem Bier übers Heiraten gesprochen hätten, nach einer Runde durch den Pool spät am Sonntag. Einige der anderen Erinnerungen, die ich an den Ort hatte, erwähnte ich nicht, daran, wie ein Bettler jenseits dieser geheiligten Pforten zu sitzen. Manches sparte man sich besser für nach der Hochzeit auf.
Dilips Mutter warf einen neugierigen Blick hinein, und dann umspielte ein feines Lächeln ihre Lippen. »Die Briten haben ein paar herrliche Gebäude errichtet.«
Die Wochen vor der Hochzeit waren die heißesten des Sommers. Nur Helden trauten sich vor die Tür. Kühe, Hunde und Menschen fielen auf der Straße tot um. Kakerlaken schauten vorbei, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Es war ein außergewöhnlich heißer Tag, als meine Schwiegermutter und Dilip zum Mittagessen in unsere Wohnung kamen. Ich verfluchte Pune dafür, dass die Stadt so einen schlechten Eindruck machte. Ich fühlte mich für alles verantwortlich, was an ihr verabscheuungswürdig war, Dinge, die mir vorher nie aufgefallen waren. Die Hitze war nicht einfach nur heiß, sondern unerträglich. Die Luft war nicht nur stickig, sondern man konnte sie nicht einatmen. Ich hatte geglaubt, bereits durch Dilips Ansprüche und Vorlieben sensibilisiert worden zu sein für die üblichen Mängel und Fehlfunktionen unserer Leben, aber erst durch das Erscheinen seiner Mutter begriff ich, dass er im Laufe der Zeit immun geworden war gegenüber diesen Unannehmlichkeiten. Ich war besorgt über jeden Makel und mir gleichzeitig mehr als bewusst, dass einige Makel auch zugleich den Charme der Stadt ausmachen konnten. Wie sehr wollte ich falsch darstellen, wo ich lebte – und wer ich war –, und war ich überhaupt in der Lage zu erkennen, was eine wünschenswerte Vertuschung war und was nicht?
Dilip und seine Mutter tranken Kokoswasser und Nimbu Pani und hatten keine Ahnung, dass ich die ganze vorherige Woche damit zugebracht hatte, den Trümmerhaufen herzurichten, der die Wohnung nun mal war, die ich mir mit meiner Mutter teilte, indem ich die Blasen werfenden Wände frisch gestrichen, kaputte Spiegel abgehängt und eingerissene Sofabezüge geflickt hatte.
Meine Schwiegermutter trug gerne Kleidung in ungewöhnlichen Farben und, wie uns klar wurde, Hüte. Ma verbarg ihr Grinsen, als die beiden hereinkamen, und auch ich konnte die Absurdität des Aufzugs dieser Lady nicht ausblenden. Sie war, das wusste ich, keine Frau von besonderem Geschmack oder außergewöhnlicher Auffassungsgabe, und dennoch verletzte es mich, wie sehr ihr Pune missfiel.
Nach dem Mittagessen saßen wir auf unserer kleinen Terrasse und besprachen die To-do-Liste für die Hochzeit. Zu dieser Tageszeit drängelten sich für gewöhnlich die Nachbarn auf ihren Balkonen, die so angelegt waren, dass sie aussahen wie übereinandergestapelte kleine Schachteln. Die Nachbarn fuchtelten wild mit den Armen, um die Tauben und Krähen zu verjagen, und befühlten die Wäsche, die sie in der Nachmittagssonne zum Trocknen aufgehängt hatten.
Auf unseren Gesichtern sammelte sich Schweiß. Drei Stockwerke unter uns machte ich die Oberseite eines Kopfes aus, eines Frauenkopfes, mit spärlichem Haar entlang des Scheitels und einem grau melierten Zopf, der zu einer Schnecke zusammengerollt war. Ich konnte das Geräusch hören, das ihr Besen aus zusammengebundenem Reisig machte, wenn er über den Boden kratzte, während die Blätter und der Schmutz raschelten und sich versammelten, raschelten und sich versammelten, in einer beliebigen Variante ihrer vorherigen Anordnung. Rauch waberte durch die Luft und trug den Geruch von Benzin und brennendem Müll zu uns, aber wir machten keine Anstalten, in die Wohnung zu gehen. Die Geräusche innerhalb des Gebäudes waren leise im Vergleich zu der tiefen, prallen Tröte, die jedes Mal loslegte, wenn ein Zug vorbeifuhr.
Ich betrachtete den dunstigen Himmel und versuchte, mich zufrieden zu fühlen, zufrieden, dass ich, obwohl ich so viele Jahre hier verbracht hatte, endlich weggehen würde. Ich sah zu Dilip hinüber. Er war auf eine Art und Weise attraktiv und groß, die jeden wissen ließ, dass er im Ausland aufgewachsen war. Baseballkappen, gute Manieren und jahrelanger Konsum amerikanischer Milchprodukte. Er rettete mich, auch wenn er davon nichts ahnte. Auf seinen Lippen erschien ein Lächeln über irgendetwas, das meine Mutter gesagt hatte, und ich kam in den Genuss des Anblicks all seiner zweiunddreißig Zähne, zur Ordnung gerufen durch jahrelanges Tragen einer Zahnspange als Jugendlicher.
Später, bei einer Schüssel mit Rabri, wandte sich meine Schwiegermutter an Ma. »Tara Ji«, sagte sie, »der Pandit wollte die Hochzeitszeremonie durchsprechen. Er fragte, ob du irgendwelche Verwandte hast, vielleicht ein Ehepaar, das im Inneren der Mandap sitzen und die Braut an deiner Stelle übergeben wird.«
»Nein, habe ich nicht«, erwiderte Ma. »Cousins vielleicht. Aber ich kann das sehr gut selbst erledigen.«
Dilips Mutter öffnete und schloss ihren Mund, atmete ein paarmal geräuschvoll ein und aus, bevor sie weiterredete. Es war ein Spleen von ihr, als müssten die Wörter wiederbelebt werden, bevor sie sie entsenden konnte. »Wenn die Mutter Witwe ist, springt normalerweise ein anderer Verwandter ein, um diese Rolle während der Zeremonie zu übernehmen.«
»Aber ich bin keine Witwe«, entgegnete Ma.
Dilips Mutter legte den Löffel weg. Ihr Mund öffnete und schloss sich erneut. Dann fing sie an, lautstark Luft einzusaugen und wieder auszupusten, als wäre unmittelbar vor ihr etwas in Flammen aufgegangen. Unser aller Blicke richteten sich auf Dilip, der sich einen Nachschlag des Desserts gönnte und dabei eine Sahnespur auf dem Tisch hinterließ.
»Das war ja weniger brenzlig als erwartet«, meinte er später, als wir allein waren. »Inder in Amerika sind manchmal sehr konservativ. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass deine Eltern geschieden sind.«
Von Mas Balkon aus habe ich nach der Schule immer die streunenden Hunde beobachtet. Meistens lümmelten sie träge mit ihrer Meute herum, die Pfoten verstümmelt und die Ohren abgebissen, und sie bewegten sich nur vom Fleck, um Autos und Autorikschas auszuweichen oder ihre Mütter und Schwestern zu besteigen. Ich glaube, das war das zweite Mal, dass ich Sex sah. Ich saß da in meiner marineblauen Schuluniform und beobachtete, was sich da unten abspielte, aber es war schwierig, zwischen kämpfenden und herumhurenden Hunden zu unterscheiden. Manchmal kam es zum Kampf, wenn ein anderer Pariahund in ihr Territorium eindrang. Ein Hochfrequenz-Knurren oder ein knacksender Ast, auf den jemand trat, ließ sie loslegen, und spätnachts, wenn ich eigentlich unter meinem Moskitonetz schlafen sollte, lauschte ich ihnen und ihrem Kampfgeheul. Ich erinnere mich, dass ich eines Morgens auf dem Weg zur Schule ein Welpen-Mädchen vor dem Tor sitzen sah, ihr Bauch zitterte vor lauter Würmern, und Flöhe marschierten über ihren Nasenrücken. An der Stelle ihres Schwanzes befand sich lediglich ein blutiges Loch.
Nach meiner Heirat mit Dilip erbte ich seine Familie, seine Möbel und eine neue Garnitur streunender Tiere. Die Hunde in der Nähe seines Wohnhauses sind gelassener, überfüttert und von einer Hausfrauen-Truppe aus Pune kastriert. Sie heben schnüffelnd die Nase in die Luft, und ihre Zungen hängen locker über den Eckzähnen. Ab und zu zwicken sie sich gegenseitig in die Genitalien und jaulen, weil sie Futter wollen.
Ich zog im Juni in Dilips Wohnung, als alle auf den Monsun warteten. Die Regenzeit war spät dran. Ein schlechtes Zeichen. Das würde ein schlimmes Jahr werden. Die Zeitungen berichteten, die Bauern gäben den Priestern die Schuld, weil sie die Götter nicht wohlgesonnen gestimmt hätten, und die Priester gaben den Bauern die Schuld, weil sie es an Frömmigkeit hätten mangeln lassen. In der Stadt gab es weniger derartiges Gerede, da ging es mehr um den Klimawandel. Der Fluss hier in der Nähe schwillt in ziemlicher Regelmäßigkeit an und wieder ab, aber der Monsun sorgt für schmutzig braunes tosendes Hochwasser.
Wenn Dilip mich unten leckt, reibt er seine Nase an meinen Schamlippen und atmet tief ein.
»Sie riechen nach nichts«, sagt er. Er ist stolz auf diese Beschaffenheit, sagt, das sei ungewöhnlich und möglicherweise einer der Gründe, warum er sich uns als Paar vorstellen könne. Sein Leben sei mittlerweile erfüllt von intensiven Gerüchen, im Büro und sogar im Fahrstuhl, und er sei so erleichtert, dass ich nach dem Sport und in superstressigen Situationen so geruchlos bleibe. Er sei in Milwaukee aufgewachsen, wo seine Ohren nur weiche Q-Tips und Vorstadtstille kennengelernt hätten. Pune, sagt er, sei wirklich laut, der Geruch sei ätzend, aber seine Sinne könnten mit diesem Ansturm fertigwerden, solange unser Zuhause ihn wieder auf null setze. Er erzählt jedem, dass es zu keinen schrillen Veränderungen kam, als ich bei ihm einzog. Dass mein Leben nahtlos mit seinem verschmolz.





























