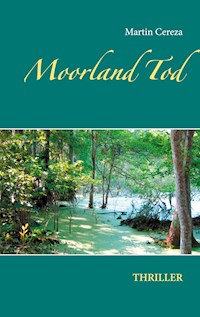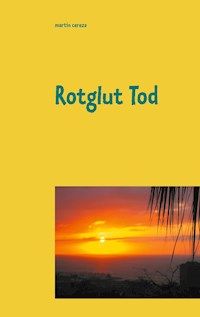Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Gletscherleiche ruht im ewigen Eis. Der junge Bergretter, der sie findet, wird ermordet. Eine alte Frau gibt ein Geheimnis preis. Der Mord an einem jungen Mann der Bergrettung löst eine gnadenlose Jagd durch ganz Europa aus. Kostete ihm der Fund einer Gletscherleiche aus den Vorkriegsjahren sein Leben? Was kann die alte Sennerin erzählen? Das spannende Geschehen führt den Leser aus dem hochalpinen Grenzgebiet zur Schweiz zurück in das Wien des Jahres 1938. Ein Bauernmädchen aus dem Bergdorf dient einer wohlhabenden Familie als Hausmädchen und erlebt schreckliche Zustände in den Wirren der Vorkriegszeit. Ein dreiviertel Jahrhundert später brechen die Ereignisse von damals neuerlich auf und versetzten ein Dorf in Angst und Schecken. Von der wunderschönen Gletscherwelt über die traumhaften Strände Teneriffas, die einzigartige Schönheit der Toscana bis in den märchenhaften Wienerwald spannt sich der Bogen fesselnder Wendungen im spannungsgeladenen Roman von Martin Cereza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
martin cereza
Jahrgang 1951.
Der Autor war über Jahrzehnte als Ermittler tätig.
In dieser Zeit bekam er umfangreiche Einblicke in die
Schattenseiten organisierter Kriminalität einzelner
Syndikate. Dieses Wissen verarbeitet er erfolgreich in
seinen spannungsgeladenen Romanen.
Seine bisherigen Werke,
»rotglutTOD« und »rachsuchtTOD«
fanden große Beachtung bei seiner Leserschaft.
Er ist verheiratet und lebt in Tirol-Österreich.
Eli gewidmet.
Ihre Kraft ist mein Motor
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
1
Kühl war es im stillen Innenraum der alten Ruprechtkirche zu Wien an diesem sonst so sonnigen Herbsttag des Jahres 1938.
Der Geruch verbrannter Kerzen lag über dem abgenutzten Steinboden des ehrwürdigen Gotteshauses, dessen uralte Holzbänke seit Jahrhunderten gläubige Menschen zum Gebet in die älteste Kirche der Stadt an der Donau pilgern ließen.
Das hübsche Mädchen kniete still auf den groben Steinstufen vor dem prächtigen Altar. Tief im Gebet versunken, fröstelte es sie in der Kühle der Kirche.
Der Herbst hatte Einzug gehalten in Wien und die Bewohner mit frischem Ostwind auf das Ende der warmen Jahreszeit aufmerksam gemacht.
Sie verbarg das verweinte Gesicht in ihren feingliedrigen Händen. Leises Schluchzen, tief aus ihrer unglücklichen Seele, war das einzige Geräusch in der Stille des alten Kirchenschiffes. Als sie ihre Hände vom Gesicht nahm und vor den kleinen Brüsten zum Gebet faltete, konnte man ihre schönen ebenmäßigen Gesichtszüge erkennen. Über einer hohen Stirn trug sie ihr pechschwarzes Haar glatt nach hinten gekämmt und zu einem langen Zopf gebunden. In den dunklen Augen lag ein Ausdruck tiefer Traurigkeit. Große Tränen liefen über die hohen Backenknochen und verloren sich in den Fältchen der zuckenden Mundwinkel.
Die vollen Lippen bebten leicht, als sie flüsternd zu beten begann.
„Heilige Maria Mutter Gottes, verzeihe mir meine große Sünde…“
Ein neuerlicher Weinkrampf schüttelte den zierlichem Körper.
Wie soll ich nur meinen Eltern unter die Augen treten, dachte sie verzweifelt. Was wird Mutter sagen, der Vater, die Geschwister?
Sie blickte auf das wunderschöne alte Kirchenfenster, wo im oberen Teil die Darstellung des Heilandes am Kreuz, mit Maria und Johannes, eingearbeitet worden war. Den unteren Teil beherrschte die Madonna mit dem Kinde. Durch die unzähligen Butzen der einzigartigen Kirchenfenster strömte das milde herbstliche Sonnenlicht. Bunte Strahlen erleuchteten die alten Gemäuer und den Altar. Sie erzeugten eine mystische Stimmung, in dem von uralten Steinmauern umgebenen Gebetsraum.
„Was du hier siehst, Leni, ist das älteste Kirchenfenster von Wien. Es stammt aus dem Jahre 1270 und hat mehr als 740 Jahre überdauert.“
Sie dachte an die Worte ihres Hausherrn, damals, beim allerersten Besuch der Kirche zum heiligen St. Ruprecht im Sommer des Jahres 1937.
Mehr als ein Jahr war seither vergangen.
Immanuel Oreovic, in dessen Hausstand das Mädchen arbeitete, hatte sie eines Tages in die Kirche geführt. Sie erinnerte sich noch genau an seine damaligen Erzählungen.
„Ich bin ein Atheist, Leni. Du weißt was einen Atheisten ausmacht?“
Leni hatte genickt und an ihre Mutter gedacht. Die hatte ihr einst erklärt, dass Atheisten an keinen Gott glaubten und daher nie die Gnade des Himmelreiches erfahren würden. Vielmehr würden diese Ungläubigen ewig in der Hölle schmoren müssen.
„Gut, also ich glaube nicht an diesen ganzen Kirchenkram. Ist alles nur Bauernfängerei. Egal, ob Christen, Juden, Moslems und was es sonst noch gibt. Ich glaube nur an mich und meine eigenen Fähigkeiten, an sonst gar nichts. Meine Eltern waren Juden. Auch meine Frau ist streng gläubige Jüdin. Sie ist oft in der Synagoge und betet dort inbrünstig, das hast du sicher auch schon gemerkt, nicht wahr? Ich muss sagen, dass mir die alten katholischen Kirchen sehr gut gefallen. Sie sind architektonische Meisterwerke und eignen sich gut zum Nachdenken oder wenn man einfach nur allein sein will.“
Oreovic hatte sie angeschaut und ihr über das seidige, tiefschwarze Haar gestrichen.
„Eine Synagoge ist dagegen etwas anderes. Sie ist ein jüdisches Gotteshaus für Gebet und für das Studium der Schriften. Wir sind daran vorbeigekommen, oben in der Seitenstettengasse. Dort ist die Synagoge der jüdischen Gemeinde Wien untergebracht. Ich habe dir das Gebäude gezeigt, erinnerst du dich? Die gläubigen Juden treffen sich dort nicht nur zum Gebet, wie viele Leute denken, sondern auch zum Austausch und eben zum Studium alter Schriften. Ich gehe auch manchmal hin. Nicht um zu beten. Oh nein. Ich treffe mich dort mit Geschäftsleuten der jüdischen Gemeinde. Mit den reichen Juden sind gute Geschäfte zu machen, wenn man Ihre Schliche erst kennt.
Wie schon gesagt, mir gefallen die alten katholischen Gotteshäuser besser. Diese hier ist die älteste Kirche in Wien und für mich eine der schönsten in der Stadt. Der Legende nach wurde sie durch die beiden Glaubensboten aus Salzburg, Chuniald und Gislar, im Jahr 740 gegründet. Die Befestigungen des bis heute gut erhaltenen Hauptschiffes mit der Empore, sowie die unteren Turmgeschosse mit den romanischen Doppelfenstern, gehen auf das frühe 12. Jahrhundert zurück. Wenn du also zu deinem Herrgott beten willst, dann gehe in diese Kirche, mein Kind. Es ist nicht weit hierher von unserem Haus in der Salzgasse und hier findest du immer Ruhe und Frieden.“
So war sie damals neben ihrem Hausherrn andächtig in der Kirche gestanden und hatte gedacht wie anders diese doch war. Sie hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der kleinen Dorfkirche, in ihrem Heimatdorf in den Tiroler Bergen.
Daheim…., wie weit weg das alles war.
Der Bauernhof, die Eltern, die Geschwister, die geliebten Tiere.
Wie lange hatte sie das nicht mehr gesehen?
Seit mehr als einem Jahr war sie nun schon in der großen Stadt.
Ein langes Jahr, das ihr wenig Freude bereitet hatte.
Im Gegenteil, es war ein langes Jahr, voller Heimweh, Schmerz und unendlich viel Leid gewesen.
2
Patrick Höcher war bester Laune. Ruhige Tage wie der heutige, kamen selten vor. Er lag auf der Terrasse des alten Gebäudes, in welchem die Einsatzzentrale der Bergrettung untergebracht war, in der Sonne und genoss ein Stück des köstlichen Apfelkuchens seiner Mutter zum Kaffee.
Die Natur stand in voller Blüte. Der süße Duft des Frühlings, der im Tal Einzug gehalten hatte, lag in der warmen Luft. Auf den Pisten der Gletscherskigebiete im Land tummelten sich immer noch jede Menge Skifahrerinnen und Skifahrer, um den herrlichen Firn zu genießen. An diesem Tag, Anfang Mai 2013, war in der Zentrale ausgesprochen wenig los gewesen. Bald würde Feierabend sein. Es war bereits 16:30 Uhr. Gegen 17:00 Uhr schlossen die letzten Lifte auf den Gletschern, dann war Schluss.
Patrick Höcher, Polizeibeamter und Mitglied der örtlichen Bergrettung, rechnete nicht mehr mit einem Einsatz. Aus der Ferne vernahm er das Motorengeräusch des anfliegenden Helikopters.
Die Besatzung von Adler 11 war zu einem Unfall auf der Autobahn gerufen worden und kehrte nun zurück.
In diesem Moment läutete das Telefon.
„Bergrettung, Einsatzzentrale, Höcher.“
„Notrufzentrale Innsbruck, Servus Patrick. Der Wirt der Schutzhütte am hinteren Ferner hat uns angerufen. Er meldet einen Unfall im unteren Bereich des Gletschers. Es soll sich um einen Benny Hylba handeln, ein ihm bekannter Einheimischer. Gäste auf der Terrasse der Hütte haben beobachtet, wie der junge Mann mit seinem Snowboard in eine Gletscherspalte gestürzt ist. Die Koordinaten hast du auf deinem Schirm. Viel Glück beim Einsatz.“
Patrick versendete umgehend die Einsatz SMS an die Bergretter im Tal und vereinbarte als Treffpunkt den großen Parkplatz am Talschluss. Er kannte Benny Hylba gut. Ein junger Mann aus dem Dorf. Seine Eltern betrieben ein Vier Sterne Hotel im Ort und Benny war, wenn man so will, von Beruf Sohn. Er trank manchmal gern über den Durst. Der Polizei war bekannt, dass er von Zeit zu Zeit auch zum Joint griff. Ansonsten ein lustiger Junge, wie es so viele gab, im Tal der Ski-Superlative, wo es immer etwas zu feiern gab, wo Partys zum Tag gehörten wie der frische Schnee, die hübschen Mädchen und der Sonnenschein. Derzeit war allerdings wenig los im Ort. Die Wintersaison war zu Ende, die meisten Hotels hatten bereits geschlossen. So auch das Hotel von Bennys Eltern. Warum Benny noch in der Gegend war, verwunderte Patrick. Die Familien der Hoteliers hatten sich schon auf die Malediven, Seychellen, Kanaren oder sonst wohin verdrückt, um erst einmal Urlaub vom Saisonstress zu machen.
Patrick rannte aus dem Gebäude zum gelandeten Helikopter, informierte Pilot und Notarzt über die Gegebenheiten des neuen Einsatzes und innerhalb kürzester Zeit war das Team wieder in der Luft. Bei der Zwischenlandung am Talende stiegen zwei weitere Bergretter zu.
Der Helikopter gewann schnell an Höhe und kreiste bald über dem Einsatzgebiet des unteren Ferners, einer der wenigen, noch nicht von Seilbahnen erschlossenen Gletscher im Land. Keine Liftstütze und keine Piste trübte den herrlichen Blick über das glitzernde Eisfeld, umgeben von stattlichen Dreitausendern.
Welch traumhafter Anblick, dachte Patrick. Und doch durfte man sich von der trügerischen Schönheit nicht täuschen lassen. Viele Gefahren lauerten in dieser Hochgebirgswelt und wurden allzu oft gröblich unterschätzt. Das Ergebnis waren tödliche Unfälle, gefährliche Einsätze für die Bergretter und Tragödien für die betroffenen Familien.
Patrick hatte den Hüttenwirt am Mobiltelefon erreicht.
„Ja Patrick, es ist der Benny. Seine Clique, du kennst ja die Jungs, haben bei mir übernachtet und gestern Abend ein wenig gefeiert. Richtig weitergegangen ist es dann nach dem Frühstück. Sie hatten viel Spaß und es floss reichlich Bier. Die anderen Burschen sind noch hier. Sie bleiben noch eine Nacht. Der Benny ist allein abgefahren. Wir wollten ihm das ausreden, er war ja auch nicht mehr ganz nüchtern, aber er bestand darauf. Einige Gäste von mir haben beobachtet, wie er über den Ferner gefahren ist. Sie haben gesehen, dass er plötzlich verschwunden war. Ich fürchte, er ist in eine der unteren Randspalten gestürzt.“
Patrick konnte sich das gut vorstellen. In den letzen Tagen war eine Kaltfront durchgezogen. Am Gletscher war ein halber Meter Neuschnee gefallen. Vor zwei Tagen hatte es aufgeklart. Das schöne, warme Frühlingswetter hatte viele Tourengeher auf die Berge gelockt. Die Gefahr im freien Gletschergebiet in eine der zugeschneiten Spalten zu fallen, war daher sehr groß. Eine Abfahrt ohne Sicherung war, selbst für einen ortskundigen Jungen wie Benny, ein mehr als großes Risiko.
Der Wirt wies die Hilfsmannschaft über Telefon ein. Aus der Luft konnte man gut erkennen was passiert war. Im spaltenreichen unteren Gletscherteil, war ein schwarzes Loch mit etwa 6 Meter Durchmesser sichtbar, an dessen Rand eine Spur endete. Offensichtlich war eine Neuschneebrücke über der Spalte eingebrochen.
Zwei Retter wurden mit dem Tau abgesetzt. Eine Landung war viel zu gefährlich. Erst musste die Lage sondiert werden, die Sicherheit des Einsatzteams hatte stets absolute Priorität. Nachdem die Männer die Umgebung des Unglücksortes untersucht hatten, wiesen sie den Helikopter auf einem sicheren Platz ein.
Der Pilot musste die Landung zweimal abbrechen.
Zu viel Schnee wurde durch die Rotoren aufgewirbelt und behinderte die Sicht. Beim dritten Mal gelang das waghalsige Manöver. Retter und Material konnten abgesetzt werden.
Die mit Seilen gesicherten Männer standen am Rand der Einbruchstelle. Sie versuchten durch lautes Rufen Kontakt mit dem Verunglückten aufzunehmen.
Nichts rührte sich.
Die Rufe verhallten im dunklen Loch der Gletscherspalte. Nur ein fernes Echo war zu vernehmen.
„Ist eine verdammt tiefe Spalte, verläuft schräg in Richtung Mitte des Gletscherbruches, an die 150 Meter tief, teilweise mit Abstufungen durchsetzt. Mit Glück ist der Junge auf einem der Vorsprünge hängen geblieben“, konstatierte Hans Holler, ein älterer, sehr erfahrener Bergretter. Er leitete den Einsatz vor Ort.
„Kenne die Spalte, habe vor einigen Jahren im Sommer versucht sie zu erkunden, musste wegen des starken Wasserflusses aber aufgeben. Nach meiner Ansicht kommt nur eine Bergung mit der Winde in Frage.“
Hans galt als erfahrener, umsichtiger Einsatzleiter.
„Wer geht?“, fragte er und blickte seine Männer ernst an. Trotz unzähliger Einsätze war jede neuerliche Begegnung mit der Gefahr, möglicherweise sogar mit dem Tod, eine enorme Herausforderung für Geist und Körper der Betroffenen.
„Ich gehe“, sagte Patrick Höcher und war schon damit beschäftigt sich für den Einsatz vorzubereiten.
Mittlerweile war auch der Helikopter der Polizei gelandet und hatte neue Einsatzkräfte abgesetzt. Ein Teil der Männer sicherte das Umfeld der Einbruchstelle, um die Gefahr für das Team so gering als möglich zu halten, andere bauten die erforderlichen Gerätschaften auf. Alles funktionierte ohne vieler Worte, tausendfach geübt.
„Einsatzleiter Berg von Zentrale. Kommen!“
Das war Hollers Funkgerät.
„Hier Einsatzleitung. Kommen!“
„Zentrale, Gschwentner, wie schaut es aus bei euch?“
Simon Gschwentner war der Chef der Bergrettung. Er besetzte üblicherweise die Zentrale während eines Einsatzes, um erforderliche Maßnahmen im Tal zu koordinieren.
„Wir haben alles vor Ort. Spaltensturz. Kein Kontakt.
Patrick Höcher geht am Seil der Winde hinunter. Hoffen auf Beendigung vor Dunkelheit. Mehr dann später. Ende.“
Wie so oft bei Einsätzen kam bei Hans Holler der pensionierte Heeresoffizier durch. Knappe Anweisungen, die ohne Widerspruch zu befolgen waren. Nicht immer kamen alle Bergretter damit zurecht und doch respektierten sie ihn, als äußerst kompetenten und verlässlichen Kameraden.
Patrick hatte sich die Seilausrüstung angelegt, die anderen Einsatzutensilien überprüft und am Seil der Winde den Brustkarabiner eingeklinkt.
„Ich bin bereit. Sprechprobe, Eins, Zwo, Eins, Zwo. Okay das passt! Ich nehme Seil und Gurt mit. Es ist eng da unten, wie es scheint. Ich denke zu zweit haben wir nicht Platz. Ich versuche es allein. Los! Lasst mich runter!“
„Pass auf dich auf Patrick!“
Hans Holler gab das Kommando zum Abseilen.
Patrick stieg rückwärts in die Spalte ein. Langsam seilte er sich Schritt für Schritt ab.
„Drei“, ertönte es aus dem Funkgerät.
Von oben wurde ihm die Abstiegshöhe bekanntgegeben. Es wurde bald ziemlich dunkel um ihn. Er schaltete die Stirnlampe ein.
„Sieben!“
Das blaue Gletschereis leuchtete im spärlichen Licht der Lampe.
„Zwölf!“
Die Spalte verlief etwas schräg und wurde enger. Er war an einem Vorsprung angekommen. Hier war Benny erstmals aufgeschlagen. An der Kante des Eisvorsprunges waren Blutspuren zu erkennen. Mein Gott, dachte Patrick, wenn er bis hierher frei gefallen ist, dann habe ich nicht viel Hoffnung. Er zwängte sich über den Vorsprung und rief nach dem Verunglückten.
„Benny, hallo Benny kannst du mich hören? Ich bin es, der Patrick. Benny, hörst du mich?“
Nichts rührte sich, seine Worte verhallten im tiefblauen Gletschereis.
„Fünfzehn!“
Plötzlich spürte Patrick Widerstand unter seinem rechten Fuß. Er blickte nach unten und stellte fest, dass er auf dem Belag des Snowboardes stand. Er hob das Bein an, stemmte sich mit beiden Beinen gegen die Spaltenwand und ließ sich langsam rückwärts ins Seil gleiten. Weit kam er nicht. Die Spalte war zu eng. Es genügte jedoch, um erkennen zu können, dass Benny mit dem Kopf nach unten über der Tiefe hing.
„Ich habe ihn! Er hängt mit dem Kopf nach unten. Das Board hat sich in der Spalte verkeilt. Ich kann nicht feststellen ob er lebt. Verletzungsgrad auch nicht feststellbar. Er steckt nur noch mit einem Schuh in der Bindung. Von dem wird er gehalten. Holt den Doktor an den Funk. Kommen!“
„Patrick hier ist Clemens. Was kannst du feststellen. Kommen!“
Clemens Hüleke war der Notarzt der Crew. Trotz seiner Jugend ein sehr erfahrener Notfall-Mediziner. Sie hatten schon manch schwierigen Rettungseinsatz zusammen durchgezogen. Clemens war geborener Kölner und von rheinischer Frohnatur. Nach seinem Medizinstudium an der Universität Innsbruck, war er in Tirol geblieben. Er gehörte zu Patricks besten Freunden.
„Ich habe selbst kaum Platz und komme gerade einmal an seinen Fuß ran, Clemens. Mehr geht nicht, weil man nicht vorbeikommt. So wie ich es beurteilen kann, ist die einzige Möglichkeit ihn am Fuß zu sichern, damit er nicht weiter abstürzen kann. Dann irgendwie versuchen das Board loszuwerden, den zweiten Fuß ans Seil anbinden und hoch mit ihm. Ich brauche das Okay von dir und von der Einsatzleitung!“
„Wie groß ist das Risiko, dass er weiter abstürzen könnte? Kommen!“
Das war Hans Holler.
„Schwer zu sagen Hans. Wie gesagt er hängt an einem Bein in der Bindung. Wenn die ausbricht ist er weg und da geht es noch verdammt weit hinunter.“
„Hast du irgend eine Möglichkeit festzustellen ob er am Leben ist?“
Clemens´ Stimme klang besorgt.
„Negativ, habe kein Lebenszeichen von ihm. Komme nicht ran um Puls zu fühlen oder Atmung zu kontrollieren.“
„Okay, wir müssen das Risiko eingehen. Er hängt schon zu lange. Es muss jetzt schnell gehen um allfällige Gehirnschäden durch den Blutstau zu verhindern. Eine mögliche Verletzung der Wirbelsäule müssen wir hintanstellen. So oder so, ich bin dafür dass wir ihn so schnell als möglich rausholen. Kopfüber, wie er hängt. Es geht nicht anders.“
„Wenn der Doc sagt dass es okay ist, dann los, Patrick. Lass uns beginnen“, befahl Hans.
„Brauchst du noch etwas von uns? Kommen!“
„Vorläufig nichts. Ende“, antwortete Patrick.
Es gelang ihm, sich soweit zu drehen, dass er Bennys Knöchel gerade einmal erreichen konnte. Patrick hing nun waagrecht im Seil und konzentrierte sich voll auf seine Aufgabe. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als eine doppelt genommene Rebschnur oberhalb des Knöchels um das Bein zu binden, an der er dann das Seil verknoten konnte. Das war nicht gerade aus dem Rettungslehrbuch, allerdings gab es keine andere Möglichkeit.
„Ich habe ihn am Knöchel, Seil langsam spannen“, sprach er in sein Funkgerät.
Als das Seil soweit gespannt war, dass Benny gesichert schien, versuchte er den Fuß aus der Bindung zu bekommen, was relativ leicht zu bewerkstelligen war.
Patrick richtete sich wieder auf und trat von oben auf das Board, um es am Körper von Benny vorbeizubringen. Er musste ein paar Mal kräftig zutreten, bis es schließlich nachgab und in die dunkle Spalte fiel.
Der leblose Körper hing an einem Fuß über dem schmalen Abgrund und pendelte leicht hin und her.
Mittels einer in das Seil geworfenen Schlinge, gelang es Patrick den abgewinkelten zweiten Fuß zu fassen, um das Seil daran befestigen zu können.
„Okay, ich habe ihn an beiden Beinen, soweit das unter diesen Umständen möglich war. Langsam hochziehen, sehr langsam, es wird sehr eng hier. Seid vorsichtig!“
Zentimeter für Zentimeter wurde Benny hochgezogen.
Als sein Kopf auf gleicher Höhe mit Patricks Gesicht war, öffnete er unvermutet die Augen und stöhnte laut. Sein vom Schmerz verzerrtes Gesicht war voll verkrusteten Blutes.
„Benny, hallo Benny! Kannst du mich hören?“
Patrick strich ihm sanft über den Kopf.
Benny brachte ein schwaches Nicken zustande und schloss die Augen wieder.
„Er lebt! Er lebt, Burschen! Sehr vorsichtig jetzt noch über die Kante, dann geht es besser.“
Langsam verschwand Benny nach oben und Patrick bereitete sich für seinen eigenen Aufstieg vor. Er verschaffte sich auf dem kleinen Vorsprung etwas Platz, um die Beine entlasten zu können. Mit dem kleinen Eispickel hackte er Eis weg, um sich einen Stand bauen zu können.
Fast wäre er vor Schreck ins Seil gefallen, als eine große Eisplatte ausbrach, ihn an die gegenüberliegende Spaltenwand drückte und mit lautem Krachen nach unten abrutschte.
Patrick blickte der Eisplatte nach, froh dass sie ihn nicht verletzt hatte.
Als er den Kopf hob, stockte ihm der Atem. Ein eisiger Schauer lief über seinen Rücken und ließ seine Nackenhaare kribbeln.
„Das gibst es doch nicht“, murmelte er verstört.
3
John Levynn wischte mit dem blütenweißen Taschentuch über seine schweißnasse Stirn.
„Verdammte Hitze“, murmelte er beim Griff nach dem Wasserkrug, um sich ein Glas Eiswasser einzuschenken. Seit Tagen war die Klimaanlage im Wohnblock vor den Toren von Tucson/Pima County, nun schon defekt. Arizona wurde wieder einmal von einer gnadenlosen Hitzewelle heimgesucht. Sein Apartment glich einer Gluthölle. Am frühen Morgen hatte er seinen fluchenden Nachbarn, ein ehemaliger Offizier der Armee, am Gang getroffen.
„Wir sind die modernste Militärmacht der Welt und keiner dieser Dummköpfe ist in der Lage diese beschissene Anlage in Gang zu bringen. Zu meiner Zeit hätte es so etwas nicht gegeben. Verdammter Mist!“
„Beruhige dich Danny. Es ist unsere Stärke unter besonders schwierigen Verhältnissen Höchstleistungen zu erbringen. Schon vergessen, Kamerad?“
Er hat schon recht gehabt, dachte Levynn nun. Die Gebäudeverwaltung der Armee war für die Wohnanlage zuständig, in der ausgediente Soldaten und Angehörige aller möglichen Dienste untergebracht waren.
Eine Art Heim für verdiente Kämpfer und Geheimnisträger.
John Levynn gehörte zwar nicht zu den verdienten Kämpfern, er war unehrenhaft aus dem Geheimdienst entlassen worden, ein Geheimnisträger blieb er allerdings sein Leben lang. Levynn hatte das Vertrauen seiner Vorgesetzten zutiefst missbraucht. Er war in Machenschaften verwickelt gewesen, die in den Bereich höchster Korruption einzureihen waren und hatte sich auf Staatskosten bereichert.
Zwei Jahre Gefängnis und die darauf folgende unehrenhafte Entlassung waren die Konsequenz daraus gewesen. Ein Jahr hatte er abgesessen. Der Rest war ihm auf Bewährung erlassen worden. Seither verbrachte er sein Leben in dieser Wohneinheit.
Er wollte wieder zum Wasserglas greifen, als der Telefonapparat auf seinem glanzvoll polierten Schreibtisch summte. Der Anruf kam aus der Schweiz, wie er am Display sehen konnte. Er kannte die Nummer nicht.
„Ja bitte, wer spricht?“
„Hallo, John. Jesper spricht hier. Jesper Morgen, du erinnerst dich?“
Und ob er sich erinnerte. Jesper Morgen, ein Schulkollege und Freund aus der Kinderzeit. Ihre Familien hatten dasselbe Schicksal. Mit viel Glück war es ihnen gelungen, 1938, buchstäblich im letzten Augenblick, vor den Nationalsozialisten aus Wien zu flüchten.
Über verschlungene Wege waren ihre Väter und Mütter nach Nordamerika gelangt. Jesper und John waren dort 1953 zur Welt gekommen.
1960 trafen sie sich durch Zufall in Tel Aviv, wo sie dieselbe Schule besuchten, wieder. Jespers Vater ging 1963 zurück nach Europa. Er hatte an der Universität Zürich einen Forschungsauftrag erhalten und seine Familie nachgeholt. John ging nach dem Studium in die Vereinigten Staaten und meldete sich freiwillig zum Dienst in der Armee. Seit dieser Zeit hatten sie nichts mehr voneinander gehört.
„Jesper! Ich kann es nicht glauben. Wie lange ist das her? 45 Jahre? Wie geht es dir? Du rufst aus der Schweiz an, wie ich sehe. Lebst du immer noch dort?“
„Ja, Jonny, das tue ich.“
Er nannte Levynn bei seinem Spitznamen.
„Ich lebe in der Nähe von St. Moritz. Es geht mir soweit ganz gut. Und dir?“
„Wenn diese verdammte Hitze nicht wäre, ginge es mir besser. Nein. Nein, mir geht es gut. Ich kann nicht klagen.“
„Wir werden nicht jünger, bestenfalls ein wenig weiser, nicht wahr“, lachte Jesper.
„Du sagst es mein Freund, weiser und leiser. Wie hast du mich gefunden? Soweit mir bekannt, findet sich meine Telefonnummer nicht im Telefonbuch oder im Internet.“
„Der alte Oreovic, Ben Joshua Oreovic, hat mir gesagt wie ich dich erreichen kann. Ist zwar schon etwas senil der alte Herr, aber er hat mich an seinen Sohn verwiesen und der wusste wie ich an dich rankomme. War nicht einfach. Aber es hat geklappt.“
„Freut mich, freut mich. Nach so langer Zeit Jesper. Erzähle mir, was ist der Grund deines Anrufes?“
„Es geht um eine alte Geschichte Jonny. Eine Story, die uns vor vielen Jahren unsere Väter erzählt haben. Über ihre Flucht aus Wien und was sie damals zurücklassen mussten. Kannst du dir denken worum es geht und warum ich mich an dich wende?“
„Nicht ganz, habe aber einen leisen Verdacht, du wirst mich aufklären, Jesper. Wenn es allerdings das ist woran ich denke, dann sollten wir uns treffen, nicht wahr? Am Telefon wollen wir nicht darüber sprechen. Was meinst du, Jesper?“
Levynn war plötzlich hellhörig geworden und aufgeregt. Seit Jahrzehnten war er einem Geheimnis auf der Spur, nun schien sich etwas zu tun.
„Du hast recht, Jonny, das sollten wir wohl. Mach einen Vorschlag wo und wann. Vielleicht irgendwo in der Mitte?“
„Was hältst du von Wien?“, fragte Levynn.
„Die Stadt unserer Ahnen. Wäre dir das angenehm?“
„Und ob! Das wäre wundervoll.“
Jesper freute sich offensichtlich über den Vorschlag.
„Also gut, dann machen wir das.“
John Levynn öffnete seinen Kalender um einen Termin zu suchen.
„Wie wäre es mit Freitag? Passt dir das?“
„Das ist in Ordnung. Und wo in Wien?“
„Ich denke ich kann am Morgen in der Stadt sein.
Wenn ich da bin melde ich mich bei dir. Deine Nummer?“
Jesper gab ihm die Telefonnummer und sie verabschiedeten sich.
Nachdem John Levynn aufgelegt hatte, buchte er einen Platz in der Frühmaschine über Los Angeles nach Wien für Freitag, 17. Mai 2013.
Er griff wieder zum Telefon und wählte eine Nummer in New York.
„OREO Investment, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?“
„Verbinden Sie mich mit Mister Oreovic. Es ist dringend. Sagen Sie ihm Levynn will ihn sprechen.“
„Es tut mir leid Sir, Mister Oreovic ist in einer Besprechung. Darf man Sie zurückrufen?“
„Sie haben mich wohl nicht verstanden! Ich habe gesagt dringend und das heißt bei mir sofort! Also holen Sie Ihren Boss, aber rasch“, bellte Levynn in den Hörer.
Das wirkte, die Dame schien verstanden zu haben.
„Was glaubst du, was ich hier mache Levynn? Urlaub oder was? Ich bin in einer dringenden Besprechung.
Schon mal etwas von schweren Zeiten an den Märkten gehört?“
Ben A. Oreovic war gereizt und nervös.
„Beruhige dich Ben. Ich habe gerade einen Anruf erhalten, von einem Freund aus der Schweiz. Scheint um das Erbe unserer Familien zu gehen. Ich bin sicher, dass dich das interessieren wird. Könnte sein, dass die Sache wichtiger ist als dein Börsenkram. Du weißt was ich meine?“
„Hängt es mit..“
„Nicht am Telefon“, unterbrach ihn Levynn rasch.
„Ich verstehe. Was schlägst du vor, John?“
Ben A. Oreovic hatte sich beruhigt und schien plötzlich höchst interessiert an den Neuigkeiten.
„Ich treffe mich kommenden Freitag in Wien mit dem Anrufer. Wenn du Lust hast, kommst du vorbei und wir hören uns gemeinsam an, was er zu erzählen hat.“
„Natürlich habe ich Lust dazu. Wohin in Wien soll ich kommen?“
„Das erfährst du früh genug.“
John Levynn legte auf.
„Hallo. Hallo Levynn!“
Oreovic sah den Hörer an und fluchte leise.
„Buchen Sie einen Flug, sodass ich Freitag morgens ausgeruht in Wien sein kann“, fuhr er seine Sekretärin Linda barsch an.
„Business Class, Sir?“
„First Class natürlich. Habe ich nicht gesagt, ich möchte ausgeruht sein?“
Linda, blond wie ein Engel und eigentlich mit dem Boss nicht nur in den Angelegenheiten des Büros in engstem Kontakt, hatte nicht mehr den Mut zu fragen, was mit den anderen Freitag-Terminen zu geschehen hatte.
4
Jo Skey lag ausgestreckt auf dem breiten Bett. Die Finger seiner linken Hand spielten mit dem gekrausten Schamhaar des ausgesprochen hübschen Mädchens an seiner Seite.
„Noch immer nicht genug, Jo?“, das Mädchen hatte sich aufgerichtet und seine Hand zärtlich zur Seite geschoben.
„Dein Guthaben ist aufgebraucht, mein Liebling. Du kannst aber gerne nachbessern, kennst ja meine Tarife.“
Sie hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und drehte sich schnippisch zur Seite. Skey lachte.
„Gerade weil ich deine Tarife kenne, ist mir die Lust vergangen. Mach dich raus aus meinem Bett, zieh Leine. Ich habe zu tun. Verschwinde. Ich brauche dich hier nicht mehr.“
„Könntest ruhig etwas freundlicher zu mir sein, ich war ja auch lieb zu dir.“
Das Mädchen erhob sich gekränkt und trippelte ins Badezimmer.
Jo blickte auf sein Mobiltelefon und betrachtete die Nachricht die er soeben erhalten hatte.
„Lust auf eine Jagd?“
Mehr stand da nicht. Er wusste genau vom wem die Worte stammten.
Fünfzehn Jahre lang war der Schreiber der Zeilen sein Boss gewesen, sein Agentenführer in der Spezialeinheit des Auslandsgeheimdienstes. Unzählige Aufträge hatten sie allein und gemeinsam mit anderen Agenten durchgeführt.
Bereits mit sechzehn Jahren war er in den Militärdienst eingetreten. Seine Vorgesetzten hatten bald erkannt, dass er etwas Besonderes war. Sein sagenhaft hoher IQ, in Verbindung mit seiner Kaltschnäuzigkeit, seine enorme mentale Stärke und die exzellente körperliche Fitness, prädestinierten ihn zum Agenten dieser Spezialeinheit.
Vor fast genau einem Jahr war er ausgeschieden.
Bei einem Einsatz im Jemen, sie waren unterwegs gewesen den Führer einer radikalislamistischen Organisation zu erledigen, war etwas schief gelaufen.
Ein Fehler im Elektronikchip der Bombe hatte sie zu früh zur Explosion gebracht. Zwei seiner Kameraden waren regelrecht zerfetzt worden. Er überlebte, weil er kurz zuvor aus dem Wagen gestiegen war, um seinen vorgesehenen Standort einzunehmen.
Jo Skey war festgenommen worden und saß unter grauenvollen Folterungen acht Monate in einem Gefängnis wie im Mittelalter. Im Rahmen eines Gefangenenaustausches kam er im Frühjahr 2012 frei und quittierte den Dienst.
Seither lebte er in Monaco. Lukrative Privataufträge ermöglichten ihm ein sorgenfreies Leben im Fürstentum. Dass er zum Auftragskiller geworden war, störte ihn nicht. Er hatte schließlich nichts anderes gelernt.
Außerdem war in diesem Job, mit relativ wenig Aufwand, viel Kohle zu machen. Das gefiel ihm.
„Kommt auf das Jagdgebiet an“, tippte er in sein Telefon und schickte die Nachricht über. den Atlantik. Es dauerte nur einige Augenblicke und die Antwort war da.
„Treibjagd. Treffen im Jagdhaus. Zeitpunkt folgt.“
Jo schaltete sein Mobiltelefon ab. Er musste nicht antworten. Kam keine Antwort, so wusste der Anrufer, dass Jo verstanden hatte und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein würde.
Er sprang aus dem Bett, legte sich auf den Rücken und absolvierte in kurzer Zeit fünfzig Sit-Ups, drehte sich auf den Bauch und machte fünfzig Liegestütze.
Danach ging er ins Bad. Das Mädchen Rosalie, eine französische Studentin, die sich über den Sommer ihr Studium horizontal verdiente, war verschwunden.
Jo holte einen Aluminiumkoffer aus dem Stahlschrank, öffnete ihn und entnahm die Teile eines Präzisionsgewehres. Fast zärtlich strich er über die einzelnen Stücke, setzte das Gewehr zusammen und zerlegte es wieder. Diese Übung wiederholte er, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Sein Arbeitsgerät so schnell als möglich bereit zu machen, war sein täglich Brot. Es verwunderte ihn sehr, dass die Nachricht von seinem Ex-Boss gekommen war. Er hatte seit dessen Rauswurf aus der Firma keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.
5
Ein kalter Ostwind, verbunden mit Starkregen, fegte an diesem Freitag im Mai über den Vienna International Airport. Flug Delta 8837 aus New York war soeben gelandet.
Die Passagiere strömten in die große Ankunftshalle.
„Kümmere dich um den Mietwagen-Service, Darling.“
Ben A. Oreovic lächelte seine Sekretärin Linda an.
„Ich habe bereits einen Wagen mit Fahrer bestellt. Der müsste in der First Class Lounge bereit stehen.“
Linda hauchte ihm einen Kuss auf die Wange.
Sie hatten nur Handgepäck. Das reichte für eine Nacht im besten Nobelhotel an der Wiener Ringstraße.
„Küss die Hand gnädige Frau, Verehrung der Herr!“
Franz Navrotill, Fahrer beim Nobelvermieter Global Luxury, hielt den Wagenschlag des schwarzen Daimlers auf und verbeugte sich galant.
„Was hat er gesagt, Liebling“?, fragte Linda.
„Du sollst einsteigen und ganz lieb zu mir sein.“
Sie sah ihn zweifelnd an, und ließ sich in die tiefen Polster fallen.
Die Fahrt vom Flughafen zum Hotel dauerte im morgendlichen Frühverkehr etwa eine Stunde.
Im Foyer wartete bereits John Levynn. Er saß in einem tiefen Ledersessel und studierte ein Journal. Als er die beiden Ankömmlinge sah, eilte er auf sie zu und begrüßte sie herzlich.
„Hallo Ben, alter Freund, wie geht es dir? Irre ich mich oder ist deine Frau einige Jahre jünger geworden. Wie macht sie das nur?“
Levynn hatte hebräisch gesprochen. Er lächelte Linda charmant an.
„Lass deine Witze Levynn. Lerne endlich dich zu benehmen und sprich unsere Sprache, damit Linda dich verstehen kann.“
Ben A. Oreovic war sofort wütend über Johns Verhalten. Der lachte nur belustigt.
„Unser Gesprächspartner ist schon hier. Er wartet in seinem Zimmer auf uns. Sag deiner Sekretärin, oder was immer sie sein mag, sie soll sich verdrücken.
Schick sie Einkaufen oder sonst wohin. Ich will sie hier nicht mehr sehen. Mach was ich dir sage. Sofort!“
Levynn scherte sich nicht um Bens Aufforderung Englisch zu sprechen.
Er sah ihn mit seinen eiskalten Augen scharf an und setzte sich dann in Richtung Aufzug in Bewegung.
Oreovic geleitete die leicht verwirrte Linda zur Rezeption, gab ihr einen Kuss und folgte Levynn.
Ein livrierter Boy verbeugte sich elegant und brachte sie in den 7. Stock, wo sie Jesper Morgen in seinem Zimmer bereits erwartete.
„Das ist unser Gesprächspartner, ihr kennt euch ja schon, nicht wahr?“
Levynn grinste hinterhältig.
„Ich schlage vor, wir machen einen kleinen Spaziergang. Die frische Luft wird uns gut tun, nach den langen Flügen.“
John Levynn schob die beiden Männer auf die Zimmertür zu und sie verließen gemeinsam das Hotel.
Auf einer etwas abgelegenen Bank im Stadtpark, mit Blick auf das vergoldete Denkmal des Wiener Walzerkönigs, nahmen sie Platz. Levynn holte ein kleines Gerät, ähnlich einem Mobiltelefon aus seiner Aktentasche und stellte es auf die Bank.
„Das wird die Freunde aus Ost und West abhalten, uns zu belauschen. Ab jetzt können wir uns also gefahrlos unterhalten. Zu gefährlich im Hotel. Ich brauche euch nicht näher vorzustellen. Ihr kennt euch ja bereits. Zumindest telefonischen Kontakt hattet ihr ja schon. Ab jetzt wird über die ganze Sache am Telefon nicht mehr gesprochen ist das klar? Eure erste Unterhaltung war schon gefährlich genug.“
„Soll das heißen, dass dein ehemaliger Verein meine Telefone abhört?“
Ben A. Oreovic sah Levynn entsetzt an.
„Sagen wir einmal so“, John Levynn überlegte sich eine Formulierung.
„Ich bin zwar schon seit mehr als zwei Jahren nicht mehr im Rennen, habe aber immer noch meine Kontakte in die Firma und gute Freunde dort. In den Aufgabenbereich der Jungs fällt nun mal auch, unsere Brüder und Schwestern in aller Welt zu schützen. Jene Mitbürger, die über Einfluss und Vermögen verfügen, und das sind deren nicht wenige, stehen unter besonderem Schutz und deshalb ist es notwendig über das Leben dieser Leute Bescheid zu wissen. Wir verstehen uns?“
Levynn zwinkerte Oreovic lächelnd zu.
„Das ist ja… das ist unfassbar! Das ist illegale Bespitzelung. Ein Skandal ist das. Mir ist bekannt, dass man dich rausgeworfen hat. Ich kenne deine schmutzige Geschichte, John Levynn. Ich werde mich beschweren.
Ich habe beste Kontakte in den Kongress. Ich mache dich fertig, darauf kannst du Gift nehmen!“
Ben A. Oreovic war dunkelrot angelaufen, an seinem Hals pulsierte eine Ader so heftig, dass sie zu platzen drohte.
„Jetzt reg dich nur nicht künstlich auf Ben und nenne mich ruhig weiter beim Vornamen. Wir sind doch alte Freunde, oder? Was glaubst du, was die Typen im Kongress, oder sagen wir besser deren Handlanger, unter dem Deckmantel 9/11 machen? Dagegen sind diese Spielchen wirklich harmlos. Außerdem hat das mit unserer Sache nichts zu tun. Das sind politische Angelegenheiten. Von uns nicht beeinflussbar.
Also lassen wir das und kommen wir zum Wesentlichen. Ich habe euch hierher gebeten, damit wir uns über etwas unterhalten können, was nur uns drei angeht. Jesper ich möchte dich bitten jetzt im Detail zu erzählen was dich veranlasst hat uns zu kontaktieren“.
John Levynn klopfte Jesper kameradschaftlich auf die Schulter und lehnte sich zurück.
Es hatte aufgehört zu regnen und schien nun doch noch ein sonniger Tag zu werden.
Ben A. Oreovic hatte sich eine Pille eingeworfen die ihn wohl beruhigen sollte. Jesper Morgen blickte die beiden Männer lange an, bevor er mit seiner Schilderung begann.
„Wie euch bekannt, betreibe ich in einem kleinen Ort im schweizerischen Engadin einen bescheidenen Schmuckladen. Am letzten Mittwoch hatte ich einen Kunden aus Österreich, genauer gesagt aus Tirol. Er legte mir einen einzigartig geschliffenen Brillanten zur Begutachtung vor. Ein ausgesprochen schöner Stein, Rundschliff, 0,75 Karat, Farbe L, Reinheitsgrad SI 1.
Zuerst war ich mir nicht sicher, aber bei genauerer Betrachtung stellte ich fest, dass ich den Schliff kannte.
Es ist eine einzigartige Arbeit und jeder Fachmann kennt diesen Schliff. Er stammt von Josip Abrovicszé, einem Spezialisten des Gewerbes, der Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, so um 1902 bis 1920 in Wien lebte und sich auf das Bearbeiten von Diamanten aus Afrikas Süden spezialisiert hatte.
Der besagte Stein stammt mit hundertprozentiger Sicherheit aus seiner Werkstatt.
Diese besonderen Edelsteine waren fast alle im Besitz jüdischer Familien in Wien und Umgebung. Kaufleute, Anwälte, Ärzte, Künstler, vorwiegend vermögende und ehrenwerte Leute. Teilweise waren die Steine in Schmuckstücken verarbeitet, teilweise hatten sie die Besitzer lose, als Geldanlage, im Tresor.
Als der Druck der Nationalsozialisten auf die jüdische Bevölkerung immer brutaler wurde und kein Jude vor Übergriffen, verbunden mit Diebstahl und Enteignung, sicher sein konnte, entschlossen sich viele wohlhabende Familien zu einer ganz besonderen und einmaligen Maßnahme.
Sie vertrauten Immanuel Oreovic, Bens Großvater, ihre Vermögenswerte an.
Immanuel Oreovic war zu dieser Zeit ein angesehener Kaufmann in Wien. Er betrieb einen gut florierenden Kunst-und Antiquitätenhandel. In der Innenstadt hatte er ein nobles Geschäft und zählte die beste Wiener Gesellschaft zu seinen Kunden.
Er sollte die Wertgegenstände vor den Nazi-Schergen in Sicherheit bringen.
Von einem Gremium jüdischer Würdenträger war er für diese Aufgabe ausgewählt worden. Erstens, weil er jüdischer Abstammung war, zweitens, weil er, nach Ansicht des Waisenrates, die besten Voraussetzungen für ein derart heikles Unternehmen mitbrachte.
Wie gesagt, Immanuel Oreovic war zwar jüdischer Abstammung aber bekennender Atheist. Er hatte mit jüdischen Werten und unserem Glauben absolut nichts am Hut und so kam es, dass die Nazis ihm irgendwie vertrauten, zumal er vielerlei Geschäfte mit Hitlers Schergen machte. Oreovic war durch und durch Geschäftsmann. Er war an jedem Geschäft interessiert, egal um was es ging und egal mit wem es zustande kam.
Es wurde ihm damals nachgesagt, dass er großen Einfluss auf den Schwarzmarkt ausüben würde. Trotz teils heftigen Widerstandes der jüdischen Geschäftsleute, die von seinen dunklen Machenschaften teilweise Bescheid wussten, schien Immanuel Oreovic in dieser schweren Zeit der einzige Mensch zu sein, der in der Lage war die Vermögenswerte der verzweifelten Familien so lange vor dem Zugriff der Nazis verbergen zu können, bis das Schreckensregime ein Ende haben würde. In ihrer Not vertrauten viele Brüder und Schwestern darauf, dass ihr gesamtes Familienvermögen in sicheren Händen sei. Sie übergaben jede Menge Schmuck, Gold und andere Wertsachen an Oreovic.
Es gab ein Komitee unter den Juden, welches genau Buch führte über die Übergaben und deren Werte. Außerdem war genau festgelegt worden, welchen Anteil Oreovic für die Verwahrung erhalten sollte. Die Großväter von Jonny und mir waren damals in diesem Gremium vertreten und sollten die Aufbewahrung überwachen. Oreovic hatte den Großteil der Gegenstände heimlich aus der Stadt gebracht. Wie er das bewerkstelligt hatte und vor allem wo er die Dinge lagerte, wurde nie bekannt. Vermutlich in einer versteckten Lagerhalle oder dergleichen. Genaueres ist nicht bekannt oder besser gesagt, wurde uns nicht überliefert.
Jedenfalls hatte Oreovic einen genauen Plan über das Versteck. Unsere Väter sollten eine Abschrift des Planes und genaue Ortskenntnisse des Depots bekommen.
Es konnte nicht irgend ein Erdloch oder eine Höhle sein, zumal ja auch Gemälde und Teppiche unter den Sachen waren. Eine trockene und stabile Lagerung war daher unbedingt erforderlich. In den Wirren vor dem Novemberpogrom, der Reichskristallnacht, wie es die Nazischweine zynisch nannten, kam es nicht mehr zur Übergabe des Planes an das Komitee. Immanuel Oreovic hatte alle Aufzeichnungen bei sich, als er Ende Oktober 1938 spurlos verschwand.
Spätere Recherchen eines Anwaltes, der in Kreisen der Gestapo nachforschte, ergaben, dass Oreovic von den Nazis gefasst worden war, in eines der grauenvollen Lager verbracht und dort, 1940, zu Tode kam.
Seine Frau Sara hatte sich schon vorher von ihm getrennt. Sie war nach Amerika emigriert, wo sie bei ihrem Sohn ihren Lebensabend verbrachte.
Die an Oreovic übergebenen Wertgegenstände der Familien, sie dürften einen Zeitwert von mehreren Millionen Dollar haben, liegen seither irgendwo in einem Versteck, das kein Mensch kennt, oder aber die Nazis haben ihm bei der Festnahme sein Geheimnis entlockt und die Dinge sind längst in alle Welt verstreut.
Kurz vor den Novemberpogromen, konnten sich unsere Familien über Griechenland nach Amerika absetzen.
Viele andere Familien hatten dieses Glück nicht. Sie wurden von Hitlers Schlächtern verschleppt und kamen in den Gasöfen grauenvoll ums Leben.
Jesper Morgen unterbrach seine Erzählung und wischte sich gerührt über die Augen.
„Mittwoch tauchte nun ein junger Mann bei mir auf und legte den besagten Brillanten auf den Tisch. Er sagte, er habe den Stein von einem Freund bekommen und wolle ihn für diesen bewerten lassen.
Der Brillant stammt aus der Vorkriegszeit, aus einer jüdischen Sammlung, da bin ich absolut sicher.
Ob er allerdings aus einer der Sammlungen stammt, die Oreovic übergeben worden waren, kann natürlich kein Mensch mit Sicherheit sagen.
Woher aber hat der Bursche aus Tirol diesen Stein?
Gibt es mehrere davon? Existieren gar noch die Pläne der Verstecke? Fragen über Fragen, die ich mir gestellt habe.“
Jesper Morgen lehnte sich zurück. Seine Stirn war schweißnass. Er zückte ein buntes Taschentuch und tupfte sich das Gesicht trocken. Die Schilderung hatte ihn offenbar sehr mitgenommen, zumal nun auch die Sonne den herrlichen alten Park wärmte und leichter Dunst aus den nassen Gräsern und Sträuchern aufstieg.
Ben A. Oreovic war erregt. Missmutig, ja zornig, marschierte er vor der Parkbank auf und ab.
„Zuerst möchte ich feststellen, dass mein Großvater nicht mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache gemacht hat. Er war kein schmutziger Kollaborateur.
Das ist schlicht und einfach eine gemeine Unterstellung. Er war ein angesehener Geschäftsmann und….“
Oreovic wurde von John Levynn unterbrochen.
„Er war ein Gauner“, fauchte der eisig.
„Ein Betrüger. Ein Bandit. Ein Scheißkerl. Ein gottloser Satansbraten, der unseren Glauben mit Füßen trat.
Er war damals eine Größe am Schwarzmarkt, skrupellos und gerissen. Das wissen wir. Das war allseits bekannt. Außerdem war er ein Frauenheld, vor dem kein Rock sicher war. Diesbezüglich scheinst du ja genetisch belastet zu sein, mein lieber Ben.“
Levynn grinste Ben süffisant an, was diesem noch mehr Zornesröte ins Gesicht trieb.
„John, du bist ein gemeines Schwein, ein..“
„Pass auf was du sagst. Denk immer daran mit wem du es zu tun hast. Also überlege und bleibe gelassen, ja?
Es könnte dir sonst nicht bekommen.“
Ben A. Oreovic zitterte vor Zorn, wandte sich ab und ging ein paar Schritte über den Rasen. Er versuchte sich unter Kontrolle zu bringen. Man sah ihm an, dass er Angst vor John Levynn hatte. Nicht so sehr vor der Macht und dem Einfluss dieses Mannes, der einst eine Größe des Geheimdienstes gewesen war, vielmehr vor dessen eiskalter Brutalität, für die er bekannt war.
„Setz dich wieder zu uns Ben. Wir müssen uns überlegen, was zu tun ist.“
Levynn deutete einladend auf die Parkbank. Er wandte sich an Jesper Morgen.
„Hast du herausfinden können wer der Mann mit dem Brillanten ist? Woher genau er kam?“
„Ich habe nur das Kennzeichen seines Wagens notieren können. Außerdem habe ich noch ein Video der Überwachungskamera. Die Aufnahmen sind aber nicht von allzu guter Qualität.“
„Das ist ja schon etwas“, sagte Levynn zufrieden.
„Ich kenne einige Leute, die den Kerl ausfindig machen, verlasst euch drauf. Ich finde schon Mittel und Wege die uns weiterhelfen. Es ist ein erstes Zeichen seit 75 Jahren. Unsere Väter haben nichts unversucht gelassen, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Vergebens. Nun haben wir die Chance, doch noch Gerechtigkeit für unsere Ahnen einzufordern. Wir müssen diese Chance ergreifen. Wie Jesper schon erkannt hat, kann niemand mit Sicherheit sagen, dass uns der Stein zu der Sammlung führt. Es ist aber das erste Mal, dass überhaupt ein Hinweis aufgetaucht ist. Seit 75 Jahren, unglaublich. Wir müssen es riskieren, wir müssen alles tun, um herauszufinden, was es mit dem Brillanten auf sich hat.“
Levynn zündete sich eine Zigarette an und fuhr dann fort.
„Ich schlage vor, dass wir zuerst versuchen den Burschen ausfindig zu machen. Gelingt uns das, so wird es nicht schwer sein herauszuquetschen, woher er diesen Stein hat. Ich denke da an einen Mann mit besonderen Fähigkeiten für derlei Dinge. Ihm hat noch jeder ein Liedchen vorgesungen.“
Seine eisigen Augen starrten Ben A. Oreovic an, dem ein kalter Schauer über den Rücken lief.
Der ist rücksichtslos, dachte er, der bringt auch Menschen um, ohne mit der Wimper zu zucken. Warum mache ich da eigentlich mit?
„Ich…. ich habe noch eine Frage John.“
Ben A. Oreovic` Stimme war unsicher, seine vor dem Bauch gefalteten Hände zitterten, kleine Schweißperlen glitzerten auf seiner hohen Stirn.
„Wozu braucht ihr eigentlich mich bei der Sache?“
„Weil du der glorreiche Enkel von diesem Dreckskerl bist. Dieses Schwein, dass unsere Vorfahren getäuscht und betrogen hat und das Vermögen unserer Väter, Freunde und Verwandten gestohlen hat.“
„Mein Gott, das ist doch nur eine Vermutung! Noch wissen wir überhaupt nichts. Du sagst selbst, dass sich möglicherweise die Nationalsozialisten die ganzen Sachen unter den Nagel gerissen haben. Damals wurde doch geraubt und geplündert was das Zeug hielt. Ihr kennt doch die Geschichten. Es taucht ja mittlerweile immer wieder Raubkunst aus der damaligen Zeit auf, oder etwa nicht?“
„Da hast du schon recht Ben. Nur ist bis heute nicht ein Stück aufgetaucht, das den Schätzen zugeordnet werden konnte, die Oreovic damals übergeben worden waren. Außerdem, woher hätten die Nazis von dem Gremium und der Vorgangsweise wissen sollen?
Oreovic war sicher nicht so dumm, diese Geheimnisse preiszugeben. Das glaube ich einfach nicht, dazu war er zu gerissen, zu schlau, zu abgeklärt.
Es mag stimmen, dass er im Lager umgekommen ist.
Ja, das ist gut möglich. Was aber, wenn er einen Komplizen, einen Vertrauten hatte, der entkommen konnte?
Wäre doch möglich, oder? Nein, ich habe ein untrügliches Gefühl, dass die Angelegenheit stinkt und zwar gehörig. Also Ben, mach dir nicht ins Hemd, du bist dabei. Du weißt schon zu viel und kannst nicht mehr abspringen. Außerdem wirst du die Sache finanzieren, mein Freund. Es war dein Großvater der unsere Familien betrogen hat. Das ist sozusagen sein Erbe an dich, okay? So wie ich das sehe, bist du wohl der Einzige von uns, der die nötigen Mittel locker aufbringen kann.
Sollte an der Sache was dran sein, wovon ich mittlerweile überzeugt bin, so ist es unser Recht und unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass das gestohlene Eigentum zurückkommt zu den rechtmäßigen Besitzern. Wir sind gefordert, alle Mittel einzusetzen um diesen Auftrag auszuführen, um das Unrecht gutzumachen. Das betrifft dich genauso wie uns. Also warte einfach ab was passiert. Bei mir ist die Planung und Ausführung der Aktion in guten Händen. Ihr seid doch einverstanden, dass ich die Sache organisiere?“
John Levynn sah die beiden Männer herausfordernd an.
Ben A. Oreovic sah aus, als wollte er noch etwas einwenden, unterließ es aber, nach einem Blick in die kalten Augen seines Gegenübers.
Jesper Morgen nickte zustimmend.
6
John Levynn saß an einem der kleinen Tische auf der Terrasse des Bistros, im pompösen Yachthafen von Monte Carlo und genoss den Blick auf Luxusyachten aller Preisklassen.
„Hallo Jonny“, sagte Jo Skey und klopfte ihm von hinten auf die Schulter. Levynn fuhr erschrocken herum.
Er war in Gedanken gewesen und hatte ihn nicht kommen hören.
„Du solltest einen alten Mann nicht so erschrecken mein Junge. Er könnte einen Herzschlag bekommen.
Dir ginge damit womöglich ein gutes Geschäft durch die Lappen.“
John lachte und umarmte ihn herzlich.
„Wie geht es dir Jo? Lange nicht gesehen.“
„Schau mich an, sieht so jemand aus, dem es schlecht geht? Seit ich von dir nicht mehr unterdrückt und gequält werde, blühe ich auf.“
„Du machst wirklich einen hervorragenden Eindruck, mein Sohn.“
Levynn betrachtete ihn prüfend. Er hatte Jo früher oft mein Sohn genannt. Er liebte ihn wirklich wie einen Sohn. Er hatte dem Jungen eine große Zukunft in der Firma vorausgesagt. Was Jo jetzt machte, hatte ihm bisher absolut nicht gefallen. Dass er nun selbst seine Dienste in Anspruch nehmen sollte, betrachtete er als Zufall oder Schicksal oder was auch immer. Jedenfalls war er froh, dass Jo bereit war mit ihm zu sprechen.
Skey setzte sich und sah ihn fragend an.
„Was hast du mir zu erzählen? Raus mit der Sprache“.
„Nicht hier Jo, nicht hier. Lass uns ein Stück gehen, da redet es sich leichter.“
Er winkte dem Kellner, bezahlte und sie gingen los. Es war früher Vormittag, die exquisite Marina lag ruhig in der Morgensonne. Wie an der Riviera üblich, war es Anfang Mai schon recht warm, frühsommerlich konnte man es nennen. Einige Bootseigner waren unterwegs zum Bäcker, um das nötige Gebäck für ein schönes Frühstück an Deck zu besorgen.
Levynn setzte sich am äußersten Steg auf den Holzboden und ließ seine Beine knapp über dem Hafenwasser baumeln. In seinen modischen Jeans und dem teuren Polohemd sah er, trotz seiner sechzig Jahre, fit und durchtrainiert aus. Er schob die dunkle Sonnenbrille nach oben und sah Skey lange an.
„Es geht um eine reine Privatsache, Jo. Was ich dir jetzt erzähle und worum ich dich bitte, geht nur mich und dich etwas an. Kein Mensch darf etwas von der Sache erfahren. Ist das klar?“
„Bei mir ist dein Geheimnis in den besten Händen, das weißt du doch, oder?“
„Ja, natürlich. Sonst hätte ich mich auch nicht an dich gewandt, mein Sohn. Kommen wir also zur Sache.“
Levynn steckte sich eine Zigarette an und begann zu erzählen.
„Dein Auftrag führt dich nach Österreich, genauer gesagt nach Tirol. Zielobjekt ist ein junger Mann. Er heißt Patrick Höcher, 30 Jahre alt, ledig, wohnt allein in einem kleinen Appartement. Polizist.“
„Polizist?“
Jo räusperte sich und zog an seiner Zigarette.
„Ich erledige aus Prinzip keine Bullen. Zu gefährlich.
Ermittlungen nach Polizistenmorden werden mit vielfachem Einsatz geführt, Korpsgeist und so, du kennst das ja, nicht wahr?“
Levynn musste lächeln. Natürlich kannte er solche Situationen aus Erfahrung.
„Du sollst den Jungen ja nicht ermorden, sondern befragen. Hör mir gut zu. Patrick Höcher ist letzte Woche bei einem Juwelier in der Schweiz aufgetaucht und hat einen Brillanten bewerten lassen. Er hat angegeben für einen Freund zu handeln. Wir haben über das Autokennzeichen seine Identität herausgefunden. Ich glaube ihm die Geschichte mit dem Freund nicht so recht. Ich will wissen, woher er den Stein hat und wer diesen jetzt in seinem Besitz hat. Interessanterweise stammt der Brillant aus Familienbesitz, welcher 1938 verschwunden ist. Damals verschwanden auch wichtige Aufzeichnungen. Aufzeichnungen, die für mich von unschätzbarem Wert sind. Nicht von materiellem Wert, nein, individueller Wert, familiäre Kostbarkeiten, die Aufschluss über den Verbleib von Teilen unserer Familien nach den Gräueltaten der Nazis geben können. Du verstehst was ich meine?“
„Ich denke schon. Was verlangst du also von mir?“
Skey bot seinem Gegenüber eine Zigarette an.
„Deine Filterlosen sind mir zu stark. Danke.“
Levynn schmunzelte.
„Ich verlange nichts von dir, Jo. Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du fährst nach Tirol, spionierst die Gegebenheiten aus, schnappst dir den Burschen und unterziehst ihn einer Spezialbehandlung. Du quetscht aus ihm heraus woher er den Brillanten hat. Ich will alles wissen. Wann, woher, wie viel und was hat der Bursche noch. Habe ich mich klar ausgedrückt? Nimm ihn in die Mangel bis du sicher bist, dass er kein Geheimnis mehr hat.“
„Was springt für mich dabei heraus?“
Skey blickte Levynn fordernd an.
„Dein üblicher Tarif, samt Unkosten. Vorschuss zwanzigtausend Dollar, ist das okay?“
„Abgemacht. Wann soll es losgehen?“
„Sofort! Und denk daran, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Du hast seit deinem Ausscheiden keinen Kontakt mehr zu mir gehabt.“
„Ich bin nicht dümmer geworden, nur weil ich nicht mehr in der Firma bin. Diskretion ist die Basis meines neuen Jobs, keine Sorge Jonny.“
7
Skey war die ganze Nacht durchgefahren. Er hatte sich für einen dunkelgrünen Range Rover als Mietwagen entschieden. Immerhin ging es in die Berge und er wollte kein Risiko eingehen. Beim Autovermieter im italienischen Grenzort Ventimiglia hatte er einen amerikanischen Diplomatenpass, ausgestellt auf den Namen Dr. Keith Reynolds, vorgelegt und die Miete für zwei Wochen im Voraus bezahlt.
Mit den italienischen Kennzeichen fühlte er sich sicherer, unauffälliger. In Monaco zugelassene Fahrzeuge fielen zwangsläufig auf, das wusste er aus Erfahrung.
Mit dem öffentlichen Bus war er von Monaco nach Ventimiglia gereist. Seine Spezialausrüstung war unkontrolliert geblieben und so konnte er sich ab sofort im Europäischen Schengen Raum frei bewegen.
Den kürzeren Weg über die Schweiz vermied er. Der Grenzübertritt mit Waffen im Wagen war viel zu gefährlich. Es war später Samstag Vormittag, als Jo Skey, alias Dr. Keith Reynolds, im Hotel Das Kahbasser eincheckte. Er buchte ein Doppelzimmer für vorerst zehn Tage. Nachdem er sich frisch gemacht hatte, begab er sich ins Restaurant zum Brunch. Er vertilgte gerade eine Portion Tiroler Schinken mit Spiegeleiern, als Benedikt Kahbasser, Chef der noblen Herberge, an seinen Tisch kam.
„Guten Appetit Mister Reynolds. Herzlich willkommen im Kahbasser.“
„Oh“, Skey legte sein Besteck nieder.
„Danke sehr. Sie sind der Wirt?“
Benedikt Kahbasser war überrascht über das perfekte Deutsch des Amerikaners.
„Ja. Ich bin der Senior hier. Benedikt Kahbasser. Ich hoffe sie fühlen sich wohl bei uns. Was führt sie in die Berge, wenn ich fragen darf, Dr. Reynolds?“
„Ach, nennen Sie mich doch Keith. Erstens suche ich etwas Erholung und zweitens möchte ich auf die Jagd gehen. Vorausgesetzt ich bekomme Gelegenheit dazu.“
Skey lächelte ironisch.
„Auf die Jagd? Aha. Außer uralten Rehböcken und nichtführenden Schmalgeißen ist derzeit Schonzeit.
Für Gams, Hirsch, Steinbock und Murmeltier ist es noch zu früh.“
„Es kommt mir gar nicht so auf den Abschuss an. Es ist die Natur die ich genießen will, die Umgebung, die ich kennenlernen will und die gute Luft. Habe ich Glück und kann einen guten Rehbock ansprechen, soll es mir recht sein. Ansonsten gehe ich gerne wandern.
Ich interessiere mich für Land und Leute.“
Skey schob sich den letzten Bissen in den Mund und kaute genussvoll.
„Ich werde mit meinem Sohn sprechen. Johannes ist im Haus für Animation zuständig und betreut auch unsere Jagdgäste. Wie gesagt, derzeit ist noch nichts los, erst im Herbst ist dann richtig Jagdsaison bei uns.
Einen schönen, erholsamen Tag, Keith. Genießen sie den Aufenthalt bei uns.“
Benedikt Kahbasser erhob sich und ging wieder nach nebenan in die Stube, wo am Stammtisch schon reger Besuch herrschte.
Jo Skey holte seinen Wagen aus der Tiefgarage. Er wollte sich erst einmal ortskundig machen. Der riesige Parkplatz des Einkaufszentrums am Ortsrand war nur spärlich belegt. Er stellte den Wagen ab und schlenderte in den Markt. In einem Papierladen kaufte er eine Landkarte, Maßstab 1:25.000 und einen Wanderführer.
Im Sportgeschäft erwarb er Bergschuhe, Berghose und einen Rucksack. Typische Jagdbekleidung fand er in einem Trachtenshop. Den Einkaufswagen vor sich herschiebend erreichte er seinen Wagen. Er sah sich um.
Der riesige Parkplatz war fast leer. An der dem Eingang abgewandten Seite rammte er den Range Rover, sodass ein leichter Kratzer entstand. Danach legte er seinen Einkauf in das Fahrzeug und stellte den Einkaufswagen an den dafür vorgesehenen Platz.
Vor der Polizeiinspektion parkte er und läutete. Nach einem Summton öffnete sich die Tür und er gelangte durch eine Sicherheitsschleuse in das Wachzimmer.
Eine junge Polizistin stand hinter dem hölzernen Tresen und begrüsste ihn freundlich.
„Guten Tag, was kann ich für sie tun?“
Hübsche Mädchen haben die hier bei den Bullen, dachte Skey und lächelte charmant.
„Hallo, mein Name ist Dr. Reynolds. Ich bin amerikanischer Staatsbürger und möchte einen Schaden an meinem Mietwagen melden.“
Er legte seinen Diplomatenpass und den passenden Führerschein auf den Tresen. Die Polizeibeamtin nahm beide Papiere an sich und begutachtete sie. Unbemerkt schob sie den Pass in den Scanner unterhalb des Pultes. Wie ein Ami sieht der nicht aus, dachte sie, eher wie ein Ägypter oder so.
„Was ist wann und wo passiert, Dr. Reynolds?“
Sie sah ihn fragend an.
„Ich bin nicht ganz sicher. Ich denke es muss vorhin am Parkplatz des Einkaufszentrums geschehen sein, während ich im Laden war. Nur ein Kratzer. Vermutlich eine Hausfrau, deren Einkaufswagen sich selbständig gemacht hatte. Es handelt sich aber um ein Mietfahrzeug und ich brauche wohl eine Bestätigung, polizeiliche Meldung oder so.“
„Ist das der Wagen?“
Sie deutete aus dem Fenster.