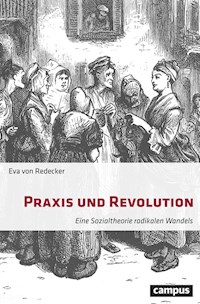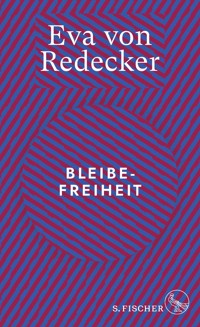
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein radikal neuer Freiheitsbegriff von einer leidenschaftlichen Stimme der Gegenwartsphilosophie Selten wurde Freiheit so intensiv diskutiert wie in der Pandemie: die Freiheit zu reisen, sich uneingeschränkt zu bewegen, Menschen dort zu treffen, wo man möchte. Doch wie zukunftsfähig ist ein derart räumlich abgesteckter Freiheitsbegriff, da wir Zeiten entgegensehen, in denen die Orte schwinden, an denen es sich leben lässt und Klimakrise oder Kriege ganze Landstriche unbewohnbar machen? Die Philosophin Eva von Redecker denkt Freiheit darum ganz neu: als die Freiheit, an einem Ort zu leben, an dem wir bleiben könnten. Bleibefreiheit entfaltet sich zeitlich. Als auch künftig lebbare Freiheit rückt sie nicht nur die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in den Blick, sie verringert auch den Abstand zwischen dem Freisein Einzelner und ihrer Gemeinschaft. Bleibefreiheit lässt sich nur gemeinsam herstellen. Und sie wächst, wenn wir sie teilen. »Gelehrt, rigoros, spielerisch und lesbar, gleichzeitig in der Welt und über ihr schwebend, ist von Redecker eine brillante und wundersame Intellektuelle, angetrieben von der philosophischen Frage, wie wir aus dem, was wir jetzt tun, eine bessere Zukunft machen können.« Wendy Brown
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eva von Redecker
Bleibefreiheit
Über dieses Buch
Ein radikal neuer Freiheitsbegriff von einer leidenschaftlichen Stimme der Gegenwartsphilosophie
Selten wurde Freiheit so intensiv diskutiert wie in der Pandemie: die Freiheit zu reisen, sich uneingeschränkt zu bewegen, Menschen dort zu treffen, wo man möchte. Doch wie zukunftsfähig ist ein derart räumlich abgesteckter Freiheitsbegriff, da wir Zeiten entgegensehen, in denen die Orte schwinden, an denen es sich leben lässt und Klimakrise oder Kriege ganze Landstriche unbewohnbar machen? Die Philosophin Eva von Redecker denkt Freiheit darum ganz neu: als die Freiheit, an einem Ort zu leben, an dem wir bleiben könnten. Bleibefreiheit entfaltet sich zeitlich. Als auch künftig lebbare Freiheit rückt sie nicht nur die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen in den Blick, sie verringert auch den Abstand zwischen dem Freisein Einzelner und ihrer Gemeinschaft.
Bleibefreiheit lässt sich nur gemeinsam herstellen. Und sie wächst, wenn wir sie teilen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Eva von Redecker, geboren 1982, ist Philosophin und freie Autorin. Von 2009 bis 2019 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität und als Gastwissenschaftlerin an der Cambridge University sowie der New School for Social Research in New York tätig. 2020/2021 hatte sie ein Marie-Skłodowska-Curie-Stipendiatium an der Universität von Verona inne, wo sie zur Geschichte des Eigentums forschte. Eva von Redecker beschäftigt sich mit Kritischer Theorie, Feminismus und Kapitalismuskritik, schreibt Beiträge für u.a. »Die ZEIT« und ist regelmäßig in Rundfunk- und TV-Interviews zu hören. Seit Herbst 2022 richtet sie am Schauspiel Köln die philosophische Gesprächsreihe »Eva and the Apple« aus. Bei S. FISCHER erschien zuletzt ihr Buch »Revolution für das Leben. Philosophie der neuen Protestformen« (2020) sowie ein Vorwort zur Jubiläumsausgabe der »Dialektik der Aufklärung«. Aufgewachsen auf einem Biohof, lebt sie heute im ländlichen Brandenburg.
Inhalt
[Widmung]
Die Ankunft der Schwalben
Bleibefreiheit
Bewegungsfreiheit
Zerbrochene Freiheit
Zukünftige Freiheit
Schwindende Welt
Das Ausbleiben der Schwalben
Die Freude der Schwalben
1. Zeitfülle
Allein auf dem Mars
Xanthippes Gesellschaft
Die Eigentumsposition
Den Tod sehen
Trillionen auf dem Mars
Hier bleiben, sterblich bleiben
2. Erfüllte Zeit
Verknappter Überfluss
Dem Tod zuvorkommen
Bleiben als Fluch?
Die Geburt wiederholen
Embryos in Sarkophagen
Wir werden unfrei geboren
3. Zeit der Fülle
Ein Prisma
Ordnung der Mutter
Welche Mutter und wie viele?
Aus Zeit gemacht
Aus Gezeiten gemacht
Dysbiose
Ungezwungene Regeneration
Redundanz
Coda
Dank
Für die Six O’Clock Society
Die Ankunft der Schwalben
Bleibefreiheit
Wissen Sie, wie es sich anfühlt, wenn die Schwalben wiederkommen? Ich kenne niemanden, der neben Scheunen und Schuppen lebte, dem der Moment nichts bedeutete. Es ist ein Festtag, fast wie Weihnachten oder der Erste Mai. Noch der konventionellste Landwirt, in dessen Ställen Zigtausende Stück Federvieh der Schlachtung entgegenvegetieren arretiert die offenen Scheunenfenster, damit die Schwalben ungehindert ein- und ausfliegen können. Die Gärtner im Nachbardorf haben Tonschalen geformt, damit sich ein Nest unter dem Blechdach nicht erhitzt. Sogar Lesben verfluchen ihre Katzen. Mitten im schnöden Alltag des anbrechenden Anthropozäns sind Schwalben heilig geblieben.
Aber das Datum steht nicht vorab im Kalender, und wir richten das Fest nicht aus. Man tut auch gar nichts, außer sich davon zu erzählen. »Bei uns sind die Schwalben schon da – und bei euch?« Ein Teil des Zaubers besteht darin, dass die Schwalben gar nicht ganz bei uns ankommen. Anders als andere Singvögel landen sie nahezu niemals auf der Erde. Nur zum Nestbau sammeln sie kleine Matschbällchen vom Boden; sie holen ein wenig Erde zu sich in die Höhe, um dort auf ihr zu leben. Trunk und Jagd erledigen die Rauchschwalben im Flug. Sie bleiben in ihrem Element. Und unsere Welt weitet sich ein wenig, wenn plötzlich wieder diese scheinbar schwerelosen Körper in jubilierenden Loopings über die Dächer ziehen. Nicht unsere Schwalben, und doch kommen sie zu uns.
In der ersten Pandemiewelle hätte ich eigentlich in die USA reisen sollen, um einige Vorträge zu halten. Einladungen, über die ich mich ursprünglich sehr gefreut hatte. Aber als klar war, dass ich nicht würde fahren können, war mir das merkwürdig gleichgültig. Mehr noch: Ich war richtiggehend erleichtert. Plötzlich kam es mir vor wie ein Glücksfall, als sei ein Frevel gerade noch verhindert worden. Was hatte ich mir eigentlich eingebildet, dieser Tage in einem Flugzeug zu sitzen und CO2 in die Atmosphäre zu pumpen? Ein Vortragsmanuskript über Autoritarismus auf den Knien, aber in meinen eigenen Selbstverständlichkeiten gefangen? Das Freiheitsempfinden an dem Tag kam allerdings nicht vom erleichterten Gewissen. Ich hatte ja auch nichts richtig gemacht. Es war einfach ein verblüffender Genuss von Offenheit – keine Termine, keine Fristen heute – und dazu das Geschenk einer ganz besonderen Gunst. An genau dem Tag kamen die Schwalben wieder. Und ich war da.
Bewegungsfreiheit
»Bleibefreiheit« habe ich das dann probeweise genannt. Die Freiheit, zu bleiben. Das ist natürlich paradox. Wieso sollte man angesichts eines vereitelten Flugs von Freiheit sprechen? Zumal ich ja von Anfang an nicht hätte zusagen müssen. Und nun, da die Reise geplant war, wurde ich unfreiwillig von ihr abgehalten. Bleibezwang kann keine Freiheit sein. Und auch abgesehen von meiner konkreten Situation widerstrebt das Bleiben der Assoziation mit Freiheit.
Schließlich ist »Freiheit« in der westlichen Tradition untrennbar mit Bewegungsfreiheit verknüpft. Thomas Hobbes, der mit seiner Schrift Leviathan Mitte des 17. Jahrhunderts die moderne politische Philosophie begründete, erklärte etwa: »Freiheit bedeutet genau genommen das Fehlen von Widerstand, wobei ich unter Widerstand äußere Bewegungshindernisse verstehe.«[1] Gut einhundert Jahre später hieß es beim britischen Rechtsgelehrten William Blackstone weiterhin, dass individuelle Freiheit in »Lokomotion«,[2] also Fortbewegungsfähigkeit bestünde. Die mechanische Vorstellung von Freiheit als ungehinderter Bewegung scheint vielleicht etwas simpel, aber sie unterliegt auch komplexeren Konzeptionen. Wenn Freiheit vom autonomen Willen abgeleitet wird, besteht sie im Entscheidungsspielraum, innerhalb dessen der Wille sich bewegt. Liberale Freiheit ist stets auf ein räumliches Imaginäres angewiesen, sie ist geradezu eine geometrische Figur. Rechtlich abgezirkelte Sphären, innerhalb derer uns nichts einschränken soll als dieselben Rechte anderer, geben ihr den nötigen Rahmen. Und schon bevor Freiheit als Menschenrecht revolutionär verbrieft wurde, ließ sie sich als Ortswechsel erfahren: Frei ist, wer aus Ägypten ins Gelobte Land aufbricht. Frei ist die Stadt, in der die Fron aufgehoben, frei sind die Nordstaaten, in denen die Sklaverei verboten ist. Nachdem dann das vermeintlich gleiche Recht auf Freiheit eingeführt wurde, stand und fiel sein Wert mit dem Anspruch auf Freizügigkeit, also dem Recht, seine Heimat zu verlassen, ohne ein Abzugsgeld zu zahlen.
Schließlich war die Reisefreiheit einer der Hebelpunkte, der das Ende des undemokratischen Staatssozialismus einläutete. Und wenn Sie mich nach der größten Ungerechtigkeit der Gegenwart fragten, würde ich vermutlich sagen, dass sie darin besteht, wie die im Laufe der letzten zweihundert Jahre befestigten Nationalstaatsgrenzen die globale Ungleichheit um den Preis Zehntausender Menschenleben zementieren. Das Gefühl von Weite, das einen beim Blick auf Zugvögel überkommt, müsste für Menschen überhaupt noch realisiert werden. Mein deutscher Pass erlaubt mir den visumsfreien Besuch von 191 Ländern, einer Bürgerin in Simbabwe, wo viele Schwalben die andere Jahreshälfte verbringen, steht nicht mal ein Drittel davon offen, schon gar nicht die gen Norden.
So sehr, wie Freiheit und Bewegungsfreiheit zusammenfallen, ist es auch kein Wunder, dass die pandemiebedingten Reisebeschränkungen von vielen als drastische Freiheitseinbuße empfunden wurden – und das nicht nur, wo sie Menschen tatsächlich in beengten und gewalttätigen Haushalten festhielten. Freiheit ist Bewegungsfreiheit. So gesehen bildet das Bleiben geradezu den Nullpunkt der Freiheit.
Zerbrochene Freiheit
Ich hätte den Begriff der Bleibefreiheit vielleicht umgehend als Idiosynkrasie eines an Schreibtisch und Gemüsegarten gebundenen Reisemuffels zu den Akten gelegt, wenn er nicht einen Anklang in grundlegenden politischen Forderungen der Gegenwart fände. Gegen den Kohletagebau wird mit »Alle Dörfer bleiben« und für den Wald mit »Danni bleibt«, »Moni bleibt« oder »Fechi bleibt« mobilisiert. »Wir bleiben alle« ist die Kampfansage gegen Gentrifizierung und Verdrängung aus der Stadt. Gegen jede Abschiebung von Geflüchteten steht die Forderung nach sicherer Bleibe. Auch die Befreiungsbewegung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten betont die Beharrung: »We’re here. We’re queer. Get used to it.« (»Wir sind da. Wir sind pervers. Gewöhnt euch dran.«) Und wenn der NABU Plaketten an besonders schwalbenfreundliche Gehöfte verteilt,[3] geht es abermals darum, dass die Nester, zu denen die in offener Beziehung lebenden Vogelpaare treu zurückkehren, bleiben dürfen.
Aber dass das Bleiben eine Forderung ist, macht aus ihm noch keine Freiheit. Geht es hier nicht eher um Sicherheit? Oder, wenn’s hochkommt, um »Leben«? Vielleicht auch einfach: Umweltschutz, Minderheitenschutz. Und solcher Schutz steht aktuell nachgerade unter Verdacht, die Freiheit abschaffen zu wollen.
Tatsächlich gibt es seit einigen Jahren kein wirksameres Manöver, um progressive Forderungen auszuhebeln, als die Berufung auf Freiheit. Der zentrale Wert der 68er-Generation befeuert nun die Kampagnen von Meloni, Bolsonaro und Trump. Ich sehe das nicht als einfache Übernahme. Es ist eher das offene Zutagetreten eines Bruchs, der den liberalen Freiheitsbegriff von Anfang an durchzieht: Einerseits verspricht uns die moderne Freiheit, dass wir im Prinzip alle Eigentümer sein können und über bestimmte Ausschnitte der Welt ungehindert herrschen dürfen. Andererseits verpflichtet diese Freiheit uns darauf, den Ansprüchen der anderen nicht ins Gehege zu kommen. Wir müssen Schranken anerkennen, um gegenseitig Freiheit zu wahren. Maßvolle Maßlosigkeit. Und diese beiden Seiten klaffen nun in aller Öffentlichkeit auseinander. In nahezu jeder hitzigen gesellschaftlichen Debatte – sei es um Infektionsschutz, um Diskriminierung, um Migration, um Nachhaltigkeit – wiederholt sich das Schauspiel: Beide Seiten wedeln jeweils mit einem Stück der zerbrochenen Freiheit. Der Besitzanspruch hier, die Rücksichtsschranke dort. Es ist, als gingen wir mit Scherben aufeinander los.
Die Bleibekämpfe gegen Abschiebung und Abbaggerung könnten als Speerspitze der Selbstrücknahme beschrieben werden. Die Forderung, dass jemand oder etwas bleiben soll, ruft zu dessen Verteidigung nach neuen Schranken im Hier und Jetzt, die den Besitzliberalen im Weg stehen. Kaum etwas versinnbildlicht das derzeit so gut wie die Aktivist_innen, die sich mit bloßen Händen auf den Asphalt kleben. Sie werden gewissermaßen selbst zur Schranke. Ihnen gegenüber stehen kopfschüttelnde Menschen, deren Alltag schon jetzt so voller Hürden ist, dass sie nicht wissen, wie sie eine weitere Komplikation ertragen sollen. Und manche unter ihnen sind besessen von ihrem Besitzanspruch auf Mobilität, springen mit erhobenen Fäusten aus ihren Autos und nutzen ein Spracharsenal, das die aktive Vernichtung von Insekten auch Menschen anzutun sehnt. Gerade der überholte, ausgehöhlte Verfügungsanspruch, den ich als Phantombesitz bezeichne, kippt unheimlich schnell in Gewalt.
Aber ist das wirklich alles? Sind die ergänzenden Hürden der Zweck der Proteste? Sind sie nicht eher eine bereits schiefe Übersetzung von weitreichenderen Anliegen in unsere gängigen Bilder? Was, wenn es gar nicht primär um eine Neuvermessung der Grenzen ginge, sondern um eine andere Vorstellung davon, wie wir uns aufeinander beziehen? Man kann die Position derer, die stur in Lützerath oder auf der Landebahn bleiben, auch ganz anders einordnen. Nicht als Extrempunkt im bekannten Feld, sondern als Vorschein eines neuen. Das Neue wäre dann allerdings gar kein Feld mehr, sondern eher eine andere Zeit. Denn das Bleiben verlässt das räumlich Imaginäre der liberalen Freiheit und bezieht sich auf die Möglichkeiten der Zukunft. Auf der räumlichen Achse mag keinerlei Freiheit im Bleiben liegen. Aber auf der zeitlichen alle.
Hier bleiben und frei bleiben können. Schon die pandemiebedingten Einschränkungen lassen sich eigentlich besser begründen, wenn man sie von der Bewegungsfreiheit im Moment ablöst. Es ging um die Freiheit, irgendwann wieder unbekümmerter unter Menschen zu sein. Jetzt zu Hause bleiben, um später besser reisen zu können: Um diese Überlegung anzustellen, muss man Freiheit zeitlicher denken. Jetzt gar nicht mehr fliegen, um später noch atmen zu können. Dazu erst recht. Aber geht das überhaupt? Kann man unseren Freiheitsbegriff verzeitlichen?
Zukünftige Freiheit
In seinem vielbeachteten Urteil vom 24. März 2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es unrechtmäßig sei, Klimaschutzmaßnahmen stark ungleichmäßig über die Zeit zu verteilen. Wenn wir jetzt gar nichts unternehmen, werden die derzeit Jugendlichen später zu umso drastischeren Einschränkungen gezwungen sein. Das hieße, dass wir unsere Freiheit aktuell auf ihre Kosten nutzen. Diese zeitliche Perspektive beschreibt das Gericht selbst als »intertemporale Freiheitssicherung« und ermöglicht damit seine ungewöhnliche, ja geradezu revolutionäre Argumentation. Die Urteilsbegründung verlässt das gegenwartsgebundene Bild, in dem Freiheitsansprüche nur von denen erhoben werden können, die auch wirklich da sind. Dies ist überhaupt nur möglich, weil die Bundesregierung selbst das Pariser Abkommen unterzeichnet und sich somit verpflichtet hat, ihren Beitrag zum Erderwärmungslimit von 1,5 Grad zu leisten. Dadurch wird verhindert, dass die in Zukunft zu erhebenden Ansprüche unendlich und unüberschaubar werden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt klar absehbar, welche Emissionen überhaupt nur noch ausgestoßen werden dürften. Wenn das Budget gleich verbraucht wird, ist nachher logischerweise nichts mehr übrig. Und auch der hinausgezögerte Ausbau von Alternativen wirkt sich auf die Zukunft aus. Mehr hergebrachte Mobilität jetzt heißt weniger Mobilität später.
Ohne die Bedeutung dieser Gerichtsentscheidung schmälern zu wollen, ist es doch wichtig, nicht zu viel in sie hineinzulesen. Der Freiheitsbegriff, mit dem das Urteil operiert, ist weiterhin derjenige der Bewegungsspielräume und Schranken. Die Freiheit, um deren gerechte Verteilung es geht, besteht geradezu im Brennstoff-Besitz. Klimaschutz wird als unbedingt notwendig behandelt, tritt aber als Freiheitsblocker auf den Plan. Dass Freiheit auch im Reichtum einer lebendigen, biodiversen Welt oder in der kollektiven Macht einer Neuerfindung unserer Lebensform liegen könnte: Das kommt nicht in den Blick.
Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist aus guten Gründen nicht für eine vollständige Revision des verfassungsmäßigen Freiheitsverständnisses zuständig und hat mit der Intertemporalität schon viel gewagt. Eine tatsächliche Verzeitlichung der Freiheit würde aber sehr viel mehr umfassen, als dieselbe Reisefreiheit in die Zukunft hinüberzuretten. Es könnte heißen, Freiheit selbst anhand der verfügbaren, lebbaren Zeit zu bemessen. Nicht: Wie viel Raum darf ich nehmen? Sondern: Wie viel Zeit ist mir vergönnt? Jetzt, nachher, auf lange Sicht? Von Freiheit über die Zeit hinweg käme man auf Freiheit an Zeit. Der Begriff der Bleibefreiheit kann diese Facetten bündeln. Gönnen wir den zukünftig Lebenden diese Freiheit?
Die Umstellung, sich Freiheit selbst als Zeit vorzustellen, vollzieht sich nicht leicht. Sie ist keine bloße gedankliche Operation, sie berührt all unsere Impulse und Interessen. »Freie Fahrt voraus!« – das Gefühl kennt man. Aber was spüren wir, wenn wir Bleibefreiheit haben? Es ist wie ein Aufatmen. Die Bleibefreiheit gewährt ein unverhofftes, intensives Empfinden unbedrohter Lebendigkeit. Dieses Empfinden verdankt sich der erfolgten Vergewisserung, dass der eigene Aufenthaltsort offenbar wirklich kein Gefängnis ist. Anders als bei der Bewegungsfreiheit ist der Anfangspunkt der Bleibefreiheit damit auch der Endpunkt der Unfreiheit. Denn bloße Bewegungsfreiheit hat den Haken, dass sie die Unfreiheit eigentlich bestehen lässt. Man ist dann nur selbst woanders. Im Extremfall braucht man die anhaltenden Missstände sogar als Kontrast, um sich seiner eigenen Befreiung wieder und wieder zu versichern. Das degradiert auch die errungene Freiheit – den Ort, an dem die andere Luft weht – zu einer bloß komparativen Größe. Immerhin besser als vorher. Oder sogar bloß: immerhin nicht genauso wie vorher. So lässt sich bequem die Frage verdecken, ob das jetzt alles gewesen sein soll. Ob man überhaupt am richtigen Ort angekommen ist. Die Bleibefreiheit ist auf einen solchen Vergleich gar nicht angewiesen. Die Einsicht, nicht im Gefängnis zu sein, hätte auch Bestand, wenn es nirgendwo echte Gefängnisse gäbe. Es ist kein Vergleich – »im Gefängnis wäre es schlimmer als zu Hause« –, sondern eine Erfahrung. Ich kann hier und frei bleiben. Und diese Erfahrung ist viel gefährdeter, viel realer im Schwinden begriffen als die durch politische Entscheidungen reglementierte Reisefreiheit.
Einen Ort zum Freibleiben zu haben, ist ein großes Glück. Es ist ein Vermögen – nicht im Sinne der eigenen Fähigkeit, sondern der einem gewährten Gabe. Die besagten Bleibekämpfe widmen sich gerade der Aufgabe, diese Grundlage zu verallgemeinern. Das Ziel besteht darin, eine Zukunft zu sichern, in der Freiheit für alle Bestand behalten könnte. In Arbeitskämpfen und im Aufbegehren gegen Unterdrückung geht es um die Freiheit an Zeit; Umweltschutz und Gesundheitswesen wollen dem Leben zukünftige Zeit sichern. Trotzdem trifft der Begriff der Bleibefreiheit keine kategorische Vorentscheidung. Sie können damit auch dafür argumentieren, dass die Kinder in der Schule, eine Tradition aufrechterhalten oder der Tagebau aktiv bleiben sollten, wenn sich in diesen Dingen über die Zeit hinweg Freiheit ausweisen ließe.
Schwindende Welt
Unser gängiger Freiheitsbegriff ist untauglich für das Anthropozän. Er reagiert empfindlich darauf, wenn die Mobilität in benzinverbrennenden Blechkisten angekratzt wird. Aber von der Frage, ob es in Zukunft noch Vögel gibt, bleibt er völlig unberührt. Wo Landstriche durch Krieg und Naturkatastrophen unbewohnbar werden, ist die Reiseerlaubnis ein Notbehelf, eher ein Migrationszwang als eine Freiheit. Auch das Fliegen der Schwalben soll man nicht übermäßig zur Freiheit stilisieren: Die Vögel ziehen fort, weil es in der kalten, nassen Jahreszeit im Norden zu wenig Nahrung gibt. So wie Bleibefreiheit das Abzugsrecht voraussetzt, ist Bewegungsfreiheit auch nur Freiheit, wo das Bleiben möglich wäre. Und Letzteres, das Bleiben-Können, ist weitaus voraussetzungsreicher. Es erfordert die Wahrung einer bewohnbaren Welt.
Ein paar Jahre habe ich mit kalifornischen Kolleg_innen gebangt, in deren Gegend ausufernde Waldbrände so viel Asche in die Atmosphäre spien, dass sich bei uns die Sonnenuntergänge dramatischer färbten. Im Sommer 2022 brannte dann auch Brandenburg. Noch zu meinen Lebzeiten, wenn mir deren volles Maß gewährt sein sollte, werden weite Teile der jetzt besiedelten Erdoberfläche unbewohnbar sein. Die Klimafrage ist inzwischen zwar den meisten Menschen bewusst. Sie bewegt, wie wir sahen, schon den höchsten Gerichtshof. Aber genau wie das nicht umgesetzte, ohnehin lediglich die Emissionen berücksichtigende Pariser Abkommen, ist dieses Bewusstsein wirkungslos. Die Menge des ausgestoßenen CO2 steigt jedes Jahr auf einen neuen Höchststand. Wir halten Kurs auf eine Welt mit mindestens vier Grad über vorindustriellen Temperaturen. Regenwälder, Gletscher und Korallenriffe werden verschwunden und der Anteil fruchtbarer Böden drastisch gemindert sein. Auch in den vergleichsweise verschonten Breiten werden Extremwetterereignisse und Überschwemmungen den Alltag heimsuchen, Lagerstätten für Atom- und Giftmüll durchkreuzen, Infrastruktur zerstören und Grundgüter wie sauberes Wasser verknappen. Wer soll da überhaupt noch zum Aufatmen kommen?
Aber etwas an diesen Beschwörungen scheint mir unlauter. Als würde man verzweifelt nach einem Werkzeug suchen, das die Schmerzgrenze dann doch überschreitet. Mich interessieren eher die Werkzeuge, die die Taubheit auflösen. Die Apokalypse ist längst da. Ich schaue bang in den Himmel voller heißer Sommerluft, er ist so leer, dass ich mich inzwischen manchmal bereitwillig von einer Mücke stechen lasse. Die Schwalben müssen doch zu fressen haben. Noch in der größten Angst vor der kommenden Katastrophe findet sich eine Entlastung der Gegenwart. Als ob das hier das intakte Leben wäre. Alles, wovor wir uns fürchten, geschieht bereits jetzt irgendwem. Meist profitieren wir sogar davon. Und auch die wirklich neuen Effekte der Erderwärmung kommen nicht aus der Zukunft, sondern aus vergangenen Handlungen.
Ich glaube sowieso nicht, dass man irgendwen von einem nahenden Kollaps überzeugen muss. Im Gegenteil, das Gefühl einer einstürzenden Welt ist omnipräsent. In dieser phänomenal reichen Gesellschaft, inmitten all dieser Technik und Kompetenz, gibt es nirgends mehr Reserven. Ein paar Jahrzehnte Privatisierung, Effizienzsteigerung und Finanzialisierung, und plötzlich ist alles marode. Den eingebauten Leerlauf, den es bräuchte, damit jemand Zeit hat, um im Notfall das Ärgste abzufangen, gibt es nicht mehr. Die Energie, die Menschen in Ausnahmesituationen aufbringen, ist bereits als feste Größe im neoliberalen Normalbetrieb eingeplant. Gerade weil alle es spüren, driften die Reaktionen so weit auseinander. Denn vom Standpunkt der Zukunftslosigkeit aus hat der Phantombesitz, hat die raffende, rabiate Selbstbehauptung ja durchaus ihre eigene Rationalität. Wenn man nicht mehr am kommenden Reichtum wird partizipieren können, dann will man zumindest im allgemeinen Inferno auf seine Kosten kommen. Das bisschen Zerstörung lass ich mir nicht nehmen!
Wir werden nicht einfach im Holozän bleiben, in dieser freundlichen Epoche, die vor zwölftausend Jahren auf die letzte Eiszeit folgte und zwischen zwei weißen Polkappen eine üppige Zahl aufeinander abgestimmter Ökosysteme ermöglichte. Aber gerade darum hängt absolut alles davon ab, wie viel wir ins Anthropozän mitnehmen können, um uns darin einzurichten.
Das Ausbleiben der Schwalben
Im selben Frühjahr, in dem ich nicht nach Kalifornien flog, rief mich eine gute Freundin an. Elisabeth ist eine Generation älter als ich und war mal meine Geschichtslehrerin. Sie kommt, wie ich, von einem Hof in Schleswig-Holstein und lebt in einem Haus mit Scheunenanbau. Elisabeth sprach mit merkwürdig klangloser Stimme, wie aus einer Welt ohne Echo. »Eva«, sagte sie, »dieses Jahr sind bei mir die Schwalben nicht gekommen.« Stille. »Jetzt ist es wirklich vorbei«, sagte sie, nicht mal klagend, sondern als lese sie ein Messergebnis ab. »Jetzt erwarte ich gar nichts mehr.«
Der australische Naturphilosoph Glenn Albrecht hat 2005 den Begriff der »Solastalgie« geschaffen, um das Trauma zu beschreiben, das durch den Verlust der vertrauten ökologischen Umwelt entsteht. Nostalgie, aber in Echtzeit: eine Sehnsucht nicht nach Vergangenem, sondern nach dem, was man für unverrückbar gegenwärtig hielt.[4] Das Wort, das aus dem lateinischen »solacium« – Trost – und dem griechischen »algia« – Leid – zusammengebaut ist, kommt einem nicht gerade leicht über die Lippen. »Leiden an Trostlosigkeit«: Das beschreibt nicht schlecht, was Menschen in einer sterbenden Welt befällt. Aber der Neologismus macht mich stutzig, weil in ihm so viel fehlt. Es kommt weder die Welt vor, auf die sich die Sehnsucht richtet, noch der Grund ihres Verlusts. Sie stirbt schließlich nicht von allein. Die Schwalben verhungern am Insektensterben. In längeren Trockenperioden kommen sie nicht zum Nestbau, weil es Pfützen braucht, um Matschbällchen aufzusammeln. In manchen Regionen werden Singvögel auch direkt gejagt. Solastalgie benennt keine Schuldigen, nicht mal Ursachen. Kein Wort von Insektiziden, industriellem CO2-Ausstoß und Luftgewehren. Dabei ist das Heimweh ja auch ein anderes, wenn man vertrieben wurde und nicht aus eigenem Antrieb umzog.
Vielleicht wäre »Weltschmerz« eine bessere Kategorie als Solastalgie, weil damit immerhin betont würde, dass es um einen Gesamtzusammenhang geht und nicht um einen einzelnen Ort, dem man immer noch den Rücken kehren kann. Die Scheune steht noch. Dennoch ist für Elisabeth die Zeit stehen geblieben. Nicht die auf der Uhr, die ja auch am Arm einer Leiche weiterläuft, sondern die belebte, erlebbare Zeit. Die Zeit, in der Jahre mit Ankunft und Abflug der Schwalben zusammenfallen: Sie wurde zerstört. Der Schock über das Ausbleiben der vier vertrauten Brutpaare betrifft dabei nicht nur acht Vögel und ihre Nachzucht, sondern ist Anzeichen des sechsten Massenaussterbens. Die Trostlosigkeit entsteht nicht, weil über diesen Verlust nichts hinweghelfen kann, sondern weil er eben nicht nur dieser eine Verlust ist. Das, was beim normalen Trauma innerpsychische Zwangsvorstellung ist – dass es immer wieder so sein wird –, hat hier naturwissenschaftlich belegte Realität.
Angesichts dieser Realität ist auch der Anklang von »Solastalgie« an »Nostalgie« skandalös. Man meint fast schon mitzuhören, dass es für die bessergestellten Schichten in den bessergestellten Ländern bald ein paar Regierungsprogramme zur Solastalgie-Kur gibt, Forschung zu Resilienzfaktoren bezuschusst werden wird – und ansonsten kann man immer noch sagen, dass solche Sentimentalitäten wie die unersetzbare Ortsbindung überwunden gehören. Die Moderne hat uns schließlich keinen Trost versprochen, sondern Freiheit.
Aber war es die ganze Freiheit? Fehlt ihr nicht etwas sehr Entscheidendes? Hängt unsere Freiheit nicht vom Fortbestand der lebendigen Welt ab? Besteht sie nicht geradezu darin?