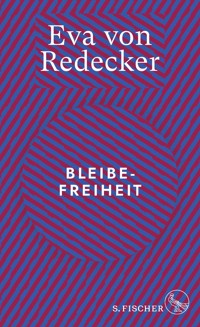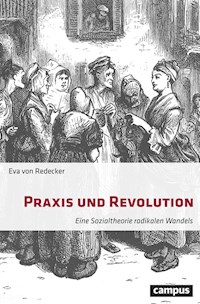
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gibt es einen Zusammenhang zwischen zäher Alltagspraxis und großer Umwälzung? Unter welchen Bedingungen können kleine Veränderungen revolutionäre Ausmaße annehmen und an welche Grenzen stoßen sie? Eva von Redecker plädiert vor dem Panorama ausgewählter Literaturbeispiele dafür, dem Revolutionsbegriff eine neue Gestalt zu geben. Radikaler Wandel wird in diesem Buch sozialtheoretisch erschlossen und als langwieriger Übertragungsprozess verständlich, in dem Gegenstand und Antrieb der Veränderung in eins fallen: in Praxis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva von Redecker
Praxis und Revolution
Eine Sozialtheorie radikalen Wandels
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Gibt es einen Zusammenhang zwischen zäher Alltagspraxis und großer Umwälzung? Unter welchen Bedingungen können kleine Veränderungen revolutionäre Ausmaße annehmen und an welche Grenzen stoßen sie? Eva von Redecker plädiert vor dem Panorama ausgewählter Literaturbeispiele dafür, dem Revolutionsbegriff eine neue Gestalt zu geben. Radikaler Wandel wird in diesem Buch sozialtheoretisch erschlossen und als langwieriger Übertragungsprozess verständlich, in dem Gegenstand und Antrieb der Veränderung in eins fallen: in Praxis.
Vita
Eva von Redecker ist wiss. Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der HU Berlin und stellvertretende Direktorin des Center for Humanities and Social Change.
Inhalt
Vorwort
Einleitung: »…es handelt sich um eine Revolution.«
I.Marias Ménage und die Flüchtigkeit alternativer Praxis
I.1Praktische Normativität
Die Priorität des Praktischen
Drei praktische Regeltypen
Drei Weisen praktischen Wissens
Wiederholbarkeit
I.2Die Materialität der Praxis
Bewegte Materie
Unteilbare Praxis
Ambivalenz und Interpretationsoffenheit
Wandel durch Überlagerung
I.3Praxiszusammenhänge
Teile ohne Ganzes?
Verkettungen
Verankerungen
Ambivalente Ankerpraktiken
II.Jakobinische Strickerinnen und die Bahnen der Strukturierung
II.1Die Dualität sozialer Strukturen
Die Strukturierungstheorie
Regeln, Ressourcen, Rekursivität
Materialismus durch Praxisübertragung
Materialismus durch Praxisverkettung
II.2Anerkennung und performative Strukturierung
Nichts als und doch mehr als Praxis
Wiederholung, Anerkennbarkeit, Performativität
Dreifache Hermeneutik
Erosion
II.3Drei Aggregatzustände des Sozialen
Versteinerte Strukturen
Geronnene Strukturen
Flüchtige Zwischenräume
Interstitielle Strukturierung
III.Martas unsichtbare Bezugsgruppe und interstitielle Strukturumbrüche
III.1Dis-Aggregation: Performative Kritik und das Lachen der Mimesis
Performativität rückwärts
Performative Kritik im Besonderen: Drag
Performative Kritik im Allgemeinen: Unfügsame Praxis
Subversives Lachen
III.2Konstitution: subkollektive Assoziation
Sub-Kollektive
Macht durch Assoziation
Praxis zwischen Welt und Mitwelt
Strukturen zwischen Spontaneität und dauernder Erscheinung
III.3Kontamination: Strukturüberlagerung
Subversion oder Perversion?
Szenarienüberblendung und synchrone Genealogie
Strukturumschlag und Re-Artikulation
Metaleptische Verschränkung
IV.Die Hinrichtung der Marquise und metaleptische Paradigmenwechsel
IV.1Paradigmenwechsel als sukzessiver Austausch von Ankerpraktiken
Paradigmenwechsel nach Kuhn
Kippbilder entzerren
Paradigmenwechsel nach Masterman
Replikation und Rekursivität
IV.2Der revolutionäre Entstehungsprozess des Revolutionsbegriffs
Prozess oder Ereignis?
Kulmination an der Bastille
Kumulation im Gang durch die Peripherie
Zur Vergegenwärtigung von Transformationsprozessen
IV.3Metaleptische Dynamiken
μετάληψις
Fern-Metonymie
Grund-Folge-Vertauschung
Mittelmäßiger Witz
Konklusion: »Die Mühen der Ebene« und die revolutionäre Tradition
Literatur
Filme
Vorwort
In Revolutionen wird zwar alles anders, aber nicht alles neu. Wandel ergibt sich aus dem Bestehenden und zwar, so die These dieses Buchs, durch das Umfunktionieren gegebener Strukturen nach Maßgabe von Praktiken, die in gesellschaftlichen Zwischenräumen vorweggenommen und eingeübt werden. Es bedarf dieses beharrlichen Untergrunds – oder auch dieser untergründigigen Beharrlichkeit –, um sicherzustellen, dass nach Fortsetzung nicht einfach Althergebrachtes, nach Auflösung nicht einfach Leere und nach Krisen nicht einfach Lähmung herrscht.
Die Praxis der Zwischenräume wird dabei aber nicht zum neuen Subjekt der Revolution erklärt – also zu dem, was die Revolution macht. Anders als Bücher, für die trotz aller Vielstimmigkeit und aller Kollektivarbeit doch eine Autorin verantwortlich zeichnet, werden Revolutionen überhaupt nicht »gemacht«. Sie entstehen aus Konstellationen von Bedingungen, die niemand steuert.
Etwas nicht zu steuern, heißt aber nicht, dass man es nicht (besser) verstehen könnte. Dieses Buch verwendet gut 250 Seiten darauf, Konstellationen radikalen Wandels sozialtheoretisch zu bestimmen und schließlich auf den der antiken Rhetorik entlehnten Begriff der Metalepsis zu bringen. Gemeint ist damit ein verkehrendes Ineinandergreifen – in diesem Fall von abseitiger Praxis und bedingenden Strukturen –, das einen Übergang ermöglicht.
Mit Doktorarbeiten vollziehen Wissenschaftlerinnen den Übergang in die akademische Gemeinschaft. Die tradititionellen Rituale, die damit – trotz aller neoliberalen Einebnung – immer noch verbunden sind, stiften bemerkenswerte Verwandtschaftsverhältnisse: auf die Adoption durch Doktormütter oder -väter folgt die Entstehung eines Werkes. Wie Nonnen nach bestandenem Novizat in einer symbolischen Zeremonie der Eheschließung in die Klostergemeinschaft aufgenommen werden, wird die Promovendin durch die Disputation Teil der Wissenschaftsgemeinde. Als deren Mitglied steht sie schließlich vor der Aufgabe, die Offerte wieder weltfähig zu machen und von einer Qualifikationsschrift in ein Buch zu verwandeln – nicht zuletzt, um sich anschließend von dem Gesellenstück trennen und neuen Forschungsfeldern zuwenden zu können.
Ich staune immer noch, dass dies gelungen sein soll. Und es ist ein ganz einfacher und überhaupt nicht neuer Begriff, auf den mich dieses Staunen bringt: Dankbarkeit.
Mit der Würdigung all der Hilfe, Ermutigung und Herzlichkeit, die mich durch die letzten Jahre getragen haben, ließen sich ihrerseits leicht 250 Seiten füllen. Ich hoffe, dass meine Dankbarkeit viele über die folgenden Passagen hinausreichende Ausdrucksmöglichkeiten finden wird und beschränke mich auf den Versuch, den Anteil derer zu benennen, ohne die dieses Buch schlichtweg nie geschrieben worden wäre.
Rahel Jaeggi danke ich als Betreuerin der diesem Buch zugrundeliegenden Dissertation: Für die grandiose Mischung aus vorbehaltloser Begeisterung für das Projekt im Allgemeinen und gehöriger Skepsis gegenüber fast allen seinen besonderen Hypothesen. Gerade das, wovon ich mich über weite Strecken der Promotion maßlos überfordert gefühlt habe – immer schon als die philosophische Dialogpartnerin angesprochen zu werden, die ich doch durch die Arbeit an der Qualifikationsschrift überhaupt erst allmählich zu werden gedachte –, erscheint mir im Nachhinein als die großzügigste Gabe. Es gibt also Lernprozesse.
Rahel als Chefin danke ich für das inspirierende und sich ständig bereichernde Umfeld, sowohl an der Humboldt-Universität als auch vorübergehend an der New School, New York, in dem ich Kooperationen, Herausforderungen und Freundschaften finden konnte, wie es sie in dieser Dichte wohl nur in wenigen intellektuellen Zentren gibt – dieser Dank gilt zugleich meinen wunderbaren Kolleg_innen am Lehrstuhl.
Schließlich danke ich Rahel für tiefe persönliche Vertrauensbeweise und dafür, den Elfenbeinturm mit so sprudelnder Lebendigkeit zu füllen, dass ich nie dazu gezwungen war, kostbare Zeit mit Grübelei darüber zu verschwenden, ob ich am richtigen Ort sei.
Raymond Geuss danke ich für die Zweitbetreuung und zunächst überhaupt einmal dafür, dass er sich dazu durchringen konnte, diese kurz vor Emeritierung doch noch zu übernehmen. Das Semester, das ich schreibend in Cambridge verbrachte, sicherte das Rückgrat der gesamten Arbeit. Die Gründlichkeit und Unbestechlichkeit, mit der Raymond sich auf meine Ideen einließ, war eine unschätzbare Hilfe; zu danken habe ich außerdem für eine unvergessliche Nachhilfestunde in Altgriechisch, die mir dazu verhalf, meinem eigenen Grundbegriff zu vertrauen, sowie für Beratung und Ermutigung in der Überarbeitung des Buchmanuskripts.
Die enorme Hilfe, nahezu das gesamte Manuskript zu lesen, haben mir in der Dissertationsversion Daniel Loick, in der Buchversion Lukas Kübler und in den prekären Zwischenstufen Lea-Riccarda Prix gewährt; alle drei bilden auch als Diskussionspartner_innen einen unersetzlichen Bestandteil meines philosophischen Horizonts.
Für Lektüre, Kritik und Verbesserung einzelner Teile danke ich Judith Butler, Robin Celikates, Lucy Duggan, Antke Engel, Sophia Ermert, Aurélie Herbelot, Leonie Hunter, Matthias Mader, Tobias Matzner, Judith Mohrmann, Johanna M. Müller, Katrin Pahl, Sophie von Redecker, Isette Schuhmacher, Margarete Stokowski und Selana Tzschiesche.
Einzelne Kapitel und deren Vorformen haben davon profitiert, in folgenden Zusammenhängen diskutiert worden zu sein: In mehreren Workshops mit Nancy Frasers Einstein-Gruppe; in der Lebensformen/formes de vie-Veranstaltungsreihe, die Estelle Ferrarese in Paris und am CMB Berlin organisiert hat; bei Antke Engels zehnjährigem Jubiläum des Instituts für Queer Theory; einmal im Colloquium für feministische Philosophie an der HU (Mikkola), zweimal im Sozialtheorie-Colloquium in Jena (Rosa/Strecker, Rosa/Reitz) und einmal im Politische-Theorie-Colloquium in Bremen (Nonhoff/Vogelmann).
Dem Sozialphilosophie-Colloquium an der HU danke ich für viel mehr als für die zwei Sitzungen, in denen ich vorstellen durfte: für eine konstante intellektuelle Basis.
Für die Einladungen in Institutscolloquien oder Vorlesungsreihen, in denen ich Material aus diesem Buch vorgetragen konnte, danke ich Sarah Bufkin (Oxford), Alice Crary (New York), Christine Hauskeller (Exeter), Hilge Landweer und Christine Kley (FU Berlin), Christian Thies (Passau), Adriana Zaharijević (Belgrad) und der Philosoph*innengruppe (Frankfurt a. M.).
Hilfreiches Feedback habe ich auch von Konferenzen in Prag, New York, Nisyros, Erlangen, Hannover, Genf, Zürich und Dresden mitgenommen. Eine Sonderstellung nimmt mein allererster mit der Revolutions-Thematik befasster Vortrag auf der Frankfurter Graduiertenkonferenz 2010 ein. Ich danke dem Schicksal dafür, in einem Panel mit Bini Adamczak und Daniel Loick gelandet zu sein – für alles weitere Bini und Daniel.
Für die erfreuliche Zusammenarbeit mit dem Campus-Verlag und ein fantastisches, wenn auch notgedrungen fragmentarisches Lektorat danke ich Isabell Trommer.
Gute Ratschläge und Rückenstärkungen an entscheidenden Stellen – zum Teil auch durchweg –, sowie institutionelle oder editorische Einsichten verdanke ich: Elisabeth Bonsen, Antke Engel, Estelle Ferrarese, Iwona Janicka, Patricia Purtschert, Martin Saar, Margarete Stokowski, Sabine Lammers, Sidonia Blättler.
Das entscheidende enge im weiteren Umfeld bestand aus Isette Schumacher, Johanna M. Müller, Lea-Riccarda Prix und Hilkje Hänel. Ihr habt das wirkliche Kunststück vollbracht, nicht nur die intellektuellen Bedürfnisse besser zu versorgen als irgendjemand sonst, sondern nebenbei auch noch alle anderen im Blick zu behalten.
Die ungeheure Nachfrage nach Lehre in der praktischen Philosophie und Kritischen Theorie an der HU-Berlin – mit Seminargrößen von bis zu 100 Teilnehmer_innen –, habe ich oft als einen der Gründe dargestellt, die das Schreiben dieses Buchs erheblich erschwert haben. Dialektische Kontextualisierung, so würde ich es im Seminar zu erklären versuchen, erlaubt aber, dass etwas wahr sein kann, ohne die Wahrheit seines Gegenteils auszuschließen: Ich hätte dieses Buch auch nicht ohne meine Studierenden schreiben können. Sie haben mich in ihrem Wissensdurst unablässig an den Sinn der theoretischen Arbeit erinnert und zugleich damit lebendig gehalten, dessen Ergebnisse in Frage zu stellen. Dieses Buch wäre sehr viel weniger interessant, wenn ich es nicht auch mit und für Euch geschrieben hätte.
An dem Punkt, an dem man sich für intellektuelle und editorische Unterstützung bedanken kann, müssen bereits entscheidende Vorbedingungen gewährt worden sein. Es ist ein immenser Luxus und ein großes Glück, in einem Haushalt zu leben, der einem zu Schreiben erlaubt. Meine tiefste Dankbarkeit gilt den Liebsten, den Freund_innen und der Schwester, die dort und dergestalt mit mir das Leben teilen, sowie allen Gästen, die Geduld mit einer schreibenden Gastgeberin aufbrachten.
Und doch sind gelegentlich Rückzugsorte mit Zentralheizung und weniger Zimmern ein Geschenk. Thank you, Ann, for shelter at 346 (and everywhere else) und dank Dir für’s Repro-Paradies Richardstraße, Lea. Ein großes Dankeschön auch an die Zeckendorf-Tower-WG und den Hof Schoolbek.
Pingu, I know you distrust any ritual acknowledgements. I will simply remain grateful to you forever.
Wenn hier von so viel beharrlicher Unterstützungsarbeit die Rede ist, dann gibt es doch nur eine einzige Person, die mich wirklich durch alle Übergänge gebracht hat: meine Mutter. Sie hat mich gelehrt und macht mir weiterhin vor, worauf es unterwegs ankommt: Freiheitsliebe, Geistesgegenwart, Tatkraft und Ehrlichkeit.
Susanne von Redecker, geborener Steffen, möchte ich deshalb nicht nur aus ganzem Herzen danken, sondern auch dieses Buch widmen.
Einleitung: »…es handelt sich um eine Revolution.«
Als am 14. Juli 1789 die Bastille gestürmt wurde, soll König Louis XVI. einen seiner Höflinge, den Grafen de la Rochefoucauld-Liancourt, gefragt haben, ob in Paris ein Aufstand vor sich gehe. »Non, Sire, c’est une révolution« – »Nein, mein Herr, es handelt sich um eine Revolution«, lautete dessen Antwort.
Man könnte meinen, damit sei bestimmt, was unter einer Revolution zu verstehen ist. Nichtsdestotrotz wirbt dieses Buch dafür, »Revolution« neu zu denken – in gehörigem Abstand zu der unweigerlichen Assoziation mit dem Bastillesturm. Revolution soll als Form radikalen Wandels vorgestellt werden, der aus den Zwischenräumen einer sozialen Ordnung angestoßen wird und in langwierigen Übertragungsprozessen zu einer neuen Konstellation führt. Neu, weil in ihr selbstverständlich wird, was vorher undenkbar schien. Einübung des Zukünftigen und Umfunktionierung des Bestehenden sind dabei grundlegender als Aufstand und Bruch. Zur Eingrenzung dessen, was über den »bloßen Wandel« hinaus Revolution genannt wird, dient dann nicht der kämpferische Umschlagpunkt, sondern die Gestalt der neu begründeten Praxis: Ist sie in bislang historisch als revolutionär verstandenen Momenten verankert? Setzt sie ein möglichst reichhaltiges Erbe emanzipatorischer Hoffnungen und Versprechen fort?
Ein solches praxis- und prozessorientiertes Verständnis von Revolution wird in diesem Buch auf drei Weisen etabliert. Zunächst wird die Begriffsgeschichte angerissen und der Frage nachgegangen, auf welche Dilemmata und Desiderate bestehender Revolutionstheorien ein neuer Bestimmungsversuch zu antworten hätte. Die vier Hauptteile des Buchs entwickeln dann sozialtheoretisch das Transformationsverständnis, das den »gedehnten« Revolutionsbegriff begründet. Gerade weil in dem Begriff so viele Hoffnungen und so drastische historische Erfahrungen konzentriert sind, soll die Theorie der Revolution an Überlegungen dazu, wie sozialer Wandel überhaupt funktioniert, rückgebunden werden. Anschauungsmaterial wird in die sozialphilosophische Argumentation durch vier Literaturbeispiele getragen. Mary Wollstonecrafts Novelle The Wrongs of Women, Charles Dickens’ Tales of Two Cities, eine Videoinstallation von Matt Ebert und Bryan Landry, sowie Tania Blixens Erzählung »Die stolze Dame« leisten auf eine dritte, gewissermaßen untergründige Weise Überzeugungsarbeit für eine Neu-Konfiguration des Revolutionsverständnisses. Ihnen folgend hätten wir beim Blick auf soziale Kämpfe weniger das Ereignis vor Augen, um das es zwischen Louis XVI. und Rochefoucauld-Liancourt ging, sondern die Praxis einer eingekerkerten Beziehungskonstellation, einer Versammlung von Strickerinnen, einer militanten Drag-Queen und einer entlaufenen Enkelin.
Auch wenn es stimmen sollte, dass die geistesgegenwärtige Äußerung »Non, Sire, c’est une révolution« anlässlich des Bastillesturms fiel, wäre damit im Vokabular der Zeit zunächst nur gemeint gewesen, dass in dem ewigen Auf- und Ab der welthistorischen Wechselfälle ein Umschlagpunkt erreicht sei. Diese Bedeutung von »Revolution« geht zurück auf den ursprünglich astronomischen Sprachgebrauch, in dem die »Revolutionen der Gestirne« ihre immergleichen Umlaufbahnen beschrieben, deren Scheitelpunkte ab der Renaissance mit historischen Extremsituationen verglichen wurden. Gemäß der lateinischen Wurzel »revolutio« bezeichnete das Wort ausgerechnet die Rückkehr von etwas in die Ausgangskonstellation (Griewank 1969: 144). So bestand denn auch die Glorious Revolution in England – das einzige neuzeitliche politische Ereignis, das vor der Amerikanischen und Französischen Revolution den Titel »Revolution« erhielt – nicht in Cromwells Republikgründung nach der Hinrichtung Karl I., sondern in der erfolgreichen, verfassungskonformen Thronübertragung auf Wilhelm III. von Oranien.
Aufruhr und Rebellion hingegen waren auch schon in der Frühen Neuzeit allgegenwärtige politische Phänomene. Das ganze 17. und 18. Jahrhundert hindurch treten sie etwa in Frankreich in großer Zahl auf; zu ihrem immer wieder erprobten Standardrepertoire gehört dabei meist auch eine Gefängnisstürmung, wie wir sie heute nur noch mit der Bastille verbinden (Tilly 1968). Solches Aufbegehren bezeichnete sich selbst jedoch nie als »revolutionär«. Auch in der eigentlichen Revolution nutzten die Abgeordneten des dritten Standes zunächst nicht diesen Terminus. In den Schriften von Voltaire und Rousseau, den von Widersachern des Hofes meist-rezipierten Philosophen, spielt der Begriff zwar insofern eine Rolle, als sie Geschichte für wechselhaft hielten und die verschiedensten Umbrüche Revolutionen nannten, ihre Hoffnung auf politische Neugründung delegierten diese Autoren aber gerade nicht an den Revolutionsbegriff. Politisch neu und aufgeladen war vielmehr die Konstitution – das, wofür dann die verfassungsgebende Nationalversammlung einstand. Im Juli 1789 noch in Versailles tagend, war diese zunächst der Idee gar nicht zugetan, die Aufwiegler_innen des Bastillesturms als Teil ihrer Bestrebungen anzusehen (vgl. Sewell 1996).
Erst als im Zuge der Revolutionskriege und der inneren Eskalation der ersten Republik die Mobilisierung der Massen dringlicher wurde, begann sich die Bezugnahme auf die Revolution durchzusetzen, auch wenn Referenzen auf personifizierte Allegorien wie Vernunft und Freiheit, später dann die republikanische Herkules-Figur, weitaus wichtiger blieben (Hunt 1983). Damit war aber nach wie vor nicht ein eindeutiges Bekenntnis zur Novität der eigenen Gesellschaft verbunden. »Revolution« bedeutete immer noch »Zurückwälzung«, und sei es die Zurückwälzung der konterrevolutionären Kräfte. So unterschiedliche Revolutionstheoretiker_innen wie Karl Marx und Hannah Arendt haderten im Nachhinein damit, dass die Akteur_innen der Französischen Revolution in historischen Rückgriffen vor sich selbst verbargen, dass ihr Handeln präzedenzlos war. In deren eigenen Begriffen lag es aber nahe, sich genau dann als revolutionär zu verstehen, wenn man eine fundamentalere Ordnung wieder herstellte – sei es die der Natur, in deren Schoß die größten Innovationen wie etwa der Menschenrechte zurückprojiziert wurden, oder die der römischen Republik, deren Insignien Robespierres Republik sich geradezu kultisch aneignete.
Dennoch lassen sich solche Imitate auch im modernen Sinn des Revolutionsbegriffs als Anzeichen dessen lesen, dass tatsächlich etwas Beispielloses geschehen war. Gerade die Bodenlosigkeit des Neuen – das, was Arendt »den Abgrund der Freiheit« nennt und Marx »die neue Weltgeschichtsszene« – hat die Akteur_innen womöglich in historische Kostüme oder kosmische Gesetze flüchten lassen (Arendt 2002: 442; Marx 2007: 10). Im gängigen modernen Verständnis bedeutet Revolution jedenfalls genau das – radikaler Wandel, der keine »Rückkehr«, sondern ein Neuanfang ist. In diesem Verständnis mischen sich erstmalig die drei eben separierten Elemente: auf die Gesamtgesellschaft gerichtete Transformationsbestrebungen wie die der Verfassungsgebenden Nationalversammlung, kollektive Widerstandspraktiken wie die des Gefängnissturms, und der Eindruck geradezu von physikalischen Kräften gezwungen einen Scheitelpunkt passiert zu haben.
Wenn auch in der westeuropäischen Vorstellung die Französische Revolution paradigmatisch bleiben sollte, verdankte sie ihre Konturen zusätzlich zu dieser Gemengelage der Gruppierung von weiteren Ereignissen. Die Amerikanische Revolution wie auch die polnisch-litauische konstitutionelle Neugründung unterstrichen die zentrale Rolle der Verfassungen, die anschließend auch in nahezu allen deutschen Kleinstaaten zum Objekt der revolutionären Begierde wurden. Und nur die »Schwarzen Jakobiner« in Haiti vollbrachten 1791, was in allen anderen Revolutionen metaphorisch beschworen wurde: den Übergang von Sklaverei zu Selbstherrschaft.
Es ist das so angereicherte und neu verfasste Verständnis von »Revolution«, das die Erwiderung des Höflings zur Pointe macht. In seinem Einspruch – »Non, Sire, c’est une révolution« – korrigiert er nicht bloß seinen Herrscher, sondern sagt diesem sein Ende voraus.
Die neue Sicht, dass Revolutionen nicht den alten Ausgangspunkt, sondern einen neuen, höher gelegenen Zustand anstreben, wurde auch von anderen in Westeuropa fühlbaren Tendenzen plausibilisiert. In der Aufklärungsphilosophie war neben zyklischen Weltalter-Vorstellungen wie etwa der Moses Mendelssohns und der meisten französischen Enzyklopädisten auch das Bild vom stetigen geschichtlichen Fortschritt entstanden. Lessings Erziehung des Menschengeschlechts propagiert diesen ebenso wie Condorcets in den Revolutionswirren verfasster Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes.
Die Überzeugung, dass es wirklich Neues in der Welt gebe und dass sich die Geschichte insgesamt in einer gerichteten Bewegung befinde, fand im 18. und 19. Jahrhundert viele Anhaltspunkte in der Erfahrung. Die koloniale Expansion, die Entwicklung neuer Produktionstechniken und -verfahren, Bevölkerungswachstum und beginnende Konzentration in den Städten sprachen in westeuropäischen Augen alle die Sprache gewaltig fortschreitender, nicht mechanisch umlaufender Tendenzen. Als deren säkulare Quellen wurden zunehmend entweder die Natur oder das menschliche Handeln selbst erwogen. Auf einer phänomenologischen Ebene liegen die Dampfmaschine und die Revolutionen, die Marx später zu »Lokomotiven der Geschichte« ernannte, einander somit tatsächlich bereits nahe: beide wurden Ende des 18. Jahrhunderts »patentiert« und beide bildeten die Grundlage für die Mobilität des 19. Jahrhunderts.
Andererseits erschüttert aber gerade die Erfahrung der Revolution, des vermeintlichen Kulminationspunkts von Fortschritt, das aufklärerische Bild seiner stetigen Entwicklung. Von Seiten der Revolutionskritiker_innen wird ihr Abgleiten in die Schreckensherrschaft als chaotisch und barbarisch empfunden; ihre eigentlichen Befürworter_innen wiederum finden sich damit konfrontiert, dass »am Ende« eben gerade nicht die blühende Volkssouveränität steht, sondern eine in Napoleons offensichtlicher Annäherung an die Symbole der Bourbonen bereits vorweggenommene Re-Inthronisierung der Königsfamilie. Von Anfang an herrschte somit eine simultane Uneinigkeit sowohl darüber, ob das Neue besser, als auch ob das Alte überhaupt überwunden sei.
Karl Marx ist nicht zuletzt auch deshalb der einflussreichste Philosoph der Revolution, weil es ihm gelang, diese widerstreitenden Momente nicht nur auf einen Begriff zu bringen, sondern eine ganze Theorie der Revolution daraus zu machen. In seiner Konzeption spielen sowohl stetige Entwicklung als auch erschütternde Ereignisse, rebellierende Akteur_innen und über deren Köpfe hinweg ablaufende Vorgänge, Innovation und Kontinuität eine Rolle.
Als grundlegenden geschichtlichen Faktor isolierte Marx das Anwachsen der Produktivkräfte. Der Fortschritt darin, mittels Technologie, Wissen und Arbeitsorganisation Güter zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung immer effektiver und in immer größerer Komplexität herstellen zu können, zwingt nach Marx auch den Rest der Gesellschaft (und die menschlichen Bedürfnisse selbst) zur Weiterentwicklung. Als Basis jeglicher Gesellschaft und als Kriterium, um deren verschiedene Formen voneinander zu unterscheiden, entwickelt sich die Produktionsweise – als Organisationsform der Produktivität – nach Marx aber gerade nicht stetig, sondern über dialektische Umschlagpunkte. Letztere, die eigentlichen Revolutionen, verdanken sich dem Ineinandergreifen von Widersprüchen auf zwei Ebenen. Einerseits müssen die Produktionsverhältnisse, also die institutionelle Ordnung, der vollen Ausschöpfung der vermehrten Produktivkräfte im Weg stehen, andererseits bedarf es einer Gruppe von Akteur_innen, deren materielle Interessen an der Überwindung der bestehenden Ordnung hängen und denen es gelingt, ihr Interesse als allgemeines auszuweisen.
Revolutionen haben nach Marx also einen Antrieb und einen Mechanismus. Revolutionen werden aus einem zugrundeliegenden Fortschritt gespeist, und sie gelingen dank der dialektischen Natur der Geschichte, dank der Tatsache, dass diese als durch Widersprüche strukturierter Gesamtzusammenhang aufzufassen ist. Stetig wächst nicht nur die Produktivität, sondern auch die Arbeiter_innenklasse; dialektisch negiert nicht nur diese ihre bourgeoisen Ausbeuter_innen, sondern auch das technische Wachstum die Zweckmäßigkeit der bisherigen Produktionsverhältnisse.
Die beiden Ebenen von Produktivkraftdynamik und Klassenkampf werden oft als Unstimmigkeit von geschichtsphilosophischen und akteurszentrierten Elementen in Marx’ Geschichtsverständnis benannt, zumal Marx selbst nie zufriedenstellend klären konnte, wie sich die objektive Bedingungen eigentlich in das Handeln einzelner und kollektiver Subjekte übersetzen (vgl. Elster 1985: 428ff.). Dennoch lässt sich dieser Spagat auch als Kern der materialistischen Revolutionstheorie hervorheben. Dieser bestünde dann genau darin, dass bestimmte verfügbare und bestimmte unverfügbare Bedingungen zusammenkommen müssen, damit Revolutionen gelingen. Revolutionen – und Geschichte überhaupt – haben so gesehen stets auch ein »passives Element« (Marx 1981: 386; Jaeggi 2014: 78). Das erkannt zu haben, sichert die Überlegenheit der marxistischen Transformationstheorie gegenüber deterministischen und voluntaristischen Vereinseitigungen – etwa Vulgärmarxismus oder Blanquismus – und das vielleicht anschlussfähigste Theorem des historischen Materialismus (vgl. Jaeggi 2017).
Wenn auch die orthodox marxistische Deutung der Französischen Revolution inzwischen von der Geschichtswissenschaft in nahezu allen Einzelheiten widerlegt ist (Skocpol 1979; Cobban 1999), leuchtet doch ein, inwiefern ihr Ablauf das materialistische Schema dialektischen Fortschreitens nahelegt (vgl. Hobsbawm 1962). Vor der Kulisse des langen Prozesses der industriellen Revolution stellt die politische Revolution den Kulminationspunkt dar, an dem die Macht von der aristokratischen, in feudaler Landwirtschaft verwurzelten Klasse an die aufstrebenden, kapitalistisch produzierenden Bürger_innen übertragen wird. Die für den Siegeszug des Kapitalismus so wichtige liberale Rechtsordnung wird von letzteren im Verweis auf angeblich natürliche Menschenrechte als universaler moralischer Fortschritt proklamiert. Die Unterschichten, die gemeinsam gegen Krone und Adel gekämpft hatten, spalten sich nunmehr in Kapitalbesitzende und solche, die nur ihre Arbeitskraft auf den Markt zu bringen haben und produzieren den nächsten Widerspruch.
Als Theorie der Revolution beansprucht der historische Materialismus indessen immer schon mehr als nur eine überzeugende Deutung des vergangenen Geschehens. Worum es eigentlich geht, ist Aufschluss über das Vorausliegende. Das marxistische Modell war auch deshalb so einflussreich, weil es auf drängende revolutionspraktische Fragen eine Antwort anbot. Wenn man sich Revolutionen als Vorgänge mit Anfang, Übergangsmoment und Ergebnis vorstellt – also als Ereignisse, die ausbrechen, sich durchsetzen und sich stabilisieren müssen – kann die marxistische Revolutionstheorie an jedem dieser Punkte Fortschritt und Dialektik als entscheidende Faktoren ausweisen: Revolutionen brechen nach Marx aus, weil sich nicht nur materielle Widersprüche zuspitzen, sondern zugleich auch eine Akteursgruppe – Klasse – entstanden ist, die sowohl das Interesse als auch die Macht hat, die bestehende Ordnung zu überwinden. In ihnen gelingt der Übergang von einer sozialen Form zu einer anderen, weil das Gebiet, dessen Widersprüchlichkeit den dialektischen Umschlag erzwingt, auch die Form der Gesellschaft im Ganzen bestimmt – der Fortschritt geschieht nicht fragmentarisch. Zugleich ist der Übergang ohnehin nicht als totaler Bruch oder restloser Szenenwechsel vorgestellt. Die neue Gesellschaft entsteht »im Schoß der alten« (Marx 1972 [1847]: 181). Diese Kontinuität in der Diskontinuität bildet auch das Fundament zur Stabilisierung, weil vorher Gewachsenes dialektisch bewahrt bleibt. Die neue Ordnung hat zudem dank ihrer Fortschrittlichkeit Bestand: Nach jeder Revolution ist die Welt produktiver und freier, nach der letzten, sozialistischen, dann sogar auch noch friedlich und unentfremdet. Wenn auch das marxistische Verständnis das Feld der Revolutionsdeutungen nie vollständig erschöpfte, steckt es doch in seiner Reichweite ab, wie viel aufzubieten wäre, um nicht nur von Revolution zu reden, sondern eine Revolutionstheorie zu entwickeln, die ihre Vorstellung von Antrieb und Mechanismus des Wandels philosophisch begründen kann.
Es sind denn auch nicht so sehr andere Theorien, die mit ihren Argumenten den Marx’schen Revolutionsbegriff widerlegt hätten, sondern bestimmte geschichtliche Tendenzen und Erfahrungen – also genau der Stoff, aus dem der historische Materialismus selbst sich speist –, die ihn haben problematisch werden lassen. Diese Herausforderungen, die theoretische Ergänzungen und Abstandnahmen zum marxistischen Korpus provoziert haben, lassen sich in einem kursorischen Durchgang durch die historischen Erfahrungen von misslingenden revolutionären Ausbrüchen, Übergängen und Stabilisierungen veranschaulichen.
Im Laufe des »langen 19. Jahrhunderts« erwies sich zunächst der Revolutionsausbruch als Dilemma. Die Tatsache, dass der industrielle Fortschritt einerseits unaufhaltsam wuchs, gerade die organisiertesten Arbeiterschaften in Westeuropa aber nicht revolutionierten, zermürbte den Glauben an eine verlässliche Kopplung von Fortschritt und Dialektik. Innerhalb der deutschen Sozialdemokratie wurden angesichts dieses Dilemmas zwei widerstreitende dogmatische Antworten formuliert, die das Problem im Nachhinein betrachtet vermutlich eher verschärften. Karl Kautskys Variante des wissenschaftlichen Sozialismus beharrte auf einer notwendig dialektischen Geschichtslogik und versteifte sich taktisch darauf, den richtigen Moment abzuwarten. Die Dialektik würde greifen, wenn der Fortschritt vielleicht auch unerwartet langsam sei. Eduard Bernsteins Revisionismus betrieb dagegen offene Häresie an der Unauflöslichkeit von technischem Fortschritt und dialektischer Zuspitzung und schlug vor, den Fortschritt lieber über den Weg parlamentarischer Wahlen und nicht im offenen Klassenkampf zu suchen. Er stellte sich gewissermaßen eher auf die Seite des Fortschritts als auf die Seite der Dialektik. Als im Vorfeld des Ersten Weltkriegs die Mobilisierung breiter Teile der Arbeiterklasse gelang, aber eben nicht im Namen der internationalen Solidarität, sondern unter dem Banner der national-chauvinistischen Kriegsführung, waren beide Varianten desavouiert. Offenbar konnte längere Wartezeit auch zu dramatischen Verlusten führen – und die parlamentarische Symbiose mit der Nation zur völligen Evakuation der eigenen Klasseninteressen.
Das damit besiegelte »Ausbruchsdilemma« reflektieren auf diamentral entgegengesetzte Weise sowohl Lenin als auch die erste Generation der Frankfurter Schule. So sehr Lenin proklamiert, in Marx’ Geschichtsbild verwurzelt zu sein, ist sein Revolutionsverständnis doch gerade eine Konsequenz aus dessen Auflösung (vgl. Geuss 2006). Die Avantgarde-Partei übernimmt gewissermaßen die Arbeit der stockenden historischen Fortschrittstendenzen. Der Klassenkampf ist bei Lenin vorrangig eine machtpolitische Frage: eine Angelegenheit, die zwar dialektisch interpretiert, tatsächlich aber organisatorisch und martialisch gelöst wird.
Wo Lenin gewissermaßen eine erzwungene Dialektik betreibt, theoretisiert die erste Generation der Frankfurter Schule eine ausstehende. Revolution wird hier nach wie vor im Modus des Fortschritts und über den Mechanismus der Dialektik gedacht, aber beide Aspekte werden ambivalent. Mit dem Erstarken des europäischen Faschismus und schließlich der Shoah vor Augen schien sozialer Fortschritt höchstens noch mit dem unheimlichen Anwachsen der Produktivkräfte verknüpfbar, wenn gleichermaßen immense Regressions-Möglichkeiten eingeräumt würden. Die Pazifizierung der konsumorientierten Arbeiterschaft der westlichen Nachkriegsordnung zementierte schließlich das diagnostizierte Ausbruchsdilemma: Ideologie bildete aus Sicht der Kritischen Theorie das entscheidende Element, das die nunmehr unüberbrückbare Kluft zwischen objektiven gesellschaftlichen Widersprüchen und ausbleibendem subjektiven Aufbegehren erklärte. Als Kritik richtete sich die theoretische Arbeit nachfolgend einerseits »nur« auf die Bedingung der Möglichkeit von Revolution. Andererseits ist aber festzuhalten, dass sie sich als Ideologiekritik eine überaus weitreichende Aufgabe vornahm. Wo nicht mehr von klar durch Klassenstatus prädestinierten Träger_innen der Revolution ausgegangen wird, ist die Arbeit an der Ideologie eine, die in zweifacher Hinsicht revolutionäre Folgen verheißt: sie erodiert einen wichtigen Pfeiler des Bestehenden und sie setzt ihre Adressat_innen für die revolutionäre Praxis frei.
Diese revolutionäre Praxis selbst geriet aber ohne eine feste Verankerung in geschichtlichen Großtendenzen in ein weiteres Dilemma, nämlich das des Übergangs. Gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts drängte sich von mehreren Seiten der Eindruck auf, dass der immer schon heikle Übergang zu etwas wirklich Neuem und wirklich Besseren die menschliche Gesellschaft vor eine paradoxe – wenn nicht gar unmögliche – Aufgabe stelle. Angesichts dessen, dass die kommunistische Revolution offenbar auch dort, wo ihre Feinde sie nicht besiegt hatten, gescheitert war – und zwar vor allem und restlos an ihren eigenen Idealen (vgl. Adamczak 2007) –, stellte sich ernsthaft die Frage, ob so etwas wie ein radikaler Wandel einer Lebensform zum Besseren überhaupt möglich war.
Dieser Zweifel, der den modernen Revolutionsbegriff von konservativer Seite schon immer begleitet hatte (vgl. Burke 1982 [1790]; Gentz 2010 [1800]), wurde bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der anti-autoritären, inner-sozialistischen Lenin-Kritik geäußert. Rosa Luxemburg etwa prognostizierte hellsichtig, dass in autoritärer Organisation letztlich die alte, verinnerlichte »Knute« auch über die eigenen revolutionären Ziele triumphieren werde (Luxemburg 1977: 87). Martin Buber, der aus anarchistischer und utopisch-sozialistischer Perspektive die Kongruenz von revolutionären Mitteln und Zwecken einfordert, fasste das Übergangsdilemma als »Tragödie der Revolutionen« folgendermaßen zusammen: »daß sie, auf das positive Ziel hin betrachtet, das Gegenteil des gerade von den ehrlichsten und leidenschaftlichsten Revolutionären Herbeigesehnten zur Folge haben, wenn und weil das Angestrebte nicht schon vorrevolutionär so weit vorgebildet war, daß die revolutionäre Aktion ihm nur noch den vollen Entfaltungsraum zu erringen hat« (Buber 1950: 77f.). Wenn das Neue nicht schon da ist, so legt Buber nahe, wird stets das Alte die Überhand behalten. Diese paradoxe Diagnose droht grundsätzlich die Möglichkeit des Übergangs auszuhöhlen und stellt diesem Buch zugleich die Herausforderung, ihn neu zu denken.
In der Theoriebildung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich grob drei, zum Teil auch überlappende Stränge identifizieren, die Bubers pessimistische Einschätzung untermauern. Insofern das französische Theoriemilieu fest in der kommunistischen Partei verwurzelt geblieben war, wirkte der Stalin-Schock hier besonders stark und führte in vielen intellektuellen Biografien zu drastischen Brüchen mit marxistischen Ansätzen. Der Strukturalismus, der Gesellschaft als stabil in Praktiken oder Signifikationsordnungen reproduziert versteht, ist das deutlichste Beispiel eines philosophischen Themenwechsels hin zu den Beharrungskräften.
Im Anschluss an Louis Althusser und Michel Foucault wurde zweitens mit der Subjektivierungstheorie ein Ansatz entwickelt, in dem die Erfahrungen und Prägungen von unterworfenen Subjekten diese gerade nicht auch zu Träger_innen der Revolution machen. Vielmehr erklärt die Subjektivierungstheorie die Permanenz der bestehenden Mächte über deren Verlängerung in die damit überhaupt erst geformten Subjekte hinein. Ohne die dialektische Grundannahme notwendiger und produktiver Widersprüche zeichnet sich kein gangbarer Weg ab, der aus diesen Verhältnissen auch wieder hinaus führte.
Dass die gegebenen Verhältnisse nicht allein in der jeweiligen Produktionsweise wurzeln, sondern in diversen historisch gewachsenen und psychologisch verinnerlichten gesellschaftlichen Arrangements, lässt sich auch als Grundeinsicht feministischer und anti-rassistischer Theoriebildung beschreiben. Schon bevor dieser Punkt kanonisch wurde, haben Denker_innen wie Simone de Beauvoir und Frantz Fanon ihn ausführlich demonstriert. Dass Rassismus, Patriarchat und Heteronormativität mit dem Wandel der Wirtschaftsform ebenfalls erledigt wären, erschien nicht nur im Blick auf den real existierenden Sozialismus unplausibel, sondern auch theoretisch widerlegt, wo in ihrer historischen Genese und psychologischen Verankerung Eigenlogiken erkannt waren. Eine Multiplizität von Unterdrückungsformen, die sich zumindest nicht vollständig aufeinander reduzieren lassen – also das inzwischen als »intersektional« bezeichnete Verständnis des Sozialen –, unterläuft aber auf noch grundsätzlichere Weise das historisch-materialistische Transformationsverständnis. Revolutionen können ja nur dann eindeutig als Umschlagpunkte zu einer höheren, besseren Gesellschaftsform ausgewiesen werden, wenn man sie im Sinne dialektischen Fortschreitens auf einer als Gesamtentwicklung verstandenen Linie ansiedeln kann. Zerfasert sich diese in verschiedene Aspekte sind plötzlich gegenläufige Entwicklungen erkennbar – etwa, dass die in der Französischen Revolution durchgesetzte Bürgerfreiheit Frauen nicht einmal mit formalen Rechten ausstattete und sie in eine der öffentlichen und ökonomischen Sphäre entgegengesetzte Kompensations-Rolle zwang. Während ihre Klasse zur Herrschaft gelangt war, fanden sich bürgerliche Frauen im Westeuropa des 19. Jahrhunderts intensiverer patriarchaler Beherrschung und Einschränkung ausgesetzt als es im 18. Jahrhundert der Fall gewesen war. Zugleich ist es auch nicht so, dass bei einer Vervielfältigung der Kampfplätze das Modell von deren dialektischer Zuspitzung Bestand behielte. Vielmehr eröffnen sich diverse Möglichkeiten, Widersprüche zu verschieben oder zu verdecken, wie zum Beispiel wenn die westeuropäische Arbeiter_innenschaft in kolonialistisch-rassistischen und nationalchauvinistischen Überlegenheitsgefühlen den Interessenkonflikt gegenüber ihren kapitalistischen Ausbeuter_innen aus dem Blick verliert. Und sogar wenn man die mitunter zu unvermittelt an sozialen Identitäten orientierten Kategorien der Intersektionalitätstheorie anlegt, wird es sehr schwer, zuzuordnen, welche Tendenzen und Phänomene eigentlich zu welchem »Widerspruch« gehören.
Selbst ohne die vorher skizzierten Gründe, die Hoffnung auf Wandelbarkeit generell gering zu halten, konnte der Revolutionsbegriff nicht einfach »mitwachsen«, um der Multiplizität von Unterdrückung Herr zu werden. Wenn der Strukturalismus keinen dynamischen Antrieb wie den Fortschritt mehr denken kann und die Subjektivierungstheorie die Zuspitzung von Widersprüchen auf der Akteursseite unwahrscheinlich werden lässt, dann verändert die intersektionale Vervielfachung die gesamte Landkarte. Die herrschenden Verhältnisse stellen sich nunmehr als eine Art Knoten dar, der sich nicht nur nicht auflösen lässt – weil sämtliche Ausgangspunkte in ihn verwickelt sind –, sondern auch nicht zerschlagen. Denn bei Licht besehen handelt es sich gar nicht nur um einen Knoten, der getroffen werden könnte.Was aus einer Perspektive wie ein Knoten aussieht, bildet aus anderer vielleicht gerade das soziale Band.
Angesichts solcher Paradoxien ist es nicht ganz überraschend – und auch nicht nur Folge quietistischer Ideologie, sondern echter Probleme des klassischen Revolutionsbegriffs – dass dort, wo die Sozialphilosophie des späten 20. Jahrhunderts überhaupt von Transformation und nicht nur über Beharrungskräfte sprach, ein eigentlicher Revolutionsbegriff gar nicht mehr in Betracht gezogen wurde. Aufgegeben scheint er sowohl in Ansätzen, die auf Subversion und Variabilität setzen wie auch dort, wo das alte Revolutionsverständnis durch einen geradezu apokalyptischen Ereignisbegriff überboten wird (Badiou 2011; Žižek 2002). Zwischen Veränderungsbestrebungen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, Widerstandspraktiken der Basis und historischen Umschlagpunkten ist offenbar kaum noch ein Zusammenhang herstellbar, wo sich die Deutungsklammer dialektischen Fortschreitens gelöst hat. Selbst in der Kritischen Theorie, die sich wenn nicht als direkte Advokatin, dann doch als Platzhalterin einer ausgebliebenen Revolution zu verstehen gewohnt war, trat der Begriff eher in den Hintergrund. Wo an historischen Fortschrittslinien festgehalten wurde – wie im Werk besonders des frühen Jürgen Habermas und in Axel Honneths Überlegungen zur Verwirklichung der Freiheit –, verlaufen diese evolutionär ohne dialektische Kulminationspunkte. In Axel Honneths Die Idee des Sozialismus tritt das revolutionäre Erbe allerdings jüngst wieder in den Vordergrund (Honneth 2015a). Die von ihm avisierten, pragmatistisch ergänzten Lern- und Experimentierprozesse bleiben aber insofern ihrerseits evolutionär, als eine Überschreitung des mit dem Begriff der sozialen Freiheit gefassten normativen Horizonts ausdrücklich nicht zur Debatte steht (Honneth 2015b). In gewisser Weise geht es also um den – wenn auch ausgesprochen weitreichenden – Vollzug eines bereits abgesteckten Übergangs und nicht um den nächsten Umschlagpunkt.
Raymond Geuss fasst die theoretische Abkehr vom Revolutionsbegriff nicht ohne Bedauern folgendermaßen zusammen:
»If the prospects for a traditional revolution, a radical change in the political structure in the direction of increasing substantive rationality, were grim in the 1930s or the 1950s, they are, if anything, much worse at the start of the twenty-first century. We also lack a belief in a unitary, teleologically structured history and the consolation of the ›dialectic‹. It is understandable under these circumstances that attempts to appropriate the Frankfurt School might concentrate on what might seem the only viable portion of their legacy, their cultural criticism in the narrow sense. This is perfectly understandable, but it is a mistake.« (Geuss 2006: 136)
Während Geuss für eine Fortsetzung des revolutionstheoretischen Projekts jenseits der Prämisse fortschreitender Dialektik plädiert, betont Wendy Brown, dass man sich mit dem Ende von teleologischer Geschichtsauffassung und »dialektischem Trost« auch den Verlust des klassischen Revolutionsbegriffs eingestehen müsse. Sie schlägt vor, dessen Erbe zu sichten und irreparable Besitzstände aufzugeben (Brown 2003: 15, s. auch Brown 1999). Von dieser »linken Trauerarbeit« erhofft sie sich zumindest den Erhalt eines utopischen Horizonts, allerdings in Abwesenheit eines Mechanismus zu dessen Erreichen: »to recuperate a utopian imaginary in the absence of a revolutionary mechanism for its realization« (Brown 2005: 114). Mit dem Verzicht auf einen Realisierungsmechanismus der revolutionären Bestrebung wäre das Übergangsdilemma allerdings nicht gelöst, sondern lediglich unterstrichen. Es zu umgehen, bedürfte dann ganz neuer Formen der Praxis, die Brown selbst allerdings in jüngeren Äußerungen für auszumachen hält:
»I think there are many many forms of political action today that actually are making efforts in this direction. I think there’s all kinds of experiments going on in prefigurative politics – that is, politics that is trying to anticipate another world, a different order. I think there are all kinds of oppositional efforts that are coalitional, that are multi-dimensional, and open, and pluralistic […]. [A] lot of especially the youth-oriented or youth-built Left projects today are extremely promising, extremely exciting, and full of the kind of energies we need that link alertness to race, to sexuality, to gender, to sustainability, to the survival of the planet, to indigeneity … and to capitalism, without reifying one of those, without fetishizing any one of those. And I think it’s still very difficult to figure out how to mount a serious challenge to a regime of globally integrated, finance-dominated capitalism that will take seriously that that existing regime will literally bring life to an end as we know it within a century if we don’t replace it with something else.« (Brown 2017)
Tatsächlich sind einige genuine Elemente revolutionären Protesthandelns mit Beginn des 21. Jahrhunderts wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die »Bewegung der Plätze« – Tahir, Zucchotti Park, Gezi – trat den Machthabern gegenüber mit grundlegenden Transformationsansprüchen auf und verfolgte teilweise Organisations- und Kommunikationsstrategien, die selbst bereits eine radikaldemokratische Alternative zu bisherigen Regierungsformen darstellten. Das scheinbar spontane Auftreten solcher Besetzungen war oft minutiös durch eine Reihe von Koordinationsformen der Beteiligten vorbereitet worden. Ein Effekt dieser Bewegungen war es, dass sich das in einer Erfahrung »bleierner Zeit« unhinterfragbar gewordene Ausbruchsdilemma plötzlich wie ein Nebelschleier verzog. Protest und Widerstand sind wieder präsent. In der radikal basisdemokratischen und pluralistischen Organisationsform, die an den unterschiedlichsten Schauplätzen erprobt wurde, zeichnete sich zudem eine Strategie ab, die auch dem Paradox des Übergangs etwas entgegenhalten konnte. Die hier verwendeten Mittel verkörperten bereits die für die Zukunft eingeforderten Prinzipien und drohten deshalb nicht, die falsche Vergangenheit über die Köpfe der Revolutionär_innen hinweg zu verlängern. Anstatt in dialektisch vorgebahnten Weisen gesellschaftliche Widersprüche auszukämpfen, stellen die Versammlungen überhaupt erst ein Forum her, in dem über Fragen des Zusammenlebens verhandelt und entschieden werden könnte – wenn es sich denn festigte. Hannah Arendt, die den Modus der Machtkonstitution aus politischem Basishandeln heraus analysierte, hat in ihrem Essay über »Tradition und Geist der Revolution« nachgezeichnet, wie in sämtlichen modernen revolutionären Momenten episodisch solche Rätebildungen stattfanden. Arendts Darstellung mündet jedoch ihrerseits in der Diagnose eines schmerzlichen Dilemmas. Nach Ausbruch und Übergang erweist sich nämlich auch die Stabilisierung des Neuen als unverfügbar. Laut Arendt bestand »das Versagen der Revolution« darin, dass sie »für alles Institutionen gefunden hatte, nur nicht für den sich in ihr manifestierenden Geist« (Arendt 2011: 298). Gegen Arendts Diagnose, dass es die anti-politische Dringlichkeit des Mitleids gewesen sei, die die Französische Revolution habe scheitern lassen, hat Judith Mohrmann kürzlich die konstitutive Rolle von Emotionen für die (insbesondere revolutionäre) Politik herausgestellt (Mohrmann 2015). Die Sorge um die langfristige Sicherung bestimmter revolutionärer Errungenschaften ist damit natürlich nicht beschwichtigt.
Neuere radikaldemokratische Theorien nehmen das Motiv der konstituierenden Macht zum Anlaß der Unterscheidung zwischen Politik und »dem Politischen«, das sich zeige, wenn eine Ordnug als Ganze in Frage gestellt ist und neu verhandelt, was überhaupt Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen ist. In der Verstetigung des Wechselspiels zwischen bereits konstituierten Institutionen und neuer, konstituierender Macht scheinen sie dabei aber aus der von Arendt als Not beschworenen Instabilität eine Tugend zu machen. Ein Revolutionsbegriff, der tatsächlich ein gänzlich neues Institutionengefüge und radikalen Wandel auch im Sozialen anvisiert, rückt so außer Reichweite – Arendt jedenfalls geht es um die Ersetzung der bestehenden politischen Steuerungsorgane durch Räte, nicht darum, erstere durch letztere in Atem zu halten.
Die Unzulänglichkeit bloßer Interventionspolitiken lässt sich anders angefangen aber auch herausstellen, wenn man bedenkt, dass sie auf Seiten der bestehenden Institutionen ein Ausmaß von Solidität voraussetzen, das selbst in westlichen Demokratien nicht mehr selbstverständlich gegeben scheint. Konterrevolutionäre und konservativ-revolutionäre Projekte zielen in einer beispiellosen globalen Sychnronität auf autoritäre Gegenentwürfe zum Erbe der revolutionären Tradition, der 68er und des Feminismus.
Revolutionäre Politikformen als bloße Interventionsstrategie von revolutionären Transformationsansprüchen lösen zu wollen, steht zudem in merkwürdiger Spannung zu der Tatsache, dass die Erwartung radikalen Wandels sich in gewisser Weise bereits zur zeitgenössischen Grundstimmung verdichet hat. Dass unserer Lebensform die Ressourcen ausgehen, dass wir uns in der Katastrophendynamik des Klimawandels befinden, bildet eine Art »Hintergrundgewissheit«. Diese artikuliert sich indessen häufiger in apokalyptischer Unheils-Erwartung als in revolutionärer Hoffnung. Wo der Weltuntergang wahrscheinlicher scheint als die Weltrevolution, könnte man mit Walter Benjamin wähnen, mit der Lokomotive der Geschichte sei nichts besseres mehr anzufangen, als sie im Griff zur Notbremse zum Stehen zu bringen (Benjamin 1991: 1232). Nach nahezu hundert Jahren zusätzlicher historischer Erfahrung legt sich allerdings die Befürchtung nahe, dass damit auch eine Haltestelle über dem Abgrund gewählt werden könnte, was vielleicht dazu beiträgt, dass es in der Kritischen Theorie derzeit wieder vermehrt zu Ortsbestimmungen der Revolution kommt.
Die Frage, wie ein revolutionärer Umbruch – oder, mit Arendt gesprochen, »Neuanfang« – langfristig gesichert werden könnte, lässt sich als eine nach der Verfassung verstehen. Hauke Brunkhorst hat in diesem Sinne den Fortschritt im Medium des Rechts – als in Verfassungen aufgehobenen Lernprozess – wieder zum revolutionären Motor erklärt (Brunkhorst 2014). Christoph Menke überführt das vermeintliche Stabilisierungsdilemma demgegenüber gerade von einem Revolutions-gefährdenden in einen Revolutions-wahrenden Faktor, indem er es konsequent überbietet (Menke 2015). Revolution hieße für ihn nicht, eine Ordnung subjektiver Rechte stabil zu instituieren, sondern gewissermaßen den Moment »vor« diesem Akt zu verstetigen: die kollektive politische Urteilsfindung. Dieses Bild ergibt sich – negativ dialektisch – aus der Analyse der gegebenen, in der Form subjektiver Rechte verankerten Herrschaftsformen. Stabilität oder »Ruhe« würde in der potenzierten, vom rechtlichen Eigenwillen befreiten Politik dann eine neue und letzte Form subjektiver Rechte gewähren: das Recht auf Rückzug – »Permanente Revolution mit Urlaubsanspruch«, wenn man so will.
In gewisser Weise bleibt Menke mit dieser umfassenden Konzeption dennoch Browns Gebot treu, sich der Frage nach Übergangsmechanismen vorerst zu enthalten. Seine rechtsphilosophische Argumentation ist kategorial, insofern stellt sich ihr gar nicht die Aufgabe, sozialtheoretisch nach revolutionären Akteur_innen und historischen Dynamiken zu fragen.
Diese sozialtheoretische Ebene in einem Neuentwurf positiver Dialektik mitzuberücksichtigen, zeichnet das Projekt Rahel Jaeggis aus. Ausgehend von Überlegungen zur Dynamik immanenter Kritik hat sie mit der Konzeption von Lebensformen als Problemslösungszusammenhängen ein geschichtsphilosophisches Modell vorgelegt, das die Klammer zwischen Fortschritt und Dialektik wieder schließt, aber gewissermaßen »andersherum«: Antrieb des progressiven Wandels ist nicht eine gegebene, selbstlaufende Fortschrittstendenz, sondern die Dialektik von Krisen-induzierten Lernprozessen, die in sämtlichen Bereichen einer Lebensform aufbrechen können (Jaeggi 2018). Der Mechanismus, mit dem Krisen auf gelungene, das heißt nicht-regressive Weise überwunden werden können, ist dann der Fortschritt, verstanden als Anreicherung gemachter Lernerfahrung mit neuer. Als zähe Bündel von Praktiken sind die zu Lebensformen geronnenen Problemlösungen dann auch mit einer Stabilität versehen, die sich in zukünftigen Lernfortschritten zu erhalten verspricht.
Dieses Modell setzt für seinen Vollzug allerdings entweder ein ausreichend integriertes und bewußtes Subjekt voraus, das lernend auf Krisen zu reagieren vermag, oder einen sehr starken Begriff objektiv vorliegender praktischer Widersprüche. Ersteres erinnert an Menkes Konzeption der revolutionären »Durchpolitisierung«. Das allerdings hieße, dass es überhaupt erst einer Revolution bedürfe, um ein solch lernfähiges Subjekt zu erschaffen – zumindest Antrieb und Mechanismus dieses Wandels müssten dann mit anderen Mitteln beschrieben werden. Letzteres, also die Annahme objektiver Widersprüche (und nicht einfach Differenzen, Diskontinuitäten, Ambivalenzen, Anomalien) steht vor der gesellschaftstheoretischen Herausforderung, die an Ausbruch- und Übergangsdilemma illustrierten Zweifel an dialektischen Voraussetzungen ausräumen zu können. Wenn die Widersprüche da sind, warum werden sie dann nicht zuverlässig wirksam? Und wenn es hinzutretender, kontingenter Faktoren bedarf, um von der Latenz in die Zuspitzung zu kommen, welchem Antrieb folgen dann widerum diese? Dogmatisch dialektische Positionen erklären diese Prozesse zum Automatismus. Undogmatische historische Materialist_innen wie Jaeggi – und je nach Lesart beziehungsweise Werkphase auch Marx – bleiben an dieser Stelle auf Konzeptionen radikalen Wandels angewiesen, die dessen Gestalt als offene Frage behandeln.
In Praxis und Revolution soll nach Antrieb und Mechanismus von Wandel deshalb so gefragt werden, dass damit Fortschritt und Dialektik nicht schon mitgemeint sind. Zunächst geht es »nur« darum, Transformationsdynamiken – über deren Existenz, anders als über die von Fortschritt und objektiven Widersprüchen, kein Zweifel besteht – zu erschließen.
Wie man die sozialtheoretischen Anforderungen an einen Revolutionsbegriff versteht, hängt gewissermaßen mit den Annahmen über das »Gleisbett« der historischen Verlaufswege zusammen. Der Großteil der Darstellung wird darin bestehen, eine bestimmte Vorstellung von der »Machart des Sozialen« zu verteidigen und auf deren Grundlage zu klären, wie Wandel überhaupt funktioniert, bevor dann am Schluss noch einmal eingegrenzt wird, dass revolutionärer Wandel erstens radikal sein und zweitens in Praktiken ankern muss, die mit dem revolutionären Erbe in Verbindung stehen. Das impliziert, dass revolutionärer Wandel nicht gänzlich unbewusst bleiben kann. Er geschieht zwar insofern hinter dem Rücken der Akteur_innen, als diese die Folgen ihres Handelns nicht absehen können und ihre Ziele selten klar vor Augen haben – geschweige denn deren Umsetzung »im Griff«. Aber irgendwer muss entgegen dem Bestehenden auf alternative Praxis gesetzt haben und irgendwie muss der Strukturumbruch mit menschlichem Handeln in Zusammenhang stehen. Revolutionen sind keine Naturkatastrophen. Sie brechen nicht von außerhalb des Sozialen über Gesellschaften herein. Sie sind aber auch nicht mit dem Klimawandel vergleichbar, der zwar auf menschliches Handeln zurückführbar ist, den aber keine Akteursgruppe vorab als gute Alternative propagiert hätte.
Revolutionen über den Praxisbegriff auf menschliches Handeln zu beziehen, könnte auch als Abschaffung des »Gleisbetts« verstanden werden – als würden Marx’ »passive Elemente« einfach abgetragen, als seien Revolutionen letztendlich nur vom willentlichen Handeln der Menschen abhängig. Anders als denjenigen, die das angesichts der Sättigung des Marx’schen »Gleisbetts« mit teleologischer Geschichtsphilosophie und ökonomistischer Gesellschaftstheorie vorbehaltlos begrüßen, optiert die hier entwickelte Position aber für eine »Re-Materialisierung«. Insofern Handlungen dem Begriff der Praxis nachgeordnet werden, bilden sie selbst nämlich das teilweise Unverfügbare, Unbewusste, Eigenlogische – sie werden also gewissermaßen zum »Materiellen«. Es geht nicht darum, das Gleisbett abzuschaffen und eine freischwebende Lokomotive zu konzipieren, sondern in ein Bild zu wechseln, in dem Bedingung und Realisierung nicht zwei klar getrennte Dinge sind, sondern letztlich aus demselben Stoff. Die gesamte erste Hälfte des Buchs widmet sich der Aufgabe, eine solche Auffassung des Sozialen theoretisch zu entwickeln und zu verteidigen. Verstanden als Praxis bildet die menschliche Handlungsfähigkeit auch ein starres Gleisbett; verstanden als Praxis sind die materiellen Bedingungen selbst in Bewegung.
Durch diese Konzeption wird Wendy Browns Plädoyer, den klassischen Revolutionsbegriff grundlegend zur Disposition zu stellen, Rechnung getragen, zugleich aber auch der Versuch unternommen, einen Schritt über das von Brown abgesteckte Ziel hinauszugehen – nämlich durchaus neben dem Minimal-Modus der utopischen Hoffnung auch neue Begriffe für Transformationsmechanismen zu schärfen. Der Revolutionsbegriff wird dabei nicht auf seine hegel-marxistische Umlaufbahn zurückgewälzt. Die Bewegung, die die Darstellung nimmt, lässt sich eher als eine beschreiben, die den Fliehkräften folgt und darauf bedacht ist, den Radius der konsultierten Positionen gerade um jene zu erweitern, in denen sich die Lehren aus den revolutionären Dilemmata niedergeschlagen haben. Das soll aber nicht die einzige Erweiterung bleiben.
Die bereits berührten transformations-hemmenden Positionen (Ideologiekritik, Strukturalismus, Subjektivierungstheorie), denen meine Revision des Revolutionsbegriffs Rechnung tragen soll, verweisen allesamt auf misslungene Revolutionsdynamiken. Das erklärt sich nicht nur durch die fraglos noch ausstehende Emanzipation der Menschen, sondern auch dadurch, dass es vor allem jene Ereignisse waren, die einen Niederschlag in der westlichen akademischen Philosophie gefunden haben. Partiell optimistisch stimmende Momente wie die dekolonialen Selbstbefreiungen und die Frauenbewegung sind nur in seltenen Fällen und ansatzweise in die kanonische Theoriebildung eingeflossen. Das heißt natürlich nicht, dass hier eine Reflektion nicht stattgefunden hat – sie gehört nur einem Erbe an, über das testamentarisch kaum Buch geführt wird. Wenn Réné Char in einer von Arendt wiederholt zitierten Wendung – »notre héritage n’est pas precéde par aucunce testament« – konstatiert, dass die Aneignungsregeln des kulturellen Erbes allgemein außer Stand gesetzt sind, dann gilt das für etwaige Revolutionsdiskurse umso mehr (Char 1946: 8). Die kritische Sichtung des Hinterlassenen – um in Wendy Browns Bild zu bleiben – eröffnet somit überhaupt erst die Frage, mit welcher Erbmasse wir es zu tun haben – und mit welchem »wir«.
Im Sinne einer solchen »rettenden« oder »perlentauchenden« Kritik (Arendt 2001: 223ff.), möchte ich die beiden entscheidenden begrifflichen Vorschläge dieses Buchs, die Antrieb und Mechanismus des sozialen Wandels neu fassen sollen, über zwei Zitate aus dem Kontext der frühen zweiten Welle der Frauenbewegung illustrieren.
Im 1969 in New York erschienenen Black Women’s Manifesto, einer vom Typoskript fotokopierten Anthologie, findet sich unter dem Titel »Double Jeopardy: On being black and female« eine Gesellschaftsanalyse der Schwarzen Feministin Frances Beal. Der Text wurde im Folgejahr auch in den Band Sisterhood is Powerful aufgenommen und kann als wegweisend für das verstanden werden, was einmal Intersektionalitätstheorie heißen sollte, also die Reflektion auf die Möglichkeiten zur radikalen Überwindung von mehrfach verschränkten und dennoch unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen. Beal geht darin auch auf ihr Revolutionsverständnis ein und fordert:
»We must begin to understand that a revolution entails not only the willigness to lay our lives on the firing line and get killed. In some ways, this is an easy commitment to make. To die for the revolution is a one-shot deal; to live for the revolution means taking on the more difficult commitment of changing our day-to-day life patterns.« (Beal 1969: 32).
Mit der Priorisierung des Lebens statt des Sterbens für die Revolution geht eine grundlegend gewandelte Vorstellung davon einher, was eine Revolution überhaupt ist. Offenbar kein einmaliges, martialisches Ereignis, sondern ein andauernder Prozess – etwas, um das man sich, wie es eine aktuelle Anthologie von Feminist_innen of colour unter dem Titel Revolutionary Mothering zuspitzt, beständig kümmern muss (Gumbs et al. 2016).
Beals Vision des »Living for the Revolution« trifft sich mit einer Passage in der Rede, die Helke Sanders 1968 in Frankfurt am Main hielt. Auf der hauptsächlich durch den »Tomatenwurf« als Gegenwehr zu männlich-dominantem Redeverhalten berühmt gewordenen Delegiertenkonferenz des SDS formulierte Sanders als Abgeordnete der Berliner Freien Universität die Position des »Aktionsrats zur Befreiung der Frauen« folgendermaßen:
»wir können die gesellschaftliche unterdrückung der frauen nicht individuell lösen. wir können damit nicht auf zeiten nach der revolution warten […]. wir wollen versuchen, schon innerhalb der bestehenden gesellschaft modelle einer utopischen gesellschaft zu entwickeln. in dieser gegengesellschaft müssen aber unsere eigenen bedürfnisse endlich einen platz finden.« (zit. nach Lenz 2008: 61f.)
Diese beiden Schlaglichter eines sich revolutionär verstehenden Feminismus – einmal im Umfeld der Black Panther und einmal der Neuen Linken in der BRD – reflektieren intensiv auf Transformationsstrategien. Aus der Multiplizität der emanzipatorischen Ziele ergibt sich unmittelbar die Frage danach, wie sämtliche Anliegen in das revolutionäre Szenario einzutragen seien – die Antwort deutet in Richtung einer revolutionären Lebensformpolitik (Loick 2017). Zwei Motive stechen dabei hervor: das der Alltagspraxis und das der Vorwegnahme. Der nachdrückliche Verweis, als Schauplatz der Revolution die Alltagspraxis in den Blick zu nehmen, bezieht sich nicht – wie häufig in der 68er Bewegung – auf die individuell und psychologisch verstandene Ebene, sondern richtet sich auf geteilte Praktiken. »Day-to-day life patterns«, »Gegengesellschaften« innerhalb der bestehenden Ordnung werden somit zu den Arenen einer Transformation, die weiter reicht als der Begriff des Kampfes. Dies resultiert in einer veränderten Blickrichtung, wie sie auch Bini Adamczak über den Begriff der »Beziehungsweise« propagiert (Adamczak 2017). Anstatt nach dem grandiosen Ereignis der Revolution Ausschau zu halten, scheinen diese Denkerinnen mit ausladender Geste einmal um sich herum zu deuten und zu sagen, dass genau dieser Moment, jener Alltag, sich richtig angegangen dazu eignet, als Revolution ausgewiesen zu werden – ein veritables »Non, Sire …«.
Die Perspektive, in der das Gelingen der Revolution weder übergreifenden geschichtlichen Prozessen noch singulären Ereignissen anvertraut wird, sondern dem, was in emanzipatorischen gesellschaftlichen Zwischenräumen geschieht, nenne ich im Folgenden »interstitiell«. Im Englischen bedeutet »interstitial« laut Oxford Dictionary sowohl »in den Zwischenräumen angesiedelt« als auch »die Zwischenräume ausweitend«. Vollständiger oder radikaler interstitieller Wandel bestünde folglich darin, vormalige Zwischenräume zum neuen Herzstück zu machen – wie das gelingen soll ist damit freilich noch nicht geklärt.
Die interstielle Gestalt von Transformationsprozessen eröffnet ein Verständnis der Zeitlichkeit von Revolution, das mit einer gewöhnlichen instrumentellen Abfolge bricht, die die Revolution als Mittel zwischen Vergangenheit und Zukunft stellt. In der von Beal geforderten anhaltenden Anstrengung um die Revolution, so Sanders, verkehrt sich die Abfolge von Vergangenheit und Zukunft. Das Nach-revolutionäre müsse genau jetzt, vor der Revolution, getan werden. Darin gerade bestünde dann die Revolution.
Wir haben es beim interstitiellen Wandel also mit einem gerichteten Prozess zu tun, aber dieser gewinnt seine Richtung nicht aus einem angesteuerten, in der Zukunft liegenden Ziel – dem telos – und auch nicht aus einem inneren dynamischen Bewegungsgesetz. Der Mechanismus des Fortschreitens wird ersetzt durch das Ausharren beim Wegweisenden. Enklaven des Zukünftigen in der Gegenwart eröffnen eine neue Perspektive auf die Wahl der richtigen Mittel in gegebenen Antagonismen. Sie verlangen Aufmerksamkeit und Virtuosität in der Übertragung, die schließlich die gesamte Gegenwart zur gewünschten Zukunft brächte.
Solche Übertragungsmechanismen zu verstehen, ist das Kernanliegen von Praxis und Revolution. Der Begriff, der die verschiedenen Facetten revolutionärer Dynamik schließlich zu bündeln verspricht, lautet »Metalepse«. Als »Metalepse« oder, griechisch, »Metalepsis« wird eine eher seltene rhetorische Figur bezeichnet, die eine doppelte Übertragung erfordert. Eine ihrer typischen Formen ist die Vertauschung von Zweck und Mittel oder Ursache und Folge. Die eben beschriebene Zeitlichkeit, in der sich das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft umkehrt, ist in diesem Sinne »metaleptisch«. Wie sich noch herausstellen wird, sind es aber auch raffiniertere Konzeptionen eines »verkehrenden Ineinandergreifens« wie die performative Kritik oder der Paradigmenwechsel.
Während eine eigentliche Bestandsaufnahme erst am Ende des Buches möglich sein wird, zeichnet sich bereits ab, wie eine interstitiell-metaleptische Perspektive sich zu den drei benannten Dilemmata verhalten würde. Zu einem ausgedehnten Prozess ausgeweitet – dem, was Juliet Mitchell schon 1965 als »longest revolution« reklamierte (Mitchel 1965) – stellt sich die Frage nach dem Anfangen gar nicht als die nach einem entscheidenden Ausbruch, sondern danach, welche Momente oder Praktiken im Gegebenen sich als solche ausweisen lassen, die mögliche »nach-revolutionäre« Qualität haben. Beginnen hieße dann, diese zu stärken und auszuweiten – »living for the revolution«. In der metaleptischen Verkehrung von vorher und nachher löst sich auch die Paradoxie des unmöglichen Übergangs. Die Frage ist nicht die nach einem abrupten Szenenwechsel, sondern nach Strukturen, die ermöglichen, vormals untergründige Praxis zu neuen Paradigmen zu erheben. Deren Institutionalisierung und Routinisierung wäre dann auch das, was Stabilität verspräche. Das Neue als beharrlich Eingeübtes verlöre seine Flüchtigkeit.
Das hier Beal und Sanders abgeschaute Bild der interstitiellen, metaleptischen Revolution deckt sich in weiten Teilen mit der Strategie der »Präfiguration«, die auch schon im obigen Brown-Zitat anklang. Unter diesem Begriff wird in letzter Zeit das eigentlich mal als »utopischer Sozialismus« diskreditierte und im kommunitären Anarchismus bewahrte Transformationsverständnis in der Linken wieder verstärkt diskutiert. Im Post-Marxismus taucht das Bild etwa in Debatten um Commons und Commonisierung auf und wird post-operaistisch als Exodus-Strategie in Anspruch genommen (Virno 2002, Holloway 2010). Innerhalb der radikalen Black Studies wird die Tradition des »marooning«, der Entlaufenen-Enklaven, mit dem Begriff der »undercommons« reaktualisiert (Harney/Moten 2013). Der zeitgenössische Anarchismus, wie ihn Uri Gordon porträtiert hat, verfolgt die Taktik »präfigurativer Politik« (Gordon 2013). Iwona Janicka wiederum hat diese auf den Begriff einer mimetischen Solidarität mit Singularität gebracht (Janicka 2017). In der Queer Theory sprechen sich mit José Muñoz und J. J. Halberstam prominente Stimmen für die in konkreten Utopien oder »queer times and spaces« eingekapselte Zukunft aus (Muñoz 2009; Halberstam 2005). Auch die radikaldemokratische Organisationsform von Occupy und anderen Platzbesetzungen, die besonders gut in Isabell Loreys Theorie des Exodus aufgeht (Lorey 2011), ist, wie erwähnt, als Vorgriff auf die Zukunft konzipiert. Die letzte massive feministische Mobilisierungswelle schließlich hat sich in ihren Aufrufen zum Frauen*tagsstreik 2017 explizit auf das Motto der argentinischen Gruppe »Ni Una Menos« berufen: »ponemos en practica el mundo en el que queremos vivir« – »Lasst uns die Welt in die Tat umsetzen, in der wir leben wollen.«
Diese Perspektive auf Wandel bleibt – zumindest als Theorie – allerdings so lange einseitig, wie sie das mit Marx als »passive Bedingungen« eingeführte und dann in die Zähigkeit materieller Praxis übersetzte Element ausblendet. Es bedarf keines großen Scharfsinns, um die Idee, mit punktuellen Vorgriffen die Welt verändern zu wollen, als »naiv« zu diskreditieren oder des Voluntarismus zu überführen.
Diese Vorwürfe treffen aber nur solange, wie die Vorwegnahme als jederzeit erfolgsversprechend (das wäre das Naive), oder als lediglich vom Willen der Akteur_innen abhängig (das wäre voluntaristisch) propagiert würde.
Wenn die Transformation, auf die präfigurative Politik abzielt, interstitiell ist, dann gilt es zunächst, ein besseres Verständnis von deren Antrieb und Mechanismus zu gewinnen. Lässt sich überhaupt ein plausibles Verständnis radikalen Wandels – letztlich also ein Geschichtsbild – entwickeln, das aus den Zwischenräumen mobilisiert und in »rückwirkenden Vorgriffen« strukturiert ist? Wann glückt die Metalepsis? Nicht, ob präfigurative Politik »richtig oder falsch« ist, sondern was die strukturellen Bedingungen für ihr Gelingen sind, rückt dann ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
Eine solche Konzeption wird im Folgenden aus Grundbegriffen entwickelt, die eher der »Revolutionsskepsis« zuzuneigen scheinen, nämlich ein auf Wiederholung fußender Praxisbegriff und ein das jeweils zukünftige Handeln bedingender Strukturbegriff. Auf ihrer Basis geht es dann darum, sich überhaupt der Funktionsweise von Wandel zu vergewissern – Voraussetzung auch dafür, womöglich wieder die Umschlagpunkte ausweisen zu können, an denen menschlicher Einsatz wirksam werden kann. Erst am Ende wäre dann von Revolution wieder dort die Rede, wo soziale Wandlungstendenzen mit menschlichen Emanzipationsbestrebungen zusammenfallen.
Im Kern speist sich die Sozialtheorie radikalen Wandels, die in der zweiten Hälfte des Buches entfaltet wird, aus einer Synthese von Thomas S. Kuhns Vorstellung von Paradigmenwechseln und Judith Butlers Konzeption performativer Kritik (Kuhn 1962; Butler 1990). Beide, so möchte ich zeigen, teilen eine interstitielle Ausrichtung und eine metaleptische Dynamik. Zudem können sie in die materialistische Praxistheorie eingelassen werden, die die erste Buchhälfte vorschlägt. Dass ausgerechnet Kuhn sich zum Denker eines prozessualen Revolutionsbegriffs heranziehen lässt, mag überraschen und verdankt sich einer spezifischen Lektüre, der Margaret Masterman den Boden bereitet hat (Masterman 1965). Sie siedelt gerade im Kern der kuhnschen Vorstellung, nämlich im Begriff des Paradigmas selbst, ein wittgensteinianisch-praxistheoretisches Motiv an. Was ein Paradigma sein wird, sind anfänglich konkrete, krude und vorläufige Vorgehensweisen, die überhaupt nur zum Vorschein kommen, weil die gängigen Verfahren in die Krise geraten und von wiederkehrenden Anomalien – unter ihnen nicht zuletzt das embryonale neue Paradigma – verunklart wurden. Sich bewährende neue Praktiken werden dann nach Masterman durch Übertragung oder Analogie-Bildung zugleich ausgeweitet und abgesenkt; sie werden zu Grundlagen – oder, wie ich es nenne, »Ankern« – immer weiterer Bereiche des Sozialen.
In das Bild dieses prozessualen Kuhns lässt sich die performative Kritik als das eigentlich interstitielle Moment eintragen. Sie stiftet die Anomalie (oder, mit Butler, »trouble«) und bietet gleichzeitig potenzielle Anknüpfungspunkte für andere Praxisfortsetzung. Dabei verstehe ich performative Kritik selbst bereits auf eine gegenüber der gängigen Lesart radikalisierte Weise. Schon in Bezug auf Butlers eigene Konzeption scheint mir die Diagnose der »bloßen Subversion« eine Fehllektüre. Tatsächlich beschreibt Butler in einer Reihe von Fällen – deren prominentester die Analyse von Drag ist – einen Mechanismus mit drastischen Folgen, nämlich das Aufbrechen einer Struktur durch das Auftauchen einer zuwiderlaufenden, eigentlich unkenntlichen (»unintelligiblen«) Praxis. Wenn man das Subversion nennt, dann meint man damit jedenfalls mehr als Variation oder Flexibilität – etwa den Effekt, dass etwas, das subversiv unterhöhlt wurde, komplett zusammenbrechen kann. »Alter Maulwurf« ist schon bei Marx einer der Namen von Revolution (Marx 2007: 116).
Butlers theoretischer Rahmen selbst trägt indessen auch nicht zur Erhellung der Gelingensbedingungen solcher Umbruch-Effekte bei. Hier lässt sich mit den Mitteln der Strukturierungstheorie nacharbeiten. Als Ausgangssituation von Wandel beschreibe ich eine Situation von Strukturüberlagerung, die dadurch ermöglicht ist, dass Praktiken ambivalent oder multifunktional sind. Es ist also gerade nicht die Abweichung innerhalb »einer« Struktur, sondern die Situation, die sich aus der Kollision verschiedener Strukturen ergibt, die Transformation ermöglicht. Wenn eine Praxis, die eigentlich nur in einem speziellen – ich nenne ihn sub-kollektiven – Kontext intelligibel wäre, unter die Instanzen einer allgemein kenntlichen Struktur gemischt auftaucht, dann bietet sie Anschlussmöglichkeiten in zwei Richtungen. Man kann sie im hegemonialen Sinne weiter wiederholen; es kann aber auch die sub-kollektive Codierung aufgegriffen und fortgesetzt werden. Wenn letzteres geschieht, artikuliert sich das, was eigentlich unintelligibel sein sollte, und wird zu jener Ausnahme, die eine sich als ausnahmslos gebende Struktur so wenig verkraften kann, dass sie in ihrem Status als unhintergehbarer Boden der Tatsachen brüchig wird. Dadurch vergrößert sich abermals der Spielraum für die gegenläufigen Anschlüsse.
Das Muster, das sich hier abzeichnet, ist metaleptisch in dem wörtlichen Sinne, der sich aus der altgriechischen Wortbedeutung ableiten lässt. Aus einer Ansammlung ähnlicher Instanzen wird eine herausgegriffen, die sich als irrig herausstellt. »Meta« heißt in diesem Zusammenhang »von inmitten Ähnlicher«; »lepsis« ist der Zugriff, der aber auch ein Fehlgriff sein kann. Die Metalepsis ist demzufolge kein bloßer lapsus, wie er jederzeit stattfinden könnte, sondern ein verkehrendes Ineinandergreifen, das auf passende Strukturen angewiesen ist.
So wie in der rhetorischen Figur der Metalepsis eine doppelte Übertragung stattfindet – von einem Wortspiel über das andere zum Referenten – wird in der performativen Kritik eine unintelligible Praxis in eine artikulierte Struktur eingereiht und dann von dort aus aufgegriffen und gegen die übergreifende Ordnung gewendet. Im interstitiellen Wandel sagt gewissermaßen der Maulwurf »ick bin all hier«.
Den »Maulwurf« an dieser Stelle »ick bin all hier« sagen zu lassen, bildet denn auch rhetorisch eine Metalepsis: In den Wettlauf von Hase und Igel wird der Maulwurf anstelle des listig siegreichen Igels eingeschmuggelt und mit ihm die Metapher für Revolution. Nur eine doppelte Übertragung löst das Rätsel. Will sagen: Auch wenn man die unintelligible revolutionäre Praxis vorher nicht sehen kann, wird sich, nachdem sie sich artikuliert und das herrschende Paradigma erodiert hat, herausstellen, dass sie immer schon da gewesen sein muss. Wenn dem so ist, bilden präfigurative interstitielle Praktiken tatsächlich die notwendige Bedingung jeden radikalen sozialen Wandels. Revolutionär hinreichend sind sie aber nur, wo ihnen metaleptische Strukturüberlagerungen den Übergang zur Ankerstruktur – zum neuen Paradigma – bieten.
Um den vollen Begriff der Metalepsis entfalten zu können, arbeitet dieses Buch in vier systematischen Teilen jeweils einen Grundbegriff aus. »Praxis«, »Struktur«, »performative Kritik« und »Paradigmenwechsel« sind also die Motive, die auch die Gliederung bestimmen.
Der erste Teil definiert den Praxisbegriff, fächert die Normativität von Praktiken auf und begründet insgesamt ein praxeologisches Verständnis des Sozialen. Der zweite für sich genommen skizziert einen praxistheoretisch anschlussfähigen, dynamischen Strukturbegriff, auf dessen Grundlage soziale Formationen als disparate Gebilde unterschiedlicher Aggregationsdichte analysiert werden können. Der dritte Teil revidiert das Motiv performativer Kritik so, dass interstitielle Strukturumbrüche erklärt werden können. Und der vierte Teil schließlich deutet das Motiv des Paradigmenwechsels auf prozessuale Weise neu aus, wendet es auf jüngere Revolutionsgeschichtsschreibung an und bringt es mit der Figur der Metalepse zur Deckung.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: