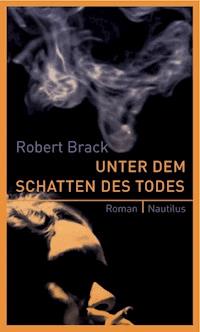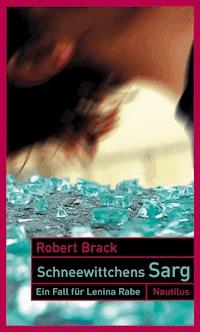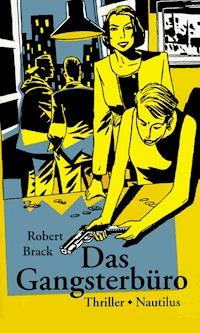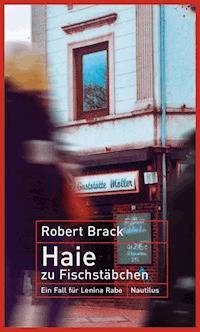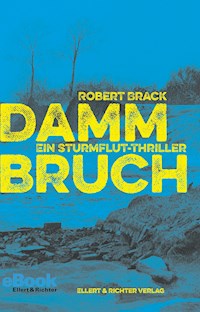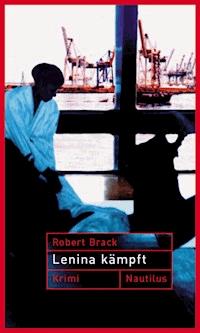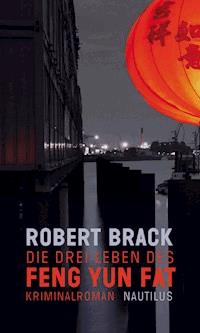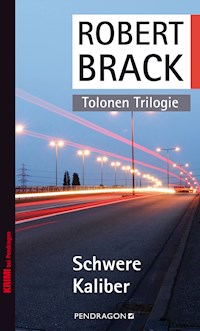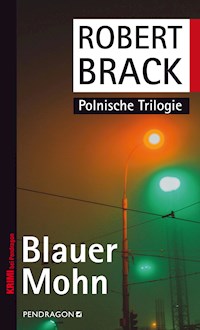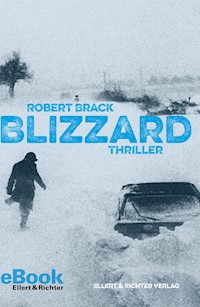
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ellert & Richter
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dezember 1978: Bankräuberin Gisela freut sich auf die bevorstehende Entlassung ihres Komplizen Frieder aus dem Gefängnis. Als Überraschung für ihn hat sie mit ein paar Komplizen den Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Hamburger Innenstadt geplant. Der Überfall findet kurz nach Weihnachten statt, doch nicht alles verläuft nach Plan. Es kommt zu einer Schießerei, und Simona, eine undurchsichtige Bekannte von Gisela, schließt sich den fliehenden Gangstern an. Die beiden haben sich – zufällig? – im gerade eröffneten Casino im Hotel Interconti kennengelernt. Die Flucht führt geradewegs in die zerstörerische Schneekatastrophe, die Norddeutschland um den Jahreswechsel überfällt. In einem Bauernhaus in Ostholstein wird die Bande eingeschlossen. Rivalitäten und Intrigen brechen sich Bahn. Wer kann wem vertrauen? Wem steht das kostbare Collier namens "Blizzard" zu? Im Kampf gegeneinander entgeht den Verbrechern, dass im Nachbarhof eine tödliche Gefahr lauert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ROBERT BRACK
BLIZZARD
THRILLER
ELLERT & RICHTER VERLAG
Inhalt
Kapitel 0
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
UNTER 0
DIE PERSONEN
DER AUTOR
Vorsehung oder Verhängnis, man hat die Wahl.
Balzac, Geschichte der Dreizehn
0
Glitzer, glitzer. Die Welt ist eine Kathedrale, erbaut aus Kristallen, üppig geschmückt mit leuchtenden Diamanten, überdeckt mit schimmerndem Staub wie Puderzucker.
Wie durch zigtausend Prismen bricht sich das Licht der aufgehenden Sonne in dem glänzenden Schmuck, der mit großzügiger Hand über die Welt verteilt wurde. Winzige Regenbögen explodieren, als sie den Kopf neigt. Das Blau der Eisfläche spiegelt sich im Himmel. Das grelle Licht schmerzt in ihren Augen. Schönheit tut weh.
Meterhoch türmen sich Eiswände und Schneeschichten, bizarre Formen aus gefrorenem Wasser, mal grellweiß, mal bläulich matt oder grau, mal durchsichtig wie Glas. Zapfen und Zacken, erstarrte Tropfen. Manches sieht aus wie geronnene Luft, als wäre der Sturmwind erstarrt. Wasserwirbel schockgefroren, überschäumende Brandung in der Bewegung gestoppt, ein Wald aus Stämmen, Zweigen, Nadeln, Disteln und Dornen aus Eis. Dünen aus feinsten Kristallen. Gebirge aus Blöcken von gefrorenem Wasser, krustig und mit scharfen Kanten wie Blätterteig aus Eis, garniert mit Baisers aus Schnee, verziert mit frostiger Zuckerwatte.
Schwacher Atem stößt dampfende Wolken aus.
Luft! Luft! Wie kann es sein, dass zu wenig Luft in der Luft ist? Jeder Hauch ist so kalt, dass Nase und Kehle einfrieren.
Inmitten der Eisfläche hockt sie da wie eine Marionette, der man die Fäden zerschnitten hat, auf einem angewinkelten Bein, das andere nach vorn gestreckt. Im groben Mantel, die Füße in klobigen Stiefeln. Dicker Wollschal, Fellmütze. Der Mantel ist so groß, dass er sich wie ein Zelt um sie ausbreitet. Ihre Kleider sind trotz des Glitzerflaums, mit dem sie gepudert wurden, ein hässlicher dunkler Klecks in dieser makellos weißen Umgebung.
Übrigens ist sie nicht der einzige dunkle Fleck in diesem reinlichen Paradies. Da ist noch einer, neben ihr. Erstarrt sitzen sie da, als wären sie aneinander festgefroren.
Rote Streifen ziehen sich durch den Schnee, als farbige Nuance eingeträufelt in das alles beherrschende Weiß. Ein paar Spritzer auf dem klaren Eisfenster, das ihren Blick in die dunkle Tiefe des Meeres lockt. Das Rot versickert im Schnee, das warme Rinnsal gräbt ein winziges Flussbett, dann verblasst es mehr und mehr, übrig bleibt nur eine Ahnung von Leben.
Ist das mein Blut, fragt sie sich. Fließt es noch? Oder ist es längst erstarrt?
Diese Helligkeit tut weh. Dieses verdammte, grell schimmernde Eis! Der Himmel wölbt sich wie eine blaue Kuppel über der weißen Wüste. Alles ist still. Die letzte Flocke ist herabgesunken, in der Glaskugel herrscht Ruhe. Wäre es nicht an der Zeit, dass jemand sie nimmt und schüttelt, damit ein neues Schneegestöber entsteht und denen die Sicht nimmt, die mich einfangen wollen? Wo ist die mächtige Hand, die uns hilft, dem Verhängnis zu entkommen?
Los doch! Greif zu! Schüttle das Glas! Lass uns verschwinden im wilden Schneegestöber und mit uns die ganze Welt.
1
Die kleine weiße Kugel rotierte im Kessel, getrieben von der Macht der Rotation, prallte ab von unsichtbaren Hindernissen, flitzte als Querschläger über den Kranz der roten und schwarzen Zahlen, ließ sich von den vorstehenden Rauten schikanieren, surrte, klackerte, eierte herum, ignorierte die grüne Null und fiel schließlich nach einer halben Ewigkeit in eins der Fächer. Dreiundzwanzig, rot, ungerade. Und wieder schob der Croupier die Jetons auf die andere Seite des Tischs, wo sie sich vor der blonden Frau im kleinen Schwarzen auftürmten. Die hat wirklich Glück, dachte Gisela. Nur gut, dass Karl mir vor allem kleinteilige Chips in den Beutel gelegt hat, sonst müsste ich mir noch Gedanken über meine Ausgaben machen.
Die junge Frau trug eine hübsche Perlenkette um ihren Schwanenhals. Wenn die echt ist, würde es reichen, ihr in einer Seitenstraße eins über den Schädel zu ziehen und mit dem Ding das Weite zu suchen. Wäre das nicht genug? Aber sie sah schon das scheinheilig-geschäftsmäßige Gesicht von Karl vor sich: „Na meine Liebe, du weißt doch, dass ich dir nur einen Bruchteil vom eigentlichen Wert auszahlen kann.“ Sei’s drum, spontane Raubüberfälle waren sowieso nicht ihre Sache. „Und außerdem arbeiten wir nie am Wochenende“, hatte Frieder mit einem schelmischen Lächeln gesagt, „denn am Wochenende haben die Banken geschlossen.“ Frieder, der gerade wegen bewaffnetem Raubüberfall in Santa Fu hockte.
Gisela vergewisserte sich, ob ihre dunkle Lockenmähne noch immer so üppig auf ihre Schultern fiel wie erwünscht und strich dann mit kalkulierter Nervosität über ihr dunkelblaues Kleid, zu dem sie weiße Glacéhandschuhe trug, die bis zu den Ellbogen reichten. Sie wolle das Spielgeld nicht mit den bloßen Händen berühren, weil das Unglück bringe, hatte sie Karl erklärt. Der hatte gelacht und gesagt: „Ja, ja, Aberglaube ist in unseren Kreisen weit verbreitet. Setzt du auf die Dreizehn?“
„Die Dreizehn ist schwarz, dabei müsste sie doch rot sein“, hatte sie geantwortet. Er hatte nachsichtig gelacht, mit selbstgefälligem Unterton: Menschen, die abergläubisch sind, so kündete dieser Unterton, sind leichter zu beherrschen.
Das war an der Bar gewesen, wo er ihr das Säckchen aus Samt – dunkelblau, passend zu ihrem Kleid – übergeben hatte. Spielgeld. Eine Investition in die Zukunft.
Die Blondine auf der anderen Seite lächelte. Leicht verschämt, stolz und zurückhaltend zugleich. Sie wollte nicht triumphieren, das sprach für sie. So viel Lebenserfahrung hatte sie mit schätzungsweise Mitte Dreißig schon gesammelt. Immerhin hatte sie bereits ein paar hundert Deutsche Mark vor sich aufgehäuft, und nicht wenige der Jetons stammten aus dem Säckchen von Giselas Geschäftspartner Karl Schneider, den manche „Beutel-Schneider“ schimpften.
Schneider war gegangen. Das hatte sie sich ausgebeten. „Du musst mir nicht beim Verlieren zuschauen“, hatte Gisela gesagt. Was ihn amüsiert hatte: „Aber du verlierst doch absichtlich.“ Und sie hatte hochmütig entgegnet: „Umso schlimmer, mein Lieber.“
„Faîtes vos jeux!“ Man sprach Französisch im neunten Stock des Hotels Intercontinental in Hamburg an der Außenalster. Das nagelneue Kasino war eine internationale Attraktion. Anfang des Jahres hatte der Finanzsenator die erste Kugel geworfen, jetzt ging das Jahr 1978 seinem Ende entgegen und der Ko-Investor Staat konnte zufrieden sein, er sahnte mit ab.
So wie die Blonde gegenüber, die gerade ihren Einsatz an die Transversale 16-18 gelegt hatte. Wieder zwei rote und eine schwarze Zahl. Gisela bildete sich ein, die Blonde würde mehr auf rote als auf schwarze Zahlen setzen. Was sie allerdings nicht mathematisch belegen konnte. Ergo: Aberglaube.
Die Frau mit der Glückssträhne blickte irritiert auf. Sie hatte eine Stimme gehört. Ihre Augen, die eben noch das Tableau gemustert, den Croupier angelächelt und Gisela einen entschuldigenden Blick zugeworfen hatten, irrten hektisch hin und her. Als würde sie nach einem Fluchtweg suchen.
Gisela schaute sie betont erstaunt an. Aber ihr Versuch mütterlich-mitfühlend zu wirken – sie war etwas älter als ihr Gegenüber – ging ins Leere. Denn im gleichen Moment, als die Kugel geworfen wurde und über den schwarzen Kesselrand surrte, sprang die Blonde auf. Als der Croupier „Rien ne va plus“ sagte, wandte sie dem grünen Tisch den Rücken zu, und als die kreisende Kugel ihren Radius verengte, ins Trudeln geriet und zu klackern anfing, eilte sie mit weit ausholenden Schritten davon und wirkte dabei durchaus sportlich. Unter dem Kleid, das an den Schultern gepolstert war, sich ansonsten eng an Hüften und Oberschenkel schmiegte, konnte Gisela kurz das Muskelspiel beobachten.
Der Blickrichtung nach zu urteilen, hatte die Blonde an der Bar etwas Beunruhigendes bemerkt. Gisela schaute betont desinteressiert hinter sich. Dort plauderte eine seriös wirkende, ältere Hanseatin in einem altmodischen dunkelgrünen Abendkleid mit einem graumelierten Herrn im dunklen Zweireiher. Sie trug Goldschmuck, der nicht zu ihrem toupierten platinblonden Haar passte.
Aber das war jetzt nebensächlich, denn die Geflüchtete hatte erneut gewonnen, wie der Croupier leicht irritiert annoncierte. Und nicht zu knapp: elfmal einhundert macht 1100 Deutsche Mark, das war kein Pappenstiel. Damit konnte so eine junge Frau schon mal einen Monat durchkommen, wenn sie keine allzu hohen Ansprüche stellte.
Die anderen Spieler schüttelten die Köpfe, lächelten verlegen, zuckten mit den Schultern, blickten sich suchend um.
„Ich schau mal, ob ich sie finde“, sagte Gisela im Aufstehen. „Das wäre doch zu dumm.“ Als ob ein Kasino keine Vorkehrungen für derartige Fälle getroffen hätte. Aber das war ja egal, sie wollte die Blonde jetzt nicht wieder verlieren.
Gisela durchstreifte die diversen Räume, Bars, Foyers, Lounges, die Säle mit dem amerikanischen Roulette, die Blackjack- und Poker-Tische. Nichts zu machen. Gleichzeitig fühlte sie sich irgendwie beobachtet. War Schneider noch da?
Blieb nur noch das Inspizieren der Toiletten übrig. Ebenfalls Fehlanzeige. Alles leer, niemand stand händeringend vor einem der modernen Waschbecken mit den blitzenden Armaturen und starrte verzweifelt in den Spiegel. Auch die Kabinentüren standen sämtlich sperrangelweit auf. Na schön, wenn wir schon mal hier sind – Gisela steuerte das nächstliegende Klosett an. Trat ein, schob die Tür zu, hielt inne.
Draußen im Flur näherten sich hastige Schritte. Klappernde Absätze, leicht unregelmäßig, wie von einer Frau, die es nicht gewohnt war, auf Pfennigabsätzen einen Sprint hinzulegen – oder vor jemandem zu flüchten.
Die Tür wurde aufgestoßen, hastiges Atmen, ein leise geflüstertes „oje, oje!“, gefolgt von einem hektischen Herumirren im Waschraum, hin und her vor den Kabinen. „Was mach ich jetzt … da drinnen findet die mich doch …“
Gisela hatte schnell begriffen, worin die Gefahr bestand: Man konnte durch den Spalt unter Tür und Kabinenwand durchspähen. Niemand versteckt sich in einer Toilette, wenn er wirklich gesucht wird. Was das Flüchten betraf, hatte Gisela einige Erfahrung.
Draußen im Korridor erneut Schritte. Langsam, gemessen, vielleicht sogar zögerlich. Ein verhaltener Ruf: „Simona?“
Gisela hätte beinahe laut aufgelacht, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Sie zog die Tür auf. Die Blonde starrte sie kurz an. Gisela bedeutete ihr einzutreten. Und schon war die Tür geschlossen und verriegelt.
„Was …“, flüsterte die Blonde, die nicht so ganz zu begreifen schien.
Gisela klappte den Deckel herunter. „Hock dich drauf!“
Die Blonde kletterte auf den Toilettendeckel.
Meine Güte, dachte Gisela, was man alles tut, nur um an Geld zu kommen.
Die Tür zum Waschraum ging auf.
„Simona?“
Schritte trippelten hin und her. Offenbar inspizierte die Dame die Ecken und Nischen, schaute in jede der leeren Kabinen.
„Simona? Ich weiß, dass Sie hier sind.“
Gisela schaute die Blonde an, die geduckt im engen Kleid auf der Toilette hockte, die Augen weit aufgerissen vor offensichtlicher Verzweiflung, einen Finger an den Lippen, unausgesprochen bettelnd: Schweigen Sie, retten Sie mich.
Gisela nickte zustimmend.
Die Tussi da draußen wurde aufdringlich. Sie klopfte an die Tür. „Simona, kommen Sie raus!“
Die beiden Gefangenen schwiegen.
Die Klinke wurde mehrmals betätigt. Die Tür wackelte.
Die Frauen in der Kabine hielten den Atem an.
Draußen geschah etwas Eigenartiges. Unter dem Türschlitz waren Knie zu sehen, und Hände. Diese Frau war sich für nichts zu schade. Auf allen Vieren spähte sie unter der Tür in die Kabine hinein. Also jetzt mal im Ernst, wie weit will die denn noch gehen?
Die junge Frau, die anscheinend Simona hieß, presste die Lippen zusammen.
Gisela entschloss sich, die Komödie zu beenden. Kurz und schmerzlos. Sie drehte den Riegel um und öffnete die Tür einen Spaltbreit.
„Also hören Sie mal!“, sagte sie streng zu der älteren Dame im grünen Kleid, die vor ihr hockte und gequält aufschaute.
„Oh, verzeihen Sie …“ Die Armreifen schepperten.
„Was tun Sie denn da?“
Die Frau erhob sich auf die Knie, blickte verlegen drein.
„Das schickt sich nicht!“, sagte Gisela streng.
„Entschuldigen Sie, aber ich dachte …“ Die Frau stand auf und fuhr sich durch das platinblonde Haar.
„Ich könnte Sie anzeigen!“
„Nein, nein, bitte …“ Die Frau hob den Saum des Kleids und besah ihre Beine. Von den Knien ausgehend zogen sich durch beide Strümpfe breite Laufmaschen. „Ach, herrje.“
Draußen im Korridor näherten sich erneut Schritte. Die Frau blickte verstört zur Tür, dann wieder zu Gisela. Sie trat einen Schritt vor, schaute sie eindringlich an.
„Jetzt reicht es aber. Ich schreie um Hilfe“, sagte Gisela laut.
Die Schritte waren vor der Tür angekommen. Man hörte durcheinander plappernde Frauenstimmen.
„Nein, lassen Sie“, sagte die Frau. „Ich gehe schon.“
„Das ist wohl besser.“
Drei Damen traten ein. Die Frau im grünen Kostüm drehte sich um und eilte an ihnen vorbei nach draußen.
Gisela schloss die Tür und blickte auf die ausgestreckte Hand der Blonden. „Da, nehmen Sie.“ Sie hielt ihr die Perlenkette hin.
„Wie bitte?“
„Ich kenne sie doch. Die lässt nicht locker. Sie wird draußen auf mich lauern. Mich in die Enge drängen, mich zur Rede stellen. Mich womöglich durchsuchen. Und dann verliere ich meine Anstellung. Wenn sie die Kette bei mir findet.“
„Ich verstehe kein Wort.“
Vor den Waschbecken wurde eifrig über Banalitäten palavert.
Die Blonde beugte sich vor und flüsterte Gisela ins Ohr: „Das war meine Chefin, Annegret Weiler-Gehling, die Juwelierin. Und das hier ist nicht meine Perlenkette. Ich habe sie mir nur geliehen. Ohne zu fragen, verstehen Sie?“
Gisela hatte einige Erfahrung in Bezug auf Eigentumsdelikte und daraus resultierende Verstrickungen. Sie nickte. Simona legte ihr die Kette in die Hand.
„Sie sind ja lustig“, sagte Gisela. „Sie kennen mich doch gar nicht. Und wenn die wirklich wertvoll ist …“
„Geben Sie mir Ihren Ausweis!“
„Wie bitte?“
„Dann komme ich zu Ihnen und hole mir die Kette wieder ab. Finderlohn eine Flasche Schampus, ist das ein Wort?“
„Meinen Ausweis als Pfand?“ Gisela verzog zweifelnd das Gesicht. „Ist das Ding denn auch echt?“ Sie hielt das Collier ins Licht, obwohl sie wusste, dass sie diesbezüglich über keine Expertise verfügte.
„Ist Ihr Ausweis echt?“, fragte Simona.
Beide schauten sich kurz an. Bist du eine Komplizin oder eine Betrügerin, schienen sie sich gegenseitig zu fragen.
Dann mussten sie lachen.
Die Kommentare draußen vor der Kabine fielen sowohl amüsiert wie anzüglich aus. Dann verließen die schwatzenden Damen den Raum.
„Gut“, sagte Gisela und öffnete ihre Handtasche, um das Collier darin verschwinden zu lassen. Sie holte ihren Personalausweis heraus und hielt ihn der Blonden hin, die, wie sie jetzt bemerkte, zu allem Überfluss auch noch strahlend blaue Augen hatte. „Immerhin bin ich damit ins Kasino gekommen.“
Simona nahm das graue Heftchen, klappte es auf und fragte: „Die Adresse stimmt?“
Gisela nickte. „Natürlich.“
„Dann komme ich morgen Nachmittag vorbei?“
„Gern.“
Simona nickte zufrieden. „Sie gehen vor.“
Gisela entriegelte die Tür und hielt inne. „Aber was ist mit Ihrem Gewinn?“
Die blauen Augen leuchteten auf. „Da fällt mir schon was ein. Gehen Sie jetzt.“ Simona schob sie sanft aus der Kabine. Die Tür klappte zu, das Schloss klickte.
Im Vorbeigehen warf Gisela einen kurzen Blick in die Spiegel über den Waschbecken. In jedem sah sie genau gleich aus, nur im letzten nicht, denn da war eine Lampe defekt und ein Schatten fiel über ihr Gesicht.
Draußen näherten sich Schritte.
Nichts wie weg hier.
Hat doch gut geklappt, oder?
2
Wenn man es in Hamburg richtig hübsch haben will, architektonisch betrachtet, baut man mit rotem Backstein und verziert die Mauern mit Türmchen, die spitze Dächer haben, und vergisst auch romantische Nischen und Erker nicht. Die Gefängnismauern in Fuhlsbüttel waren darüber hinaus noch großzügig mit Stacheldraht versehen. Das Eingangsgebäude sah aus wie eine Bibliothek, der Besuchsraum war in der Kirche untergebracht.
„Hier veranstalten sie auch Konzerte“, sagte Frieder.
Gisela schaute sich um und rümpfte die Nase. „Na ja.“
Aufsichtsbeamte standen vor den Wänden und achteten darauf, dass die Besucher und Besuchten an den Tischen keinen Unfug trieben. Eine Frau hatte sogar zwei kleine Kinder mitgebracht. Die würden später bestimmt nicht straffällig werden.
„Vorgestern hat ein Chor Bachkantaten gesungen.“
„Aha.“ Sie schaute ihn an. Er hatte sich kaum verändert. Die Haare waren etwas länger geworden, die Koteletten breiter und neuerdings grau meliert, aber sonst wirkte sein breiter kantiger Kopf so intelligent und durchsetzungsfähig wie eh und je. Seine braunen Augen einfühlsam, sein Mund sinnlich. Ja, er gefiel ihr immer noch.
„Du lachst“, sagte Frieder, „aber mir hat’s gefallen.“
„Ist ja auch bald Weihnachten.“
„Eben.“
„Kurz danach kommst du raus.“
„Wie man so sagt. Ich werde entlassen.“
„Das klingt auch nicht besser.“
„Nein.“
„Und? Hat es dir was gebracht hier drin?“
„Ich bin zu einem besseren Menschen geworden, was sonst?“ Frieders Mundwinkel deuteten an, dass er dies ironisch meinte.
„Ich finde, du warst auch vorher schon ein guter Mensch.“
Er senkte die Stimme. „Weil ich so gut ‚Hände hoch, das ist ein Überfall’ brüllen konnte?“
„Du hast nie gebrüllt, sondern das Nötige stets deutlich und sehr bestimmt vorgebracht. ‚Runter auf den Boden und stillhalten’, fand ich immer am schönsten.“
„Nicht flüstern!“, mahnte der Aufseher.
Frieder verzog das Gesicht. „Aber damit ist jetzt Schluss, ein für alle Mal.“
„Ganz recht“, sagte Gisela und ließ ihre Augen aufleuchten. „Ein und für alle Mal. So soll es sein. Ganz ohne dein Zutun.“
„Da bin ich aber gespannt.“
Gisela ließ die Zeige- und Mittelfinger der rechten und linken Hand aufeinander zugehen. Sie begegneten sich und gingen wieder auseinander, dann begegneten sie sich wieder. „Ich habe eine junge Dame kennengelernt, die mir in gewisser Weise eine Arbeit angeboten hat. Eine sehr interessante junge Dame übrigens. Sehr lebhaft und auch sympathisch.“
„Sieh mal an.“
„Ja, sieh mal an. Sie hat mir sozusagen eine kurzfristige Möglichkeit in einem Schmuckgeschäft in Aussicht gestellt.“
„Sozusagen?“
„Nachtschicht. Ist doch mal was anderes.“
„Aha.“
„Und schon nach Weihnachten kann es losgehen.“
„Wenn der Trubel sich gelegt hat. Dann ist es nicht gleich so anstrengend“, sagte Frieder. „Aber …“
Sie unterbrach ihn lebhaft. „So ist es. Und was Hin- und Rückfahrt betrifft, so kann ich mich auf einen guten Freund verlassen.“
Frieders Gesicht verdüsterte sich. „Das gefällt mir nun weniger. Du sollst mir doch treu bleiben.“
„Bleib ich auch! Der gute Freund hat übrigens auch gute Freunde.“
„Gefällt mir noch weniger. So viele Männer um dich herum.“
„Ach, Frieder!“ Gisela lachte und schaute ihn verliebt an. „Die lasse ich alle sausen für dich.“
„Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass eine attraktive Frau leicht in Schwierigkeiten gerät, wenn sie sich mit zu vielen Männern umgibt. Deswegen waren wir doch auf unsere Zweisamkeit bedacht.“
„Weißt du, ich mag es, wie du dich ausdrückst“, sagte Gisela.
Frieder warf einen leicht beunruhigten Blick auf den Aufseher in ihrer Nähe. Gisela bemerkte jetzt, dass er ziemlich angespannt war. Mit beiden Händen umklammerte er den Rand der Tischplatte.
„He“, sagte sie leichthin und versuchte ein verführerisches Lächeln. „Keine Sorge. Was die Zweisamkeit betrifft, ist vorgesorgt. Wir machen Ferien an der Ostsee.“ „Was hältst du davon?“
„Hm …“ Er ließ die Tischkante los und lehnte sich zurück. Unzufrieden.
„Nur wir beide“, versicherte Gisela, „versprochen. Wir fahren ein Stückchen übers Meer. Eine Insel … wie wäre das?“
Sein Gesicht blieb regungslos, wie versteinert. Wenn er so dreinblickte, machte er ihr Angst. Weil sie dann fürchtete, nicht mehr an ihn ranzukommen. Diesen Blick hatte er, wenn er andere zurechtwies. Komplizen, wenn die nicht gespurt hatten oder ihm irgendwie quergekommen waren. In solchen Fällen konnte er ungemütlich werden. Sie übrigens auch, das hatte sie sich bei ihm abgeguckt. Weshalb sie in manchen Zeitungen geschrieben hatten, sie sei die Bandenchefin. Was nicht stimmte. Sie und Frieder waren ein Team, die anderen bloß Gehilfen, fertig. Genauer gesagt: Bei der Arbeit ein Team, privat ein Paar, aber die Bereiche schön getrennt. Nie hatte es eine vertrauliche Geste oder ein zärtliches Wort gegeben, wenn andere dabei waren. Weder bei der Planung noch bei der Vorbereitung oder der Durchführung. Sie waren absolut professionell und verlangten dies auch von anderen. Die Reporter der Sensationspresse hatten Lügengespinste über sie verbreitet – Gangsterbraut, Räuberliebchen, Bandenchefin, Intrigantin, je nach Bedarf. Alles Unsinn. Das Leben ist viel weniger aufregend, als es sich diese Märchenschreiber vorstellen. Wobei, in einem Punkt hatten sie recht gehabt, das hatte sich Gisela während ihrer bereits verbüßten Haftstrafe – die eigenartigerweise kürzer ausgefallen war als die von Frieder – eingestanden. Nachts, nachdem das Licht ausgegangen war und sie auf der oberen Pritsche liegend zur dunkelgrauen Decke geschaut hatte. Wenn der verzerrte Schatten des Zellengitters zu sehen war, weil draußen ein Scheinwerfer ungünstig stand, dann hatte sie zugeben müssen: Es hat mir großen Spaß gemacht! Ich habe es genossen, eine Bank zu überfallen, Menschen in Schach zu halten, Geld zu erzwingen, Hals über Kopf zu flüchten und später die Beute auf einem großen Tisch auszuschütten. Das war mehr als aufregend gewesen, das hatte sie glücklich gemacht. Natürlich nur, wenn Frieder dabei war, aber das war ja immer der Fall gewesen.
Beim nächsten Mal jedoch wäre sie auf sich allein gestellt.
Daher kam sicherlich dieser Drang, ihm so viel wie möglich anzuvertrauen, damit er eingebunden war, auch wenn er erst einen Tag später entlassen wurde.
„Was ist mit dieser jungen Dame?“, fragte Frieder.
Gisela war überrascht. Das war es also, was ihm Sorgen bereitete. Das mit den Komplizen war zweitrangig? Manchmal war es gar nicht so einfach, seinen Gedanken zu folgen.
„Ich habe sie zum Tee eingeladen. Und da hat sie mir Avancen gemacht. Weil sie wusste, sie kann mir vertrauen. Übrigens hatte ich es genau darauf abgesehen, weil ich ja wusste, wo sie arbeitet. Und dann hat mir der Zufall in die Hände gespielt.“
Frieder schaute sie kopfschüttelnd an, er verstand kein Wort. Gisela schaute zu den beiden Aufsehern in ihrer Nähe, die waren gerade mit der Familie beschäftigt, wo es Streit gab und eins der Kinder weinte.
„Also, sieh mal. Sie hat sich im Betrieb ein Schmuckstück ausgeliehen, aber vergessen zu fragen. Als das herauszukommen drohte, musste sie es zwischenzeitlich loswerden. Ich habe ihr geholfen. Sie hat es dann wiederbekommen, als sie zum Tee kam. Ich bin ja keine Diebin!“ Das sagte sie so laut, dass es sogar der Aufseher hören konnte, der nun wieder näherkam. „Seitdem sind wir befreundet. Sie ist sehr schlecht auf ihre Chefin zu sprechen. Genau genommen lässt sie kein gutes Stück an ihr. Sie würde ihr am liebsten einen Denkzettel verpassen, verstehst du?“
Frieder wiegte zweifelnd den kantigen Kopf. Sie sah ihm an, dass er dachte: Zwei Frauen, das kann nicht gut gehen.
„Es geht nur um einen Tipp“, fügte sie hastig hinzu. „Sonst alles wie gehabt.“
Frieder war noch nicht überzeugt. „Ohne mich …“, begann er.
Der Aufseher trat an ihren Tisch und unterbrach ihn: „Die Besuchszeit ist vorbei!“
Gisela erschrak. „Aber …“
„Sie haben die Zeit bereits überschritten.“
„Ohne dich …“, sagte sie.
Frieder schüttelte den Kopf. Der Wärter zog ihn fort.
Was hatte er damit gemeint? „Ohne mich“, das konnte alles Mögliche bedeuten, konnte eine Feststellung sein, eine Aufforderung, eine Mahnung, eine Absage.
Darüber grübelte sie noch nach, als sie durch das Gefängnistor ins Freie trat und über das nasse Kopfsteinpflaster Richtung Hochbahn lief. Sie merkte, dass sie schwitzte. Obwohl sie sich den Mantel gar nicht übergezogen hatte. Es war ungewöhnlich warm für Anfang Dezember. Ein leichter Regen setzte ein. Sie schaute auf. Kahle Äste. Feine Tropfen nieselten ihr ins Gesicht.
Nun wurde ihr doch kalt. Hastig schlüpfte sie in den Mantel.
Zweifel überkamen sie und hielten noch an, als sie schon in der Bahn Richtung Innenstadt saß. Hatte sie sich übernommen? War sie zu vertrauensselig? Aber nein, entschied sie, als sie an der Station St. Pauli die glitschige Treppe hinaufstieg. So etwas wie Vertrauen gibt es nicht, es gibt bloß Individuen, die geschäftsmäßig in Verbindung stehen. Nur Frieder ist da eine Ausnahme.
Sie schaute durch das Gitter zur Straße. Reifen zischten vorbei, Pfützen spritzten, Regen prasselte. Vor dem Ausgang ein dichtes Spalier wartender oder zögernder Menschenbeine, feuchte Rücken, nasse Schultern, darüber ein Dach aus aufgespannten Regenschirmen. Alles Grau in Grau. Ich will Farbe, ich will einen Regenbogen!
Ihr Knirps-Schirm, immerhin, der war rot.
Die Ampel schlug um auf Grün.
Sie schritt aus.
3
Draußen hupt es zum zweiten Mal. Diesmal länger, dringlicher.
„Ich komme ja schon.“
Gisela stand vor dem Spiegel der Garderobe im Hausflur und strich sich über das Wollkleid. Es gefiel ihr gut. Sie kaufte gern bei C&A. Schlichte Alltagskleidung stand ihr viel besser als mondäne Abendgarderobe. Das grau-beige-schwarze Karomuster sorgte für eine gewisse Lebendigkeit, aber die Farben waren zurückhaltend. So wie sie selbst auch. So ein Auftritt als Dame wie im Kasino war reine Maskerade. Doch, sie mochte lebhafte Farben, aber nicht an sich selbst. Sie hatte Frieder überredet, den Flur ihrer Wohnung mit einer orange- und gelbgemusterten Tapete auszustatten, das Wohnzimmer in grün mit vertikalen bunten Streifen, gerahmte Bilder mit impressionistischer Kunst aus Bildbänden, die sie im Antiquariat erstanden hatte. Bunte Kissen auf dem braunen Sofa. So liebte sie ihre Welt. Mit Wehmut, denn es war nur ein Provisorium auf Zeit. St. Pauli war nicht ihre Welt. Ich war eine Person im Übergangsstadium. Noch nicht in fester Form. Im Kasino, so ihr Eindruck, hatte sie sich ohne es zu wollen in eine andere Frau verwandelt. Das war wundersamerweise wie von selbst passiert.
Mitunter fand sie sich eigenartig.
Sie band sich die schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz und zupfte den Pony zurecht. Heute kein Makeup, sonst kommt Randy noch auf falsche Gedanken. Sie wählte den Trenchcoat, weil ihr der Wintermantel zu warm erschien. Noch immer war es, wie sie in den Nachrichten gemeldet hatten, „für die Jahreszeit zu mild“.
Wieder hupte es. Sie schlang das Halstuch um, setzte die Strickmütze auf und wählte die flachen Schuhe.
Zog die Wohnungstür zu, prüfte, ob sie wirklich geschlossen war, drehte den Schlüssel zweimal um und ließ das Schlüsseletui in ihrer Umhängetasche verschwinden. Kurz fiel ihr Blick auf das handgeschriebene Namensschild: „Friedholm/Lohmann“ stand dort in ordentlichen Druckbuchstaben. Eines Tages, so hoffte sie innig, würde der Name Friedholm für sie beide genügen. Vielleicht, wenn sie in Schweden angekommen waren und Egon „Frieder“ Friedholm sie vor den Altar einer niedlichen kleinen Dorfkirche irgendwo in der Nähe von Bullerbü führen würde.
Wieder hupte es energisch. He! Geht man so mit einer ausgewiesenen Gangsterbraut um? Gisela eilte die steile Treppe hinunter und trat mit leicht simulierter hektischer Aufregung auf die Gilbertstraße.
Die Fahrertür des grauen Ford Taunus ging auf und Randolf Hinrichs, genannt „Randy“ stieg aus, im schwarzen, einreihigen Mantel mit Pelzkragen. Sah teuer aus, war aber, wie sie wusste, gebraucht gekauft. Leider trug er keinen Hut wie sonst immer in der Öffentlichkeit, was Gisela aufrichtig bedauerte. Der Anblick seiner sehr schütteren schwarzen Haare, die er lang wachsen ließ, um damit kunstvoll, aber vergeblich, die kahlen Stellen zu bedecken, war ihr peinlich. Im Nacken war zu viel davon vorhanden und kräuselte sich über dem Hemdkragen.
Randy, leicht gedrungen und immer mit einem Bartschatten auf den Wangen, bemühte sich, galant zu sein und eilte um den Wagen herum, um ihr die Beifahrertür zu öffnen.
Gisela dankte mit der knappen Andeutung eines Lächelns und stieg ein, wobei sie darauf achtete, dass der Saum des Kleids bis über die Knie reichte. Sie wusste, dass Randy ein Faible für ihre Knie hatte, und wollte ihn keinesfalls in irgendeiner Hinsicht ermutigen. Dafür, dass er der beste Freund ihres Verlobten war, nahm er sich gelegentlich zu viel heraus.
Randy ging um den Taunus herum und polierte kurz mit dem Ärmel eine Stelle auf der Motorhaube.
„Wir sind spät dran“, sagte Randy, als er sich hinters Steuer klemmte.
„Tut mir leid.“
„Schon gut.“ Er warf ihr einen knappen Blick zu. „Du siehst gut aus.“
„Danke.“
„Ich hab den Wagen aufmotzen lassen. Er läuft jetzt wie ‘ne Eins. PS-Zahl praktisch verdoppelt.“ Er ließ kurz den Motor aufheulen. Es klang tief und guttural.
„Prima.“
Sie bogen auf die Ost-West-Straße. „Schneider erwartet uns um siebzehn Uhr, und der Verkehr ist dicht.“
Gisela schaute auf ihre Armbanduhr. Echtes Gold. Ein Geschenk von Frieder. Sie trug sie gern, war aber darauf bedacht, sie unter dem Ärmel zu verstecken. Leider vergaß sie immer wieder, das hübsche Ding aufzuziehen.
„Hach“, ärgerte sie sich. „Stehengeblieben.“
„Da!“ Randy deutete mit dem dicken kurzen Zeigefinger auf die Uhr neben dem Tachometer.
„Wir haben noch eine Stunde Zeit.“
„Bis Bergedorf und dann weiter“, sagte er bedeutungsschwanger.
„Das schaffen wir schon.“
Als hätte er diese nichtige Bemerkung als Aufforderung verstanden, gab er Gas und wechselte auf die Überholspur. Die Gegend, durch die sie jetzt fuhren, sah aus, wie sie sich Amerika vorstellte. Betonschluchten. Gewerbe, Büros, Tankstellen, Garagen.
Die Unterhaltung erstarb. Randy konzentrierte sich auf den Verkehr. Es regnete schon wieder. Das monotone Hin und Her der Scheibenwischer machte sie müde. Randy fluchte gelegentlich. Irgendwann sagte er unvermittelt: „Entschuldige.“ Und sein Blick glitt über ihre Knie. Das blöde Kleid schien heute kürzer zu sein als sonst. Sie zupfte daran herum.
Bergedorf, Reinbek, Wentorf. Fast waren sie am Ziel, da fragte Randy unvermittelt: „Wie geht’s Frieder?“
„Danke gut.“
Er brummte etwas Unverständliches und lenkte den Taunus in die Einfahrt vor einer Villa am Rand des Orts, die aussah wie ein Modell aus dem Faller-Baukasten. Jenseits des tristen Gartens breiteten sich Wiesen aus. Hinter dem Panoramafenster des Wohnzimmers im Hochparterre war die Silhouette von Schneider zu sehen. Er wartete schon ungeduldig. Dabei waren sie gerade mal zwölfeinhalb Minuten zu spät.
Randy ließ zweimal den Motor aufheulen, als wollte er sich auf diese Weise für das Zuspätkommen entschuldigen. Dann stieg er aus und fand noch Zeit behutsam mit dem Ärmel über eine Stelle an der Tür zu wischen. Besser er poliert sein Auto als mein Knie, dachte sie. Diesmal verzichtete er darauf, ihr die Tür zu öffnen, sondern eilte gleich zur Eingangstreppe.
Gisela sah nicht ein, warum sie sich hetzen sollte. Sie stieg gemächlich aus und ließ ihren Blick über die ländliche Szenerie gleiten. Grüne Weiden mitten im Dezember. Sehr hübsch. Aber der Modellbauer hatte vergessen Kühe oder Pferde darauf zu setzen. Wer sollte jetzt das saftige Gras mampfen?
Sie spürte den Regen im Nacken und folgte Randy ins Haus.
Als sie in den Vorraum trat, hatte Randy offenbar schon einen Tadel erhalten. Er blickte betreten drein und beeilte sich, den Mantel an die Garderobe zu hängen. Schneider begrüßte sie freundlich und half ihr aus dem Trench. Sie folgten ihm ins Wohnzimmer. Gelsenkirchener Barock. Eine Schrankwand mit dekorativen dicken Büchern. Auf dem Couchtisch warteten englischer Tee und dänisches Gebäck, beides aus dem Albrecht-Discount-Laden, wie Gisela erkannte. Das Teeservice musste wohl noch von Oma Schneider stammen. Alles recht gemütlich, fand Gisela, trotz Randy und dem Gastgeber.
Karl N. Schneider – so stand der Name an der Klingel, aber niemand wusste, wofür das N stand – war ein schlaksiger Mittfünfziger mit leichtem Bauchansatz, der immer graue Anzüge trug, die etwas zu groß wirkten. Schmales, braun gebranntes Gesicht, Habichtnase, eng stehende Augen, die fast weißen welligen Haare zurückgekämmt. Eine Rolex Oyster am linken Handgelenk, ein Goldkettchen am rechten. Keine Krawatte. Drei offene Hemdknöpfe gaben den Blick auf eine gebräunte haarlose Brust frei. Die Bräune kam angeblich vom vielen Segeln auf der Ostsee.
Sie nippten am Tee, sprachen übers Wetter - „Ich erwarte einen Kälteeinbruch mit Eisregen“, erklärte Schneider. Randy, dem nicht viel einfiel, sagte irgendwann. „Wir sollten mal wieder zum Bowling gehen.“ Schneider schaute ihn irritiert an: „In dieser Phase der Planung? Ausgeschlossen.“
„Eisregen wäre nicht so günstig für unsere Unternehmung“, sagte Gisela, um das Gespräch auf das eigentliche Thema zu lenken.
Schneider wehrte ab: „Bis dahin ist ja noch viel Zeit.“
„Genau drei Wochen“, stellte Gisela fest, denn heute war Donnerstag, der siebte Dezember.
Schneider verschränkte die Hände und blickte sie erwartungsvoll an. „Also? Wie sieht es aus?“
„Frieder geht es gut“, sagte sie und fand sich bockig. Aber warum fragte auch niemand nach ihm?
„Fein“, sagte Schneider.
„Er vertraut uns und hofft das Beste.“ Meine Güte, wie klingst du albern, dachte sie.
„Sehr gut“, sagte Schneider.
Schweigen. Gisela nippte am Tee, Randy grapschte nach den Keksen. Jetzt zupf nicht ständig an deinem Kleidsaum, die Strumpfhose ist doch dick, da schimmert nichts durch. Sei du wenigstens locker, wenn’s die Herren schon nicht sind.
Schneider warf ihr einen auffordernden Blick zu: „Wie läuft es also?“ Ganz der Oberlehrer.
„Alles nach Plan. Ich habe Fortschritte gemacht. Wir sind jetzt befreundet, Simona und ich. Sie hegt einen gewaltigen Groll gegen ihre Chefin. Das kommt uns gut zupass.“
„Die Weiler-Gehling hat sich nach dem Tod ihres Mannes gut gehalten. Viele dachten, sie verkauft, andere, sie fusioniert mit der Konkurrenz, um sich Unterstützung zu holen. Stattdessen hat sie alle hinter sich gelassen. Wer in Hamburg auf sich hält und Schmuck kaufen will, geht zu Weiler-Gehling.“ Schneider hielt demonstrativ die Rolex hoch.
„Ich weiß“, sagte Gisela. „Simona hat mir alles haarklein auseinandergesetzt.“
„Simona“, sagte Schneider amüsiert.
„Fräulein Steinfest“, korrigierte Gisela. „Aber wir sind jetzt per du. Nach der Geschichte im Kasino – das war ja auch zu verrückt – hat sie sich mir anvertraut. Sie ist sympathisch, aber sie hat einen Hang zum Mondänen. Das mit der ‚geliehenen’ Perlenkette spricht Bände. Eigentlich ist sie eine normale junge Frau, aber es brodelt etwas in ihr. Wie bei einem Vulkan. Als wäre da eine Macht, die nach oben drängt. Ich weiß nicht, ob es bloß deshalb ist, weil sie sich von ihrer Chefin gegängelt und erniedrigt fühlt oder ob da noch mehr ist. Vielleicht fühlt sie sich benachteiligt wegen ihrer Abstammung. Aber darüber weiß ich noch nichts.“
„Bitte nicht klein-klein, das interessiert uns weniger“, sagte Schneider ungeduldig.
Randy schaute derweil aus dem Fenster. Der Regen schien ihn mehr zu interessieren als der Charakter der für ihre Unternehmung entscheidenden Verbündeten. Gisela merkte, wie sie immer unzufriedener wurde.
„Ich muss sie doch abklopfen auf ihre Zuverlässigkeit“, sagte sie.
„Sicher. Vor allem aber in Bezug auf das, was sie uns bieten kann.“
„Soweit bin ich noch nicht. Aber immerhin hatte ich sie schon so weit, dass sie sagte: ‚Wenn ich abends diesen ganzen Glitzerkram in den Tresor packe, dann möchte ich am liebsten alles zusammenraffen und das Weite suchen.’ Sie träumt davon, in Juwelen und Schmuck zu baden, in der Badewanne. Das hat sie mir anvertraut. Sie ist wirklich … exaltiert.“
„Ich bin froh, dass du es nicht bist, Gisela“, sagte Schneider augenzwinkernd. „Aber ernsthaft: Sie soll uns doch bloß Zugang verschaffen. Meinst du, es ist nötig einen Romeo auf sie ansetzen?“
„Wen denn? Wer schafft so was denn in drei Wochen?“ Gisela schüttelte energisch den Kopf. Tatsächlich war sie verärgert. Traute er ihr denn gar nichts zu? So ein Blödmann! „Mach dir mal keine Sorgen. Ich krieg das schon hin. Morgen treffe ich sie. Und dann verspreche ich ihr ein Bad in Juwelen und Gold.“
„Frauen sind so berechenbar“, sagte Schneider an Randy gewandt, aber der schaute immer noch nach draußen. Jetzt nicht mehr verschlafen, sondern hellwach, denn es näherten sich Motorgeräusche. Er stand auf und trat ans Fenster. Lautes Dröhnen. Etwas fuhr in die Einfahrt.
„Eine Honda, 750er. Wer ist das denn?“
Schneider schaute auf seine Rolex. Du bist auch berechenbar mit deinem Glitzerkram, dachte Gisela.
Schneider nickte zufrieden: „Das ist Kid. Pünktlich auf die Minute.“
„Kid?“, fragte Gisela.
„Jemand in Lederkluft mit schwarzem Helm“, sagte Randy.
„Mein Chauffeur“, erklärte Schneider.
Als der „Jemand“ ins Wohnzimmer trat – er hatte offenbar einen Schlüssel zur Villa Schneider – war Gisela einigermaßen verblüfft.
„Darf ich vorstellen“, sagte Schneider. „Kyr-“ Die Person unterbrach ihn mit hoher Altstimme: „Kid K.“ Und hielt Gisela die Hand hin, sie schüttelte sie. Sanfter Druck. „Angenehm.“ Dann trat der Jemand zu Schneider und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Die Person schenkte Randy nur ein Kopfnicken. Er? Oder sie?