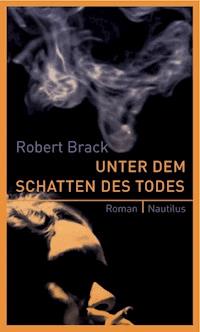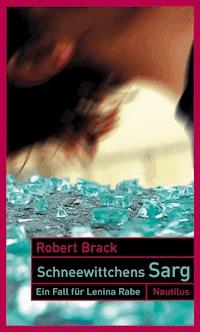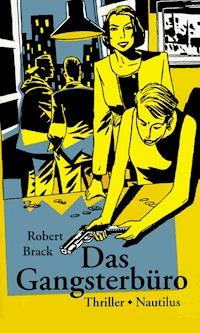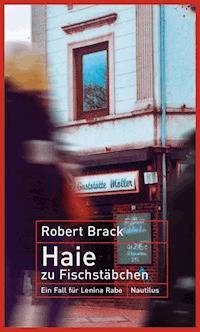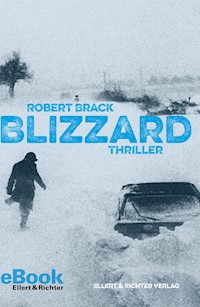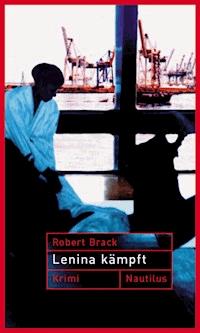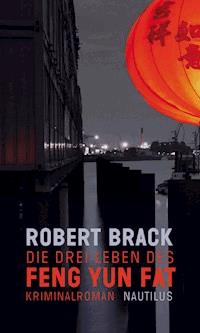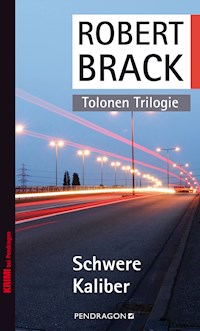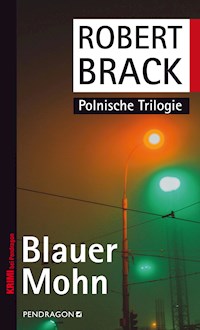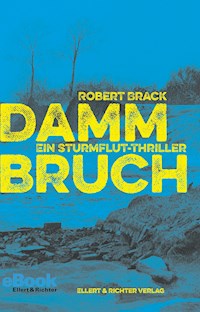
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ellert & Richter
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Einbrecher Lucius Lou Rinke, frisch aus der Haft entlassen, plant seinen letzten großen Coup. Nur leider hat er seine Rechnung ohne das Sturmtief Vincinette gemacht, das am 17. Februar 1962 mit zerstörerischer Gewalt über die Hansestadt hereinbricht. Auch ahnt er nicht, dass er ausgerechnet in dieser Nacht einer Frau begegnen wird, die ihre ganz eigene Auffassung von der Durchsetzung von Gerechtigkeit hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ROBERT BRACK
DAMM
EIN STURMFLUT-THRILLER
BRUCH
Gebt mir nur einen Teufel auf einmal,so fecht ich ihre Legionen durch!Shakespeare, Der Sturm
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Die Personen
Der Autor
1
Betty stand unter der knorrigen Weide am Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg und schaute über den Ernst-August-Kanal. Um sie herum rauschte es. Der Wind zerrte an Kleid und Mantel, wollte ihr das Tuch vom Kopf reißen. Und warum auch nicht? Sie zog es ab und ließ die kastanienbraunen Locken im kalten Wind flattern.
Aber das Rauschen kam nicht vom Wind, der durch die Bäume am Kanalufer fegte, die hängenden Zweige der Trauerweiden zum Flattern brachte und über die Wasseroberfläche peitschte, dass es spritzte. Das Rauschen hatte nichts mit dem Baum und seinen Ästen zu tun, denn der hatte keine Blätter, es war Winter, Mitte Februar. Nein, das Rauschen hing in der Luft. Überall. Seit Tagen schon. Es war allgegenwärtig und wollte nicht aufhören. Ihrem Gefühl nach lag es über der ganzen Stadt, über dem ganzen Land, über der ganzen Welt. Vom Wind gemacht, der unsichtbare Saiten in der Luft zum Klingen brachte und eine tosende Musik erzeugte. Eine Sturmsinfonie. Nicht gerade harmonisch, aber bombastisch. Ein vielstimmiges dröhnendes Brausen.
Das Großartige daran war: Man konnte diese Musik nicht nur hören, sondern sogar spüren. Es war ein handfester Missklang, der sie packte und schüttelte, der an ihr riss und zerrte, der sich ihr entgegenschleuderte und versuchte, sie umzuwerfen, hochzuheben, fortzuwehen. „Wo der Wind mich hingetragen“, dachte Betty, „ja, das weiß kein Mensch zu sagen.“
Sie drehte sich um, wandte sich ab von den kleinen Hütten, die hinter ihr geduckt in einer Kuhle lagen, schaute über den Kanal in die Ferne, in jene Richtung, in die der Wind sie zu drängen versuchte. Aber nach Osten? Wieder nach Osten? Niemals!
„Du kannst mich in den Kanal werfen, du brüllendes Ungeheuer“, dachte Betty, „aber du wirst mich niemals wieder in den Osten schaffen, nicht dorthin. Nicht auf diese blutgetränkte Erde. Ich habe der Erde dort zu viel Blut gespendet!“
Und jetzt schrie sie es: „Niemals! Niemals, ihr verfluchten Dreckschweine, ihr Hundesöhne, ihr Mistkerle! Niemals werdet ihr mich wieder treten, mich in den Schmutz werfen und mich quälen. Nein! Nein! Nein!“
Der Sturm schluckte ihre Schreie, als hätte ihr Mund lautlose Worte geformt. Wie oft hatte sie diese Beschimpfungen heimlich geflüstert, nachts unter der Bettdecke? Aber heute ganz laut! Ach, wie tut es gut, alles herausschreien zu können, es wegzuschreien. Der Welt die eigene Wut entgegenzuschleudern, ohne dass es falsche Ohren hören. Die richtigen Ohren, das sind die Ohren der Natur. Die falschen, das sind die Ohren der Menschen. Mit der Natur kann man nicht einfach kurzen Prozess machen, mit den Menschen schon. Ja, so ist das. Trau dich, Betty! Die Zeit des Großreinemachens ist gekommen, des rücksichtslosen Aufräumens. Sei ein Sturm, Betty, fahre hinein in das Dasein dieser Elenden und fege sie hinweg mit harter Hand. Zack!
Sie lachte. Schüttelte sich. Mehr noch als der Sturm wurde sie von der in ihrer Brust aufwallenden Freude geschüttelt. Sie krümmte sich vor Lachen, richtete sich wieder auf und breitete die Arme aus, um sich dem Wind zu ergeben. Und wirkte mit ihren flatternden Haaren und dem weit geöffneten Mund wie eine rachsüchtige Medusa.
Klatsch, traf sie ein Peitschenhieb am Hinterkopf. Das hast du nun davon, du dummes Mädchen! Die Weide trauert nicht, sie schlägt zurück. Der Wind beansprucht die Vorherrschaft. Du bist kein Sturm, kein Orkan, du bist nur ein kleiner Mensch.
Ach was! Besser du wirst vom Wind gepeitscht als von einem Folterknecht.
Betty drehte sich um und stapfte in ihren Gummistiefeln durch den Morast der Gartenkolonie zurück zu ihrer Bude.
2
Der Junge stemmte sich gegen den Wind. Lag schräg darauf wie auf einem Luftkissen, das verhinderte, dass er auf die Schnauze fiel. Alberner Kerl, dachte Rinke, während eine vorbeifahrende Straßenbahn ihm die Sicht nahm. Dann war der Bursche wieder zu sehen. Gleiche Haltung, immer noch schräg und mit ausdrucksloser Miene.
Auch wenn er nicht so grotesk schief gelegen hätte, sah er in Rinkes Augen lächerlich aus. Und er war zu jung. Trug Blue Jeans und eine Lederjacke, Tolle mit Entenschwanz, Rollkragenpullover und – immerhin – Wildlederschuhe mit Kreppsohlen. Ein Leisetreter im Stil der Halbstarken, die Rock’n’Roll hörten, der seit einiger Zeit auch auf dem Kiez Furore machte. Die Stern-Lichtspiele in der Großen Freiheit wurden gerade zu einem Musikklub umgebaut. Damit noch mehr Lärm produziert werden konnte. Wirklich gute Musik wurde systematisch abgeschafft. Ein Trauerspiel, wie Rinke fand, aber er war in dieser Hinsicht auch sehr altmodisch.
Dabei war Rinke erst siebenundzwanzig Jahre alt. Er trug einen schwarzen Trenchcoat, eine Schiebermütze und ebenfalls Wildlederschuhe mit Kreppsohlen. Auch er war ein Leisetreter, aus gutem Grund. Dass er altmodisch war, lag vielleicht daran, dass er einen nicht unerheblichen Teil seines noch jungen Lebens hinter Gittern verbracht hatte, wodurch seine Verbindung zum Alltag immer wieder unterbrochen worden war.
Eine Windböe attackierte seine Mütze. Rinke zog sie noch tiefer ins Gesicht, stellte den Mantelkragen hoch und überquerte die Reeperbahn. Ein VW Käfer hupte ihn frech an, ein vorbeifahrender Opel Kapitän spritzte Wasser gegen seine Hosenbeine. Die Straßenbahn klingelte.
Rinke ließ sich nicht beirren, ging schnurstracks auf den Jungen zu, der an der Ecke zur Talstraße im Wind herumalberte. Wenn der mir jetzt komisch kommt, kriegt er einen Tritt in den Arsch und tschüs, nahm er sich vor.
Der Junge sah ihn kommen und erkannte sofort, dass dies seine Verabredung war. Er stellte sich gerade hin, stramm und ordentlich, als wollte er bei der Bundeswehr anheuern. Ich weiß ja nicht, dachte Rinke, der ist doch noch feucht hinter den Ohren. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Wenn dein Kumpel plötzlich und unerwartet aus dem Verkehr gezogen wird, brauchst du einen Ersatzmann. Und wenn die Zeit drängt, nimmst du fast jeden. Na, schauen wir ihn uns mal an.
Er blieb vor ihm stehen und tippte sich an die Mütze.
„Tach.“
„Tach auch“, nickte der Junge und fuhr sich mit beiden Händen über die Frisur, als fürchtete er, sie könnte in Unordnung geraten sein. Dabei war sie mit einem halben Pfund Pomade beschwert. Fehlte nur noch, dass er einen Kamm aus der Gesäßtasche zog, um sich zu frisieren.
„Und sonst?“
„Würd gern ‘ne Zigarette rauchen, dick und rund.“
Rinke nickte, zog eine Packung „Juno“ aus der Manteltasche und bot dem Jungen eine an. Der griff zu. Rinke gab ihm Feuer, was gar nicht so einfach war bei dem Wind. Sie mussten dazu ganz dicht an das Eckhaus treten.
„Wir sind also verabredet“, stellte Rinke fest.
Der Junge grinste. „Stimmt.“
Rinke nahm sich die Zeit, seine eigene Zigarette anzuzünden, und nickte knapp.
„Na, dann gehen wir mal los.“
Rinke schritt aus. Der Junge kam gerade so mit und fragte schräg von der Seite: „Äh, stellen wir uns nicht vor? Du heißt Lucius, oder?
„Sag einfach Lou, das genügt. Lou wie das Raubtier.“
Der Junge sah ihn leicht irritiert an. „Löwe?“
„Wolf!“
„Ah … ähm, mein Name ist Peter Kummerfelt. Mit t hinten.“
Rinke blieb stehen und schaute ihn mit gespielter Empörung an: „Im Ernst? Das ist ja wirklich erstaunlich!“
Der Junge ballte die Fäuste.
Rinke gab ihm grinsend einen Klaps auf die Schulter und sagte: „Ich nenne dich Piet, das ist kürzer.“
„Meinetwegen.“
Sie gingen weiter. Der Wind fauchte um die Hosenbeine der Passanten, als wollte er sie fesseln und zu Fall bringen.
Eine Matrone in der Uniform der Heilsarmee brachte ihre Tuba vor dem Sturm in Sicherheit. Ihr älterer Kollege wurde mit seiner Basstrommel in den Hauseingang neben dem Backsteingebäude gedrückt, direkt gegen das verführerische Lächeln einer halbnackten Frau in Strapsen auf der Reklametafel des Tag- und Nachtklubs „Rote Katze“. Der Musikant ging in die Knie.
Rinke blieb stehen und half ihm wieder hoch, schob ihn aus dem Eingang in Richtung des „Jesus lebt“-Schriftzugs. Dann musterte er interessiert die üppige, barbusige Schönheit auf dem Plakat. Sein Blick fiel in das mit rotem Samt ausgeschlagene Schaufenster, in dem neben einer Sektflasche, einer schwarzen Maske und langen Handschuhen ein fein säuberlich drapiertes Negligé lag. Dazu eine kleine Statuette aus Plastik: die Venus von Milo mit ausgestreckten Armen! „Frohsinn und Glück rund um die Uhr“ stand in goldenen Buchstaben gestickt auf einem Band aus rotem Samt. Auf einem hässlichen, vergilbten Schild am Rand der Hinweis: „Kein Zutritt unter 21!“
„Wie alt bist du denn?“, fragte Rinke.
„Wieso?“
„Wie alt!“
„Na ja, einundzwanzig.“
„Dass ich nicht lache.“
„Achtzehn.“
„Pah!“
„Doch! Fast achtzehn.“
Rinke schüttelte den Kopf. „Egal, wir gehen trotzdem rein.“
Der Junge schaute beinahe bestürzt auf das Plakat mit der Nackten und stolperte hinter Rinke in die Rotlichtbar. Ein kalter Windstoß fuhr ihm über den Nacken, als wollte er ihn zurückhalten. Sie duckten sich durch einen schweren filzigen Vorhang.
Drinnen konnte man zunächst kaum etwas erkennen.
Die Augen mussten sich erst an den roten Samt, die roten Lämpchen, den schwarzen Tresen und Tische gewöhnen. Die nackte Haut der Damen auf den Sofas hob sich grell von der Umgebung ab. Kaltes Fleisch notdürftig in enges Korsett oder knappes Kleid geschnürt. Piets Blick blieb an bläulichen Adern auf prallen Oberschenkeln und wulstigen Brüsten hängen.
Rinke trat an den Tresen. Die Frau dahinter sah aus wie ein in die Jahre gekommenes Saloon-Girl aus einem Western mit grotesk rotgefärbten Haaren. Sie trug ein grünes Kleid, unter dem nicht viel von ihr zu erkennen war bis auf das Dekolleté, das dem Grand Canyon Konkurrenz machen konnte. Sie beugte sich nach unten und brachte eine Flasche Faber-Sekt zum Vorschein: „Champagner für die Herren?“ Gefälschtes Lächeln, bröckelnder Lippenstift, die hochtoupierten blonden Haare schwankten hin und her.
„Nein, danke“, sagte Rinke.
Sie stutzte, als sie den Jungen genauer musterte. „Eine Dame zur Gesellschaft?“
„Nein“, sagte Rinke.
Sie kniff die Augen zusammen. „Schüler haben keinen Zutritt.“ Sie machte eine Handbewegung, als wollte sie Piet nach draußen scheuchen.
„Wir sind verabredet“, sagte Rinke stoisch.
„Verabredungen finden hier erst ab einundzwanzig statt.“
„Mit Ullmann.“
„Kenn ich nicht. Hier sind nur Frauen, wie man sieht.“
„Onkel Otto ausm Bambi.“
„Na schön“, lenkte die Bardame ein. „Ich schau mal nach, was sich machen lässt.“ Sie hob eine Klappe und kam hinter dem Tresen hervor. Unter ihrem wallenden Kleid trug sie Holzsandalen. Sie öffnete eine Tapetentür mit kleinem, schwarzem Knauf und verschwand.
Rinke ließ seinen Blick durch die Bar schweifen und nickte den beiden Frauen auf dem Sofa zu. „Ihr habt ja gar keine Musik hier“, stellte er fest.
Die Blonde in Korsett und Strapsen sagte: „Kostet Geld“, und deutete auf eine Musikbox weiter hinten in dem schlauchartigen Raum.
„Und ihr habt keins?“, fragte Rinke betont ungläubig. „Bei den Preisen hier?“
„Sackt alles die Chefin ein“, sagte die Schwarzhaarige in dem knappen grünen Kleid und streckte ein schlankes Bein aus. Netzstrümpfe endeten in glänzenden Pumps, die so eng waren, dass Aschenputtel sie in allen Lebenslagen garantiert nicht verlor.
Rinke ging an den beiden vorbei und beugte sich über die Wurlitzer. Suchte die Songtitel ab, fand einen, den er kannte, zog sein Portemonnaie aus der Innentasche des Mantels und warf zwei Groschen in den Schlitz. Dann drückte er L14. Die Mechanik setzte sich in Bewegung. Rinke ging zurück zum Tresen.
Eine Bläserfanfare ertönte. Piet zuckte zusammen. Die beiden Frauen runzelten die Stirn. Eine Streicherkaskade ergoss sich wie eine Flutwelle aus den Lautsprechern, dann eine helle klare Stimme, eine spanische Melodie: „Malagueña“. Gesungen von Caterina Valente. Rinke atmete tief durch.
Piet warf ihm einen ungläubigen Blick zu.
Rinke holte die Zigaretten hervor und bot dem Jungen eine an. Bläser, Streicher und Gesang überschlugen sich vor Begeisterung und das Stück mündete in einen Flamenco-Rhythmus. Rinke deutete Tanzbewegungen an, wiegte Hüften und Schultern. Piet rauchte verbissen.
Die Tapetentür ging wieder auf, die Bardame steuerte auf sie zu, blieb dicht vor Rinke stehen und sagte: „Mir könntest du auch mal eine anbieten.“
Rinke hielt ihr die Packung hin und gab ihr Feuer. „Die Marke passt zu dir.“
„Na klar.“ Sie blies den Rauch über ihn hinweg. Sie war größer als er, obwohl sie nur Sandalen trug.
„Kommt mal mit. Aber fass bloß nichts an“, sagte sie zu Piet, dessen Blick immer wieder klammheimlich zu den Animiermädchen schweifte. „Sonst kriegen wir noch Ärger von wegen Sitte und Moral.“ Die Mädchen kicherten.
Hinter der Tapetentür führte eine schmale steile Treppe nach oben. Die Bardame ging mit klappernden Sandalen voran, das Kleid leicht geschürzt. Die trällernde Stimme von Caterina Valente folgte ihnen.
Oben ein Flur mit gelb-grün gestreifter Tapete und eine Reihe Türen mit Nummern, die allerdings keine Reihenfolge ergaben. Sie trat vor eine, die halb geöffnet war, und deutete mit dem Daumen hinein: „Bitte.“
„Herzlichen Dank für Ihre Mühe“, sagte Rinke, was sie wohl als Frechheit interpretierte, denn sie verzog abweisend das Gesicht. Rinke grinste und trat ein. Der Junge folgte, schloss die Tür und baute sich dahinter auf, breitbeinig, Arme verschränkt.
„Guten Tag, Otto.“
„Entschuldigung.“ Ein kleiner Mann in braunem Anzug mit gepunkteter Krawatte, weiß-braunen Budapestern und einem dünnen, schwarzen Oberlippenbart unter einer prominenten Hakennase stand von einem Doppelbett auf, das den größten Teil des Raumes einnahm. Darauf lag eine üppige Brünette in Lederkostüm mit vielen Schnüren und begutachtete sich im Spiegel hinter dem Bett.
„Du kannst gehen, Eva“, sagte der kleine Mann.
Sie verschwand nach draußen, auf hohen, dünnen Absätzen balancierend. Ihr linkes Auge umrahmte ein tiefdunkles Veilchen.
„Entschuldigung, wir hatten eine Besprechung.“
Rinke deutete auf sein Auge und sagte: „Hatte sie das schon vor der Besprechung?“
„Hör mal, für wen hältst du mich? Ich bin doch kein Unmensch. Im Gegenteil, ich musste sie trösten. Das gehört zum Geschäft.“ Ob er das Veilchen meinte oder das Trösten, blieb offen.
Die beiden Männer gaben sich die Hand.
Ullmanns Blick fiel auf Piet, der dastand wie Pik Sieben. „Wer ist das denn?“
„Mein Lehrling.“
„Wie heißt du?“, blaffte Ullmann.
„Peter Kummerfelt“, stieß der Junge hervor wie beim Appell.
Ullmann schaute Rinke an. „Der muss ja noch viel lernen.“
„Er heißt Piet“, sagte Rinke. „Mit einem t hinten.“
„Wie lange kennt ihr euch?“
„Seit eben.“
„Und den willst du mitnehmen?“
„Er ist mir empfohlen worden.“
„Von wem?“
„Erwin aus dem Hippodrom.“
„Der hat ein Herz für Trebegänger.“
„Und ein Auge für junge Talente.“
Beide lachten. Piet schaute sie irritiert an. Er hatte das Gefühl, dass dieser Witz, den er nicht verstand, auf seine Kosten ging.
„Ich arbeite da!“, stieß er zornig hervor.
„So?“ Ullmann hob eine Augenbraue.
„Er fegt das Sägemehl zusammen“, erklärte Rinke.
Ullmann grinste. „Da hat er ja zu tun. Und ein paar Äppel springen auch noch dabei raus.“
Piet warf ihm einen finsteren Blick zu.
„Na schön“, sagte Ullmann. „Dann gehen wir mal in den Keller und schauen uns die Folterwerkzeuge an.“ Er zog die Schublade des Nachtschränkchens auf und nahm einen Eisenring heraus, an dem mindestens zwanzig Schlüssel hingen.
3
Sie stiegen die Treppe ins Erdgeschoss hinab, liefen einen kurzen Gang entlang und gelangten zu einer Tür, die ziemlich morsch aussah, leicht schief hing und vier Schlösser hatte. Ullmann wählte nacheinander vier Schlüssel aus und schloss auf. Die Tür schwenkte langsam auf, sie war sehr schwer wegen der Stahlplatten auf der Innenseite. Sie folgten Ullmann in den Keller, wo er einen Verschlag öffnete, in dem ein paar Kohlen, Briketts und Reste von Feuerholz lagen. Eine weitere Tür mit weiteren zwei Schlössern, dann standen sie in einem Raum, der wie das Büro eines Buchhalters aussah. Mit Schreibtisch, Aktenregal und Rollschrank. Ungewöhnlich waren nur das Gemälde von einem röhrenden Hirsch im Wald, auf dem eine nackte Diana saß, und das „Micky Maus“-Heft auf dem Tisch. Das Titelbild zeigte Donald, wie er mit einem Regenschirm von einer Skischanze springt. In einer Ecke stand ein kleiner Tresor, dessen Schloss herausgebrannt worden war. Daneben lehnten ein Schneidbrenner an der schimmeligen Wand sowie zwei Gasflaschen, die eine rot, die andere blau. Außerdem lagen da noch ein Paar Handschuhe und eine Schutzbrille.
„Bitte schön“, Ullmann deutete auf die Geräte. „Zinser, made in Germany. Mit dem haben schon die Gebrüder Sass gearbeitet! Brennt gut und schneidet gut, wie du siehst. Wir haben das Ding spaßeshalber mal ausprobiert. Wir dachten schon, du kommst gar nicht mehr.“
„Hat sich was verzögert.“ Rinke ließ offen was. Ullmann schien das zu akzeptieren.
Rinke griff nach dem Schneidbrenner und inspizierte ihn gründlich. Am Griff war eine kleine Plakette angebracht: schwarzer Adler auf gelbem Untergrund, umrundet von dem Schriftzug „Deutsche Reichsbahn“.
„Ist der aus der Zone?“
„Quatsch. Das ist noch bewährtes Handwerkszeug aus der guten alten Zeit. Damit haben die Nazis Eisenbahnschienen im Osten zusammengeschweißt.“
„Na, vielen Dank auch. Und meine Vorfahren und ihre Genossen ins KZ transportiert.“ Rinke verzog das Gesicht.
„Tu nicht so empfindlich“, sagte Ullmann. „Du revanchierst dich ja jetzt.“
„Ich muss das Ding erst mal ausprobieren.“
„Bitte, tu dir keinen Zwang an.“ Ullmann trat hinter den Schreibtisch, setzte sich in einen quietschenden Drehstuhl, griff nach dem Comicheft und schlug es auf.
Rinke drehte Acetylen und Sauerstoff an und zündete die Flamme. Probierte kurz am Tresor herum, nickte vor sich hin und schien zufrieden. Er schaltete das Gerät aus.
„Wenn ich mich recht erinnere, hat mein Vater auch eine Weile mit so einem Gerät gearbeitet.“
„Also bitte, Familientradition“, sagte Ullmann, ohne aufzuschauen. „Was willst du mehr.“
Piet stand wieder herum wie Pik Sieben.
Ullmann lachte über eine lustige Comicszene mit dem Großen Bösen Wolf. Betont desinteressiert fragte er: „Seit wann bist du raus?“
„Knapper Monat“, sagte Rinke, während er das Gas abdrehte und die Schläuche abschraubte.
„Und schon geht’s wieder los“, sagte Ullmann. „Tja, der Mensch muss arbeiten.“
„Ich hab Pläne.“
„So?“
„Ja.“
„Und zwar?“
„Diese Sache und dann dampfe ich ab nach Spanien. In Marbella scheint die Sonne sogar im Winter und auch nachts.“
„Hab davon gehört. Wirst ganz schön ins Schwitzen kommen.“
„Genau das ist meine Absicht“, sagte Rinke halb ironisch, halb ernsthaft.
Ullmann grinste. „Zum Schweißen braucht man Hitze.“ Er legte das Heftchen beiseite und schwang die Beine vom Tisch. „Die Leihgebühr krieg ich dann von Eier-Meier, nehme ich an. Kaution hat er ja schon gestellt. “
„Gut. Dem gebe ich auch das Werkzeug zurück.“ Das war nur so dahingesagt. Beide wussten, dass ein Schneidbrenner in der Regel am Tatort zurückblieb.
„Hast wohl immer noch einen Stein bei ihm im Brett.“
„Er war gut mit meinem Vater befreundet“, sagte Rinke schulterzuckend.
„Na schön, dann los.“ Ullmann griff unter den Schreibtisch und holte zwei Rucksäcke hervor. Den einen warf er dem verdutzten Piet ins Gesicht, den anderen fing Rinke mit lässiger Geste auf.
„Los einpacken“, kommandierte Rinke, und Piet setzte sich endlich in Bewegung.
Sie hoben die Gasflaschen in die Rucksäcke und Rinke schob das Doppelrohrgestänge mit der Düse dazu.
Ullmann schaute zu. Offenbar gefiel es ihm, anderen bei der Arbeit zuzusehen. „Fährst du auch nach Marbella?“, fragte er den Jungen.
„Nee.“
„Solltest du aber mal tun. Weiß du, was die Flamenco-Tänzerinnen dort machen, wenn sie fertig getanzt haben?“
„Nee.“
„Sie packen den Stier bei den Hörnern.“ Ullmann lachte. Niemand sonst fand das witzig.
Als die Rucksäcke zugeschnürt waren und Rinke ihn fragend ansah, sagte er: „Na dann, adieu.“
„Halt!“, sagte Rinke alarmiert. „Was ist mit den Papieren?“
Ullmann schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. „Ach Gott, wo hab ich nur meinen Kopf! Ja, klar, aber klar. Lasst das Zeug erst mal stehen und kommt mit, wir gehen nach nebenan.“
Sie folgten Ullmann nach oben, durch die Bar, hinaus in den peitschenden Regen. Drei Häuser weiter traten sie in das „Foto Atelier Schwan“, in dessen Schaufenster neben Hochzeitsfotos und Kinderporträts auch Bilder von Striptease-Künstlerinnen ausgestellt waren.
Zwischen Fotoapparaten, Blitzgeräten, Objektiven, Belichtungsmessern, Super-8-Kameras, Projektoren und Vergrößerungsgeräten sowie Regalen mit Roll- und Kleinbildfilmen, in Schwarzweiß und Farbe, akribisch geordnet nach Lichtempfindlichkeit, stand ein rundlicher Mann mit glattem Schädel, spitzer Nase und Nickelbrille. Weißes Hemd, gestreifte Hosenträger. Ullmann begrüßte ihn spöttisch-herzlich, nannte ihn „mein lieber Schwan“ und erklärte: „Das sind die Herren, von denen ich dir erzählt habe. Künstlerporträts für den Außendienst. Die Papierchen hast du bereit, wie besprochen?“
„Sicher“, sagte Schwan.
Er führte die beiden Einbrecher in sein Fotostudio und setzte erst Piet und dann Rinke auf einen Hocker vor einer weißen Leinwand. Bevor es blitzte, sagte er jedes Mal: „Lächeln nicht nötig.“
Die Bilder wurden mit einer Sofortbildkamera der Marke Polaroid aufgenommen, mithilfe eines Schwamms mit einer Klarlack-Schutzschicht überzogen und anschließend von dem Fotografen an einem Schneidetisch beschnitten und jeweils in eine bräunliche Arbeitskarte für Hafenarbeiter geklebt. Der Kreis des Stempels der „Hamburger Stauerei Gesellschaft“ wurde über das neue Foto hinweg vervollständigt. Rinke war Schweißer, Piet musste sich mit dem Rang eines Schweißer-Gehilfen zufriedengeben. Auf der Einteilungskarte für Zusatzkräfte waren Einsatzort und der Name des Frachters vermerkt: Veddel-Kanal/Brandenburger Ufer, „Tameio“.
Als sie wieder in den Verkaufsraum traten, wurde die Vordertür aufgestoßen und die beiden leichtbekleideten Damen aus der „Roten Katze“ stolperten herein. Sie hatten sich Regenmäntel übergeworfen und schleppten jede einen von den schweren Rucksäcken.
„Lasst euch bloß nicht mehr bei uns blicken, ihr Faulpelze“, zischte die Blonde.
Und die Schwarzhaarige stöhnte: „Ihr seid wirklich eine Zumutung!“
„Zieht doch Bambi das Fell über die Ohren“, brummte Rinke abweisend. Aber er zwinkerte der Dunkelhaarigen zu, die das sehr wohl bemerkte.
Die Frauen drehten sich auf ihren hohen Absätzen um und staksten hinaus in den Regen.
„Hasta luego!“, rief Rinke ihnen nach.
Kurz bevor die Tür zuschlug, wehte der Wind der Schwarzhaarigen beinahe den Mantel vom Leib und Piet konnte einen Blick auf ihren kurvigen Körper erhaschen. Im Tageslicht sah man, dass sie fast so jung war wie er. Diese kurze Szene spannte die Saite der Sehnsucht in seinem Herzen beinahe bis zum Zerreißen.
„Virginia Peng“, sagte Rinke grinsend. Piet zuckte zusammen.
„Musst du noch irgendwohin?“
„Was?“
Rinke deutete auf die Rucksäcke. „Wir müssen die abstellen.“
„Ich muss nirgendwohin.“ So wie er es sagte, klang es, als hätte er noch nie ein Ziel gehabt.
Rinke zog die Zigarettenpackung aus der Manteltasche und steckte sich eine in den Mund, hielt Piet die Packung hin.
„Rauchen verboten!“, rief Foto-Schwan. „Feuergefahr!“
Rinke hob den schweren Rucksack hoch und schnallte ihn sich vorsichtig auf den Rücken. Piet tat es ihm nach.
„Ist nicht weit“, sagte Rinke. „Gleich um die Ecke.“
Als sie an der „Roten Katze“ vorbeikamen, war drinnen schon deutlich mehr los. Musik schallte aus dem offenstehenden Eingang: „Tu mir nicht weh, my darling, lass mich nie allein.“
Der Filzvorhang war aufgezogen. Piet schaute hinein. Ein fetter Kerl legte seine Arme um die Rundungen der Sehnsucht.
„Tu mir nicht weh, my darling, ich bin so gern bei dir.“
Der Wind schleuderte ihm einen Schwall Regen ins Gesicht. Das Leben war seiner Ansicht nach eine abgeschmackte Sache.
4
Polizeiobermeister Mattei schaute aus dem Fenster der Polizeidienststelle an der Georg-Wilhelm-Straße in Wilhelmsburg, spürte den Luftzug, der durch die alten Fensterflügel hereinströmte und schüttelte unzufrieden den Kopf. Der Wind schleuderte Regentropfen gegen die wellige Fensterscheibe, dahinter lag die Welt leicht verzerrt in traurigem Zwielicht. Ein paar Bäume reckten ihre Äste gen Himmel und wirkten hilflos in diesem schauderhaften Sturm, der ihre morschen Äste hin und her schleuderte, manchmal sogar einen abbrach und fortwehte. Das Prasseln der Regentropfen ließ ihn frösteln. Eine Woche Spätdienst erwartete ihn. Keine angenehme Aussicht.
Das Gerücht ging um, sie würden bald eine neue Dienststelle bekommen. Wer’s glaubt, wird selig, dachte Mattei. Er spähte nach links, dorthin, wo neue Wohnhäuser hochgezogen wurden. Einige Rohbauten waren schon fertig. Aus Beton, nicht aus diesem morschen Backstein, den sie vor ewigen Zeiten beim Bau des Polizeigebäudes verwendet hatten. Eine feste Burg war diese Polizeiwache bestimmt nicht. Und sowieso viel zu klein. Die Beamten hockten in kleinen Zimmern eng beieinander, sogar die höheren Dienstgrade mussten sich ihre Schreibpulte teilen. Manchmal gab es Streit, wenn die Männer zum Dienstschluss rasch ihre Berichte fertigmachen wollten und nicht genug Platz hatten. „Gnade euch Gott, wenn meine Bratkartoffeln verbrannt sind, wenn ich nach Hause komme!“, war ein geflügeltes Wort unter den Beamten. Es war schon so oft ausgesprochen worden, dass keiner mehr lachte, wenn der Spruch mal wieder fiel.
Polizeiobermeister Adrian Mattei hatte den Satz noch nie von sich gegeben. Zum einen, weil da niemand war, der ihm zu Hause Bratkartoffeln machte, zum anderen, weil er Bratkartoffeln sowieso nicht mochte. Sie waren ihm zu fettig und er achtete auf seine Linie. Heutzutage reichte es nicht mehr, eine Uniform zu tragen, man musste schon gut aussehen, um den Mädchen zu gefallen. Bratkartoffeln und Bier waren da wenig hilfreich. Wenn ich nicht bald eine abkriege, überlegte er, fahre ich nach St. Pauli und schaue mich da um, in Zivil natürlich. Das war eine Drohung, die er ab und zu in Gedanken formulierte, sie aber nie wahr werden ließ aus Angst vor möglichen Konsequenzen.
POM Mattei war ein Mann, der grundsätzlich Angst vor Konsequenzen hatte. Der Sturm da draußen zum Beispiel könnte ihm eine schlimme Erkältung bescheren. Und dann müsste er in seiner Einzimmerbude im Bett liegen bleiben und den Pfefferminztee seiner Vermieterin trinken. Pfui Spinne! Dann lieber Spätdienst schieben. Und sich vorsorglich einen Schal umbinden, weil die Fenster so schrecklich undicht waren.
Die Tür ging auf und mit einem unangenehmen Lufthauch kam der Kollege Danner herein. Polizeimeister Danner, stets diensteifrig, aber seltsamerweise immer ein klein wenig zu spät. Was er auch jetzt auf seine typische Art überspielte, indem er so tat, als sei jemand anderes schuld: „Wo bleibst du denn?“, fragte er.
Sie duzten sich seit Kurzem. Seit der Abschiedsfeier für den alten Eberhardt, den früheren Revierleiter. Zu spät war Mattei aufgegangen, dass es ein Fehler war, sich mit einem Untergebenen zu duzen. Aber wie machte man so was rückgängig? Der blonde, sportliche Danner war ihm kurzzeitig sympathisch erschienen. Das hatte wahrscheinlich am Bier und am Schnaps gelegen und daran, dass dieser Danner, der zwei Jahre jünger war als er, seine hübsche Verlobte bei sich gehabt hatte. Mit der konnte man es aushalten, mit ihrem Verlobten nicht so.
„Hab auf dich gewartet“, sagte Mattei knapp. „Und guten Tag übrigens.“
„Moin Moin. Ich hab mir noch die Fahndungsmeldungen angeschaut.“
Immer eifrig, der Danner, beim Kaschieren eigener Versäumnisse.
„Hier, frisch eingetroffen.“ Danner wedelte mit einem Blatt herum. „Das solltest du dir anschauen, bevor wir die Runde drehen. Wir kriegen den Taunus.“ Danner hatte ein Faible für neue Autos. Und tatsächlich, das musste Mattei zugeben, war der neue Ford Taunus 17-Peterwagen ein toller Schlitten. Bei dem konnte man ordentlich Gas geben, wenn es drauf ankam. Nur das Funkgerät funktionierte nicht immer so, wie es sollte. Ursache dafür war angeblich, dass ihr Einsatzgebiet südlich der Elbe in einer Senke lag.
Mattei nahm das Blatt Papier und warf einen Blick darauf. Ein Phantombild. Na ja. Er hatte so seine eigene Meinung zu Phantombildern. Die waren mitunter recht kunstvoll gezeichnet, nützten aber niemandem etwas, weil sie ja ein Phantom zeigten und keine echte Person. Das Phantom war eine Vermutung, eine Annäherung an die Fantasie eines Zeugen, der diese Person irgendwann einmal zu sehen geglaubt hatte. Aber wie beschreibt man einen Menschen, wenn man das nie gelernt hat? Wie erklärt man einem Zeichner, dass die Schablonen, die er als Hilfestellung benutzt, gar nicht zutreffen können, weil kein Mensch eine Schablone ist? Früher hieß es, Verbrecher hätten eine bestimmte Physiognomie, weil das Kriminelle angeboren sei. Heute durfte ein Verbrecher aussehen wie du und ich. Manchmal sogar wie ein Engel. So wie in diesem Fall.
Mattei starrte das Porträt einer schönen jungen Frau an. Zweifellos hatte der Zeichner hier eine ungewöhnlich künstlerische Leidenschaft entwickelt: Dunkle Locken umrahmten ein ebenmäßiges Gesicht mit sinnlichen Lippen und dunklen leidenschaftlichen Augen unter dichten, wohlgeformten Brauen. Hohe Wangenknochen und eine gerade Nase verliehen dieser Verbrecherin ein wenig Noblesse. Sie hätte Schauspielerin sein können. Oder so eine aus St. Pauli, eine wie die Nitribitt vielleicht, aber mit vornehmen römischen Gesichtszügen. Meine Güte, warum musste das eine Verbrecherin sein?
„Was hat die …?“
„Mord.“
„Im Ernst?“
„Schönheit schützt vor Bosheit nicht“, sagte Danner. „Die hat eine Leidenschaft für Soldaten.“
„Tatsächlich?“
„Mordet sich quer durch die alte Wehrmacht. Vielleicht ist sie ja eine Spionin.“
Mattei war sprachlos. Seine Fantasie ging mit ihm durch. Mata Hari? Kurz glaubte er, die Lippen der schönen Frau würden sich bewegen, mit kokettem Schalk das Wort „Adrian“ formen. Es ihm ins Ohr hauchen. Er hatte durchaus manchmal erlebt, dass Frauen seinen Vornamen interessant fanden. Früher hatte er dann noch einen draufgelegt und erklärt, sein Nachname Mattei sei italienischen Ursprungs. Was ja stimmte. Seine Vorfahren waren vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, nach Deutschland gekommen. Damals, als ein Italiener noch was Besonderes gewesen war. Das war heute leider anders. Heute dachte jeder gleich an Gastarbeiter, nicht an Opernsänger oder Eisverkäufer. Einmal hatte eine ihn gefragt, ob er ein Messer bei sich trüge. Da hatte er empört erklärt, er sei Polizist. Woraufhin die Dame sich abgewendet hatte mit dem Wort: „Hochstapler!“
Kurzum, Polizeiobermeister Mattei hatte bislang vor allem Pech bei den Frauen gehabt. Weshalb das Porträt einer leidenschaftlichen Schönheit ihn zu allerlei Assoziationen anregte. Wer so schön ist, kann doch nie und nimmer böse sein, oder?
„Alles klar?“, fragte Danner. „Wir müssen.“
„Ja, ja. Ich will mir nur das Gesicht einprägen.“
„Falls wir ihr zufällig begegnen“, spottete Danner.
„Ja, genau. Damit wir sie identifizieren können.“
„Identifikation einer Frau“, sagte Danner mit anzüglichem Grinsen. „Das tue ich am liebsten.“
Mattei schaute zur Wanduhr: „Oh, wir müssen los!“ Es kotzte ihn an, wie Danner immer wieder mit seinen Frauengeschichten prahlte. „Du fährst“, fügte er hinzu.
Sie waren schon fast zur Tür raus, als Mattei bemerkte, dass er das Phantombild noch immer in der Hand hielt. Er brachte es dem Wachhabenden zurück.
Draußen ließ Danner den Motor des Ford Taunus aufheulen. Mattei taumelte kurz, als eine Windböe ihn erfasste. Später muss er mich ans Steuer lassen, nahm er sich vor, ich bin immerhin sein Chef.