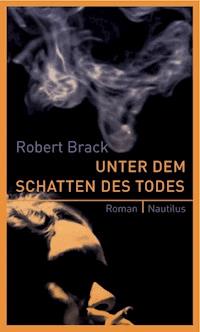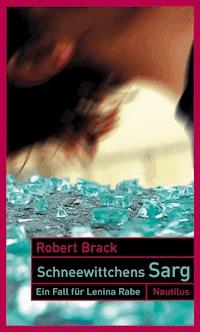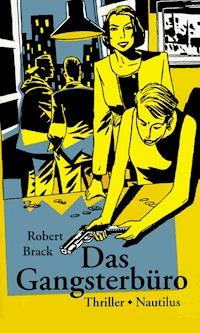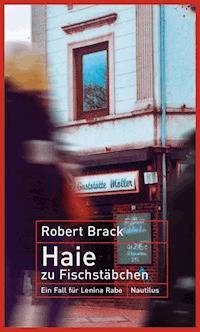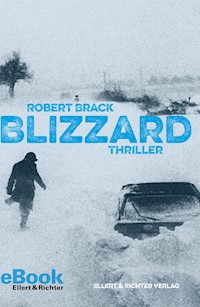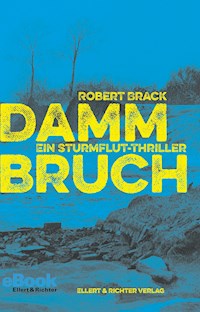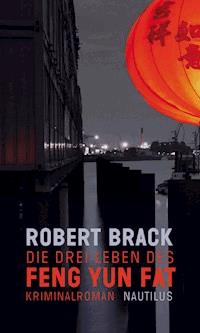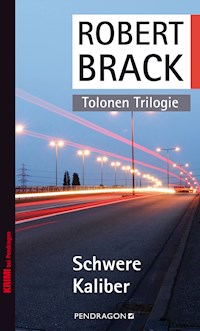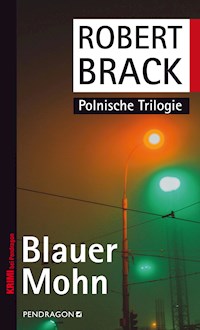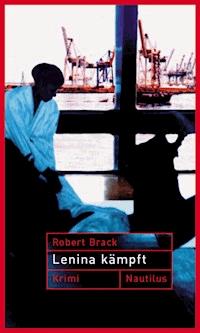
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Lenina Rabe
- Sprache: Deutsch
Lenina Rabe ist sich sicher. Es war Mord und kein Unfall. Was trieb ihren Vater nachts zum Athabaska-Kai? Und was suchte der Mann mit der Narbe, den sie bei einem Einbruch in das Detektivbüro überrascht? Lenina, eine junge Frau, die lieber Beethoven hört als sich mit ihren Freundinnen in den einschlägigen Clubs auf dem Kiez zu amüsieren, erhält immer verwirrendere Informationen. Ihr Vater, ein alter Revoluzzer und Straßenkämpfer, soll gute Kontakte zur D.P.O., der neugegründeten "Deutschen Partei für die Ordnung" gehabt haben. Und der Mann mit der Narbe macht offenkundig krumme Geschäfte mit Hektor, dem Besitzer des Szene-Ladens "Sold To The Highest Buddha Inc.", für den Lenina heimlich schwärmt. Bei ihrer Suche stolpert sie über Dokumente, für die sich nicht nur die selbsternannten Saubermänner der Stadt interessieren. Mit Hilfe ihrer in der Anti-Globalisierungsbewegung engagierten Freunde kommt sie einer Verschwörung auf die Spur, in der neben einem einflußreichen Fleischgroßhändler auch einige ihrer Bekannten aus der Club-Szene verwickelt sind. Von der Polizei gejagt gerät Lenina in eine Situation, aus der sie auch ihre Aikido-Künste nicht mehr befreien können. Mit Lenina Rabe hat der mehrfach ausgezeichnete Krimi-Autor Robert Brack, auch bekannt unter seinem erst kürzlich aufgedeckten Pseudonym Virginia Doyle, eine wunderbar widersprüchliche Krimi-Heldin geschaffen: etwas verschroben, etwas naiv, mit viel Temperament und Spontaneität ausgestattet, kühl, distanziert und dennoch sehr verletzlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Brack, Jahrgang 1959, lebt in Hamburg. Er wurde mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Zuletzt erschienen in der Edition Nautilus drei Romane über die politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik: Und #das Meer gab seine Toten wieder beschreibt einen Polizeiskandal aus dem Jahr 1931, Blutsonntag befasst sich mit den Ereignissen im Juli 1932 in Altona, Unter dem Schatten des Todes beschreibt die Hintergründe des Reichstagsbrands 1933 in Berlin. Mit Die drei Leben des Feng Yun-Fat kehrt der Autor in die Gegenwart zurück und knüpft an seine drei Lenina-Rabe-Kriminalromane Lenina kämpft, Haie zu Fischstäbchen und Schneewittchens Sarg an. Weitere Abenteuer von Rabe & Adler sollen folgen.
Editorische Notiz: Ähnlichkeiten der in diesem Roman auftretenden Figuren mit real existierenden Personen wären wie immer unvermeidlich rein zufällig und ganz und gar unbeabsichtigt. Denn im Leben geht es zu wie im Leben und nicht wie im Roman.
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten · © Lutz Schulenburg 2002Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.deAutorenfoto Seite 2: Charlotte Gutberlet
OriginalveröffentlichungErstausgabe Februar 2003
Print ISBN 978-3-89401-408-3E-Book ePub ISBN 978-3-86438-179-9
Inhalt
NULL
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NULL
In der Schublade seines Schreibtischs fand ich die Pistole. Stopp! Ich will mich ja präzise ausdrücken, habe ich mir vorgenommen: den Revolver.
Er sah genau so aus wie die Schusswaffen in amerikanischen Kriminalfilmen. Allerdings fand ich den Namen seltsam, der in das verchromte Metall an der Stelle zwischen Lauf und Trommel eingeprägt war: Arminius. Darunter zwei Buchstaben und eine Zahl: HW 5. Ich fummelte neugierig daran herum, betätigte den seitlichen Schiebeknopf und schwenkte die Trommel aus. Acht Patronen passten hinein.
Ich griff nach der Schachtel mit der Aufschrift »Kaliber .22 L.R.« und ließ sie wieder fallen. Ich spürte einen Kloß im Hals, legte das schwere Ding auf den Filzlappen in die Schublade zurück und deckte es zu.
Der Idiot! Eine sinnlosere Anschaffung als diesen Revolver konnte ich mir im Moment kaum vorstellen. Ich wischte mir die Tränen aus den Augenwinkeln und ließ meinen Blick über die riesige Wandkarte gleiten. Ich erinnerte mich noch genau, wie wir diese alte Schulkarte zusammen auf dem Flohmarkt gekauft hatten. Sie hatte nur zwanzig Mark gekostet, war ziemlich verknittert und roch muffig wie gammeliges Leder. Ich fand sie hässlich, aber er war begeistert und hängte sie sich ins Büro.
»Wenn du mal genau hinguckst, siehst du, dass Kanada viel größer ist als die Vereinigten Staaten.«
»Dazu muss ich nicht genau hingucken, das hab ich in der Schule gelernt.«
»Und hier ist übrigens der Athabasca-River.«
»Ja, ich weiß.«
»Und der Athabasca-See.«
»Ja, okay.«
Er war verdammt stolz auf seine alte Wandkarte.
Was mach ich jetzt mit dem Revolver?
Stopp! Noch mal von vorn. Ich will ja genau beschreiben, wie alles gewesen ist. Angefangen hat diese ganze grässliche Geschichte an einem Dienstagabend im Espace. Das ist eine dieser angesagten Bars in einer Seitenstraße der Reeperbahn. Da wo die Nutten rumstehen, Entschuldigung, die Huren, wie sie sich selbst nennen. Normalerweise gehe ich da nicht hin. Weder da hin, noch in andere angesagte Bars. Aber an diesem Abend hat mich Annie, meine beste Freundin, dort hingeschleppt.
Das Espace war wild dekoriert und sah aus, als wäre für immer Weihnachten. Viele bunte Lichter und Leuchten und Girlanden und Kitsch und Nippes und Schrott hingen und standen in allen Ecken herum, und Leute, die eigentlich älter waren als wir, scharten sich um den Tresen.
Annie wollte unbedingt ins Espace, weil an diesem Abend ein Typ, den sie anhimmelte, dort Platten auflegte. Der Typ war gut zehn Jahre älter als sie und hatte eine perfekte Art, über sie hinweg, an ihr vorbei oder durch sie hindurch zu sehen. Dabei müsste jeder Idiot auf sie fliegen, denn mit ihren langen dunklen Haaren und dem melancholischen Blick ist sie eine wirkliche Schönheit. Wenn Susi nicht rechtzeitig gekommen wäre, hätte Annie sich wahrscheinlich sinnlos betrunken. Aber die blonde Susi kam, hellte mit ihrem süßen Lächeln Annies düstere Stimmung auf, und die beiden konnten sich über ihre Lieblingsthemen unterhalten: Männer, die mich nicht interessierten und Musik, von der ich nicht den blassesten Schimmer hatte; und darüber, wie sie mich bekehren könnten.
Ihr Musikgeschmack war das Nervthema, und ich wollte schon gehen, als sie mich in die Zange nahmen.
Susi holte ein rosa Döschen aus ihrem nostalgischen Hirtentäschchen heraus, klappte es auf und zeigte auf die drei blauen Pillen, die darin lagen: »Für jede von uns eine«, sagte sie und hielt mir die Dose unter die Nase.
»Nein, danke«, sagte ich. Wie immer.
Annie hingegen hatte schon die Hand erhoben. Sie gierte nach Rausch.
»Wenn du erstmal so einen kleinen Glücksbringer intus hast, wirst du diese Musik lieben.«
»Musik? Welche Musik?«
»Zorch«, sagte Susi.
»Das ist nicht Zorch, das ist Cipher«, sagte Annie und nahm sich eine Pille. »Zorch hat kein Saxophon.«
Susi kniff die Augen zusammen: »Erstens sind Zorch zu zweit und zweitens ist dieses Saxophon gesampelt.«
»Das soll gesampelt sein? Quatsch.« Annie legte sich die Pille auf die Zungenspitze.
»Was meinst du?« wandte sich Susi an mich.
»Gesampelt oder nicht«, sagte ich. »Ich finde diese Musik melodisch und harmonisch recht bescheiden, vom monotonen Rhythmus gar nicht zu reden. Die Ostinato-Figur im Bass klingt nach defektem Presslufthammer.«
Annie schluckte die Pille und grinste mich an: »Lenina, du bist eine arrogante Zicke.«
»Wenn ihr meine Meinung hören wollt, sag ich euch meine Meinung.«
Susi warf mit einer Kopfbewegung ihre blonden Locken zurück, was bedeutete, dass sie sauer war. Wieder hielt sie mir die Dose hin: »Willst du nun?«
Ich schüttelte den Kopf. Sie nahm sich eine Pille, schluckte sie und drehte sich um. Dann ging sie zum DJ-Pult und hielt dem Supertypen die Dose hin. Der lachte und nahm die Pille. Er beugte sich über seine Anlage und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Sie flüsterte ihm was ins Ohr, er flüsterte ihr was ins Ohr. Ich blickte zu Annie. Sie war wie vom Donner gerührt.
Susi kam zurück und erklärte triumphierend: »Es ist Zorch.«
Annie winkte dem Barkeeper zu und deutete mit Daumen und Zeigefinger die Größe des Glases an, dann zeigte sie auf eine Flasche. Jetzt ging das mit dem Tequila doch noch los.
»Und gleich kommt Cipher.«
Als es soweit war, konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Und dann, als Annie und Susi gerade anfingen sich zu streiten, weil Annie sich über das Honeybee-Motiv auf Susis T-Shirt lustig machte, stand plötzlich dieser Kerl in der Lederjacke neben mir. Stoppelkopf, Skinheadtyp, aber irgendwie amtlich.
»Frau Rabe?«
Ich drehte mich um und sah zu ihm hoch: »Ja?«
»Kommen Sie bitte mit.«
Der Typ legte eine Hand auf meinen Unterarm.
»Wer sind Sie denn?«
»Zollfahndung.«
»Scheiße. Okay, ich komm mit.«
Annie und Susi starrten mich völlig verstört an. Ein zweiter Lederjackentyp tauchte neben dem ersten auf. Susi stopfte hastig das rosa Döschen in die Tasche ihrer superengen Hüfthose.
»Zollfahndung?« fragte Annie empört. »Soll das ein Witz sein?«
»Sie dürfen Ihr Getränk noch austrinken«, sagte der Typ und deutete auf das Tequila-Glas, das Annie mir aufgeschwatzt hatte. Ich kippte es runter. Schmeckte nach Flugzeugbenzin.
»Geh nicht«, sagte Susi. »Du musst nicht.«
Ich schaute den Typen an, der immer noch seine Hand auf meinem Unterarm hatte. Er sah nicht aus, als würde er hier einen Witz machen.
»Ich komme«, sagte ich.
»Bist du bescheuert?« rief Annie. »Du hast dir nicht mal seinen Ausweis zeigen lassen.«
Der Typ zog einen Ausweis aus der Jeanstasche und hielt ihn ihr hin.
»Trotzdem«, sagte Annie. »Sie hat nix mit Drogen …« Dann wusste sie nicht mehr weiter.
Kaum hatte sie den Ausweis gesehen, ging Susi zwei Schritte zurück und stieß gegen den Tresen.
»Wir telefonieren«, sagte ich zu Annie.
»Du musst nicht mit«, versuchte sie es nochmal. »Er hat keinen Durchsuchungsbefehl.«
»Du meinst Haftbefehl.«
»Ist doch egal.«
»Wir telefonieren, okay«, wiederholte ich und drehte mich um.
Beim Hinausgehen spürte ich einige verblüffte Blicke. Aber die meisten Gäste des Espace bemerkten nichts oder wollten nichts bemerken.
Draußen in der schmalen Straße, auf der sich im bunten Schein der lasziven Leuchtreklamen Nachtschwärmer an nicht ausgelasteten Prostituierten vorbeidrängten, stand ein VW Golf. Auf dem Dach blinkte ein Blaulicht und bewirkte, dass alle Leute einen Bogen um den Wagen machten. Ein paar nur halb angezogene Mädels in meinem Alter sahen mich mitleidig an, als mir der eine Fahnder die Tür aufhielt. Ich stieg ein und machte es mir auf dem Rücksitz bequem. Die beiden Lederjacken-Typen setzten sich nach vorn, der Fahrer verstaute das Blaulicht unter seinem Sitz und startete den Motor.
Der Beifahrer drehte sich zu mir um. Für einen Bullen machte er einen halbwegs sympathischen Eindruck. Musste so Mitte zwanzig sein. Die Stoppelhaare standen ihm gar nicht schlecht. Er war natürlich kein Skinhead, aber irgendwie germanisch sah er schon aus. Hellblond und blauäugig. Ziemlich durchtrainiert. Besuchte garantiert das Fitness-Studio. Er verzog das Gesicht und sagte: »Mein Name ist Martin Weigel, Zollinspektor. Das hier ist mein Kollege Erik Stöber.«
»Zollsekretär«, ergänzte der Kollege, der einen etwas schlapperen Eindruck machte und einen Bierbauch hatte. Er manövrierte den Wagen vorsichtig durch die enge Kiezstraße.
»Tut mir leid, dass wir Sie einfach so da rausholen mussten«, sagte der Blonde.
»Ist schon okay«, sagte ich. »Es geht um meinen Vater, stimmt’s?«
Zollinspektor Martin Weigel sah mich erstaunt an: »Ja.« Sein Kollege lenkte den Golf auf die Davidstraße. Martin Weigel musterte mich unentschlossen.
»Ich nehme an, er hat sich mal wieder in irgendwas reingeritten«, sagte ich. »Was muss ich tun?«
»Ihn identifizieren.«
»Das werde ich schon irgendwie hinkriegen.«
»Sag das nicht, Mädel«, brummte der Fahrer. »Sie haben ihn aus dem Hafenbecken gezogen.«
Die Ampel an der Ecke zur Reeperbahn schlug auf Grün um. Stöber gab Gas und bog mit quietschenden Reifen ab.
Ich kippte um, blieb auf dem Rücksitz liegen und starrte durch die Scheibe hinaus auf die vorbeiflitzenden bunten Lichter, die immer unschärfer wurden, verschwammen, und dann schloss ich die Augen.
EINS
Ich erfuhr irgendwann später, wie sie mich gefunden hatten. Martin Weigel erzählte es mir, als ich wieder etwas klarer denken konnte. Es war ja ziemlich ungewöhnlich gewesen, dass ich mich von Annie überreden ließ, mit ins Espace zu kommen. Wenn man es esoterisch betrachten will, hatte Buddha seine Hände im Spiel. Na ja, das war jetzt nur so ein Spruch. Mit Buddha meine ich die Firma »Sold To The Highest Buddha Inc.«, die ihr Hauptquartier in dem Haus hat, in dem ich wohne, Holländische Reihe in Hamburg-Altona, genauer gesagt Ottensen. Das ist angeblich ein In-Viertel, was ich lustig finde, weil in unserem Haus, abgesehen von »Buddha Inc.«, fast nur alte Leute wohnen. Und ich. Im Hinterhaus. Um zu mir zu kommen, muss man durch einen dunklen Torbogen zum Hinterhof durch und dann immer gerade aus. War mal ein Gewerbehof, jetzt spielen hier manchmal zwei junge Katzen mit dem Müll, den die Buddha-Leute in ihrem jugendlichen Leichtsinn durch den Hintereingang auf den Hof schmeißen und damit den Zorn der Rentner auf sich ziehen. Und meinen. Wie wollen diese Idioten denn in ein neues Zeitalter eintreten, wenn sie sich den Weg mit Müll zu ballern?
Chef der Techno-Buddhisten ist Hektor Sinus, ein cooler Typ Anfang dreißig, für den ich mich erwärmen könnte, wenn er nicht Kette rauchen und die falsche Musik hören würde. Ich bin nämlich völlig aus der Generation geschlagen: Gerade mal zwanzig Jahre alt und Fan von längst verwesten Pop-Idolen vergangener Jahrhunderte wie Schubert, Beethoven, Wagner, Mahler, Schönberg und so weiter. Muss mit meinem Intelligenzquotienten zusammenhängen, jedenfalls ödet mich die Simplizität von Techno-Beats und Trance-Gewaber ziemlich an. Manche Drum ’n’ Bass-Sachen, wenn sie mehr in Richtung Jazz oder Edgar Varese gehen, finde ich noch brauchbar, aber sonst: kein Interesse.
Wie dem auch sei, es war Hektor, der wahrscheinlich gerade seine fünfzigste Zigarette kurz vor Feierabend rauchte und die Fahnder bemerkte. Zollinspektor Weigel und Zollsekretär Stöber rüttelten wie wild an der Hinterhaustür, schlugen mit den Fäusten dagegen. Meine Nachbarin, Frau Sieveking, hatte ihnen von ihrem Fensterplatz im ersten Stock aus erklärt, dass die Klingeln kaputt waren, sich aber geweigert zum Aufschließen herunter zu kommen. Also brüllten die beiden Fahnder meinen Namen und Hektor fühlte sich bemüßigt ihnen zu erklären, dass ich mit Annie auf die Piste gegangen war. Er nannte auch den Namen Espace und so war es kein Kunststück für die Beamten, mich dort zu finden.
Die Autofahrt war kurz: Die Reeperbahn hoch zum Millerntorplatz, rechts abbiegen, die Helgoländer Allee runter, falsch parken vor den Landungsbrücken. Ich nahm das alles gar nicht richtig wahr. Ich lag hinten auf dem Rücksitz und versuchte einen Heulkrampf zu unterdrücken, der Besitz von mir ergreifen wollte. Die beiden Typen stiegen aus und die Tür ging auf. Zollinspektor Martin Weigel griff nach meiner Hand und sagte: »Komm!«
»Sie können mich ruhig siezen, auch wenn ich heule!«
»Okay. Kommen Sie bitte, Frau Rabe.«
Ich rappelte mich auf und schob mich mühsam vom Rücksitz. Als ich neben den beiden stand, holte ich tief Luft. Es roch nach Urin. Rechts von uns stiegen die Fans des Musicals »Buddy Holly«, das auf der anderen Elbseite in einem Zelt gegeben wurde, in ihren Provinzbus. Links entschloss sich eine Horde Touristen, die Erlebniskneipe im ersten Stock des Landungsbrücken-Empfangsgebäudes zu besuchen.
»Sie ist fertig«, stellte Stöber fest.
»Kein Wunder, so wie du ihr das an den Kopf geknallt hast.«
»Du hast ja mal wieder das Maul nicht aufgekriegt.«
»Was habt ihr eigentlich für ein Problem?«, murmelte ich.
»Los jetzt!« kommandierte Martin Weigel und fasste mich unter.
Ich schüttelte seine Hand ab: »Scheiße!«
»Kein Drama jetzt bitte, okay? Wir müssen da durch.«
Sie nahmen mich in die Mitte wie ein verirrtes Schaf und führten mich durch die Bogengänge über den Steg runter zur Anlegestelle, wo zu dieser Zeit nicht mehr besonders viel los war. Trotzdem roch es immer noch penetrant nach Bratfisch und altem Fett. Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen.
Eine Barkasse mit der Aufschrift »Hafenpolizei« brummte vor sich hin. Meine Entführer grüßten einen Beamten in blauer Uniform, der mir die Hand gab, damit ich beim Einsteigen nicht ausrutschte. Die Zöllner sprangen mir nach und ein zweiter Uniformierter löste das Tau, warf es rüber und kam an Bord. Der Motor bollerte los und die Barkasse bewegte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit in die Mitte des Stroms.
Mancher würde was drum geben, eine nächtliche Fahrt auf der Elbe mitmachen zu dürfen. Für mich war es eher so was Ähnliches wie die Fahrt auf … wie hieß der Unterweltfluss? … auf dem Styx? Auf der rechten Seite die Lichter der Stadt, auf der linken der verwaschene orangefarbene Schein des Industriehafens mit beleuchteten Schwimmdocks, Silhouetten von Kränen, Raffinerietanks und Containerbrücken. Zwei Welten, durch den schwarzen, ölig schimmernden Fluss voneinander getrennt, auf dem sie mich jetzt irgendwohin fuhren, wo ich nicht hin wollte.
Als wir den Fischereihafen passierten, wurde mir richtig schlecht.
»Gibts hier eine Toilette?«
Einer der Beamten führte mich zu einer schmalen Tür. Ich trat in die enge stählerne Zelle und wollte die Tür schließen, da sagte er: »Schließ nicht ab, Mädchen, ich pass schon auf.«
Ich schloss dennoch ab, hob den Klodeckel, kniete mich hin und kotzte. Als ich fertig war, wusch ich mir ausgiebig Hände und Gesicht an einem winzig kleinen Blechbecken und betrachtete mich in einem noch kleineren fleckigen Spiegel. Ich sah aus wie ein Gespenst und bekam eine Ahnung, was im Alter aus mir werden würde.
Der Beamte draußen klopfte: »Alles klar? Wir sind gleich da.«
»Ja, ja«, rief ich mit brüchiger Stimme.
Dann kam ich raus und ließ den alten Knacker mit seinem sorgenvollen Blick links liegen. Ich trat zu den Zöllnern an die Reling und atmete ein paarmal tief durch. Ein kühler Wind verwehte die laue Sommernachtsluft. Die Polizeibarkasse war jetzt in ein Hafenbecken eingebogen und tuckerte an einem Kai vorbei, an dem gigantische Frachter festgemacht hatten. Man hörte die Container rummsen und das Gejaule von Sirenen. Die Barkasse bog nach rechts ab, besser gesagt, nahm Kurs auf ein noch schmaleres Hafenbecken hart steuerbord, wendete und lief einen Anleger an, von dem eine Metalltreppe nach oben zum Ufer führte.
Diese Treppe stiegen wir hoch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in diesem Moment alle sehr klein vorkamen. Wie winzige Ameisen in einer Welt, die von gigantischen Amphibien aus zigtausend Tonnen Stahl regiert wird.
Oben war das Ufer mit hohen Bäumen bewachsen. Wir kletterten eine kurze Gittertreppe hinunter, gingen an einem Zaun entlang und erreichten das, was man am Hamburger Elbufer gemeinhin einen »Balkon« nennt. Nur das dieser Begriff hier im Freihafen wenig Sinn machte.
Es war eine Art natürliche Terrasse, von Bäumen umstellt und einem hohen rot-weißen Leuchtturm beherrscht, der in den orangefarbenen dunklen Himmel ragte. Sand unter meinen Füßen. Gegenüber rollten jaulende Containerspinnen hin und her und gingen ihrer Vierundzwanzigstunden-Schicht nach, und die riesigen Containerbrücken schoben sich an der Kaimauer entlang oder standen still und ließen die Laufkatzen vor und zurück kriechen.
Zwei Scheinwerfer erhellten den Balkon, und meine erste Assoziation war natürlich: wie bei Filmaufnahmen. Aber was für eine eigenartige Geschichte wurde hier abgefilmt? Links unter den Bäumen standen einige Campingstühle, darauf saßen drei Männer mit grauen Bärten und starrten feindselig vor sich hin. Neben ihnen auf dem Boden lag sorgsam geordnet Anglerzeug. Zwischen den Stühlen ein Klapptisch, darunter Kühltaschen und zusammengerollte Schlafsäcke.
Am Rand des Balkons blickten wir hinunter auf eine Personengruppe, die sich auf dem Geröll der Uferbefestigung versammelt hatte. Manche standen, manche hockten, manche knieten. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Sie hatten irgendwelche Metallkoffer dabei. Ein älterer Typ mit Glatze sah uns kommen und klopfte einer knienden Frau auf die Schulter. Sie erhob sich, eine leicht ramponierte Blondine mit schiefem Gesicht, und stolperte über die Steinbrocken zu mir.
Auf einmal waren die beiden Zöllner von meiner Seite verschwunden. »Frau Rabe?« Die Blondine säuselte etwas von Hauptkommissarin Brand und wie leid es ihr täte, es hätte einen schrecklichen Unfall gegeben: »Ihr Vater, wir vermuten, dass es ihr Vater ist, wurde tot aus dem Hafenbecken geborgen.«
Ich nickte nur.
»Erschrecken Sie nicht«, fuhr die Kommissarin fort. »Auch wenn es sich um einen Unglücksfall handelt, müssen wir überprüfen, ob es sich eventuell um ein Verbrechen handeln könnte.«
Ich nickte wieder. Wir kletterten über die Steinbrocken nach unten.
»Die Angler dort drüben haben seine … haben ihn im Hafenbecken treiben sehen und ihn herausgezogen … wie auch immer das ihnen gelungen ist … glücklicherweise, muss man wohl sagen …«
Das Wort Glück war hier wohl fehl am Platz.
»… sonst wäre er womöglich …« Sie brach ab.
Die hockenden Kripo-Beamten erhoben sich, einige gingen beiseite, ein Glatzköpfiger winkte uns zu sich. Am Boden irgendwas, mit einer Plane bedeckt.
Wir gingen ganz langsam hinüber.
»Er hatte einen Brief bei sich. Mit Ihrem Absender darauf. Der Zollbeamte, der zuerst zur Stelle war, kannte Ihren Vater offenbar, er übernahm dann die Verständigung.«
Sie sprach eine fremde Sprache, die ich nicht verstand. Wieso hatte mein Vater einen Brief von mir bei sich getragen. Welchen Brief überhaupt? Ich hatte ihm doch schon lange nicht mehr geschrieben.
Der Glatzköpfige stellte sich als irgendein Inspektor vor, murmelte banale Entschuldigungen und schob die Plane ein Stück zurück.
»Ist das Ihr Vater, Peter Rabe?«
Papa sah müde aus, obwohl er schlief.
»Ziehen Sie das Ding ganz weg.«
Er lag da wie abgeladen. Wachsweiß im Gesicht und an den Händen. Die Kleider durchnässt. Wie immer schlecht rasiert. Wie immer die Haare zu lang. Er würde sich mal wieder ganz schlimm erkälten, wenn er sich nicht sowieso schon den Tod geholt hätte.
»Ist das ihr Vater, Peter Rabe?« wiederholte der Typ von der Kripo.
Wäre er traurig, wenn er wüsste, dass er tot ist?
Seine Kollegin legte einen Arm um mich.
»Seine Name ist Peter Titus Rabe!« sagte ich trotzig.
»Er ist ertrunken.«
»Glaub ich nicht«, widersprach ich ihm und schüttelte den Arm der Kommissarin ab.
Der Glatzköpfige sah mich verblüfft an.
»Kommen Sie«, sagte die Kommissarin und schob mich beiseite, »darüber sprechen wir noch.«
Ich schaute hektisch um mich. »Wo ist dieser Zollinspektor?«
Die Kommissarin sah sich ebenfalls um. »Weg«, stellte sie fest.
»Woher kannte er mich überhaupt?«
»Er kannte ganz offensichtlich Ihren Vater, Frau Rabe.«
»So ein Scheißkerl! Er kann doch nicht einfach abhauen!«
Dann heulte ich los und hatte nichts mehr dagegen, dass diese dämliche Kommissarin mich in die Arme nahm.
Als ich mich wieder besser im Griff hatte, kam der Glatzköpfige zu mir und fragte: »Wie kommen Sie auf Mord, Frau Rabe?«
Das konnte ich ihm leider nicht erklären.
ZWEI
Ich weiß, dass es der Harmonie zwischen Körper und Geist nicht förderlich ist, wenn man sich gehen lässt. Trotzdem blieb ich im Bett. Statt zu trainieren, heulte ich vor mich hin, sah fern, knabberte Erdnussflips und trank Diät-Cola.
Ich ging nicht ans Telefon, ich kochte keinen Tee, kaufte keine Brötchen, ich lag muffig im muffigen Bett und schlurfte ab und zu mit nackten Füßen zur Toilette, warf meinem verstrubbelten Spiegelbild einen verzweifelten Blick zu und merkte noch nicht mal, dass mir beim nächtlichen Herumwälzen im unruhigen Schlaf zwei Pyjamaknöpfe abgerissen waren.
Ich glotzte sogar MTV, Viva und den ganzen Scheiß. Schrottmusik mit Schrottbildern von schrottreifen Vollidioten. Nur eine einzige Sängerin schaffte es, mich zu beeindrucken, eine Engländerin mit dem unhippen Namen Sophie Ellis-Bextor. Sie stand kerzengerade hinter ihrem Mikrophon, sang wunderschön zu drögen Rhythmen und sah aus wie der Schutzengel aller geknechteten Internatsschülerinnen. Das Stück hieß »Murder On The Dancefloor«, und als ich das Wort »Murder« in der Bildschirmecke las, musste ich schon wieder losflennen.
Irgendwann versuchte ich Annie zu erreichen, konnte aber nur ihren Anrufbeantworter mit erstickter Stimme vollquasseln. Nur um sie mit einem zweiten Anruf zu bitten, mich in Ruhe zu lassen. Idiotisch.
Erst die Faust von Tom brachte mich auf den rechten Weg zurück. Wenn er geklingelt hätte, wäre ich nie aufgestanden. Aber er polterte derart heftig gegen die Tür, dass ich Angst bekam, er würde sie einschlagen. Außerdem war es so laut, dass ich mich nicht mehr auf »Schloss Einstein« konzentrieren konnte, das gerade auf dem Kinderkanal lief. Ich kroch aus meinem Bett und tapste angefüllt mit vollkommener Gleichgültigkeit und ranzigem Selbstmitleid durch den Flur und schrie: »Was ist denn los?«
Er polterte weiter. Und plötzlich wurde ich wütend. Ich riss die Wohnungstür auf und brüllte: »Ruhe!«
Mit erhobener Faust hielt dieser schlacksige Kerl inne und grinste schüchtern: »Oh, hallo Lenina.«
»Was hast du gedacht, wer hier rauskommt? Deine Großmutter?«
Er trug eine Uniform. Dunkelblau. Allerdings waren die roten Aufnäher, die die Jacke bislang verziert hatten, verschwunden. Man sah nur noch ein paar Fäden an den Stellen, wo sie abgerissen worden waren. Hatte man den Blauen Sheriff degradiert?
»Geht dein Kühlschrank noch?« fragte er.
»Was? Ja, klar.«
Gelegentlich kam Tom rüber, um Hand an ein technisches Gerät zu legen, das schwächelte. Im Prinzip war er ein guter und nützlicher Nachbar, den man sich warm halten sollte.
»Du siehst spitze aus«, sagte er.
Er roch nach Bier, stank nach Männerschweiß, war unrasiert und stand da in seiner typischen Körperhaltung, nach vorn gebeugt, leicht gekrümmt, insgesamt etwas ausgeleiert. Aber ich wusste, er war kräftiger als er aussah und außerdem gewohnt, Argumente auf physische Art durchzusetzen.
Ich habe gelernt, dass man stark genug sein muss, um jeden Menschen achten zu können. Tom Akkermann war meine tagtägliche Herausforderung. Er klebte sich gern an mich, wenn er mich im Treppenhaus sah. Mit Höflichkeit war da selten was zu machen.
»Was willst du?« fragte ich.
»Äh, hast du Bier?«
»Du weißt doch, dass ich nie Bier habe.«
»Äh, vielleicht ne Cola?«
»Ist alle.«
Er starrte einen kurzen Moment lang gegen die Wand im Treppenhaus. »Eier?« fragte er.
»Wie bitte?« Bier, Cola, Eier – ich fragte mich, was er da für eine Nummer abzog.
»Ich hab nämlich keine mehr.«
»Du hast keine Eier mehr?« Meine Stimme klang sarkastisch. Aber auch Sarkasmus war der falsche Weg. Ich merkte nämlich jetzt, dass seine Gesichtsrötung nicht vom übertriebenen Alkoholgenuss kam, sondern, weil er fix und fertig war.
»Lenina …« Er verzog das Gesicht, und es sah aus, als wolle ausgerechnet er, der dumpfste Proll des ganzen Hauses, jetzt hier vor meiner Wohnungstür in Tränen ausbrechen. Ich reagierte wie eine Kindergartentussi: »Tom, was ist los mit dir?«
»Lenina, lass mich mal kurz rein zu dir, nur ganz kurz.« Er unterdrückte ein Schluchzen.
»Komm halt rein.« Ich zog die Tür auf und ging voraus in die Küche. Dabei musste ich meine Pyjamahose festhalten, weil der Gummi ausgeleiert war. In der Küche sah es aus wie Kraut und Rüben, und im Spiegel über dem Ausguss sah ich eine junge Frau, die vielleicht eine entfernte Ähnlichkeit mit Sophie Ellis-Bextor hatte. Na ja, ein breiteres Gesicht, ein bisschen stämmiger gebaut und leider mit einem völlig inakzeptablen Out-of-bed-look versehen. Hinzu kam, dass die Pyjamajacke aufklaffte. Da ich auch weiterhin nicht vorhatte, meine schönsten Geheimnisse ausgerechnet an einen Typen wie Tom Akkermann zu verschwenden, sagte ich kurz und knapp: »Ich mach uns gleich einen Kaffee, setz dich einfach da hin!« und verschwand im Badezimmer.
Nach einer Schnelldusche kämmte ich mir die Haare streng zurück, fand eine Hose und ein T-Shirt und zog mir die weißen Camper-Slipper an, die Annie mir zum Geburtstag geschenkt hatte, um mich »aufzuhippen«, wie sie sich ausgedrückt hatte.
Dann schmiss ich die Kaffeemaschine an und setzte mich an den kleinen Klapptisch. Tom glotzte durch die Balkontür nach draußen. Natürlich wusste er jetzt nicht, was er eigentlich wollte. Mir allerdings war klar, was geschehen war.
»Sie haben dich bei den Blauen Sheriffs rausgeschmissen, stimmt’s?«
Er nickte.
»Wie ist das passiert?«
»Ich hab einen Schwarzfahrer zu hart rangenommen.«
»Deswegen schmeißen die dich raus?« wunderte ich mich.
»Na ja, ich war wohl ein bisschen zu eifrig mit dem Knüppel, und ein paar Platzwunden hatte er auch.«
»Ist wohl nicht gut fürs Image, so was.«
»Nee, darum ging’s nicht, da ham wir ja schon ganz andere Sachen erlebt.«
»Sondern?«
»Es war der Neffe vom Geschäftsführer. Wollte sich vor seiner Clique wichtig machen.«
»Hätte nie gedacht, dass du so pflichtbewusst bist.«
»Ich habs ihm nicht geglaubt. Das war der Fehler.«
»Du solltest mal darüber nachdenken, ob du deine Kraft nicht gezielter und bewusster einsetzen kannst.«
»Wieso? Ich wollte ihm doch eins auf die Glocke geben.«
»Das ist die falsche Einstellung, Tom.«
Er sah mich verständnislos an. Ich stand auf und verteilte den Kaffee auf zwei Becher. »Milch? Zucker?«
»Immer rein damit.«
Ich stellte die Becher auf den Tisch und setzte mich wieder. »Du siehst fertig aus, Lenina.« Sein Gesicht hellte sich auf. Darin schien er Trost zu finden.
»Bin ich auch. Mein Vater ist gestorben.«
»Oh, Scheiße.« Er griff nach seinem Becher.
»Sie haben ihn aus dem Hafenbecken gefischt. Vorsicht, der ist heiß und du musst noch umrühren.«
»Hm.« Er nahm einen großen Schluck und verzog das Gesicht.
»Ich hab doch gesagt, er ist heiß.« Ich pustete in meinen Becher.
»Wie ist er denn da reingekommen?«
»Ins Wasser? Keine Ahnung.«
»Erbst du was?«
»Hm?«
»Hatte er Zaster?«
»Nee, wirklich nicht, nicht das ich wüsste.«
»Pechsache.«
»Er hatte nichts weiter als sein Büro drüben in der Großen Brunnenstraße.«
»Was’n fürn Büro?«
»Er war Detektiv.«
»Erbst du das jetzt?«
»Wahrscheinlich.«
»Dann kannst du mich einstellen. Du bist die Chefin und ich der Mann fürs Grobe. Was hältst du davon? Fänd ich nicht schlecht.«
»Das Detektivbüro hat nicht mal genug Geld für einen abgeworfen, fürchte ich.«
»Hey! Mit so ner geilen Tusse wie dir … ’tschuldigung.«
»Schon gut, ich fasse es als Kompliment auf.«
Er stand abrupt auf: »Danke, das war supernett von dir. Ich geh jetzt nochmal rüber ins Holsten-Eck. Holger ist mir sowieso noch ein paar Bier schuldig.«
Ich lief hinter ihm her bis zur Tür und sah zu, wie er voll neuer Zuversicht die Treppe hinunterschwankte, seinem nächsten Bier entgegen.
Dann zog ich mir die Windjacke über und ging los.
Es war noch hell, aber die Zentrale von »Sold To The Highest Buddha Inc.« war bereits geschlossen. Die Schaufenster-Deko in diesem Monat bestand aus einer Collage aus Modellbau-Raumschiffen und fernöstlichem Esoterik-Nippes, alles in grellen Leuchtfarben. Normalerweise sah ich beim Weggehen nach, ob Hektor vielleicht noch am Computer saß. Aber heute wollte ich ihn nicht sehen. Das war eine neue Erfahrung: Hektor war mir scheißegal. Ganz offensichtlich hatte mir mein Vater mehr bedeutet. Das war gut zu wissen.
Ich bog in die Große Brunnenstraße, die sich quer durch dieses Großstadt-Dorf namens Ottensen schlängelte, vorbei an den üblichen Jugendstilhäusern. Ich überquerte einen Parkplatz zwischen zwei Manufakturgebäuden und betrat ein kahles, von grellen Neonleuchten erhelltes, schmutziges Treppenhaus. Bis vor kurzem waren in diesem Gebäude vor allem neugegründete Firmen aus dem Medienbereich ansässig gewesen. Jetzt waren all die bunten, durchgestylten Schilder, die neben der Tür gehangen hatten, verschwunden und ganz offensichtlich hatte auch die Reinigungsfirma den Dienst quittiert. Nur die Werkstatt des Antiquitätenhändlers im Erdgeschoss war noch da. Sonst war das Gebäude leer, bis auf die rechte Hälfte des vierten Stockwerks, wo mein Vater sich eingerichtet hatte.