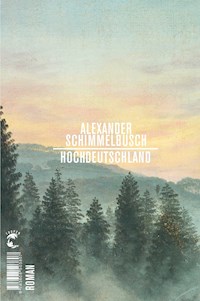9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine junge Frau, ein junger Mann und die Privilegien, die ihnen suspekt geworden sind. Der Autor des Spiegel-Bestsellers «Hochdeutschland» begeistert mit «Blut im Wasser»: «Ganz große Oper.» Kolja Mensing, Frankfurter Allgemeine Zeitung Pia und Alex kennen sich seit der Kindheit, sie waren bestimmt füreinander. Und doch haben sie sich auf dem Weg verloren und seit Jahren nicht mehr gesehen. Dabei leben die jungen Deutschen beide an der amerikanischen Ostküste. Sie treiben ziellos, stilsicher und verschwenderisch durchs Leben. Arbeiten müssen sie nicht, sie haben geerbt. Sie leben in Häusern am Meer. Als Pia erfährt, dass sie unheilbar krank ist, fasst sie den Entschluss, Alex wiederzusehen. Sie ahnt, dass er sich nach Montauk zurückgezogen hat, und bricht auf zu einer letzten Reise. Dabei erinnert sie sich an eine Entscheidung, die sie für immer bereuen wird. Alexander Schimmelbusch erzählt die berührende Geschichte zweier Menschen, die einander und auch sich selbst verloren haben. Hinter der genau sezierten Oberfläche aus Luxus verbirgt sich nicht zuletzt eine tragische Liebesgeschichte von existenzieller Tiefe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Ähnliche
Alexander Schimmelbusch
Blut im Wasser
Roman
Über dieses Buch
Pia und Alex kennen sich seit ihrer Kindheit, sie waren bestimmt füreinander. Und doch haben sie sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Dabei leben die jungen Deutschen beide an der amerikanischen Ostküste. Sie treiben ziellos, stilsicher und verschwenderisch durchs Leben. Arbeiten müssen sie nicht, sie haben geerbt. Als Pia erfährt, dass sie unheilbar krank ist, fasst sie den Entschluss, Alex wiederzusehen. Sie ahnt, dass er sich nach Montauk zurückgezogen hat, und bricht auf zu einer letzten Reise. Dabei erinnert sie sich an eine Entscheidung, die sie für immer bereuen wird.
Blut im Wasser ist eine tragische Liebesgeschichte von existenzieller Tiefe. Alexander Schimmelbusch erzählt berührend von zwei Menschen, die einander und auch sich selbst verloren haben.
«Und auf einmal wird die Erinnerung an einen alten Upperclass-Roman wach: an den Großen Gatsby. Mit seiner dichten Motivik hat Alexander Schimmelbusch dem Genre die Magie des Erzählens zurückgegeben.» Inge Kutter, Die Zeit
«Ganz große Oper.» Kolja Mensing, Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Eine Elegie in Weißgold, ein todtrauriges Duett, mit einem Finale, das die beiden Wohlstandskinder den großen Liebespaaren der Weltliteratur an die Seite stellt.» Oliver Jungen, WDR 3
«Das kühle und klare Porträt einer vermögend geborenen Generation, die das Glück mit einem Etikett verwechselt.» Claudia Voigt, Der Spiegel
«Ein existentielles Endspiel»Denis Scheck, Deutschlandfunk
«Ein gut platzierter Schlag in die Magengrube, bei dem man sich noch Tage später fragt: Was ist hier eigentlich passiert?» Matthias Wulff, WELT AM SONNTAG
«130 Seiten hat dieses kleine, unfassbar kluge Buch – damit man es zweimal lesen kann.» Jan Drees, WDR Eins Live
Vita
Alexander Schimmelbusch, geboren 1975 in Frankfurt am Main, wuchs in New York auf und studierte an der Georgetown University in Washington. Seine Romane werden von der Kritik gefeiert. 2018 erschien «Hochdeutschland» und wurde ein Bestseller. 2019 gewann der Autor den Rom-Preis der Deutschen Akademie. 2024 erschien bei Rowohlt sein Roman «Karma». Er lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright der Originalausgabe © 2009 by Blumenbar Verlag, München
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Mönch am Meer. Gemälde von Caspar David Friedrich, 1808-1810. Berlin, SMB, Nationalgalerie (Jörg p. Anders / Nationalgalerie, SMB / bpk)
ISBN 978-3-644-00483-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
AMERIKA
Ostküste
2010
ALEX
Als ich aufwache, habe ich einen trockenen Rieslinggeschmack im Mund. Ich liege reglos da, in einem leeren Raum, nackt unter einem dünnen Laken. Die gläsernen Wände, die mich umgeben, sind vereist, die kahlen Zweige hinter ihnen sind nur als graphische Strukturen sichtbar. Mein Haus ist nicht beheizt, aber mein Atem bildet keine Dampfwolken. Für einen Augenblick habe ich Angst, dass ich in der Nacht gestorben bin.
Ich stehe auf und schleppe mich ins Badezimmer, wo ich den Spiegel mit einem Handtuch verhänge. Ich habe keine Pläne für den Tag, ich habe Nasenbluten und Sehstörungen und Schmerzen in meiner Brust, für die ich keine harmlose Erklärung habe. Ich drehe am Wasserhahn und beuge mich nach vorne, nehme behutsam drei tiefe Schlucke, bevor ich meinen Kopf unter den eiskalten Schwall strecke. Den Versuch, meine Zähne zu putzen, muss ich sofort wieder abbrechen, da die Vibrationen der elektrischen Bürste Kopfschmerzen wecken.
Über die hintere Treppe gelange ich in meine aus Deutschland importierte Küche, die in ihrer Reduktion, wie es Amy formulierte, als sie vor Kurzem bei mir zum ersten Mal zu Gast war, an einen Obduktionssaal erinnert. Vor der offenen Tür des Kühlschranks beginne ich damit, eine Flasche fettarme Milch zu leeren. Ich konzentriere mich dabei auf die Schluckgeräusche, die in meinem Kopf zu hören sind, und spiele mit dem Gedanken, mir eine Zeitung auszudrucken, verwerfe diesen aber, da ich mich momentan noch nicht in der Lage fühle, mich für irgendetwas zu interessieren.
Ich schiebe eine Glastür auf und eile unbekleidet hinaus in den Garten. Die Kälte der Luft, die in mein Gesicht weht, tut mir gut; die Lebenszeichen meines Körpers stabilisieren sich. Für einen Augenblick halte ich inne, im tiefen Schnee auf der Plattform, die flach über der Wiese schwebt, und versuche, mir den Ablauf der vergangenen Nacht ins Gedächtnis zu rufen: ohne Ergebnis. Dann mache ich mich auf den Weg hinab zum Schwimmbecken, das die kalte Jahreszeit über auf Whirlpooltemperatur erhitzt ist.
Das Haus hinter mir, das ganz aus Glas und Stahl gebaut ist, habe ich selbst in Auftrag gegeben, es ist exakt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Von meinem Schreibtisch aus habe ich einen unverbaubaren Blick über den Fluss hinweg auf die Bürostädte am gegenüberliegenden Ufer. Die Zimmer sind spärlich möbliert, einige stehen leer; die Böden sind mit Platten aus Travertin ausgelegt. Ich habe mir den Grundriss meines Hauses offenbar so gut eingeprägt, dass ich mich darin auch bei Finsternis in gewohnter Geschwindigkeit fortbewegen kann, ohne irgendwo anzustoßen. Diese Tatsache ist mir irgendwann einmal im Zuge eines Stromausfalls bewusst geworden, als ich, nachdem in der Stadt die Lichter erloschen waren, meinen Ablauf fortsetzte, als wäre nichts geschehen.
In der sprudelnden Hitze unter der Oberfläche wird mir schwarz vor Augen. In meinem Zustand schwimmen zu gehen ist zweifellos gefährlich, aber ich weiß: wenn ich nicht regelmäßig Sport treibe, vergreise ich. Stoisch beginne ich daher, meine Bahnen zu ziehen. Angst vor dem Ertrinken, denke ich mir, kann man mühelos verdrängen. Man kann in die Großstadt ziehen, sich eine Aufgabe suchen, sein Glück finden. Man kann, wie ich mir denke, während ich eine formvollendete Wende abschließe, sich ein Lächeln aufsetzen.
Eine Stunde später ungefähr klettere ich auf den Beckenrand hinauf, um mich der einschläfernden Umarmung des Frostes zu stellen. Ich strecke meine Arme aus, lege den Kopf in den Nacken und beobachte den Dampf, der von meinem Körper aufsteigt; dann lasse ich meine Augen zufallen. Irgendwo auf der Welt rüsten kriegsmüde Rebellen zu ihrer letzten Offensive, irgendwo hört ein Kranker in der Nacht nur das Piepsen der Infusionsregler, irgendwo, denke ich mir, bietet ein junges Mädchen, indifferent geworden, seine Dienste an.
Im Wohnzimmer ziehe ich mir einen Bademantel über und sehe auf dem niedrigen Tisch, der inmitten der Sitzmöbel steht, leere Weinflaschen und erinnere mich daran, dass es gestern Abend mehrfach an meiner Tür geklingelt hatte, dass ich den Ton erst ignoriert, dann aber doch aufgemacht und Amy erblickt hatte. Sie trug eine aus Samt gefertigte Jacke, die im Stile Napoleons gehalten war und sicher einer illustren Manufaktur entstammte, auf mich aber ungeheuer albern wirkte, und ich erinnere mich, dass mich der Verdacht beschlich, dass die Jacke gegen mich gerichtet war, dass sich Amy diese Jacke mit dem spezifischen Vorsatz angezogen hatte, mich in den Wahnsinn zu treiben, aber bevor ich sie mit meinem Verdacht konfrontieren konnte, war sie auch schon an mir vorbeigehuscht, durch die Haustür ins Foyer hinein und weiter ins Wohnzimmer, wo sie es sich auf einem Sitzmöbel bequem machte. Ich blieb noch eine Zeitlang unter dem Vordach stehen, um hinaus ins Schneetreiben zu blicken. Über den hohen Hecken, die ich habe pflanzen lassen, um mir den Blick auf das Cancer Center zu versperren, waren die spitzen Uhrentürme der alten Universität zu sehen.
Die Tatsache, dass ich fast jeden Tag schwimme, hat im Zusammenspiel damit, dass ich kaum noch etwas esse, dazu geführt, dass ich eine schlanke und, wie ich mir denke, als ich in meiner Ankleide vor den Spiegel trete, attraktive Figur habe. Mein Bauch ist flach, meine Muskeln sind nachhaltig definiert. Um dem heute jedoch eher verwahrlosten Eindruck meines Gesichts entgegenzuwirken, wähle ich einen eng geschnittenen grauen Anzug, ein weißes Hemd, dessen Kragen ich offen lasse, und eine besonders schöne, vor einem Jahrzehnt meinem Vater entwendete schwarze Krawatte.
Als ich in meine Einfahrt hinaustrete, formieren sich Wolken über der Stadt. An den Stützbalken der Veranden der viktorianischen Holzvillen, die meine Straße säumen, flackern altmodische Petroleumlampen. Ich konzentriere mich auf die Geräusche, die zu hören sind: auf das fröhliche Geschrei von Kindern, das aus einem Wohnzimmer in die Dämmerung dringt, auf den Ruf einer Eule, auf den Donner der Triebwerke betagter Düsenflugzeuge, die von der nahe gelegenen Startbahn abheben, um die Menschen nach ihrem Tag in der Hauptstadt nach Hause zu tragen. Als ich das Taxi, das ich soeben bestellt habe, in meine Straße einbiegen und sich langsam seinen Weg zu mir hinauf bahnen sehe, kommt mir der Gedanke, dass heute ein hervorragender Tag wäre, um im Park vor dem Capitol ein wenig spazieren zu gehen.
Es wird schnell dunkel und entlang der verschneiten Straßen von Georgetown gehen die Lichter an. Diese museale Gegend, ehemals eine eigenständige Stadt, die mit der Hauptstadt erst im letzten Jahrhundert zusammenwuchs, ist der einzige Ort, wie mir wieder klar wird, als der Taxifahrer in die Prospect Street einbiegt, an dem ich mich einigermaßen heimisch fühle, was mir daher als bemerkenswert erscheint, da ich hier nie mit einer Familie, sondern immer nur allein gelebt habe. Möglicherweise, denke ich mir, hängt dieses Gefühl mit der Universität zusammen, mit meiner Alma Mater, wie man ja sagt, die für den Menschen, der an einer Universität dieser Art in Amerika studiert hat, oft wie eine zweite Staatsbürgerschaft ist, wie eine nach dem Abschluss ein Leben lang vermisste zweite Heimat. Es setzt wieder Schneefall ein und die Stille wird allein durch den Klang der Glocken der Uhrentürme durchbrochen, die seit Jahrhunderten jede Stunde schlagen, irgendjemandem wohl, aber nicht mir, wie ich mir sage.
PIA
Es ging mir schon lange schlecht, als ich schließlich zum Arzt ging, lange Zeit hatte ich mir nichts dabei gedacht, denn wie lange war es her, dass es mir gut ging? Ich rief den Nachlassverwalter meiner Mutter an, schilderte ihm meine Symptome, woraufhin er mir einen Termin machte, bei einem Spezialisten, wie er sagte; ich solle mir keine Sorgen machen. Ich stieg in meinen Mercedes, fuhr in die Stadt hinein und sprach in der Praxis vor. Ich kam sofort dran.
Den ganzen Vormittag lang wurde ich einer eingehenden Prüfung unterzogen, ich wurde abgeklopft, mehrfach angezapft, ich wurde in den Röntgensarg geschoben, und freute mich schon auf ein ruhiges Lunch im Cipriani, als ich schließlich in das Büro des Spezialisten gebeten wurde. Der alte Mann erhob sich, als ich eintrat, gab mir die Hand und lächelte. Er wies mir den Patientenstuhl zu. Er zog die Tabelle meiner Werte hervor. Er begann zu sprechen: wenn er ehrlich sein solle, gefalle ihm ganz und gar nicht, was er da sehe, die Krankheit, die ich habe, sei eine ausgesprochen hässliche, Fakt sei, dass es keineswegs gut für mich aussehe und er bitte um Verzeihung, er müsse einen Anruf entgegennehmen. Er sprach in jovialem Tone mit einem Kollegen.
Ich war dankbar, dass er telefonierte, dankbar für den Aufschub, als den ich das Telefonat begriff, und während ich etwas spürte, das sich wie das rostige Blatt einer Säge anfühlte, sah ich mich im Zimmer um. Der Alte hatte offenbar die Blood abonniert, eine Fachzeitschrift über Blutkrankheiten, denn Ausgaben der Zeitschrift lagen überall in seinem Büro verstreut. An der Wand hinter ihm hingen in Holz gerahmte Urkunden, die ihn als Mitglied der BEST DOCTORS IN NEW YORK, der BEST DOCTORS IN AMERICA und auch von AMERICA’S TOP DOCTORS auswiesen, ihm für die Jahrzehnte als PRESIDENT der NEW YORK CANCER SOCIETY dankten und ihn unter anderem als TEACHER, MENTOR, FRIEND priesen. Auf dem Fenstersims Tennispokale, an der Wand hinter mir Bilder seiner Enkelkinder, Buben mit amerikanischen Gesichtern und hübsche Mädchen mit Schleifen in den Haaren.
Wie er mir bereits mitgeteilt habe, fuhr der Alte fort, als er aufgelegt hatte, sei die Krankheit, die mich befallen habe, eine sehr gefährliche, unabhängig davon, welche Behandlungsmethode man jetzt wähle, sei es äußerst unwahrscheinlich, dass ich die Luft des Frühlings atmen werde, dies stimme ihn traurig, ich sei ja noch jung, aber so sei es nun mal, und teilte mir also formell mit, dass ich sterben werde, vor Ende des Jahres noch, sagte er und bat um Verzeihung, er müsse einen Anruf entgegennehmen, und ich stand auf, verschwand im Aufzug, fuhr ins Erdgeschoss und trat in die Sonne hinaus.
Aber ich lebe noch, ich lebe draußen vor der Stadt, im Gästehaus des an der Küste gelegenen Anwesens, das meine Mutter mir vermacht hat. Auf dem Strand vor meiner Terrasse, die man im Winter mit Glas verkleiden und so das ganze Jahr über nutzen kann, sind im Sommer Einsiedlerkrebse zu sehen und hochbeinige Vögel, die mit den Schnäbeln versuchen, die Krebse aus ihren Schneckenhäusern zu picken. Den eleganten Sandsteinbau, der weiter oben auf dem Grundstück steht, den meine Mutter errichten ließ, um darin ihren Lebensabend zu verbringen, habe ich versiegeln lassen; ich werde ihn nicht mehr betreten. In meinem Testament habe ich festschreiben lassen, dass alles so bleiben wird, wie es ist, dass der Garten gepflegt werden und ein Wachdienst dafür sorgen wird, dass kein Unbefugter das Grundstück betritt, dass diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten sind, bis das Vermögen zur Neige geht, das ich von meinem Vater geerbt habe, also für tausend Jahre.