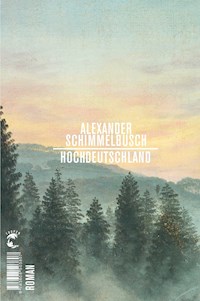19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein deutscher Herbst im Zeitalter der KI: eine abgründige, erhellende, rauschhafte Lektüre. Der lang erwartete Nachfolger des SPIEGEL-Bestsellers Hochdeutschland. Brandenburg, im Herbst 2033. Mit einem Festakt werden die führenden Köpfe der Omen SE, des wertvollsten deutschen Technologieunternehmens, in den Ruhestand verabschiedet. Für sie bricht das Zeitalter der Muße an, «die Zeit der Melonen und Feigen». Gläserne Smarthouses stehen in der unternehmenseigenen Siedlung am Auensee bereit. Dort finden sie zu sich, sie kommen zur Ruhe. Doch am Himmel über den Endmoränen kündigt sich schon ein Wetterleuchten an … Alexander Schimmelbusch führt uns an einen Ort in naher Zukunft, wo erschöpfte Bildungsbürger und die Anhänger neuer Diktaturen allein sind mit ihrer Wut und ihrer Sehnsucht, mit invasiven Arten und Technologien. Karma ist eine Zukunftsvision, ein Gesellschaftsroman, dem es um nicht weniger geht als «das gute Leben». Aber was ist gut? Wer entscheidet, und wer richtet über wen? Und was richtet sie an, die Anziehung, die Verachtung, auf allen Seiten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Ähnliche
Alexander Schimmelbusch
Karma
Roman
Über dieses Buch
Ein deutscher Herbst im Zeitalter der KI: eine abgründige, erhellende, rauschhafte Lektüre. Der lang erwartete Nachfolger des SPIEGEL-Bestsellers Hochdeutschland.
Brandenburg, im Herbst 2033. Mit einem Festakt werden die führenden Köpfe der Omen SE, des wertvollsten deutschen Technologieunternehmens, in den Ruhestand verabschiedet. Für sie bricht das Zeitalter der Muße an, der Melonen und Feigen. Gläserne Smarthouses stehen in der unternehmenseigenen Siedlung am Auensee für sie bereit. Sie kommen zur Ruhe, sie genießen. Doch am Himmel über den Endmoränen kündigt sich schon ein Wetterleuchten an …
Alexander Schimmelbusch führt uns an einen Ort in naher Zukunft, wo erschöpfte Bildungsbürger und die Anhänger neuer Diktaturen allein sind mit ihrer Wut und ihrer Sehnsucht, mit invasiven Arten und Technologien. Karma ist eine Zukunftsvision, ein Gesellschaftsroman, dem es um nicht weniger geht als «das gute Leben». Aber was ist gut? Wer entscheidet, und wer richtet über wen? Und was richtet sie an, die Anziehung, die Verachtung, auf allen Seiten?
Vita
Alexander Schimmelbusch, geboren 1975 in Frankfurt am Main, wuchs in New York auf und studierte an der Georgetown University in Washington. Seine Romane werden von der Kritik gefeiert. 2018 erschien Hochdeutschland und wurde ein Bestseller, 2019 gewann der Autor den Rom-Preis der Deutschen Akademie. Er lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Das Eismeer. Gemälde von Caspar David Friedrich, 1823. Hamburg, Kunsthalle (akg-images)
ISBN 978-3-644-00419-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Deutsch sein heißt, eine Sache
um ihrer selbst willen zu tun.
Richard Wagner
Herbst 2033
nahe Berlin
Omen
Es war der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, und die Gäste schielten verstohlen auf den Tresen unten am Seeufer, hinter dem eine Catering-Kraft seelenruhig den Ansturm der Durstigen erwartete. Dabei war die Temperatur beinahe erträglich, zum ersten Mal in jenem Saharasommer – das Quecksilber war unter die Schweißperlenschwelle gefallen, dank eines auffrischenden Windes aus den östlichen Steppengebieten.
Kronblätter der Herbstanemonen segelten über die Anwesenden, Glutspäne der Birkenholzscheite, und die junge Frau auf dem Podium hielt kurz inne, um ihr fliegendes Haar in einer Bauernkrone einzufangen.
Der Luftstrom legte das Cocktailkleid eng an ihren Körper, sodass die Konturen ihrer Physis zu sehen waren, deren Anblick die Gemüter der vornehmlich weiblichen Zuschauer mit Resignation und Ermüdung fluten musste. Denn irgendetwas an ihrem Habitus legte nahe, dass ihr Zustand nicht die Folge von Disziplin, sondern die Folge einer beneidenswerten Veranlagung war. Dass sie nicht so aussah, da sie früh schlafen und täglich laufen ging und sich allen Sinnesfreuden verweigerte, sondern dass sie so aussah, obwohl sie achtzehn Stunden am Tag arbeitete und sich primär von Brot, Käse, Avocados, Wein und Schokolade ernährte.
Der wohl ethnisch intendierte Print ihres Kleides war möglicherweise als halbherziger Versuch zu verstehen, ihr allzu nordisches Erscheinungsbild auszubalancieren, aber erstens war der Effekt eher kolonialistisch, und zweitens hatte sie das nicht nötig, sie war niemandem Rechenschaft schuldig. Denn auf die Omen SE ließ die deutsche Bevölkerung schon lange nichts mehr kommen.
Wie öfter mal an Montagen waren Spuren von MDMA in ihrem System nachzuweisen, was auch an ihrer wohligen Körperhaltung abzulesen war – sie schien ihr Dasein als Brandung aus goldener Energie wahrzunehmen, und den ostdeutschen Wind auf ihrer Haut als brasilianischen Liebhaber. Sie brauchte kein Mikrophon, ihre Stimme durchsäbelte das Rauschen der Silberweiden, sie sprach schon seit gut neunundzwanzig Minuten und ein Ende war nicht abzusehen.
Die junge Frau war nicht nur CEO des wertvollsten Unternehmens in der Bundesrepublik, sondern auch eine neue Mutter von Zwillingen, die in harmonischer Ehe mit einem Lichtkünstler zusammenlebte. Dieser widmete sich nun in Vollzeit dem Wohlergehen der kleinen Töchter des mustergültigen Paares, da ihm klar geworden sei, wie er dem Spiegel anvertraut hatte, dass kein anderer Vorgang sein Empathievermögen und damit seine schöpferische Potenz schneller würde mehren können, als die ersten Lebensjahre seiner Töchter aus unmittelbarer Nähe zu erleben. Sein Ehrgeiz sei es, sich auf die beiden wirklich einzulassen, ja sich ihnen gar anzuverwandeln, wie ein Oktopus den verborgenen Regelmäßigkeiten seiner Umgebung.
Noch Jahre zuvor hätte man eine Veranstaltung wie diese für den frühen Nachmittag angesetzt, aber Ende der Zwanziger war man dazu übergegangen, Versammlungen im Sommerhalbjahr, die nicht in klimatisierten Räumen stattfinden sollten, grundsätzlich auf direkt nach Sonnenuntergang zu legen. In die sogenannte blaue Stunde, in der sich nun ein transparenter Farbschimmer über der Wiese wölbte, ein ionisches Turmalin, in das die ersten Sterne wie gedimmte Punktstrahler eingelassen waren – wie die vereinzelten weißen Kiesel unter dem Quellwasser des Auensees, auf dessen Oberfläche die schwarzen Bojen der Hummerfallen schwammen.
«Unsere Siege haben wir bei Omen natürlich auch der Tatsache zu verdanken, dass wir ein sehr deutsches Unternehmen sind – dass wir auf Bescheidenheit Wert legen, dass wir Intimsphären respektieren und dass wir auf einen gewissen Ausgleich in der Gesellschaft bedacht sind.
Okay, könnte man nun einwenden, die Deutschen sind Nörgler und Nivellierer und renitente Geheimniskrämer, warum bitte sollten sie damit Erfolg haben? Aber das ist eben nicht alles, denn es gibt ja ein weiteres Element, noch eine lokale Zutat, und das ist die Sehnsucht», so sprach sie weiter. «Die Sehnsucht danach, unsere Fron endlich hinter uns zu lassen, um wie ein Abendsegler im Walde dem fernen Posthornklange entgegenzufliegen, der törichten Seligkeit.
Wir Deutsche träumen immer von einer besseren Welt, vom Aufgehen in der Natur, von unserer rauschhaften Transformation – durch den Kampf, verehrte Anwesende, oder durch die romantische Liebe.»
Natürlich hatten Hummer nichts verloren in Berlin und schon gar nicht in Brandenburg, aber seit Dekaden zuvor ein paar Bürgerkinder in der Spree ihre Blauen Signalkrebse ausgesetzt hatten, da sie ihrer Aquarien überdrüssig geworden waren, hatten die Tiere in den Schilfwiesen und Wasserwegen der märkischen Ebene einen Lebensraum ohne natürliche Feinde vorgefunden.
Schnell hatten sie die kreative Zerstörung heimischer Ökosysteme in Angriff genommen, nach dem bewährten Playbook invasiver Arten – durch die Verbreitung einer heimtückischen Pesterkrankung beispielsweise, gegen die sie eine Resistenz entwickelt hatten, anders als der indigene Edelkrebs, den die virulenten Mikroben beherzt in seine Auslöschung trieben. Oder durch die Veranlagung als unersättliche Allesfresser, deren Ziel es zu sein schien, die Flora und Fauna ihres Umfeldes vollständig zu verspeisen, um sich dann an den Kadavern ihrer verhungerten Feinde und schließlich auf kannibalistischem Wege aneinander gütlich zu tun.
Hinzu kam die demographische Kriegsführung mittels einer hohen Geburtenrate, die einer gewissen Liederlichkeit des Charakters der Invasoren geschuldet war, einer wahllosen Promiskuität zumindest der männlichen Schädlinge in Verbindung mit fragwürdigen urophilen Vorlieben: Wenn die Paarung ansteht, geistert die Dame an den Höhlen der Herren vorbei, um deren im Wasser gelöste Urinsignaturen im Hinblick auf erotische Kompatibilität auszuwerten. Hat eines der Harnprofile ihr Gusto angeregt, sendet sie einen eigenen Urinstrahl in Richtung ihres Auserwählten, um diesem ihre Bereitschaft zu signalisieren.
Die Mechanismen der Verdrängung waren demnach bekannt, es war ja nicht der erste Vorgang dieser Art – man denke nur an den Ersatz der in Deutschland ehemals heimischen roten Eichhörnchen durch amerikanische Grauhörnchen, bei denen es sich bekanntlich gar nicht um Hörnchen, sondern um Angehörige einer räuberischen Baumrattenart handelt. Und doch ließ der Furor der Signalkrebse einen neuen Faktor erahnen, der möglicherweise mit dem Phänomen der Auswilderung zu tun hatte, ähnlich der lustvolleren Grausamkeit jener Mitglieder terroristischer Gruppierungen, die nicht als Teil der Arbeiterklasse, sondern als Teil der Intelligenzija aufgewachsen waren.
Dem Blitzkrieg der amphibischen Panzertruppen konnte allein die Buttrigkeit ihres Schwanzfleisches Einhalt gebieten, das dem Konsens der Fachleute zufolge jenem des verdrängten Edelkrebses noch überlegen war. Die Hummerstulle eroberte die Berliner Wochenmärkte, mit veganer Mayonnaise und geriebener Zitronenschale, und so fanden sich die gerade noch siegestrunkenen Schalentiere bald in einer doppelt unerfreulichen Lage wieder: als lokale Spezialität, die zur Streetfood-Ikone avancierte, und dabei als invasive Spezies, die nicht in den Genuss von Fangrestriktionen kam.
Auch für jenen Abend im Oktober hatte die Regie ein Hummeressen vorgesehen – zwei Catering-Kräfte hatten Reusen eingeholt und auf Schubkarren hinter die Grillstation gefahren, um die Morituri unter Prasseln in eine Kühltruhe hineinzukippen.
Das traditionelle Prozedere bei der Zubereitung von Krustentieren, das Versenken in siedendem Wasser bei lebendigem Leibe, war jedoch nicht mehr darstellbar, sodass sich durchgesetzt hatte, sie vor dem Garen auf dem Wege ihrer Längsteilung schonend zu exekutieren. Und so war ein Kreischen zu hören, als der Grillmeister sein Messer schärfte, mit einem Pedal brachte er über einen Riemen einen Schleifstein zum Rotieren, auf dem er seine Klinge wandern ließ, die er hin und wieder in eine Eiswanne tauchte, um Verformungen durch die Reibungshitze zu vermeiden.
Schon in wenigen Minuten, nach dem Schlusswort der Rednerin, würden die Hummer sich in einer Choreographie wiederfinden, die zum Zwecke ihrer humanen Tötung ersonnen worden war – die Kälte, die Klinge, die Hebelwirkung, das Bersten, das Splittern, der gleißende Schmerz und dann die widernatürliche Wahrnehmung: der entzweigeschlagene Sternenhimmel. Denn Hummer verfügen über ein dezentrales Nervensystem, sodass sie nach ihrer Teilung, also in Form zweier Hälften, einer Studie der Universität Hamburg zufolge noch etwa neunzig Minuten lang weiterleben können.
«Wir alle wollen uns mal wieder auf eine einzige Sache konzentrieren – auf dem Hinflug zum Beispiel, habt ihr da gerade diesen halluzinogenen Sonnenuntergang gesehen? Eher nicht, zu beschäftigt, ich weiß schon, rhetorische Frage», so sprach sie weiter, «aber ich bin heute tatsächlich mal über meinen Schatten gesprungen, verehrte Anwesende.
Also lasst mich davon erzählen: Unser Todesstern stürzte erst hinter eine graue Gipfellinie, um im Verborgenen dann Unruhe zu stiften, um sich aus den Wolkenbergen wieder einen Weg ins Freie zu brennen, um sich ein zweites Versinken zu erkämpfen, hinter den glazifluvialen Ablagerungen. Da capo al fine.
Man wollte gleich ein Gelöbnis abgeben. Das Licht blutete wie Magma aus einem kollabierenden Vulkankegel, der auf einem fliegenden Teppich aus Nebel in Richtung Horizont zu schweben schien.
Ich sah den Vesuv Feuer speien, durch ein Fenster in Neapel, ich sah die Kuppeln und Türme von Paris im Abendlicht, vom Dache des Raphael aus, wo ich mit einem Glas Burgunder in der Hand auf die Sprengung der Flussbrücken wartete. Schwefel, Eiter, Ocker, Alarme, Überfliegungen, Eating Room Red No. 43 und darüber, als Übergang in das Ägäische Trinidad, ein kupferner Schimmer, der an napoleonischen Grünspan erinnerte. Als sei tief im Westen, an einem Nichtort wie Hannover beispielsweise, als Irrläufer eine russische Atomrakete eingeschlagen.
Diese hypnotischen Sonnenuntergänge der vergangenen Jahre», so sprach sie weiter, «sind auch als kosmisches Menetekel gegen die Seelenpest des Multitasking zu verstehen.»
Die Omen SE war im Frühling 2025 entstanden, in einem Hochparterre am Neuköllner Maybachufer, neben einem koreanisch-guatemaltekischen Fusion-Lokal. Am Anfang hatten die Gründer mit einer Rattenplage zu kämpfen, die mit den nomadischen Aktivisten zu tun hatte, die vis-à-vis auf den Böschungen kampierten, nicht selten auch kopulierten, ihre Notdurft im Kanal verrichteten und ihre Bánh-Mì- und Hummerstullenreste im distel- und farnlastigen Unterholz zu entsorgen pflegten.
Das Unternehmen war aber bald in eine Phase zivilisierenden Wachstums eingetreten, mit innovativen Angeboten in den Bereichen Medical Wellness und Spiritual Discovery – dem Spindeldorn der Omen-Anwendung Darkroom beispielsweise, einem Aufsatz für das Smartphone, der es der Userin erlaubte, nach steriler Punktion einer Fingerkuppe das Blutbild ihres Gegenübers einzusehen und somit vor dem Geschlechtsverkehr alle sexuell übertragbaren Krankheiten auszuschließen.
Omen war der Verifikator Fabularasa, der anhand für bloße Ohren unhörbarer Tremoli in der Stimme eines Gesprächspartners dessen Aufrichtigkeit ermessen konnte sowie Behauptungen kontextuell dekonstruieren und linguistisch reinigen, um sie mit der alexandrinischen Faktendatenbank der Omen abzugleichen und dem User ihren prozentualen Wahrheitsgehalt in Form einer Holznasengraphik zu präsentieren.
Omen war Freudiana, eine Coaching-Plattform für Panikmanagement und Psychotherapie, deren virtuelle Analytikerin Diana als intime Vertraute aus dem Alltag von Millionen Deutschen bald nicht mehr wegzudenken war.
Den Bau des Omen Tower am Ufer jedoch hatte die Anwendung Nosferatu finanziert, die auf Basis digitaler Profile chemische Erfahrungen kuratierte und deren Drohnen nach der Legalisierung die nächtliche Lufthoheit über deutschen Ballungsräumen erobert hatten – als Yin zum Yang ihrer Tochter Van Helsing, die ohne Unterlass die Datenströme aus den Nanoimplantaten kontrollierte und bei Gefahr die Notrettung rufen und zum genauen Standort der Konsumentin leiten konnte.
Der Zeitgeist füllte Omen die Segel, etwa der Trend zum Protektionismus, die globale Tendenz zu einem nachhaltigen Lifestyle-Patriotismus, der sich in Deutschland vor allem in einer Verstärkung der Neigung zu lokalem Konsum manifestierte – zu Grimms Märchen als Reservoir für Tätowierungsmotive beispielsweise und natürlich auch zu jenen digitalen Diensten, die sich als Unique Selling Point Datensicherheit Made in Germany auf die Fahnen schrieben.
Es ging dabei um den Ekel der Deutschen vor Garnelen aus industrieller Brackwasserzucht in Bangladesch, die in einer Brühe aus Schwermetallen und Wachstumshormonen in drei Wochen von der Larve zur Discounter-Delikatesse der Yellow-Fever-Riesengarnele mutierten, sowie um ihre Liebe zur Nordseekrabbe, im Watt vor Pellworm von den letzten Pferdefischern gefangen – stattlichen Mannsbildern des erdigen Sattelschmalzes, deren wässrige Augen seelische Tiefe anklingen ließen, ja den unerzählten Reichtum unserer Vergangenheit.
Eine kosmische Druckwelle trieb Omen voran, die schon bald nicht mehr als Eigenbau-Jolle, sondern als Airbus A420 zu verstehen war, der über dem Atlantik auf atmosphärischen Starkwindbändern kitesurfte, auf dem Jetstream – als Folge des Temperaturgefälles zwischen den Breitengraden ziehen gewaltige Luftströme vom Äquator zu den Polen, wobei sie von der Kraft der Erdrotation abgelenkt werden und aus den polwärts wehenden Gradientwinden die ostwärts fließenden Strahlströme entstehen.
In den Jahren zuvor hatten diese eine rasante Beschleunigung erfahren, sodass Linienmaschinen über der Südküste Grönlands regelmäßig die Schallmauer zu Fall brachten, ohne dabei einen donnernden Verdichtungsstoß zu verursachen, da sie in die Windbänder eingebettet waren und im Kontext dieser unterhalb der kritischen Schwelle blieben. Nicht wenige Piloten wählten Ausweichrouten, um die Vektoren zu vermeiden, da sich in ihnen oft gewaltsame Turbulenzen verbargen und viele Experten den hauchdünnen Karbonaußenschalen der neuesten Generation von Passagierflugzeugen mit Argwohn begegneten.
Der CEO aber kam nicht mal der Gedanke, Omen vom Kurs abzubringen, in Sturmfronten würde sie vielmehr freihändig hineinbeschleunigen, schließlich hatte sie ihr Unternehmen nicht allein unter den Aspekten Klimafreundlichkeit und Kosteneffizienz konstruiert, sondern die Parameter des Wolkendampfers 747 adaptiert, der mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor von einem dabei rauchenden Alkoholiker mit einem Griffel auf ein Reißbrett gezeichnet worden war.
«Wir haben Sehnsucht danach, uns vom Sekundärnutzen zu emanzipieren – das können wir uns ruhig eingestehen, auch wenn wir bei Omen diesem Phänomen mehr oder weniger vollständig unseren Wohlstand zu verdanken haben, den Überfluss, in dem wir leben. Nicht jede Äußerung oder Handlung soll dazu dienen, ihren Wiedergänger zu produzieren und in einen autonomen Verwertungskreislauf einzuspeisen.
Die Produktivität, meine Lieben, diese Wahrheit sollten wir nicht aus den Augen verlieren, die Produktivität ist für die Maschinen, für unsere funktionalen Helferlein. Wir aber sind schöpferische Organismen und sollten unsere Hallräume nicht ohne Not mit derart kleinbürgerlichen Parametern in Berührung bringen.
Wir müssen zurück auf die primäre Ebene», so sprach sie weiter, «zu den Grundpfeilern unserer Menschlichkeit, um die Krise unserer Vorstellungskraft zu überwinden. Um die Fragen zu beantworten, die uns auf der Seele brennen: Wie frei sind wir? Bestimmen planetarische Konstellationen unser Schicksal? Was verbindet uns überhaupt mit anderen? Wer waren wir in grüner Vorzeit, als unser Territorium noch vollständig unter Urwäldern im Schlummer lag?
Wer sind wir, wenn wir nicht mehr arbeiten? Was sollen wir dann machen? Wie soll unsere spirituelle Erneuerung aussehen? Sind wir Deutsche überhaupt noch zur Muße fähig? Oder kommen wir da nur wieder auf dumme Ideen?»
Ihren Rückenwind hatte die Omen auch einem Mann namens Joachim zu verdanken, dem Vater ihrer sagenumwobenen Entwicklungsabteilung – natürlich, Teamwork blablabla, aber dieser eine Geist hatte nicht nur Diana zur Welt gebracht, sondern auch Erda, die zentrale Säule der späteren globalen Dominanz des Unternehmens.
Joachims Lider waren einem mittelfrequenten Tremor unterworfen, denn in seinem Jahrzehnt bei Omen hatte er ein Schlafdefizit von über zwei Jahren akkumuliert, sodass seine Wahrnehmung hin und wieder in die Ohnmacht hineinflimmerte. Er konnte der Erschöpfung als Zustand allerdings auch Positives abgewinnen. Denn wenn man ihm die Erholung verweigere, so in etwa seine These, dann rette das menschliche Gehirn sich in ein Notprogramm, das keine Energie für die übliche assoziative Kakophonie bereithalte und dem Bewusstsein somit erlaube, punktuell in die Tiefe zu gehen.
Joachim stand im hohen Gras am hinteren Rand der Menschentraube, wobei der Begriff hier inakkurat war, denn erst hatte das Publikum sich zu einer Birne formiert, mit dem Strunk zum Podium, da zu Beginn niemand in der ersten Reihe hatte stehen wollen, bis ihre Neugier die Anwesenden um die Rednerin zu einer Banane arrangiert hatte.
Die Dekade der Pandemien hatte eine Schneise der Verluderung in den Stil deutscher Männer geschlagen, die Joachim offenbar gerade recht gekommen war, denn zu einem hellblauen Leinenjackett, das sich am Kragen schon in Auflösung befand, hatte er eine purpurne Pyjamahose gewählt, zur Feier dieses historischen Tages.
Seine Zielsetzung für die vergangene Stunde war es gewesen, einen Drei-Liter-Glasballon isländischen Gletscherwassers zu leeren, und als er seinen Plan in die Tat umgesetzt hatte, stahl er sich davon, in die Dunkelheit, in Richtung der roten Positionslichter der Lufttaxen am fernen Saum der Wiese, wo er den Ballon abstellte, auf einen hüfthohen Findling hinaufkletterte und den elastischen Bund seiner Pyjamahose hinunterschob, um der Mondsichel einen druckvollen Urinstrahl darzubieten. Seine Augen ließen dabei das gedimmte Seelenlicht jener Menschen erahnen, deren Gedanken obsessiv um das Bewusstsein der Tatsache kreisen, dem Grabe nun schon um einiges näher als der Gebärmutter zu sein.
Das Sternenlicht tänzelte auf dem Scheitelpunkt seiner Parabel, wobei er einen gravitätischen Habitus zeigte, als hege er die Absicht, der Mondgöttin Mani die Ehre zu erweisen oder der Nacht selbst ein feierliches Opfer zu bringen.
Wo war Joachim, während er mit dem Biotop kommunizierte? Ließ er gerade einen Kamm durch goldene Kinderhaare gleiten? Sah er die schwarzen Galeonen vor Messina segeln? Konnte er das Rattern der Totenkarren hören und das Weinen der Hinterbliebenen?
Kam ihm gerade eine neue Omen-Marke, erst die Idee und dann gleich die komplette Umsetzung samt diversen Präsentationen im Wortlaut, und erfreute er sich daran, sie einfach ziehen zu lassen, ohne sie mit einer Welt aus japsenden Verbrauchern zu teilen?
Oder war er wieder in diesem Prädator-Modus, der ihn manchmal ereilte? Hatte Joachim sich in das Bewusstsein eines Andenkondors begeben, der im Warteflug mit einem Endorphinschub zur Kenntnis nimmt, dass der kleine Pablo sich zum ersten Mal ganz allein auf den Weg zur Wasserstelle gemacht hat?
Sein urologischer Trakt arbeitete einwandfrei, das war offenkundig, der Beckenboden kräftig, die Prostata weich, und seine Nieren schienen gut durchspült und ohne Steine zu sein, sodass sich seinem Flow kein Hindernis entgegenstellte. Der hohe Strahldruck war nicht nur in Anbetracht seines Alters erstaunlich, denn er war gerade 48 geworden, sondern auch vor dem Hintergrund der tropischen Temperaturen, in denen die Produktion eines Schweißfilms zur Kühlung dem menschlichen Organismus ununterbrochen Flüssigkeit entzieht, die bei gemäßigter Witterung zum Füllstand von dessen Blase beigetragen hätte.
Andererseits hatte Joachim die Angewohnheit, sich konstant mit Quellwasser zu betanken, auf systematische Weise, als würde er eine Pflicht erfüllen, als würde er eine Behandlung absolvieren, als sei er kein alternder Mitteleuropäer, sondern ein Kamel am Vorabend einer gefährlichen Wüstenpassage – durch die Ténéré, auf der alten Karawanenroute für Gold, Elfenbein, Sklaven und Konkubinen.
Die beachtliche Fließrate legte zudem nahe, dass er dynamische Verstärker visualisierte – Wasserfälle, offene Hydranten, Zeitlupenbilder berstender Staudämme und die dunkelgrünen Mercedes-Wasserwerfer am Rande der Demonstrationen seiner Jugendjahre.
Joachim liebte diesen Vorgang, das Erleben einer flutenden Kraft, die Gifte und Rückstände aus seinem Organismus spülte, bis sein Gemüt sich aufhellte, bis seine Sinne wach wurden, bis die Spuren der verschwendeten Jahre von ihm abfielen, insbesondere dann, wenn er in der Nacht zuvor Wein getrunken hatte, was oft der Fall gewesen war in der nahen Vergangenheit, in den Monaten der Abwicklung seines offiziellen Lebens.
Denn niemand hatte auf ihn gewartet, keine warme Stimme hatte ihn empfangen, wenn er spät abends seine Tür aufgeschlossen hatte, nur das kaum hörbare Flüstern des Weinkühlschranks, den er in seinem Zimmer an die freie Wand hatte stellen lassen, neben die Fotografie einer Berliner Straßenszene, auf der geduckte Gestalten in froststarren Mänteln mit Säcken voller Rüben an Ruinen vorbeieilten.
Ein Jahr zuvor war Joachim in ein Hotel gezogen, um sich von Ballast zu befreien, von einer Lebensphase, die nicht viel mit ihm zu tun gehabt hatte, von einem Jahrzehnt, das ob seiner Gleichförmigkeit in seiner Erinnerung nun auf ein paar Monate zusammenschnurrte, die ihm als geringfügig erschienen, vom Detritus einer Zeit, die kein Gewicht besaß, die in Joachim nicht weiterleben würde, die nicht mal ein Regentropfen war über dem stillen Ozean seiner Kindheit.
Er besaß keine Häuser, keine Möbel, keine Bibliothek, keine Kunstsammlung, noch nicht einmal ein Smartphone nannte er sein Eigen, nur ein antikes MacBook Pro aus dem Modelljahr 2008, das er schon mehrfach hatte aufarbeiten lassen und trotzdem am Stück maximal eine Stunde lang nutzen konnte, bevor dessen Akku zu glühen begann. In den Nächten war Joachim, wenn überhaupt, nur über das im Entrée seines Zimmers an die Wand montierte Wählscheibentelefon zu erreichen gewesen.
Er besaß zwei Jacketts, vier Paar Schuhe, ein Fahrrad mit Titanrahmen, aktuell etwa zweihundert Flaschen Wein, knapp neun Prozent der Stammaktien der Omen SE und einen Koffer mit Erinnerungen – Briefe, Zeugnisse, Siegerurkunden, Notizbücher, ungültige Reisepässe und einen Brontosaurus aus Ton mit abgebrochener Schwanzspitze, den Joachim in der Grundschule gebrannt hatte.
Das Hotel lag abseits der Poké- und Ramen-Gebiete, im Rentnerstadtteil Wilmersdorf, in einer verschlafenen Seitenstraße, in der sich zudem eine historische Apotheke sowie die griechische Pilsbiertaverne befanden, in der Joachim sich am Abend vor Inkrafttreten der Fleisch-Prohibition kurz vor Küchenschluss ein letztes Mal den Grillteller Spartakus bestellt hatte.
Sein Umzug in das Hotel war natürlich auch der Zwanghaftigkeit geschuldet gewesen, die seinen Alltag immer mehr dominiert und ihm keine Wahl gelassen hatte, als in jeder Nacht vor dem Schlafengehen die korrekte Schließung aller Fenster in seiner riesigen Wohnung zu überprüfen, um etwa den Einstieg einer Bande von Entführern über die Regenrinne zu vermeiden, was zu einer Serie wahnhafter Rüttelvorgänge geführt hatte, nach deren Abschluss Joachim dann jedes Mal dazu übergegangen war, wie in Trance auf die Wählhebel und die Strömungsöffnungen der sechs Gasbrenner in seiner Küche zu starren.
Die Markierungsstriche zeigten stets allesamt nach oben, und es war auch kein Zischen zu hören, aber die Frage war doch, ob das Sichtbare Gültigkeit hatte oder ob die katastrophalen Szenarien, die sich in seiner Wahrnehmung entfalteten, sobald er die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen hatte, nicht ein äquivalentes Gewicht besaßen.
Sein Dasein war nicht stabil, so viel war klar, denn wenn er nur einen dummen Fehler machte, wenn er nur ein falsches Bild abspeicherte, wenn er nur einmal die Zügel lockerließe, dann würde eine ungeborene Wirklichkeit die Regie übernehmen, dann würde er einen der Wählhebel auf MAX übersehen, dann würde die mechanische Strömungsunterbrechung versagen, die Wohnung sich mit Gas anfüllen und die alte Elektrik des nur kosmetisch sanierten Gemäuers einen Funken produzieren.
Der Umzug war also auch als radikales Zusammenstreichen seiner allabendlichen Paranoia-Checkliste zu verstehen, da sein neues Zuhause keinen Ofen hatte, dafür einen Nachtportier als Bollwerk gegen allerlei Unbill sowie einen Rauchmelder unter der hohen Zimmerdecke.
Das Hotel kam nicht vor im Internet und war Joachim nur aufgefallen, da er spät abends einmal zu ebenjener Apotheke gefahren war, die zufällig Notdienst gehabt hatte, um seine krümmenden Rückenschmerzen wie auch die Düsternis in seiner Seele mit dem üblichen Cocktail aus Ibuprofen, Aspirin, Omeprazol und Puligny-Montrachet zu narkotisieren. Auf der dunklen Straße dort hatte ein Balkon seinen Blick eingefangen, der im ersten Stockwerk in die Zweige einer Straßenlinde hineinragte, wie die offene Brücke eines Kreuzers aus der Kaiserzeit, und durch den Wackelkontakt des alten Leuchtschildes der Absteige in ein mesmerisches Flimmern getaucht war.
Kurz darauf hatte er sich dann in die Suite mit besagtem Balkon eingemietet, die aus zwei Räumen bestand, die durch einen eleganten Rundbogen verbunden waren. Das Bett stand im Erkerzimmer auf einem Perserteppich mit ausgetretenem Flor, während irgendjemand für das Balkonzimmer wohl Jahrzehnte zuvor eine Sitzgruppe aus Nussbaum gewählt hatte, deren Elemente mit grünem Velours in der Schattierung von Erbsensuppe überzogen waren.
Das Hotel war als Transitbereich zu verstehen, denn Berlin war Joachim zu einer kaum mehr erträglichen Folter geworden. Schon der halbstündige Transfer auf dem Fahrrad zwischen Wilmersdorf und dem Omen Tower in Neukölln an jedem Morgen und Abend ließ ihn an der Möglichkeit einer sinnvollen Zukunftsperspektive für Deutschland zweifeln.
Das defizitäre Gebaren der Verkehrsteilnehmer in der Berliner Innenstadt ließ eine schleichende kognitive Degeneration der Bevölkerung erahnen. Wenn Joachim sich etwa einem Flüsterlaster näherte, dessen Fahrerin im Verkehr einfach angehalten hatte, um abrupt eine Wischtätigkeit aufzunehmen, sodass er auf seinem Rennrad ein Überholmanöver startete, dann fuhr die Betroffene meist ruckartig wieder an, womit sie ihn im Gegenverkehr fixierte, ohne die Situation zu überblicken, ohne ihn überhaupt wahrzunehmen. Seine einzige Chance war dann, sich hinter ihr wieder einzuordnen, was jedoch das Risiko mit sich brachte, dass sie erneut auf die Bremse steigen würde, wenn sie etwa der Impuls ereilte, noch schnell die Fotos von ihrem letzten Bibimbap mit den Artgenossen zu teilen.
Wie schafften es solche Menschen, sich ihre Schnürsenkel zu binden? Waren sie auf den Gebrauch fersenloser Gummischlappen angewiesen? Konnten sie auf Ausscheidungssignale angemessen reagieren, oder mussten sie Windeln tragen? Diese oder ähnliche waren seine Fragen. Konnten sie mit Messer und Gabel umgehen, oder hatte ihr Speiseplan sich auf Flüssignahrung reduziert, die sie durch eine ungekochte Makkaroni saugen mussten, da ja keine Plastikhalme mehr zugelassen waren?
Joachim fuhr immer ohne Helm und aus Prinzip ohne Licht, da er das Gefühl haben wollte, nur sein Kopf würde durch die Dunkelheit fliegen, ohne den Mühlstein seines Körpers und auch ohne das Kurbelgerät, das jener zur Fortbewegung benötigte, sodass ihm nicht erspart bleiben konnte, dass irgendein Passant, an dem er vorbeigerauscht war, als Schatten, wie ein Unheilsbote, ihm erschrocken eine Rumpfaussage à la «Ohne Licht!» hinterherbellte, als würde er die spirituelle Stagnation seiner Heimat beschreiben.
Mal abgesehen davon: Wann bitte sollte er derartiges Zubehör erwerben? Sollte er auf dem Weg in die Kimchi-Zone tatsächlich vor einem Fachhandel anhalten? Sollte er dort ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen? Dafür sollte er Zeit aufwenden? Darauf sollte er seinen neuronalen Apparat konzentrieren? Und da er sich weigerte, irgendetwas online zu bestellen, aus tief empfundener Ablehnung, gab es eben keine Möglichkeit, sich eine Lampe anzuschaffen – gut, er hätte eine Mitarbeiterin damit beauftragen können, aber das wäre ihm zu intim gewesen.
Er fuhr auch gern auf Bürgersteigen, um sich flüssig in den Kraftfeldern zu bewegen, wobei er die Beobachtung gemacht hatte, dass Gruppen von zwei oder mehr miteinander bekannten Kleinbürgern sich meist so formierten beim Nebeneinanderlaufen, dass sie die ganze Breite des Bürgersteiges blockierten, sodass für Joachim nicht möglich war, sie zu passieren, ohne sie anzusprechen, wonach er einen Kommentar à la «Wohl besonders eilig heute» ernten würde, oder sie durch lautes Klingeln aufzuschrecken, in welchem Fall es dann eher auf «Mensch, es gibt auch Fahrradwege, das ist doch asozial!» hinausliefe. Oder man konnte durch eine der Lücken schießen, wobei die Flaneure erst zusammenzuckten, um dem Missetäter dann eine Basisinformation à la «Bürgersteig!» hinterherzuschreien.
Was aber war der Zweck dieser Äußerung? War denn nicht unstrittig, dass es sich um den Bürgersteig handelte? Es war ja nicht davon auszugehen, dass der Lump dort irrtümlich unterwegs gewesen war, da er das Trottoir für eine Straße gehalten hatte. Was also war ihre Motivation beim Schreien? Hatten sie sich vorgenommen, ehrenamtlich die Einhaltung irgendwelcher Verkehrsregeln zu gewährleisten? Diese oder ähnliche waren Joachims Fragen.
Was genau wollten diese Menschen? Wie kam man überhaupt darauf, einem Fremden die Passage zu verweigern? Warum würde man nicht instinktiv einen Korridor lassen? Warum würde man nicht links- oder rechtsbündig flanieren? Dieses mittige Laufen, also die grundsätzliche Weigerung, andere vorbeizulassen, ohne ihnen die eigene Kreatürlichkeit aufzuzwingen, hatte sich unter deutschen Passanten damals wie unter deutschen Nutztieren einstmals die Maul- und Klauenseuche verbreitet.
Aber nicht etwa, dass er seine eigene Kohorte goutierte, Joachim war vielmehr sprachlos darüber, dass er sich in der sogenannten Tech-Branche verortet hatte, in der Datenwirtschaft, als Teil des Berliner Startup-Ökosystems, denn das alles war in seinen Augen so unfassbar démodé. Dass er als Disruptor galt, als Change Agent, als Marketing Mastermind, dass er von Betriebswirten und Informatikern verehrt wurde, in den Himmel gehoben sogar, wie war das denn bitte passiert?
Wie zum Teufel war er in eine solche Gesellschaft geraten? Er bekam es nicht mehr zusammen in seiner Erinnerung. Die entsprechende Datei musste im Zuge seiner fortwährenden Speicherpflege wohl als irrelevant kategorisiert und automatisch gelöscht worden sein.
Wenn er abends wieder nach Westen beschleunigte, in Richtung Zivilisation, in Kreuzberg durch die Dieffenbachstraße, wo sich die United Nations der ethnofluiden Systemgastronomie angesiedelt hatten, triggerte seine Erscheinung ein Raunen unter den Veganern, die wie Gazellen über Wasserlöcher über panasiatische Suppenschüsseln gebeugt saßen oder über glutenfreie Fladen, die mit einer Auswahl an panorientalischen Pasten bestrichen waren.
Wenn er dort durch die Schlürflärmkulisse raste, wie ein Derwisch vorbei an den Lampions der Hipsterkantinen, sah er die Untertanen aus ihrer Verpflegung aufschrecken, als könnten sie ihren Augen nicht trauen, als hätten sie ein Phantom vorbeifliegen sehen, und er wollte nicht böse sein, Verständnis aufbringen, nicht immer so eine kritische Haltung einnehmen.
Aber wenn sie dann auf die Tische stiegen, um ihm «Meister!» oder «Heiland!» hinterherzubrüllen, nahm er beide Hände vom Lenker und streckte sie in den Himmel empor, um dem Fußvolk hinter ihm seine Stinkefinger zu zeigen.
«Und auf einmal ist es so weit, verehrte Anwesende. Wir stehen vor dem Nichts und damit vor einer kaum fassbaren Verheißung. Das Leitbild einer Gesellschaft, in deren Zentrum die Knechtschaft steht, ist in den eisigen Strudel des Vergangenen geraten – woran wir bei Omen nicht ganz unschuldig sind. Denn wir haben ja unermüdlich daran gearbeitet, den Deutschen ihre Arbeit abzunehmen.
In unserer Maßlosigkeit haben wir den leeren Booster des industriellen Zeitalters abgesprengt, um das Hyperschalltriebwerk einer evolutionären Eskalationsstufe zur Zündung zu bringen. Wir haben noch gar nicht begriffen, mit was für einem ungeheuerlichen Vorrecht wir gesegnet worden sind. Nicht jeder Generation wird eine Stunde Null geboten, nicht jede Generation sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, die Anthropogenese voranzutreiben – vom Zeitalter der Arbeit in das Zeitalter der Muße, der Freiheit», so sprach sie weiter.
«Natürlich hat die Erosion unserer Wirtschaftsordnung eine Destabilisierung nach sich gezogen, natürlich werden wir den Epochenwandel auch als Abfolge schmerzlicher Verluste erleben. Aber mal ehrlich, all unseren Ängsten zum Trotze, unseren Zweifeln und Hemmungen – vielleicht sind es gerade die Übergänge, die Trümmerphasen, in denen wir als Deutsche ganz mit uns im Reinen sind.»
Den Zumutungen der Gegenwart setzte die Omen einen Rückzug entgegen, aus dem Geschrei der Jahrmarktbühne in die Sphärenklänge eines Wellnessbereiches, in dem die Fremden einander aber nicht die Körperöffnungen algorithmisierten, sondern in Bademäntel gehüllt und im Ruheraum in gebundene Romane vertieft waren. Aus dem Pöbelsport der Fußgängerzone in das Geflüster eines Kaffeehauses hinein, um dort stundenlang das Bewusstsein vagabundieren zu lassen, ohne von einem Stakkato aus maßgeschneiderten Verlockungen abgelenkt zu werden.
Und schon rasten die Hologramme durch die Dunkelheit, schwebende Gitternetzgraphiken, der Nachtzug aus Wien, Schnapstrinker in Dreiteilern, die von Thonetstühlen fielen, die verwilderten Küsse lichtscheuer Paare, auf dem Omen-Event im Berliner Zentralflughafen, dem alljährlichen Produktgötzendienst des Unternehmens.
Das Rasseln der Lungen war zu hören, das Rascheln der Tageszeitungen, bevor sich auf der Mauer der Tempelhofer Maschinenhalle das Auge des mythologischen Strudels offenbarte, ein simples Kompositum, eine weitere Omen-Marke, zitternd wie die Arbeitshand eines tuberkulösen Literaten.
Die neue Plattform einfach «Kaffeehaus» zu nennen war in der Heimatbranche auf ein eher verhaltenes Echo gestoßen. Das sei schon eine attraktive Präsentation gewesen, so ging der Tenor, es sei auch höchste Zeit, dass Omen ein soziales Medium anbiete, aber der Markenname sei eindeutig zu kerzengerade. Zu naheliegend seien die Assoziationen, zu eingefahren die Verbindungslinien. Die Legende vom Kaffeehaus als Heimstatt jener, die allein sein wollten, dazu aber Gesellschaft brauchten, harmoniere ein wenig zu nahtlos mit dem Konzept der schweigenden Gleichzeitigkeit, das Omen dem Fiepen der Spielhölle entgegensetzen wolle.
Der frühe Inkubator, der erste Co-Working-Space, in dem man für den Preis eines kleinen Braunen den ganzen Tag lang verweilen konnte, sodass Menschen aller Couleur willkommen waren, sofern sie die sozialen Codes beherrschten – das alles passe zu sauber zu der Melange aus elitärem Geist und demokratischem Spirit, die Omen in einen Umsatzstrom überführen wolle. Das sei zu stimmig, das wirke geradezu synthetisch in seiner Treffgenauigkeit, so in etwa die Reaktionen, es fehle der Makel, die Irritation, die kleine Verschiebung, in der die Erregung entstehe.
Der Entschluss bei Omen war allerdings nicht einem Fokus auf deutschsprachige Märkte geschuldet, sondern einer Auswertung der anglophonen Datenreservoire der Freudiana, die in den amerikanischen Küstenregionen damals schon erste Penetrationserfolge vorzuweisen hatte.
Die Analyse Tausender Therapieprotokolle hatte eine Häufung sogenannter Germanismen ergeben, von Lehnwörtern aus dem Deutschen, unter denen Kaffeehaus sich nach Angst und Schadenfreude überraschend auf den dritten Platz geschoben hatte – noch vor Weltschmerz, Götterdämmerung, Blitzkrieg, Poltergeist, Lumpenproletariat und Gemütlichkeit.
Der Terminus schien sich zu einem Fetisch zu entwickeln, zu einer vagen Über-Metapher für alle Vorgänge und Phänomene, die sich außerhalb der Verschwörung der spätkapitalistischen Händlermoderne bewegten. Der Begriff als Virus hatte das amerikanische Idiom mit der unterschwelligen Sehnsucht danach infiziert, so die These bei Omen, sich fortan nicht mehr zu Gewinnwarnungen und Hasskommentaren, sondern zu Aphorismen und poetischen Beschwörungen zu arrangieren.
Das Wort Kaffeehaus hatte sich zum Symbol des Widerstandes profiliert, zum Portal in europäische Wonnegefilde und nicht zuletzt zum seelischen Anker der kulturell prägenden Armenkaste, die Omen als den Nukleus der amerikanischen Zielgruppe von Kaffeehaus identifiziert hatte. Es handelte sich um vormalige Mittelklasseamerikaner, deren Bildungskredite gebündelt und von arabischen Konsortien an chinesische Syndikate weiterverkauft worden waren, aus deren Richtung die freien Geister nun auf allen Kanälen automatisierte Inkassodrohungen erreichten.
Sie brauchten eine Plattform für ihresgleichen, so die These bei Omen, deren implizite Bildungsschwelle nicht nur den gemeinen Pöbel, sondern auch den gehobenen Konsumenten entmutigen würde. Sie verspürten die Sehnsucht danach, sich in der Pflege eines zivilisierten Snobismus emotional zu regenerieren.
Sie wollten abwarten, sie wollten nachdenken, sie wollten versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu stabilisieren, bis sie etwas von Gewicht zu sagen hätten, und ihren Beitrag dann als echte Publikation begreifen. Sie wollten sich als Teil eines belesenen Bundes imaginieren, eines abgründigen Kreises, den man in vergangenen Tagen als die Bohème bezeichnet hätte.
Und so war die Plattform ein typisches Omen-Produkt jener Jahre – nicht die Neuerfindung des Rades und auch nicht die Marsrakete, sondern nur das erste in einer langen Reihe sogenannter exklusiver sozialer Medien, mit denen das Unternehmen seinen Fokus von disruptiven Risikosparten immer mehr auf erprobte Servicekonzepte und etablierte Suchtstrukturen verlagerte.
«Die Omen SE ist ein sehr deutsches Unternehmen und so haben wir früher als andere gesehen, dass wir die totale Rationalität erreichen müssen, um unser Joch abzuwerfen, um uns in der Melancholie zu verlieren, um endlich alles hinter uns lassen zu können.
Denn ich frage euch: Wer von uns hat auch nur einen einzigen Augenblick zu verschenken? Wer möchte sich unterordnen, wer möchte nach fremden Regeln leben? Wessen Seele erfüllt es mit Genugtuung, einen Großteil seiner Tage dem Mammon geopfert zu haben? Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage: Wir Deutsche wollen lieber in unseren verbliebenen Mooren versinken, als weiterhin faule Kompromisse einzugehen.
Unsere Mission ist es, hinter den irdischen Schleier vorzudringen, in den Bodenflug unserer Sensenklingen durch die von Tau benetzten Grashalme. Unsere Mission ist es, in Erfahrung zu bringen, wohin der freie Wille uns treibt, wenn wir ihm denn endlich mal Folge leisten.
Zu Beginn war die Erde des Winters, und von nun an wird sie des Sommers sein. Gesegnet sei die Schönheit unserer vom Gewicht der Beeren gebeugten Dornenzweige», so sprach sie weiter, «inmitten derer wir nun hinter der nächsten Biegung im Wege verschwinden werden.»
Der natürliche Lebensraum sozialer Medien aber waren die Kinderseelen, sodass die Intelligenz bei Omen sich bald auf die Heranwachsenden konzentrierte, auf die inneren Bilderwelten einer Generation, deren Angehörige meist schon als Teenager der Illusionen müde waren. Denn an jedem Morgen, wenn sie aus unruhigen Träumen erwachten, konnten sie am Horizont eine Abfolge aus apokalyptischen Schwellen heranrasen sehen.
Wenn es ihnen nicht gelingen würde, alle Industrienationen unter einem Regime des Verzichts zu vereinen, dann würden sich irreversible Kettenreaktionen in Gang setzen und die Erwärmung des Planeten immer weiter beschleunigen, unabhängig von allen dann noch getroffenen Maßnahmen, was eine rapide Eskalation der Zerstörung nach sich ziehen würde.