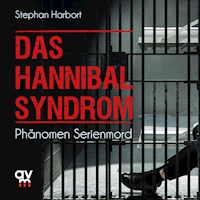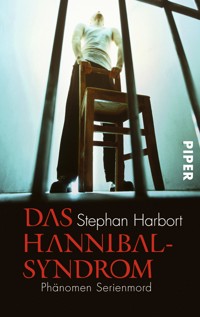7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das erste Sachbuch zum Thema Cold Cases - Pflichtlektüre für alle True-Crime- und Krimi-Fans! Wenn keine Spur zum Täter führt, wenn nichts mehr geht, wenn die Ermittlungen eingestellt werden müssen, dann spricht man von einem "Cold Case". Die Gerichtsakten der "kalten Fälle" vergilben in den Archiven der Ermittlungsbehörden, dicke, prall gefüllte Stehordner voller grausiger Details, mit Bildern blutbesudelter Leichen, zertrümmerter Schädel oder abgetrennter Körperteile. Und auf der letzten Seite findet sich stets der obligatorische Vermerk des Staatsanwalts: "Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Das Verfahren wird vorläufig eingestellt." Etwa 95 Prozent aller bekanntgewordenen Morde werden aufgeklärt. Zehn bis 20 Tötungsdelikte können pro Jahr hierzulande nicht aufgeklärt werden. Über tausend Fälle in den vergangenen Jahrzehnten. Diese "Cold Cases" werden von Spezialisten der Mordkommission bewertet, ob Hinweise übersehen oder Ermittlungsansätze nicht erkannt worden sind, oder ob nun nach all den Jahren mit neuester Kriminaltechnik alte Asservate erfolgversprechend untersucht werden können. In seinem Buch erzählt Stephan Harbort spektakuläre Cold Cases, die in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland aufgeklärt werden konnten, und spricht dabei alle Facetten dieses Themas an - authentisch, spannend, empathisch, informativ. Stephan Harbort, Jahrgang 1964, ist Kriminalhauptkommissa, führender Serienmord-Experte und Bestseller-Autor. Er sprach mit mehr als 50 Serienmördern, entwickelte international angewandte Fahndungsmethoden zur Überführung von Gewalttätern und ist Fachberater bei TV-Dokumentationen und Krimi-Serien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Stephan Harbort
BLUT SCHWEIGT NIEMALS
Deutschlands bekanntester Profiler erzählt die spektakuläre Aufklärung von Cold Cases
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn keine Spur zum Täter führt, wenn nichts mehr geht, wenn die Ermittlungen eingestellt werden müssen, dann spricht man von einem »Cold Case«. Die Gerichtsakten der »kalten Fälle« vergilben in den Archiven der Ermittlungsbehörden, dicke, prall gefüllte Stehordner voller grausiger Details, mit Bildern blutbesudelter Leichen, zertrümmerter Schädel oder abgetrennter Körperteile. Und auf der letzten Seite findet sich stets der obligatorische Vermerk des Staatsanwalts: »Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Das Verfahren wird vorläufig eingestellt.«
Etwa 95 Prozent aller bekannt gewordenen Morde werden aufgeklärt. Zehn bis zwanzig Tötungsdelikte können pro Jahr hierzulande nicht aufgeklärt werden. Über tausend Fälle in den vergangenen Jahrzehnten. Diese »Cold Cases« werden von Spezialisten der Mordkommission bewertet, ob Hinweise übersehen oder Ermittlungsansätze nicht erkannt worden sind, oder ob nun nach all den Jahren mit neuester Kriminaltechnik alte Asservate Erfolg versprechend untersucht werden können.
In seinem Buch berichtet Stephan Harbort von spektakulären Cold Cases, die in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland aufgeklärt werden konnten, und spricht dabei alle Facetten dieses Themas an – authentisch, spannend, empathisch, informativ.
Für Leo Gantzek († 12. Juni 2019).
Du fehlst.
Sehr.
»Ich merkte, wie er mich mit Laub bedeckte.
Erst mal hatte ich gar keine Schmerzen.
Ich schwebte über mir, sah meinen Körper.
Es war leicht, hell, es tat nichts weh.
Ich dachte, bleib einfach liegen.
Dann sah ich vor meinen Augen
meine Mutter und meine jüngere Schwester.
Ich dachte, du musst kämpfen.«
Die in diesem Buch geschilderten Verbrechen sind authentisch und entsprechen dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen bzw. der prozessualen Wahrheit. Die Namen der handelnden Personen sind größtenteils pseudonymisiert. Auch biografische Angaben wurden mitunter verfremdet. Diese Verfahrensweise dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte. Die in wörtlicher Rede oder als Dialog wiedergegebenen Passagen sind den genannten Quellen entnommen worden oder sinngemäß dargestellt. Die beschriebenen inneren Vorgänge der handelnden Personen fußen auf entsprechenden Selbstaussagen.
Vorwort
»Es gibt Mordfälle,
die lassen einen nie mehr los.
Besonders, wenn sie nicht aufgeklärt sind.«
Todesermittler
»Wir sind die Letzten,
die für Gerechtigkeit sorgen können.«
Cold-Case-Ermittler
»Die Täter, die bisher davongekommen sind,
können und sollen sich nicht sicher fühlen –
auch wenn ihre Taten Jahre zurückliegen.«
Cold-Case-Staatsanwalt
Wenn Kinder, Frauen, Männer oder ganze Familien in Deutschland vorsätzlich getötet werden, lassen die Ermittlungsbehörden gewöhnlich nichts unversucht, um diese besonders verstörenden und den sozialen Frieden beeinträchtigenden Verbrechen möglichst frühzeitig aufzuklären. Und dabei sind die Kripo und die Staatsanwaltschaft so erfolgreich wie sonst kaum: Die amtlichen Zahlenkolonnen des Bundeskriminalamts weisen für das Berichtsjahr 2018 insgesamt 2471 Delikte aus, die als »Mord, Totschlag oder Tötung auf Verlangen« qualifiziert werden. In 96,1 Prozent der Fälle gelang es, den Täter zu ermitteln. Seit Jahrzehnten ist die hohe Aufklärungsquote stabil.
Diese zugleich international beachtete Erfolgsgeschichte ist gewiss auch darauf zurückzuführen, dass es in der Regel zwischen Täter und Opfer eine Vorbeziehung gibt und die Delinquenten damit zwangsläufig ins Visier der Ermittler geraten. In solchen Fällen gelingt die Lösung häufig sogar binnen 72 Stunden. Besonders anspruchsvoll wird es immer dann, wenn von der üblichen Ermittlungsstrategie abgewichen werden muss, bei »Stranger to stranger«-Delikten zum Beispiel, wenn Täter und Opfer sich bei der Tat erstmals begegnen, meistens zufällig. Oder wenn der finale Beweis nicht geführt, der Beschuldigte nicht angeklagt oder der Angeklagte letztlich nicht verurteilt werden kann. Oder wenn die Fahnder auf der falschen Fährte sind und keinen Verdächtigen ermitteln können. Oder wenn den Ermittlungsbehörden Versäumnisse passieren, Fehler unterlaufen oder aus anderen Gründen die Hände gebunden sind. Auch das kommt vor: 60 bis 100 Tötungsdelikte bleiben hierzulande jedes Jahr ungeklärt. 2018 waren es genau 96 Fälle.
Wenn es nicht gelingt, den Mörder zu demaskieren, wenn die Nachforschungen eingestellt werden müssen, wenn nichts mehr geht, dann spricht man gemeinhin von einem Cold Case. Die Verfahrensakten der Altfälle vergilben mit den Jahren in den Archiven der Ermittlungsbehörden, faustdicke, prall gefüllte Stehordner voller irritierend abstoßender Details bis hin zu Nahaufnahmen verstümmelter Leichen, eingeschlagener Schädel, abgetrennter Gliedmaßen, blutbesudelter Tatorte und so weiter. Die menschliche Destruktivität hat viele Gesichter, allesamt hässlich und schwer erträglich. Am Ende, also auf der letzten Seite der Verfahrensakte, steht schließlich wie ein Menetekel der obligatorische Vermerk der Staatsanwaltschaft: »Die Ermittlungen werden nach Paragraf 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt.«
Genau das passierte in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland tausendfach. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen soll es nach Untersuchungen des Landeskriminalamts von 1970 bis 2015 insgesamt 1105 Cold Cases gegeben haben. Im internationalen Vergleich stehen die deutschen Todesermittler mit dieser Statistik gleichwohl hervorragend da, allein in den USA schätzt man die Anzahl der ungeklärten Morde auf etwa 200000.
Viele Mörder und Totschläger sind auch hierzulande ungeschoren davongekommen und leben unerkannt mitten unter uns, während ihre Opfer, die den mörderischen Angriff zumindest überlebt haben, und die Angehörigen der in den übrigen Fällen Getöteten täglich leiden – weil sie die Tat ohne Aufklärung nicht verarbeiten, nicht damit abschließen können; weil quälende Gefühle wie Wut, Verzweiflung, Enttäuschung, Hilflosigkeit und Angst sich kontinuierlich verstärken; weil das vergebliche Warten auf die erlösende Nachricht von der Festnahme des Gesuchten zermürbend ist; weil sich die Leidtragenden brisanten Selbstvorwürfen schutzlos ausgesetzt sehen und weil es zu wenig qualifizierte Therapeuten und geeignete Therapieangebote gibt. Besonders schlimm, mitunter unerträglich wird es aber spätestens dann, wenn die im steifen Amtsdeutsch formulierte und wenig empathisch wirkende Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vorliegt und damit jede Hoffnung auf Gerechtigkeit und Lebensqualität endgültig dahin ist. Doch auch das Selbstverständnis der Todesermittler leidet arg, denn ihr Anspruch ist immer gleichbleibend hoch: »Wir wollen jeden kriegen!«
»Cold Case« ist kein kriminalistischer oder juristischer Fachausdruck, sondern eine Wortschöpfung der Medien. Es existiert weder national noch international eine universelle Definition. Besonders umstritten ist, wie viel Zeit nach Beendigung der Ermittlungen vergehen soll, bis ein Altfall angenommen werden darf. Zwei Wochen? Zwei Monate? Zwei Jahre? Mittlerweile haben sich führende Fachleute hierzulande darauf verständigt, diese beliebig anmutende Komponente nicht zu berücksichtigen. Sinnvollerweise schlagen Experten des Landeskriminalamts in Düsseldorf folgende Begriffsbestimmung vor: »Mit Abschluss der eingesetzten Mordkommission wird ein ungeklärtes Tötungsdelikt als Cold Case bezeichnet.«
Die Wiederaufnahme von Ermittlungen ist jedoch nur dann möglich, wenn das zu verfolgende Verbrechen noch nicht verjährt ist. Gelingt es den Fahndern nicht, aus den Umständen der Tat wenigstens ein Mordmerkmal im Sinne von Paragraf 211 des Strafgesetzbuchs (StGB) herzuleiten, ist der Grundtatbestand, die »vorsätzliche Tötung eines Menschen« (»Totschlag« nach Paragraf 212 StGB), nach 20 Jahren verjährt, während dieser kategorische Ermittlungsvorbehalt für das qualifizierte und zwingend mit lebenslanger Haft bedrohte Delikt »Mord« nicht gilt.
Die beachtlichen Fortschritte in den forensischen Wissenschaften und der Kriminalpraxis berechtigen allgemein zu der Erwartung, weiter zurückliegende Straftaten auch nach Jahrzehnten noch aufklären zu können. Dies gilt in besonderem Maß für den Bereich der Tötungsdelikte. So sind beispielsweise Nachweisempfindlichkeit und Anwendungsspektrum der seit 1990 in Deutschland etablierten DNA-Analyse-Verfahren wesentlich erweitert worden, sodass bereits kleinste Bestandteile von Blut, Gewebeteilen, Sperma, Speichel, Vaginalsekret, Epithelzellen, Knochenmark, anagenen Haaren (die Wurzel ist intakt) oder Nasenausscheidungen genügen, um den Täter anhand seines molekulargenetischen Profils mit hoher Beweiskraft zu identifizieren.
Auch das im Jahr 1993 eingeführte Automatisierte Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS) ermöglicht auf der Basis von digitalisierten Fingerabdrücken bekannter Straftäter und Finger- bzw. Handflächenabdruckspuren unbekannter Delinquenten bundesweite, auch international ausgerichtete Recherchen, und zwar binnen kürzester Zeit mit hoher Verlässlichkeit. In früheren Zeiten, als an Tatorten noch umständlich Spurenkarten angelegt werden mussten, wäre so etwas undenkbar gewesen.
Was moderne Kriminalwissenschaften zu leisten vermögen, veranschaulicht beispielhaft der anfangs mysteriöse Fund einer skelettierten Leiche am Nachmittag des 21. Juni 1988 im Stadtwald der hessischen Kleinstadt Rosbach vor der Höhe. Weil die Leiche stark verwest war, konnte der Rechtsmediziner seinerzeit weder die Todesursache noch das Geschlecht bestimmen. Erst 29 Jahre später werden die Ermittlungen ohne besonderen Anlass wieder aufgenommen und verschiedene Experten mit umfangreichen Analysen beauftragt. Zunächst gelingt es Wissenschaftlern des Instituts für Rechtsmedizin in Gießen, aus einem Eckzahn der Leiche DNA zu extrahieren. Nach weiteren Untersuchungen steht fest, dass es sich um die Leiche einer Frau handelt, etwa 25 bis 35 Jahre alt, geboren zwischen 1953 und 1963 irgendwo in Europa. Zum Zeitpunkt ihres Todes muss die Frau schlank gewesen sein.
Rechtsmediziner aus München und Amsterdam führen auf der Basis von Schädel, Zähnen und Haaren der Leiche eine Isotopenanalyse durch (Isotope sind Varianten eines chemischen Elements). Weil menschliches Gewebe entsprechend der Zeit seiner Entstehung auch Informationen zu geografischer Herkunft, Aufenthaltsorten und Lebensumständen einer Person enthält, liegen bald weitere Informationen vor: Demnach ist die Unbekannte im südwestlichen Polen (Gebirgsregion) oder grenznah zur Ukraine aufgewachsen und während der Pubertät in südliche Alpenregionen verzogen, möglicherweise in die Schweiz oder den Norden Italiens.
Ihren letzten Lebensabschnitt muss die Frau außerhalb von Europa verbracht haben, weil die während dieser Zeit aufgenommene Nahrung für einen Aufenthalt in Indien oder einer anderen meeresnahen Region in Südostasien spricht. Nach Einschätzung der Experten ist die Rückkehr nach Mitteleuropa erst Mitte 1988 erfolgt, also wenige Wochen vor ihrem mutmaßlich gewaltsamen Tod. Zu Lebzeiten muss die Frau 1,65 Meter groß gewesen sein. Die Haare waren mittelbraun, gelockt, sie hatte Schuhgröße 34 oder 35 und Blutgruppe A. Die Frau hat 17 Zahnfüllungen besessen, überwiegend bestehend aus Silberamalgam. Besonderes Kennzeichen der Frau zu Lebzeiten: ein ausgeprägter Vorbiss.
Nach einer toxikologischen Untersuchung kann außerdem gesagt werden, dass die Unbekannte keine Drogen konsumierte. Letztlich gelingt es Fachleuten der Fachhochschule in Mittweida sogar, der Verstorbenen über eine computergestützte Rekonstruktion der Weichteile ein Gesicht zu geben. Auch wenn es bis heute noch nicht gelungen ist, die Frau zu identifizieren, belegt dieser Fall doch eindrucksvoll, welche teils erstaunlichen Untersuchungsmöglichkeiten moderne forensische Verfahren heutzutage bereitstellen.
Aber auch die Kriminalistik hat sich prächtig weiterentwickelt und neue Instrumente hervorgebracht, beispielsweise die systematisch-analytisch ausgerichtete Operative Fallanalyse (OFA). Über dieses standardisierte Verfahren können auf der Grundlage von objektiven Daten und einer Rekonstruktion des Tatgeschehens bei Cold Cases eine kriminalistisch-kriminologische Einordnung des Delikts vorgenommen und ein vertiefendes Fallverständnis erreicht werden, aber auch eine Aussage zur wahrscheinlichsten Täterpersönlichkeit ist möglich. Die fallanalytischen Erkenntnisse sind zudem geeignet, sowohl die historische als auch die aktuelle Ausrichtung der Ermittlungen kritisch zu hinterfragen und neue Ansätze für Erfolg versprechende Nachforschungen oder forensische Untersuchungen zu generieren. Ebenso können ehemalige wie aktuelle Verdächtige begutachtet und priorisiert werden.
Eine weitere Serviceleistung der OFA ist die Erfassung von Altfällen in der hierzulande seit 1988 betriebenen und ursprünglich in Kanada entwickelten ViCLAS-Datenbank (Violent Crime Linkage Analysis System), um auf Länder- und Bundesebene insbesondere bei Tötungsdelikten und Sexualverbrechen Tat-Tat-Übereinstimmungen, aber auch Tat-Täter-Zusammenhänge zu erkennen. Ebenfalls können anhand der im System gespeicherten Verhaltensfingerabdrücke vergleichende Analysen für den Fall durchgeführt werden, dass kein Sachbeweis für eine fallübergreifende Täterschaft vorhanden ist, gleichwohl aus den besonderen Umständen des Verbrechens und dem Verhalten des Täters entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden können.
Auch die moderne Computertechnik ermöglicht es der Polizei zwischenzeitlich, fallbezogen große Datenmengen zu erfassen, zu recherchieren, zu analysieren und zu bewerten. Allerdings müssen sämtliche Informationen aus den Altakten zunächst übertragen und an zentraler Stelle digitalisiert, systematisiert und in einem suchfähigen Archiv zusammengeführt werden, damit ein digitaler Aktenschrank entsteht; gerade bei Cold Cases ist dies eine zwingende Vorbedingung, will man den historischen Verlauf des Verfahrens verinnerlichen und verstehen, neue Wege beschreiten und den so eminent wichtigen zweiten Blick auf den Fall entwickeln. Diese und eine Vielzahl weiterer Optionen (beispielsweise die zeitnahe Einbindung der Bevölkerung über soziale Medien) erfordern geradezu ein professionelles Cold-Case-Management.
Neben dem lediglich kursorisch, nicht abschließend beschriebenen Anwendungs- und Auswertungsspektrum neuartiger oder verbesserter Ermittlungs- und Untersuchungsmethoden können sowohl Chancen als auch Risiken einer Altfallbearbeitung ebenso mit den natürlichen Zeitabläufen begründet werden. Denn: Veränderungen in vormaligen Beziehungsstrukturen bedingen mitunter differierende Beurteilungsgrundlagen und Anknüpfungspunkte, weil zum Beispiel der Täter von seiner Frau (die ihm ein falsches Alibi gegeben hat) mittlerweile getrennt lebt, weil eine Verbrecherbande nun nicht mehr existiert (und die darauf fußende Loyalität dem Täter gegenüber keinen Einfluss mehr besitzt), weil räumliche Veränderungen eingetreten sind (und der Einfluss des Täters auf Zeugen daraufhin geringer geworden ist) oder weil eine Falschaussage zugunsten des Täters nach eingetretener Verjährung nicht mehr verfolgbar ist, der Zeuge jetzt straffrei bleibt und nunmehr ermuntert werden kann, endlich die Wahrheit zu sagen. Insofern kann der sonst so erfolgskritische Faktor Zeit verborgene Spuren sogar freilegen.
Die kriminalistische Erfahrung lehrt jedoch ebenso, dass Zeugen sich des Zusammenhangs und der Bedeutung ihrer Beobachtung beziehungsweise Wahrnehmung erst viele Jahre später bewusst werden (zum Beispiel angestoßen durch Cold-Case-Medienberichte oder darauf spezialisierte TV-Sendungen) und maßgeblich zur Aufklärung der Tat beitragen. Für diesen Zeitkontext gilt ebenfalls, dass ältere forensische Gutachten mit verfeinerten Methoden überprüft und korrigiert werden können, sodass ein besonders robustes Aufklärungshindernis entfällt.
Zudem passiert es immer wieder, dass Personen in Verdacht geraten, eine abscheuliche Tat begangen zu haben, ihre Unschuld infolge ausbleibender Ermittlungen indes nicht bewiesen wird. Mit anderen Worten: zwar niemals festgenommen, aber lebenslänglich gefangen im Filz von substanzlosen, unberechtigten Vorurteilen und Vorverurteilungen.
So war es auch im Fall von Birgit Meier aus Lüneburg. Die 41-Jährige verschwand im Sommer 1989, seit 1994 ruhten die Ermittlungen. Die Kripo hatte zunächst ihren Ehemann, einen erfolgreichen Unternehmer, in Verdacht, seine Frau aus finanziellen Gründen ermordet zu haben, denn den Ermittlungen zufolge war ein unter für ihn besonders ungünstigen Vorzeichen stehendes Scheidungsverfahren anhängig, demzufolge der Verdächtige eine hohe sechsstellige Summe hätte aufbringen müssen. »Sie schrien mich an, ich solle es endlich zugeben«, schilderte Harald Meier später seine zwiespältigen Erfahrungen mit der Kripo, »sie haben mich echt gequält.«
25 Jahre lang galt der Mann als mutmaßlicher Mörder. Erst als ein Zusammenhang mit den sogenannten Göhrde-Morden (verübt binnen einer Woche im Mai 1989 an zwei Liebespaaren im niedersächsischen Staatsforst Göhrde) aufgedeckt und der wahre Täter, ein Friedhofsgärtner, posthum überführt werden konnte, war der vermeintliche Mörder zwangsläufig rehabilitiert – ein nicht nur in diesem Fall sehr beachtlicher Nebeneffekt erfolgreicher Cold-Case-Ermittlungen.
Die klassische Altfallprüfung – der Sachbearbeiter studiert allein die sehr umfänglichen Verfahrensakten, sucht nach Erfolg versprechenden Ermittlungsansätzen und lässt gegebenenfalls noch vorhandene Asservate insbesondere auf DNA-Spuren untersuchen – erscheint nicht sachgerecht, wenn diese anspruchsvolle und zeitintensive Arbeit unterbrochen werden muss, weil aktuelle Verbrechen Priorität haben. Erst wenn der »heiße« Fall aufgeklärt ist, kann der »kalte« wieder aufgenommen werden. Unter diesen besonders belastenden Umständen ist eine nachhaltige Fallbearbeitung jedoch nur bedingt möglich.
Weitere Gründe für das Scheitern von Altfallermittlungen haben mit dem flüchtigen Täter zu tun, der unter Umständen bereits gestorben ist, bevor man ihn identifiziert hat, der trotz starken Verdachts nicht angeklagt werden kann, weil der finale Beweis fehlt, oder er den Sitzungssaal letztlich als freier Mann verlässt, weil ihm beispielsweise eine Mordabsicht nach so langer Zeit nicht mehr mit der nötigen Gewissheit nachgewiesen werden kann und alle anderen infrage kommenden Delikte bereits verjährt sind. Diese dramatischen Momente des Scheiterns sind für Cold-Case-Kriminalisten und Staatsanwälte besonders ernüchternd.
Eine weitere bedeutsame Aufdeckungsbarriere: Generell wird angestrebt, Zeugen möglichst tatzeitnah zu vernehmen, wenn die Erinnerung an das Ereignis noch frisch und möglichst unverfälscht ist. Bei länger zurückliegenden Verbrechen wird dies naturgemäß nicht mehr möglich sein. Schlimmer noch: Die Zeugen sind regelmäßig gedanklichen Prozessen unterworfen, die der zwischenmenschlichen Wahrnehmung, Urteilsbildung und Einflussnahme zugrunde liegen. Dies betrifft klischeebehaftete Vorstellungen, unzutreffende Zuschreibungen ursächlicher Zusammenhänge oder Rekonstruktionsfehler, wenn versucht wird, Erinnerungslücken durch Allgemeinwissen oder persönliche Lebenserfahrungen zu kaschieren. So wird der ursprüngliche Eindruck von Pseudoerinnerungen überlagert und unzugänglich.
Cold Cases stellen für alle Betroffenen unbestritten eine enorme Herausforderung und Belastung dar. Vergangenes und Vergessenes muss sorgfältig aufbereitet und penibel aufgearbeitet werden, damit lange Verborgenes endlich an die Oberfläche gelangen kann. Leidvolle Erfahrungen werfen erneut ihre dunklen Schatten, lassen sich nicht mehr verdrängen, müssen ausgehalten werden. Die quälende Angst vor Entdeckung fordert ihren Tribut, das unstete Leben mit der eigenen Schuld wie auch die späte Konfrontation damit, dem persönlichen Abgrund, der bedingungslosen Kapitulation. Nicht zuletzt flammt unwillkürlich die Hoffnung wieder auf, vielleicht doch noch für Gerechtigkeit zu sorgen oder diese zu erfahren, dem Bösen seine ungeheure Strahlkraft zu nehmen.
Von all diesen Dingen werde ich im vorliegenden Buch berichten. Die »kalten« Kriminalfälle und die spektakuläre Geschichte ihrer Aufklärung habe ich bewusst so ausgewählt, dass alle Facetten des noch so jungen und doch bereits so erfolgreichen Cold-Case-Managements und seine besonderen Begleiterscheinungen sichtbar werden, dass nicht in Vergessenheit gerät, wie wichtig eine möglichst effektive und erfolgreiche Strafverfolgung ist, die gewiss auch eine ordnende und versöhnende Funktion in unserer Gesellschaft hat.
Stephan Harbort
Düsseldorf, im August 2019
Das Schweigen der anderen
»Ich liebe Dich!
Es grüßt Dich Dein letztes Stück Dreck.«
»Es tut mir sehr leid,
ich kann das in diesem Leben keinem erzählen.«
»Wenn Sie jetzt zuschauen, bedenken Sie doch bitte
auch die unerträgliche Situation für die Angehörigen,
insbesondere die fast 80-jährige Mutter,
die nach bald 29 Jahren wissen will,
was ihrer Tochter zugestoßen ist.«
»Wenn ich über Beton lief, dachte ich,
sie könnte darunterliegen.«
Schwere Baufahrzeuge haben mit ihren Erdbewegungsreifen die Zufahrt zum Gelände arg in Mitleidenschaft gezogen und zerfurcht. In den vergangenen Tagen hat es in Strömen geregnet, deshalb ähnelt der kurze Weg zur ehemaligen Müllkippe einer Schlammlandschaft. Auch wenn die Männer nur einige kurze Schritte machen, versinken ihre gelben Gummistiefel knöcheltief im morastigen Untergrund. Das Dröhnen des Raupenbaggers ist nicht zu überhören; immer wieder gräbt sich die Schaufel in den Untergrund hinein und fördert Müll nach oben, der Augenblicke später penibel abgesucht wird.
Die etwa 600 Quadratmeter große Fläche liegt in einem ehemaligen Steinbruch. Hier wachsen jetzt Bäume, Büsche und Hecken; der Matthiasweg, einer der beeindruckendsten Wanderpfade der Region, schlängelt sich einige Hundert Meter weiter durch das Areal. Ein idyllisch anmutendes Waldgebiet oberhalb des 180-Seelen-Dorfs Frauenkron, einem Ortsteil der Gemeinde Dahlem im Kreis Euskirchen; dieser menschenleer anmutende Landstrich in der Nordeifel ist nun möglicherweise auch ein Ort des Schreckens, sollten sich die Annahmen von Kriminalhauptkommissar Heinrich Quehl bewahrheiten. Der 51-jährige Todesermittler aus Koblenz, seit elf Jahren dienstlich mit Mord und Totschlag befasst, glaubt, hier auf einer ehemaligen Mülldeponie, unter meterhohen Bergen von Abfall, heute noch Spuren eines Verbrechens aufspüren zu können, das seit drei Jahrzehnten wie ein böser Fluch auf Frauenkron und seinen Bewohnern lastet.
Es ist der 4. Oktober 2011, ein Dienstag. Bereits am frühen Morgen haben die Baggerarbeiten begonnen. Am Ortsrand von Frauenkron – dort, wo die Polizei mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks seit einigen Stunden bei Wind und Wetter Müll aushebt – verläuft die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Keine drei Kilometer entfernt markiert ein Schlagbaum die deutsch-belgische Staatsgrenze.
Inmitten von prächtigen Buchenwäldern und grünen Wiesen, auf denen Kühe friedlich weiden, schmiegt sich Frauenkron in einer Senke sanft an die Hügel der Vulkaneifel. Entlang der dezent geschwungenen Marienstraße reihen sich schindelverkleidete Häuser und Höfe wie an einer Perlenschnur gezogen aneinander. Es existiert lediglich eine Bushaltestelle: Frauenkron-Waldweg. Hier im Dorf wie aus dem Bilderbuch kennt jeder jeden, alle wissen alles. Ablenkung findet man in der einzigen Kneipe, Em Backes. Dort treffen sich die Leute in geselliger Runde zum Bier nach Feierabend. Kleine Welt, heile Welt.
Doch die Dorfgemeinschaft belastet seit Generationen das geheimnisumwitterte Schicksal einer jungen Frau, die am 4. November 1982 hier ganz in der Nähe auf mysteriöse Weise verschwand. Dass die Vermisste heute in einer anderen Stadt leben könnte, einer anderen Region oder in einem anderen Land, das glauben nur wenige in Frauenkron, obwohl sich derlei Gerüchte seit Jahrzehnten hartnäckig halten und mitunter leidenschaftlich diskutiert werden; vorzugsweise am Stammtisch, wenn der Alkoholspiegel steigt und die Hemmschwelle sinkt, wenn keine Rücksicht mehr genommen werden muss, weil keiner der Betroffenen und Leidtragenden zugegen ist. Dann zerreißt man sich das Maul und weiß sehr genau, was der jungen Frau widerfahren ist, wer es gewesen sein muss, wer gelogen hat, warum es passiert ist und wer mit dem Täter gemeinsame Sache gemacht haben könnte.
Ebendiese Person hat sich kürzlich Hauptkommissar Quehl anvertraut und offenbart. 29 Jahre nach der Tat will der Mann Gewissensbisse bekommen haben, hat angeblich reinen Tisch gemacht und zu Protokoll gegeben, er wisse, wo damals die Leiche versteckt worden sei, schließlich habe er selbst mitgeholfen. Auf der ehemaligen Müllkippe müssten die sterblichen Überreste des Mädchens liegen, hat der Mann behauptet, umwickelt mit einer grünen Silofolie.
Und genau danach halten Kommissar Quehl und etwa 20 Beamte der Bereitschaftspolizei nun Ausschau. Die Vorgehensweise ist immer gleich: Der Bagger trägt das Erdreich der ehemaligen Deponie schichtweise ab, wobei jeder Aushub vorab gesichtet wird, um wenig später mit einer Harke noch genauer untersucht zu werden. Abschließend kommen Spürhunde zum Einsatz, die Leichen und Blutspuren in allen Stadien der Verwesung auffinden, aber auch Orte anzeigen können, an denen sterbliche Überreste einmal gelegen haben.
Trotz widriger Witterungsverhältnisse wird die Suche fortgesetzt, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Nachdem auch der Westdeutsche Rundfunk über die polizeilichen Aktivitäten in mehreren TV-Sendungen berichtet hat, kommen viele Schaulustige nach Frauenkron; sie beobachten die Ermittler bei der Arbeit, wollen die Absperrung überwinden, machen Fotos, sind wissbegierig und stellen Fragen. Verbrechenstourismus.
Damit die Zuschauer nicht auf das Ausgrabungsgebiet gelangen können, muss es auch nachts bewacht werden. Und egal, wo man hinkommt, überall scheint es nur ein Gesprächsthema zu geben: »Finden die jetzt endlich die Leiche?« Darauf hofft auch Willy Heinzius, der Ortsbürgermeister von Frauenkron. »Die Leute warten auf ein Ergebnis, wollen endlich Gewissheit«, sagt er im Interview dem Redakteur einer Tageszeitung. »Ich hoffe, dass die Menschen nach Abschluss der Suche endlich ruhiger werden und sich auch wieder auf anderes besinnen können. Es belastet alle hier sehr!«
Kommissar Quehl und seine Mitstreiter haben ihre Bemühungen zwar mit großen Erwartungen begonnen, doch der anfängliche Optimismus verliert mit jedem Tag, an dem keine Leiche gefunden wird, an Strahlkraft. Obwohl im Zuge der Grabungsarbeiten mitunter suspekt anmutende Dinge ans Tageslicht gelangen, handelt es sich bei näherer Betrachtung doch nur um irrelevante Kleidungsstücke, Teppiche, Müllsäcke oder sonstige Haushaltsabfälle. Nur einmal keimt kurz Hoffnung auf, als etwas besonders Verdächtiges gefunden wird: körperähnlich, in eine Decke gerollt, übel riechend. Doch die vermeintliche Leiche entpuppt sich als belangloser Tierkadaver.
Weil Kommissar Quehl nach wie vor von der Glaubwürdigkeit seines Hinweisgebers überzeugt ist und ihn der Gedanke beseelt, den Angehörigen des mutmaßlichen Opfers, aber auch den Bewohnern des Dorfes endlich Gewissheit zu verschaffen und für Gerechtigkeit zu sorgen, ordnet er nach sieben Tagen eine Ausweitung der Suche an. Ist bislang nur bis in eine Tiefe von vier Metern gebuddelt worden, soll der Müll nunmehr komplett bis zum Grund abgetragen werden. Um auch nichts unversucht zu lassen und auszuschließen, dass etwas übersehen worden sein könnte, sollen auch die Areale abgesucht werden, in denen bereits gearbeitet worden ist.
Wieder vergehen mehrere Tage. Erneut wird gebaggert, gebuddelt und geprüft, doch abermals bleibt der Erfolg aus. Heinrich Quehl ist lange genug Kriminalist, um zu wissen, dass sehr wohl auch eine andere Arbeitshypothese zutreffend sein könnte, die er bislang jedoch nicht favorisiert hat. Und die geht so: Der Haupttäter hat die Leiche zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Gelände der Deponie geborgen und an einem anderen Ort versteckt, weil er glaubte, seinem Mitwisser und Mithelfer nicht mehr bedingungslos vertrauen zu können. Je länger die Polizei erfolglos gräbt, desto wahrscheinlicher wird diese Überlegung.
Und noch ein Aspekt dieses so undurchsichtigen Kriminalfalls beschäftigt den Kommissar. Er hat den Beginn der Baggerarbeiten ganz bewusst auf den 4. Oktober gelegt, weil das mutmaßliche Opfer an diesem Tag geboren wurde. Quehl hat darauf spekuliert, dieses schicksalhafte, symbolträchtige Datum möge den Täter, weitere Gehilfen, aber auch wichtige Zeugen, die sich bislang nicht zu erkennen gegeben haben, zu irgendeiner Handlung provozieren, damit wieder Bewegung in die Sache kommt, dass etwas passiert, dass Fehler gemacht werden, dass sich jemand mitteilt – doch bislang hat sich niemand bei der Polizei gemeldet.
Nach elf Tagen ist das Areal nahezu komplett umgegraben. Nun sind nur noch wenige Kubikmeter Erdreich übrig, und keiner der an den Grabungsarbeiten Beteiligten, auch Kommissar Quehl nicht, ist so vermessen zu glauben, jetzt, ausgerechnet jetzt, nur wenige Stunden vor dem unvermeidlichen Ende der Suchaktion, könnte die Leiche doch noch geborgen werden.
Es ist etwa 10:15 Uhr, als Heinrich Quehl, nach all der Plackerei mittlerweile erschöpft und enttäuscht, den Staatsanwalt anruft, um ihm die bevorstehende Beendigung der Leichensuche und das ernüchternde Ergebnis mitzuteilen. Ein neuerlicher Stillstand der Ermittlungen droht. Denn ohne Leiche und ohne Tatort fehlen die entscheidenden Anknüpfungspunkte für Erfolg versprechende Untersuchungen.
Der Kommissar und sein Staatsanwalt sprechen seit zwei Minuten miteinander, als einer von Quehls uniformierten Kollegen unvermittelt neben ihm steht und das Telefonat unterbricht: »Wir haben etwas gefunden. Das musst du dir ansehen!«
Rückblende: Samstag, 6. November 1982. Roswitha Janssen bekommt den Anruf, der ihr Leben für immer verändern wird, am frühen Vormittag. »Deine Tochter ist verschwunden«, teilt Josefa Brüggen besorgt mit, die Vermieterin der 18-Jährigen. »Melitta ist weder in ihrem Zimmer, noch ist sie bei der Arbeit aufgetaucht. Das ist schon komisch, so kenne ich sie gar nicht.« Was weißt du schon von Melitta, denkt sich Roswitha Janssen, bedankt sich aber höflich für die Mitteilung und legt auf. Als treu sorgende Mutter kennt sie ihre Zweitgeborene schließlich sehr genau, weiß um deren jugendliche Unbekümmertheit, ihre Spontaneität, ihren Freiheitsdrang, ihre Eigenheiten, aber auch um ihren gelegentlichen Starrsinn. Manchmal tut Melitta eben Dinge, ohne sich über die drohenden Konsequenzen Gedanken zu machen – kein Grund zur Beunruhigung, wenn sie mal nicht erreichbar ist; sie wird sich schon wieder blicken lassen.
Doch schon am späten Nachmittag desselben Tages kommen Roswitha Janssen doch Bedenken. Sie schickt ihre Tochter Cornelia nach Jünkerath, dort hat Melitta vor ein paar Monaten bei Josefa Brüggen ein möbliertes Zimmer angemietet. Bis auf zwei Briefe, die Cornelia mitnimmt, erscheint sonst alles unauffällig, unverdächtig. Aus einem dieser Schreiben geht jedoch hervor, dass Melitta Liebeskummer hat und zumindest Andeutungen macht, sich das Leben nehmen zu wollen. »Es tut mir leid, aber was du gestern Abend gesagt hast, hat mir ganz schön wehgetan«, schreibt die junge Frau. »Du musst entschuldigen, aber ich habe mir eingeredet, du würdest mich genauso lieben wie ich dich. (…) Ich bin dir im Weg, und daher ist es besser, wenn ich gehe. (…) Vielleicht überlege ich es mir noch mal und komme zurück, um mit dir zu sprechen. (…) All deine Sorgen wären gelöst, wenn ich tot wäre. Du hättest dich auf mich verlassen können, dein Leben lang. (…) Ich wünsche dir daher für deinen neuen Anfang viel Glück, aber vergiss mich und dein Kind nicht. (…) Ich liebe dich! Es grüßt dich dein letztes Stück Dreck.«
Als es immer noch kein Lebenszeichen gibt, geht Roswitha Janssen am 9. November zur Polizei und meldet ihre Tochter um 23:15 Uhr als vermisst. Denn mittlerweile versteht die 48-Jährige die Briefe ihrer Tochter nicht mehr als Ankündigung einer Selbsttötung; vielmehr befürchtet sie, ihrer lebensbejahenden Tochter müsse etwas zugestoßen sein, und sie kann sich auch vorstellen, wer da seine Finger im Spiel hat: Hans Godehardt, der ehemalige Verlobte ihrer Tochter – »Wer denn sonst?« –, denn ebenjener »feine Pinkel« sei mit Melittas ungewollter Schwangerschaft nur anfangs einverstanden gewesen, berichtet Roswitha Janssen aufgebracht der Polizei. Letztlich habe er sich wegen des ungeborenen Kindes von ihr getrennt, doch ihre »angeblich nicht standesgemäße« Tochter sei nicht so leicht abzuweisen gewesen: »Sie hat um ihr Glück und das des Babys gekämpft!« Bevor Roswitha Janssen die Wache verlässt, gibt sie eine Beschreibung ihrer Tochter zu Protokoll: 1,60 Meter groß, schlank, blondes Haar, gewellt, schulterlang.
Der Polizist nimmt an, mit einer überbesorgten Mutter gesprochen zu haben, die nicht einsehen will, dass ihre volljährige Tochter mittlerweile eigene Wege geht, sich sehr wahrscheinlich noch in der Region aufhält und einfach mal eine Zeit lang für sich sein will, um den Kopf freizubekommen. »Sie werden sehen, die wird schon wieder auftauchen«, hat er Roswitha Janssen wohlmeinend mit auf den Heimweg gegeben. Und auch sonst spricht nach Einschätzung der Polizei nichts für ein Verbrechen, auch die verzweifelt anmutenden Briefe der jungen Frau nicht. Denn das letzte Schreiben könnte zwar auch als Abschiedsbrief gelesen werden, nach Lage der Dinge glaubt die Polizei jedoch eher an ein verschriftlichtes Abschiednehmen nach vorausgegangener Trennung. Zudem handelt es sich bei dem Ex-Freund von Melitta um den 20-jährigen Sohn des anerkanntermaßen reichsten Milchbauern in der Region. Der junge Mann ist weder polizeibekannt noch vorbestraft, vielmehr ein rechtschaffener Bursche aus gutem Hause mit vorzeigbarem Lebenslauf.
Über ein solches Standing verfügen das verschwundene Mädchen und ihre Familie indes nicht. Die Janssens leben erst seit 1967 in Frauenkron. In den Augen der Einheimischen sind sie Flüchtlinge aus Schlesien, protestantische Großstädter aus dem Osten in einem erzkatholischen Dorf im Westen der Republik. Obwohl durchaus darum bemüht, gelingt es den Janssens nicht, die in der Dorfgemeinschaft grassierenden Vorurteile zu entkräften. Sie sind und bleiben »Zugezogene«, denen grundsätzlich zu misstrauen ist, von denen man sich besser fernhält.
Melittas Vater Jürgen, ein gelernter Schachtmeister, findet, nachdem viele Zechen im Ruhrgebiet geschlossen worden sind, Mitte der 1970er-Jahre bei einem Bauunternehmen in Losheim am südwestlichen Rand von Nordrhein-Westfalen Arbeit und kauft nur ein paar Kilometer weiter in Frauenkron ein Haus. Der mitunter recht aufbrausende Mann verdient gerade einmal so viel, dass er die siebenköpfige Familie ernähren kann. Alles, was darüber hinausgeht und für andere selbstverständlich ist – Kinobesuche, Geburtstagspartys oder Urlaubsreisen –, können sich die Janssens nicht leisten. Die Familie wird in erster Linie von der Mutter zusammengehalten. Roswitha Janssen gilt allgemein als tüchtig, heimatliebend, zuverlässig, gewissenhaft und sehr um das Wohl ihrer Kinder bemüht. Trotzdem geht es bei den Janssens mitunter recht turbulent zu, denn der Vater achtet sehr auf Disziplin, und wenn sich die Kinder nicht an seine Vorgaben halten, gibt es neben lautstarken Vorhaltungen auch mal eine Ohrfeige.
Die Polizei der Kreisstadt Daun geht der Vermisstensache »AR 18/82« weiter nach und vernimmt zunächst eine Arbeitskollegin der Verschwundenen. Hildegard Schremmer kennt Melitta Janssen seit vier Monaten, sie arbeiten gemeinsam als Näherinnen in einer Kleiderfabrik bei Jünkerath. »Ich habe sie nach der Arbeit um etwa 13:10 Uhr mit nach Hallschlag genommen«, gibt die 43-Jährige zu Protokoll, »weil sie zur Siedlung nach Scheid zu ihrem Freund fahren wollte, um zu klären, ob er für das Kind sorgen werde. Sie hat wörtlich zu mir gesagt: ›Ich will mit den Alten sprechen!‹«
Die Zeugin berichtet weiter, Melitta Janssen sei nach 20-minütiger Fahrt an der Kreuzung in Hallschlag Fahrtrichtung Scheid ausgestiegen. Vorher habe es zwischen ihnen noch eine kurze Unterhaltung gegeben, die Hildegard Schremmer wortgetreu wiedergeben kann.
»Ich lasse dich an der Telefonzelle raus, da kannst du den Hans anrufen, dass er dich abholt. Gehst du heute das erste Mal dahin? Aber doch wohl nicht mit leeren Händen!«
»Ich hab doch kein Geld!«
»Ich kann dir fünf Mark für Blumen leihen.«
»Nein, die kriegen nichts von mir! Er hat schon eine andere. Er braucht mich auch nicht mehr zu heiraten, er soll nur für das Kind sorgen.«
»Hast du das mit der Schwangerschaft extra gemacht?«
»Nein, das ist so passiert.«
Welche Kleidung die junge Frau zu diesem Zeitpunkt getragen hat, weiß Hildegard Schremmer noch sehr genau: »Grüner Parka, weißer Strickpullover, Turnschuhe und eine selbst genähte pink-weiß karierte Schwangerschaftshose.«
Mit dieser Beschreibung wird eine groß angelegte Suche gestartet, an der sich die Feuerwehr, eine Hundestaffel, Kräfte der Bereitschaftspolizei und ein Hubschrauber beteiligen, aber auch die Familie Janssen selbst. Sollte Melitta wider Erwarten doch einen Selbstmordversuch unternommen haben, so hoffen ihre Eltern und Geschwister, sie noch lebend finden zu können. Die Dorfjugend und andere Freiwillige unterstützen die Polizei ebenfalls und durchkämmen Wälder, suchen in Steinbrüchen oder laufen an Bächen entlang. Immer wieder hört man die Leute vergebens rufen: »Me-lit-ta! Me-lit-ta!«
Unterdessen gehen die Ermittlungen der Polizei in Daun weiter. Dass die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens Beziehungsprobleme gehabt hat, bestätigt auch Josefa Brüggen, ihre Vermieterin. Einen Tag, bevor Melitta verschwunden ist, soll es zwischen ihr und Hans Godehardt eine heftige Auseinandersetzung gegeben haben. »Die haben sich so laut angeschrien, dass ich gegen 22 Uhr hoch zu ihr ins Zimmer gehen musste, damit endlich Ruhe ist.« Melitta habe schluchzend auf dem Bett gesessen, Hans Godehardt schweigend danebengestanden. Beide hätten ihr gegenüber die Trennung bestätigt, betrieben von ihm, gebilligt von ihr. Kurz darauf habe Hans Godehardt das Haus verlassen.
Die Vorgeschichte: Melitta und Hans lernen sich im Sommer 1981 kennen, als sie eine Fahrradpanne hat und er ihr in der Not behilflich ist. Beide sind sich auf Anhieb sympathisch, sie verabreden sich, unternehmen viel zusammen, lernen sich besser kennen, kommen einander näher, küssen sich erstmals im Wald und werden ein Paar. Melitta ist eine hübsche junge Frau, bescheiden, selbstlos und fleißig, mitunter aber auch etwas dickköpfig, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Hans gefallen besonders ihre blonden, schulterlangen Haare, der schlanke Körper, vor allem aber ihr herzliches Lachen.
Während seine Freundin allseits beliebt ist, fällt es Hans überaus schwer, bei der männlichen Dorfjugend anzukommen; selbst mit einem neuen Moped, schneller als alle anderen, oder neuerdings mit seinem aufgemotzten Golf-Cabrio, vermag er nirgends zu reüssieren – für die übrigen jungen Männer in Frauenkron bleibt »der Schlaks« ein Angeber und Langweiler.
Wenn Hans seine Melitta überrascht und mit dem Wagen abholt, um eine Spritztour an den Biggesee zu machen oder die Kirmes in Remscheid zu besuchen, spielen alltägliche Verpflichtungen keine Rolle mehr – Hauptsache, sie kann mit ihm zusammen sein. Einer Freundin erzählt sie sogar, bald das Traktorfahren erlernen zu wollen, um Hans auf dem Hof seiner Eltern unterstützen zu können, so gut es eben geht.
Und genau hier beginnt das Problem der beiden Liebenden. Denn sie müssen ihre Beziehung vor Hans’ Eltern geheim halten, weil insbesondere sein Vater befürchtet, Melitta, »ohne etwas an den Füßen und nicht standesgemäß«, könnte in die Familie des vermögenden Milchbauern einheiraten und sich »das Erbe unter den Nagel reißen«. Melitta wird förmlich geächtet. Sie darf den Hof der Godehardts nicht einmal betreten. Wenn sie es doch gelegentlich versucht, schlägt der Wachhund an, und die junge Frau wird unter lauten Beschimpfungen wie ein räudiger Köter davongejagt. Doch auch ihre eigenen Eltern sind gegen die Beziehung. Sie glauben, bemerkt zu haben, dass der unaufrichtige Hans es mit ihrer Tochter ohnehin nicht ernst meint; aus ihrer Sicht hat Melitta vielmehr einen Mann verdient, der sie wirklich liebt und auch in der Not zu ihr steht: »Kind, das bringt doch nichts!«
Hans wird von seinem Vater immer wieder bedrängt, die unselige Liebschaft endlich aufzugeben; falls nicht, droht er lautstark, »werde ich dich enterben, wenn du dich weiter mit diesem Flittchen abgibst!«. Letztlich gehorcht Hans und beendet die Liaison erstmals im Juni 1982.
Wenige Tage später schluckt Melitta eine Überdosis Herztabletten ihres Vaters, sie wird aber rechtzeitig von ihrer Mutter gefunden und in die Notaufnahme der nächsten Klinik gebracht. Dort wird ihr der Magen ausgepumpt. Lebensgefahr hat nach Auskunft der Ärzte jedoch nicht bestanden. Zu diesem Zeitpunkt ist Melitta bereits schwanger.
Einige Wochen später besucht Hans seine On-off-Freundin wieder. Ob er die Trennung aufrechterhalten will, sagt er nicht, druckst herum: »Mal sehen …« Melitta fühlt sich nicht ernst genommen, an der Wankelmütigkeit ihres Ich-weiß-nicht-so-recht-Freundes entzündet sich ein erbittert geführter Streit, der in Sprachlosigkeit mündet. Anschließend braust Hans mit seinem Cabrio wutentbrannt davon. Melitta setzt wenig später abermals ein unübersehbares Zeichen ihrer tiefen Verzweiflung und ritzt sich mit einem Küchenmesser an einem Handgelenk die Haut auf: allerdings nur oberflächlich, ohne dass medizinische Hilfe notwendig wird.
Im Spätsommer verlässt Melitta das Elternhaus, weil sie sich nach wie vor unverstanden fühlt. Die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährige junge Frau zieht nach Jünkerath, findet dort Unterkunft und Arbeit und meldet sich nur noch selten bei ihren Eltern, die über Dritte in Erfahrung bringen müssen, wie es ihrer Tochter geht. Die Liebe zu Hans, der sie nun wieder regelmäßig besucht, flammt erneut auf; fast jeden Abend ist er bei ihr und bleibt häufig bis spät in die Nacht.
Schließlich kommt der Abend, an dem Melitta ihm die unbeabsichtigte Schwangerschaft offenbart. Hans ist zwar sehr überrascht, aber er will die Verantwortung übernehmen und mit Melitta vielleicht sogar eine Familie gründen; Hans hofft, 13 Kilometer vom Hof seines Vaters entfernt die verbotene Beziehung insgeheim fortführen zu können.
Pustekuchen. In einem kleinen Dorf wie Frauenkron bleibt nichts lange geheim, eine problematische Schwangerschaft schon gar nicht. Hans’ Vater stellt seinen Sohn alsbald zur Rede und vor die Wahl: »Entweder du schickst diese Dahergelaufene zum Teufel, oder es ist nix mit dem Erbe. Dann gehst du leer aus, mein Junge!« Melitta ist in den Augen des Patriarchen eine ernsthafte Gefahr für sein Vermögen, seinen Einfluss, seine Reputation, seine Existenz, sein Lebenswerk – über hundert Morgen Land und ein Stall voller Milchkühe –, alles, worauf er so unbeirrt und diszipliniert hingearbeitet hat und was er nun glaubt, um jeden Preis schützen zu müssen. Die lange Tradition seiner Familie, ihre gesellschaftlich exponierte Stellung, die Macht, all dies wird nun infrage gestellt von »einer Schlampe« und ihrem ungeborenen »Bastard«. Hans-Georg Godehardt hat schon immer geherrscht, seine Familie beherrscht, eigene Vorstellungen nicht diskutiert, sondern angeordnet und notfalls mit unmissverständlichen Drohgebärden befohlen. Und genau deshalb hat sein Sohn sich gefälligst zu fügen. Basta.
Wie Hans Godehardt sich letztlich entschieden haben soll, erfährt die Polizei von einer jungen Frau, die vor einigen Tagen eine Beobachtung gemacht hat – eher belanglos, aber nun, nachdem sie vom ungeklärten Schicksal Melittas erfahren habe, sehe sie doch einen Zusammenhang, den sie unbedingt mitteilen wolle. Die Zeugin berichtet, die Vermisste und Hans Godehardt seien ihr auf der Landstraße bei Udenbreth entgegengekommen und hätten sich augenscheinlich gestritten. »Du kannst mich doch nicht mit dem Kind sitzen lassen!«, soll Melitta Janssen sich lautstark empört haben, woraufhin Hans Godehardt wortlos in seinen Wagen gestiegen sei und beim Wegfahren die junge Frau erfasst haben soll, sodass sie zu Boden gefallen sei, jedoch ohne sich zu verletzen. »Das war wohl keine Absicht, sah eher aus wie ein Unfall«, versichert die Zeugin. Und Melitta? Die habe sehr wütend gewirkt und sich über eine Wiese entfernt.
Mittlerweile hat die Polizei herausgefunden, wann und wo Melitta Janssen letztmals lebend gesehen worden ist. Zwei Zeugen haben sich gemeldet und unabhängig voneinander mitgeteilt, die junge Frau am 4. November gegen 14 Uhr in der Nähe des Godehardt-Hofs bemerkt zu haben. Ob sie das Grundstück betreten hat, wissen die Zeugen jedoch nicht. Damit rücken sowohl Hans-Georg Godehardt, aber auch sein Sohn und vielleicht sogar weitere Familienmitglieder in den Fokus der Ermittlungen, zumal sich nunmehr auch ein handfestes Motiv andeutet. Hat die Familie Godehardt spontan eine günstige Gelegenheit ausgenutzt und sich der überaus unbequem gewordenen Melitta Janssen gewaltsam entledigt? Oder ist es bei einer terminierten Aussprache zwischen den widerstreitenden Parteien zu einer ungewollten Eskalation gekommen, die tödlich verlaufen ist? Oder hat man die widerspenstige Schwangere vielmehr mit viel Geld zum Schweigen gebracht, und Melitta lebt nun an einem anderen Ort, ohne die Godehardts weiter behelligen zu dürfen? Ist das der Deal?
Von alledem will Hans Godehardt indes nichts wissen, als er bei der Polizei aussagen muss. Er bestreitet nicht, mit Melitta am Tag ihres Verschwindens auf dem elterlichen Hof verabredet gewesen zu sein, nur habe dieses Treffen wider Erwarten nicht stattgefunden, weil seine Ex-Freundin nicht erschienen sei. »Warum, das weiß ich nicht. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ich weiß auch nicht, wo sie ist.« Überhaupt, zwischen den beiden gebe es keine Beziehung mehr; er fühle sich für Melitta »nicht mehr verantwortlich«. Außerdem will er von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst haben, selbst auf mehrmaliges kritisches Nachfragen der Beamten bleibt er dabei. Letztlich bestätigen auch Wilma und Hans-Georg Godehardt in ihren Vernehmungen, die Vermisste habe sich zur fraglichen Zeit auf ihrem Hof nicht blicken lassen.
Wasser auf die Mühlen derjenigen, die annehmen, Melitta Janssen sei »einfach nur ausgebüxt«, ist die Mitteilung eines Zeugen, der aus freien Stücken bei der Polizei vorstellig wird. Der Mann ist von Beruf Kraftfahrer und erklärt, der jungen Frau am Montag, dem 8. November, zweifelsfrei begegnet zu sein, als sie mittags in Scheid seinen Linienbus verlassen habe und die Straße Richtung Zentrum gelaufen sei – vier Tage nach ihrem vermeintlichen Verschwinden!
Daraufhin wird die Suche nach Melitta Janssen aufgegeben. Denn der Busfahrer kann sich nach Einschätzung der Polizei beim Datum seiner Beobachtung nicht geirrt haben, weil ihm eben aus diesem Grund vorsorglich ein Kalender vorgelegt worden ist, um sich zeitlich besser orientieren zu können. Außerdem hat der Zeuge Melitta Janssen gut gekannt, sie ist als Schülerin jahrelang sein Fahrgast gewesen. Eine Verwechslung erscheint somit ausgeschlossen, vielmehr gilt der Busfahrer als besonders verlässlicher und glaubwürdiger Zeuge.
Somit haben die Ermittler keine rechtliche Handhabe mehr, um gegen Hans Godehardt oder seinen Vater weiter zu ermitteln. Ihre Angaben können nicht widerlegt, ein Tatverdacht gegen sie nicht begründet werden. Insofern muss das Verfahren so lange ruhen, bis sich neue Erfolg versprechende Ermittlungsansätze ergeben.
Und genau das passiert im März 1983, als ein kleiner Junge beim Spielen am Ortsausgang der Gemeinde Stadtkyll einen Schlüsselbund findet, nur wenige Meter vom Friedhof entfernt neben einer Notrufsäule. Er gibt den Fund bei der Polizei ab. Die Beamten entdecken an dem Anhänger ein Foto von Hans Godehardt. Der Rest ist kriminalistische Routine, insbesondere Roswitha und Jürgen Janssen können bestätigen, dass der Schlüsselbund zweifelsfrei ihrer Tochter Melitta gehört hat. Doch wann und unter welchen Umständen dieser an den Fundort gelangt ist – 13 Kilometer vom letzten bestätigten Aufenthaltsort der Vermissten entfernt –, bleibt letztlich ungeklärt.
Während die Polizei keine Veranlassung sieht, das Verfahren fortzuführen, leidet die Familie Janssen still; die quälende Ungewissheit, ob Melitta etwas zugestoßen ist, ob sie noch lebt, ob sie zurückkommt, oder ob sie, ihre Eltern, möglicherweise eine Mitschuld an diesem Drama trifft, sie ihre Tochter vielleicht doch zu hart angefasst haben oder mehr mit ihr hätten reden sollen – all diese unausgesprochenen Gedanken nähren Selbstzweifel und Selbstvorwürfe, nagen am eigenen Selbstverständnis, machen traurig, angreifbar, verletzbar, beherrschen die Gegenwart und verdunkeln die Zukunft.
Draußen im Dorf indes glauben viele, Bescheid zu wissen; alle haben eine Meinung: Melitta habe sich mit ihren Eltern nicht mehr verstanden und sei darum fortgegangen, es gehe ihr aber gut, heißt es; oder sie sei entweder allein oder mit Hans Godehardt nach Holland gefahren, habe das Kind abtreiben lassen und aus Scham nicht ins Dorf zurückkehren wollen; oder sie sei ins Rotlichtmilieu abgerutscht und arbeite als Prostituierte, wahrscheinlich irgendwo im Ausland; oder sie habe das Kind doch zur Welt gebracht und lebe mit finanzieller Unterstützung der Godehardts in einem anderen Bundesland; oder aber Melitta habe sich und das ungeborene Kind aus nackter Verzweiflung getötet.
Diese Vorstellungen erhalten immer wieder neue Nahrung, wenn Melitta angeblich gesehen und wiedererkannt wird, mal an einer Kreuzung in der Kölner Innenstadt, mal auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Münstereifel oder während einer Filmvorführung in einem Bonner Kino. Nur Melittas Mutter mag sich auf diese Spekulationen nicht einlassen, zumal ohnehin kaum jemand mit ihr über die Sache spricht. Nur ab und zu äußert sie ihren Verdacht: »Da oben ist was ganz Schlimmes passiert.« Mit »da oben« ist der Hof der Godehardts gemeint. Und so vergeht Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, ohne dass ihr unsägliches Leid seine Berechtigung verliert.
Im Herbst des Jahres 1987 nimmt sich ein Staatsanwalt aus Trier die Ermittlungsakten routinemäßig noch einmal vor und ist erstaunt, zu welchen Schlussfolgerungen sein Vorgänger und die Polizei in Daun gelangt sind. Kann doch nicht sein! Der Staatsanwalt will nicht glauben, Melitta sei »abgehauen«; seiner Einschätzung nach ist sie vielmehr »Opfer eines Tötungsdelikts« geworden. Dieser Vorgabe folgend, richtet die Kripo in Trier eine Sonderkommission ein, die Ermittlungen werden mit einer klaren Zielsetzung wieder aufgenommen.
Dutzende Zeugen müssen erneut aussagen, so auch jener Busfahrer, der Melitta Janssen noch am 8. November 1982 lebend gesehen haben will. Was der Mann nun aber zu berichten weiß, stellt die Sache auf den Kopf. Nachdem die Ermittler dem Zeugen seinen damaligen Dienstplan vorgelegt haben, aus dem sich zweifelsfrei ergibt, dass er die Vermisste am 8. November in seinem Bus keinesfalls gesehen haben kann, weil er an diesem Tag »dienstfrei« hatte, erkennt der Mann seinen fatalen Irrtum. Der Busfahrer will sich nun jedoch deutlich zuverlässiger erinnern und gibt zu Protokoll, Melitta sei vier Tage zuvor, also am 4. November, dem Tag ihres Verschwindens, »beim Bauernhof auf dem Hügel gewesen«. Damit existiert nun ein dritter Zeuge, der eine örtlich-zeitliche Verbindung zwischen dem Verschwinden von Melitta Janssen und dem Bauernhof der Familie Godehardt herstellt.