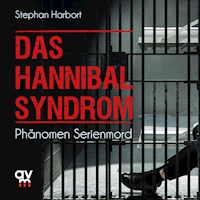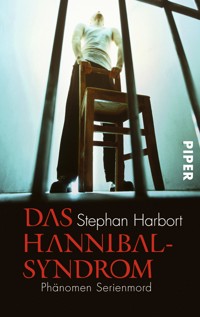13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Name Joachim Georg Kroll steht für eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte. In mehr als zwei Jahrzehnten tötete der Serienmörder mehrere Frauen und Mädchen, bevor er von der Polizei gefasst wurde. Mit analytischer Schärfe untersucht der bekannte Kriminalist Stephan Harbort den Fall des »Jahrhundertmörders«. Dabei entsteht das beeindruckende Psychogramm eines Mannes, der zeit seines Lebens von seinen Trieben gesteuert wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Stephan Harbort
»Ich musste sie kaputt machen«
Anatomie eines Serienmörders
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigungen, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Oktober 2013 © 2004 Droste Verlag GmbH, Düsseldorf Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München Titelabbildung: © keypix.de, Joachim Kroll Satz: Droste Verlag eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-8437-0654-4
Vorwort
Über Jahrtausende hinweg haben die Menschen sich erbittert und erbarmungslos bekämpft und bekriegt – um sich selbst zu befreien und den anderen unfrei zu machen. Und sie werden nicht müde, lassen nicht nach, verzweifelt wird um jeden Zentimeter Freiheit gerungen; auch wenn es den eigenen Tod bedeutet. Der Freiheitsdrang beseelt die Menschen, er treibt sie an und um. Nichts auf dieser Welt hat mehr Menschenleben gekostet als der unversöhnlich geführte Kampf um die Freiheit.
Es ist ein nicht enden wollendes Gemetzel, denn das Böse, Schlechte, Unvollkommene, Missratene gehört auch zum Drama der menschlichen Freiheit. Die Marter, das Maßlose und das Mörderische sind der Preis, der Blutzoll, den wir für unsere Freiheit zu entrichten haben. Wir fürchten uns besonders vor Menschen, die das Unmenschliche nicht scheuen, sondern danach trachten, sich daran ergötzen und dafür töten. Ihre Opfer sind vogelfrei. Die Täter leben jenseits der sozialen Ordnung, aber mitten unter uns. Die gewaltsame Unterjochung des Opfers, seine Vernichtung, wird als triumphaler Befreiungsakt gefeiert. Das Lebensmotto der »Monster« und »Bestien«, die wir gerne verbal als solche etikettieren und sozial exekutieren, mit denen wir aber sonst nichts zu schaffen haben wollen, schockiert: Ich morde, also bin ich.
Um existieren zu können, wollen und müssen sie es immer wieder tun – ohne Rücksicht auf Verluste. Die Gründe sind die Abgründe, die sich im Menschen auftun. Sie können unterschiedlicher Natur sein, einen individuellen Verlauf nehmen, doch am Ende steht immer das Drama. Der Mensch ist das »nicht festgestellte Tier«, hat Nietzsche einmal behauptet. Und die Freiheit der Wölfe bedeutet den Tod der Lämmer. Nicht selten kommen sie im Schafspelz daher: unscheinbar und unberechenbar.
Gemeinhin werden Menschen, die mit heiß-kaltem Herzen töten und nicht davon loskommen wollen oder können, als »Serienmörder« oder »Serienkiller« bezeichnet. Was genau sich hinter diesen Begriffen verbirgt, ist umstritten. Der Fall, von dem das vorliegende Buch handelt, gehört in diese Kategorie und sprengt alle Maßstäbe – damals wie heute. Die schockierenden Gräueltaten übersteigen den Verstand, das Gefühl und die Sprache.
Auch in diesem Fall wird das Böse, das Entsetzliche nicht vollends erhellt und erklärt werden können. Manchmal müssen wir uns mit Beschreibungen begnügen, obwohl wir nach Aufklärung verlangen. Hier stoßen wir an unsere Grenzen. Aber diese Geschichte, dieses Buch soll Perspektiven und Denkanstöße liefern, die etwas weiter sehen lassen. Solche »Ungeheuer«, die ungeheuerliche Taten verüben, gehören ohne Zweifel auf die Anklagebank und eingesperrt – so lange, bis ihre Schuld gesühnt ist und von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht.
Aber es hilft nicht wirklich weiter, diese verlorenen Seelen nur unter Paragraphen zu begraben und hinter hohen Gefängnismauern verschwinden zu lassen. Wird der eine hinter Gitter gebracht, beginnt ein anderer sein todbringendes Handwerk. Das schauderhafte Grauen beginnt von vorn. Immer wieder. Wenn wir unsere kollektive moralische, soziale und erzieherische Verantwortung weiterhin verharmlosen oder leugnen, den Tätern die alleinige Schuld zuweisen und sie lediglich auf den gesellschaftlichen Müllhalden entsorgen, droht tödliche Gefahr. Denn: Die angehenden Mörder können sich nicht selbst heilen oder reparieren, ihnen muss geholfen werden, und das rechtzeitig. Und dazu sind wir aufgerufen und verpflichtet, jeder von uns! Solange wir glauben, »Triebtäter« seien rational denkende und pragmatisch entscheidende Verbrecher, die anders handeln könnten, wenn sie denn nur wollten, flüchten wir uns in die falsche Richtung.
Das vorliegende Kriminal- und Justizdrama darf zu Recht als »Jahrhundert-Fall« gelten und führt uns an die Grenzen des Erträglichen – und bisweilen darüber hinaus. Die unsäglichen Verbrechen eines höchst unscheinbaren Mannes, dessen kümmerliche Existenz in sämtlichen Lebensabschnitten kaum wahrnehmbar wurde, sind ein mahnendes Beispiel dafür, wie weit ein Mensch sich von seinesgleichen entfernen kann, wozu er fähig ist, wenn man sich nicht um ihn kümmert. Und es zeigt, wie und wie weit sich seelische Deformationen und sexuelle Perversionen entwickeln können – wenn sie wie Krebsgeschwüre unerkannt und unbehandelt wuchern dürfen. Insofern ist diese Tragödie tatsächlich einzigartig. Deshalb musste sie dokumentiert werden. Deshalb müssen wir sie zur Kenntnis nehmen.
Stephan Harbort Düsseldorf, im Oktober 2003
Für meine Verlobte Ilona Gantzek. Deine Liebe ist die größte Anerkennung.
»Aber sobald das Sexualverbrechen den Gegenstand der Wollust vernichtet, vernichtet es die Wollust, die gerade nur im Augenblick der Vernichtung besteht.
Darauf muß man sich ein neues Objekt unterwerfen und es abermals töten, ein weiteres und nach ihm die Unendlichkeit aller möglichen Objekte.«
Albert Camus, Ein Schriftsteller
»Alles ist gut, wenn es maßlos ist.«
Marquis de Sade, Die Philosophie im Boudoir
Die geschilderten Ereignisse sind authentisch. Als Quellen für die Rekonstruktion und Dokumentation dienten die 781 Seiten starke Urteilsschrift des Landgerichts Duisburg (Aktenzeichen 14 Js 529/76), polizeiliche Vernehmungsprotokolle, Tatortbefundberichte, Obduktionsprotokolle, forensische Gutachten, glaubwürdige Presseberichte und persönlich geführte Interviews. Ich habe alle Ereignisorte aufgesucht, um mir vor Ort ein Bild zu machen. Die in wörtlicher Rede oder als Dialog wiedergegebenen Sequenzen wurden den genannten Quellen entnommen oder sinngemäß dargestellt. Die beschriebenen inneren Vorgänge der handelnden Personen fußen auf entsprechenden Selbstaussagen. In seltenen Fällen habe ich mir literarische Freiheiten gestattet – ohne dabei den Wahrheitsgehalt im Kern zu verfälschen. Die Namen einiger Personen sind zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte geändert worden.
1
Er hatte die mit braunem Eichenlaub gemusterte Gardine zugezogen und das Licht ausgeschaltet. Es sollte ihm vom Haus gegenüber niemand dabei zusehen können. Vor langer Zeit schon hatte er einmal vom Dachboden des Nachbarhauses aus zu seinem Küchenfenster herübergeschaut und festgestellt, dass so nichts zu erkennen war. Er setzte sich an das schmale Ende des hellbraunen Holztischs, sodass er den Herd und den Spülstein aus etwa zweieinhalb Metern Entfernung anstarren konnte. Vor ihm auf dem Tisch lag ein Brotmesser mit Wellenschliff, Klingenlänge 18 Zentimeter.
Seine gelblichen langen Finger betasteten den schwarzen Knauf des Messers. Behutsam. Zögerlich. Langsam ließ er den Daumen der rechten Hand an der Klinge entlanggleiten. Er musste vorsichtig sein, das Messer hatte er kurz vorher nochmals geschärft. Dabei fixierte er den vierflammigen Elektroherd, auf dem ein blauer und ein weißer Kochtopf standen; der blaue mit Deckel, der andere ohne. Er hatte es genauso arrangiert, das war ihm wichtig. Die etwa anderthalb Meter große Puppe, die er mühsam aufgeblasen hatte, gehörte auch dazu. Den dunkelbraunen Rock und die rot-weiß gepunktete Bluse hatte er ihr übergestreift und sie rücklings quer über den Spülstein gelegt.
Dann stand er auf, ging ein paar Schritte und überzeugte sich nochmals davon, dass der Vorhang nicht die kleinste Möglichkeit bot, ihn und alles andere zu erspähen. Er fürchtete sich vor den neugierigen Blicken seiner Nachbarn, die ihn sowieso nicht verstehen würden. Schließlich drehte er sich beruhigt um und ließ seine rechte Hand über die Bluse der Puppe gleiten. Das Spektakel konnte beginnen.
Der raue Stoff fühlte sich unendlich geschmeidig an. Seine dünnen Finger wanderten bis zum Hals der Puppe, den er mit der Hand fest umschloss. Er starrte die Puppe unentwegt an, so, als wenn er ihr etwas sagen wollte. Er kniff die Augen zusammen, sein Kiefer begann zu arbeiten, die Lippen zitterten. Doch er blieb stumm. Dann beugte er sich über den Herd. Er schob den Deckel des blauen Kochtopfs vorsichtig ein kleines Stück beiseite und lugte hinein. Die tief liegenden dunklen Augen fixierten das Objekt seiner Begierde. Minutenlang verharrte er so und glotzte. Es inspirierte, es stimulierte ihn.
Irgendwann hatte er sich satt gesehen. Er schob den Deckel wieder in seine ursprüngliche Stellung. Es musste alles seine Ordnung haben, er durfte sich keinen Fehler erlauben. Nun nahm er vier kleine Kartoffeln und fünf mittelgroße Möhren aus einer Glasschale, die links neben ihm auf der Waschmaschine stand, und legte alles in den weißen Topf. Während seine linke Hand jetzt über die Bluse und den Rock der Puppe streichelte, berührte er mit der rechten den Griff des blauen Topfs. Am liebsten hätte er wieder hineingesehen und sich sofort des Inhalts bemächtigt. Aber es war noch zu früh. Das wusste er aus Erfahrung. Er musste sich beherrschen.
Er trat einen Schritt zurück und betrachtete sein Werk ausgiebig. Schließlich setzte er sich wieder an den Tisch. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, nahm den Kopf in den Nakken und schloss die Augen. Er war nicht müde, und er dachte auch nicht nach, er ließ sich einfach von seinen monströsen Gedanken überwältigen, die jetzt von ihm Besitz ergriffen. Alles war leicht, alles war möglich.
Mit einem Mal riss er die Augen auf. Seine Blicke wanderten hektisch zwischen der Puppe und den Kochtöpfen hin und her, die rechte Hand umklammerte nun fest den Knauf des Brotmessers. Er begann leicht zu schwitzen, sein Puls raste. Und dann wurde er wieder von diesem Gefühl überrannt, gegen das er sich nicht wehren konnte, das ihn antrieb. Sein ganzer Körper begann sich zu verkrampfen.
2
»Hast Du schon mal gesehen, wie ein Mann seinen Mantel aufknöpft? Klar. Im Restaurant. Im Kino. Oder auf der Straße, wenn es warm ist. Das ist ja auch ganz normal. Macht aber ein Mann seinen Mantel auf, ohne daß jemand außer Dir dabei ist (zum Beispiel im Wald, in der U-Bahn oder im Treppenhaus), und Du siehst dann sein Geschlechtsteil, dann ist das nicht normal. Das hat schon etwas mit Sex zu tun. Mit bösem. Es gibt nämlich Männer, die eine Freude daran haben, Kindern ihr Geschlechtsteil zu zeigen. Diese Männer nennt man Sittenstrolche.«
Die Idee war richtig, man wollte es erst gar nicht so weit kommen lassen, Kinder über drohende Gefahren rechtzeitig aufklären. Im Auftrag der Innenminister von Bund und Ländern glaubte eine Expertengruppe, den typischen Kinderschänder enttarnt zu haben. Seinen Steckbrief konnte jeder nachlesen, in einem kleinen gelben Heft, 32 Seiten im DIN-A5-Format, erhältlich für 1,50 Mark am Kiosk. Im Juni 1976 war die Aufklärungs-Schrift »im Kampf gegen den sexuellen Mißbrauch von Kindern« als Flaggschiff des »kriminalpolizeilichen Vorbeugungsprogramms« erstmals erschienen. Zur Begründung hieß es: »Bei uns werden jährlich fast 100 000 Kinder zwischen sieben und 14 Jahren sexuell mißbraucht. Seelisch geschädigt. Körperlich verletzt. Und manchmal ermordet.«
Die Lebenshilfe war bestimmt für Kinder vom siebten Lebensjahr an, bündelte »kriminalistischen Sachverstand«, fußte auf »kinderpsychologischem Wissen« und enthielt wohlmeinende Faustregeln wie diese: »Wenn Du einem Sittenstrolch begegnest, nichts wie weg!« Und wie das »Böse« auszusehen hatte, war ebenfalls unzweifelhaft: Es musste ein »Mann mit Mantel« sein, natürlich. Der »Sittenstrolch« war stets ein Fremder, jemand, der wie eine Naturkatastrophe über seine Opfer hereinbrach. Besonders verdächtig erschien, wer »keine Frau hat«. Denn: »Der macht sich, wenn er böse ist, an Jungen und Mädchen heran.« So einfach war das.
Dem »Triebtäter« war man auf die Schliche gekommen. Er hatte jetzt ein Gesicht, er zeigte ein bestimmtes Verhalten. Drohendes Unheil war nun erkennbar, durchschaubar, berechenbar. Nur den »lieben Onkel«, den »netten Nachbarn« hatte niemand auf der Rechnung; so wie jenen 43-jährigen Waschraumwärter, der zu dieser Zeit in einer Duisburger Mansardenwohnung lebte – unauffällig und unbeachtet.
3
Es war kaum auszuhalten. Darbende Natur, schwitzende Menschen. Deutschland erlebte den heißesten Sommer seit dem Beginn meteorologischer Aufzeichnungen. Zweieinhalb Wochen mit örtlichen Tagestemperaturen von jeweils über 30 Grad – das hatte es bis dahin nicht gegeben. »79 Prozent der Bundesbürger«, so ermittelten die Wickert-Institute in einer Blitzumfrage, »finden die Hitzewelle unerträglich.« Und der Fernseh-Meteorologe Martin Teich unkte im ZDF: »Diese große Hochdruckzone wird uns noch einiges zu schaffen machen.«
Tatsächlichereignetesich allerorten Ungewöhnliches: Im Großraum Berlin fuhren winterliche Streukolonnen, um aufgematschten Asphalt mit Sand griffig zu halten. An der Saar schwärmten Inspektoren aus, um entlang den Flüssen zu verhindern, dass sich »die Bauern das immer knapper werdende Wasser gegenseitig abgraben«, berichtete ein Ministeriumssprecher. Züge fuhren mit Tempolimit, zwischen Köln und Koblenz lag es bei 50 km/h, weil durch Hitzeglut Gleisverformungen zu befürchten waren. Und auf den Autobahnen stauten sich kilometerweit Fahrzeugschlangen, die Betondecken waren bei Temperaturen von über 70 Grad aufgerissen. Auch in Duisburg, der gut 527 000 Einwohner zählenden Industriemetropole im Ruhrgebiet, drohten die ungewöhnlichen Witterungsbedingungen Schaden anzurichten. So musste beispielsweise im Zoo eigens ein Zeltdach installiert werden, um die seltenen Weißwale vor Sonnenbrand zu schützen.
Knapp acht Kilometer Luftlinie vom Tiergarten entfernt, im Arbeiterviertel Laar, hatte es ein kleines Mädchen viel besser als die meisten Erwachsenen, die unter der Bullenhitze ächzten. Es war der 2. Juli, ein Freitag. Das Thermometer zeigte 33,4 Grad. Tanja lachte, jauchzte und sprang immer wieder quietschvergnügt ins Wasser – denn in dem großen Innenhof der schmucklosen Häuserzeile an der Friesenstraße gab es für die vielen Kinder dieses Blocks neben einem Spielplatz auch ein Planschbecken.
Die Viereinhalbjährige aus dem Haus Nummer 3 war nicht allein, ihr zwei Jahre älterer Bruder Thomas tobte mit seiner Schwester ausgelassen über die Rasenflächen des Hinterhofs, und dann hüpften beide immer wieder in die kleine Plastikbadewanne. Es war gegen 15 Uhr, als Jutta, ein Kind aus der Nachbarschaft, sich hinzugesellte. Die Achtjährige wohnte vier Häuser weiter, in Nummer 11. Die Kinder planschten, bespritzten sich mit Wasser, rangen miteinander, sie kicherten. Mitunter wurde es laut.
Das Gejohle hatte einen Bewohner des Hauses Friesenstraße 11 aufmerksam werden lassen. Er argwöhnte, dass sich die Kinder wieder an seinem Mofa zu schaffen machen würden. Es war keine drei Wochen her, da waren die Ventile gelockert worden, beide Reifen waren platt gewesen. Er hatte die Kinder in Verdacht. Der Mann brauchte sein Mofa, um damit zur Arbeit zu kommen, und er brauchte es, um außerhalb von Duisburg herumfahren zu können – am liebsten in einsamen Gegenden, wo ihn niemand kannte. Er war häufig auf Tour, fast jeden Tag.
Jetzt stand er auf dem Dachboden und lugte aus dem Hoffenster. Die Kinder bemerkten den kleinwüchsigen hageren Mann mit der ausgeprägten Stirnglatze nicht. Er schaute zu, wie sich Tanja, Jutta und Thomas amüsierten. Die Kinder waren nackt. Tanja gefiel dem Mann besonders gut: der schlanke Körper, die schulterlangen blonden Haare zu zwei Zöpfen gebunden, das herzerfrischende Lachen, die schelmischen Grübchen in den Wangen. Sein Körper versteifte sich beim Anblick des Mädchens, er begann heftig zu schwitzen, Schweißperlen bildeten sich auf der breiten Stirn. Der Mann hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Er knöpfte sein weißes Hemd auf. Sein Blick wurde starr, irgendwie leer, er wirkte geistesabwesend. Die dunklen Augen fixierten nur noch Tanja. Er wollte ganz nah bei ihr sein. Schweißtropfen platschten auf den hölzernen Fenstersims, während der Mann sich dort abstützte. Er war jetzt in Gedanken, begann zu phantasieren.
Ein Schrei riss ihn aus seinem Fiebertraum. Jutta war gestürzt, sie hatte sich das rechte Knie aufgeschlagen. Das Mädchen weinte, wenig später verschwand sie im etwa acht Meter langen tunnelartigen Durchgang, der vom Hinterhof zur Häuserfront führte. Sie brauchte ein Pflaster – und den Zuspruch ihrer Mutter.
Der Mann dachte nach. Er glotzte immer noch unbemerkt durch das Fenster auf den Hof. Tanja und Thomas waren noch da. Um sich besser konzentrieren zu können, begann er über den Dachboden zu schlurfen – wie immer vornübergebeugt, das linke Bein etwas nachziehend. Dann wurde das Hoffenster geschlossen, und der Mann verschwand. Er hatte sich jetzt etwas vorgenommen, er hatte einen Plan.
Gegen 15.45 Uhr kam Thomas nach Hause. Abgekämpft und müde. Wortlos und mit hängenden Schultern schlich er an seiner Mutter vorbei. Die hatte für die Kinder in der Küche kalten Zitronentee bereitgestellt. Hastig stürzte er ein Glas hinunter. Dann noch eins. Petra Bracht hatte auch ihre Tochter erwartet. Aber Tanja kam nicht. Sie hakte nach: »Tomi, wo ist denn die Tanja?«
»Die kommt gleich.«
Eine Viertelstunde verging. Thomas saß vor dem Fernseher, als seine Mutter nachfragte: »Wollte Tanja noch irgendwohin, hat sie was gesagt?«
»Nee.«
Petra Bracht wurde energisch: »Entweder du sagst jetzt, was los ist, oder ich mache die Flimmerkiste aus!«
Keine Antwort.
»Ich warte!«
»Mami, ich weiß es nicht«, lenkte Thomas ein, »die hat nur gesagt, dass sie gleich hochkommt.«
»War noch jemand bei ihr?«
»Nee.«
Hans Bracht studierte die Reiseroute nach Mannheim, als seine Frau ihm von hinten auf die Schulter tippte. »Hänschen, schau doch mal nach Tanja. Sie ist noch unten am Planschbecken. Wir wollen doch nachher los, und ich muss mich noch um die Brote und so kümmern. Gehst du mal eben?« Hans Bracht nickte.
Wenig später stieß er das Stahltor zum Innenhof auf. Es war ungewöhnlich still. Etwas bedrückt verschaffte er sich einen Überblick. Tanja war nicht zu sehen. Es war überhaupt niemand da. Eigenartig, dachte er sich. Hans Bracht rief nach seiner Tochter. Keine Antwort. Dann noch mal. Wieder nichts.
Augenblicke später ließ ihn etwas stutzig werden; etwas Vertrautes, das er zu kennen glaubte. Er ging einige Schritte. Und er lag richtig: Es war das Kleidchen seiner Tochter, das unweit des Wasserbassins über dem Zaun hing, sorgfältig zusammengelegt. Tanja musste es ausgezogen haben, damit es nicht nass wurde; genauso wie ihre Schuhe. Hans Bracht griff nach dem Kleidungsstück. Er verharrte einen Moment, dachte nach. Das war schon komisch: Tanja war nicht besonders ordnungsliebend, das wusste er; aber ohne Kleid und Schuhe, halbnackt, seine Tochter wäre so nirgends hingegangen. Bestimmt nicht. Der 34-Jährige spürte, wie sich sein Magen langsam zu verkrampfen begann. Ein Gefühl bahnte sich seinen Weg, das er gut kannte, mit dem er sich aber nie hatte anfreunden wollen, und gegen das er sich nicht wirklich wehren konnte: ein Hauch von Angst.
Quatsch! machte er sich Mut. Tanja ist bestimmt schon oben. Oder ist sie eventuell doch gestürzt? Hat Tomi sie vielleicht geschubst? Ist sie womöglich bewusstlos geworden, nachdem sie gefallen war? Liegt sie hinter einem der vielen Sträucher? Oder auf der Kellertreppe? Oder hatte sie einfach nur die Hitze nicht vertragen? Hans Bracht wusste, dass es diese und viele andere Möglichkeiten gab, die meisten davon erschienen auch ihm abwegig. Dennoch inspizierte er nochmals den Hinterhof, die Kellerräume, jede Ecke, jeden Winkel. Keine Spur von Tanja. Anschließend suchte er die Friesenstraße ab. Er traf einen Nachbarn: »Haben Sie die Tanja gesehen?«
»Tut mir Leid, nein.«
Er fragte auf dem Bürgersteig spielende Kinder: »Ihr kennt doch die Tanja, war sie hier?«
Kopfschütteln.
Der besorgte Vater wurde beobachtet – von demjenigen, der im Haus Friesenstraße 11 im zweiten Stock wohnte, vom Treppenaufgang gesehen rechts. Der Mann stand schräg hinter einer altmodischen, schmuddeligen Gardine. Er wollte sehen, aber nicht gesehen werden. Sein Oberhemd war schweißfeucht. Und er war nervös.
Sie wird schon längst zu Hause sein! Hans Bracht machte sich erwartungsvoll auf den Heimweg. Seine Frau hatte ihn früher erwartet, eine knappe halbe Stunde war nun schon vergangen. »Und?« Hans Bracht drückte seiner Frau enttäuscht Kleid und Schuhe in die Hände. »Die Sachen hab’ ich unten auf der Bank gefunden. Ich hab’ alles nach ihr abgesucht, nichts. Keiner hat sie gesehen.« Er fluchte. Und dann wurde es für einen Moment still, für einen quälend langen Augenblick.
»Hans, wir müssen etwas unternehmen!«
»Jetzt beruhig’ dich, sie kommt schon noch oder wir finden sie.« Hans Bracht versuchte auch sich selbst in die Pflicht zu nehmen, kühlen Kopf zu bewahren: »Wir gehen noch mal los, wir beide. Die Kleine muss doch irgendwo sein. Tomi bleibt hier, falls Tanja doch noch auftaucht.«
Anfangs war dieses Gefühl nur unangenehm gewesen, lästig, unbequem – denn Tanja hatte sich schon häufiger verspätet; allerdings nur für ein paar Minuten, höchstens eine Viertelstunde. Und sie war währenddessen nie unbeaufsichtigt geblieben. Jetzt war es irgendwie anders, das spürten ihre Eltern. Sie hatten keinen Anhaltspunkt, keine Orientierung. Tanja hatte den Nahbereich der Wohnung verlassen. Daran zweifelten sie nicht mehr. Es schien keine Alternative zu geben. Ihre Tochter musste sich also an einem Ort aufhalten, den sie unter normalen Umständen nicht hätte aufsuchen dürfen. Allein die nicht zu leugnende Existenz der theoretischen Möglichkeit, dass diese nicht normalen Umstände sich tatsächlich ereignet haben könnten, beflügelte die Phantasie. Aber diese Vorstellungen, die sich wie eine böse Vorahnung anfühlten, wollten nicht konsequent zu Ende gedacht werden. Denn die Angst vor der »sich selbst erfüllenden Prophezeiung«, die erst durch ihre Formulierung wirksam und bedrohlich werden konnte, machte sprachlos.
Die Suche musste fortgesetzt werden. Petra und Hans Bracht alarmierten alle Nachbarn, die sie gut kannten. Und die Nachbarn spannten ihre Kinder mit ein. Denn die wussten besser als die Erwachsenen, wo man sich verstecken konnte, wo es etwas zu erleben gab oder wo sich die Kinder der Siedlung trafen.
Es war mittlerweile 17.30 Uhr, als Christina und Roland im Haus Friesenstraße 11 schellten. Sie hatten von ihren Eltern den Auftrag bekommen, die Bewohner nach Tanja zu fragen. Es dauerte eine Weile, dann wurde aufgedrückt. Im Parterre öffnete niemand. Ein Stockwerk höher wurden die beiden schon erwartet. Der Frührentner Heinz Stüllenberg stand in der Tür: »Was gibt’s denn?«
»Haben Sie die Tanja gesehen?«
Der 53-Jährige stutzte einen Moment. »Das Mädchen aus Nummer 3, die kleine Bracht? Die mit den Zöpfen?«
Kopfnicken.
»Nee, Kinder, tut mir Leid, hab’ ich heute nicht gesehen.«
Zwei Möglichkeiten blieben noch – die Wohnungen unter dem Dach. Bis dorthin waren es 14 Stufen. Die Holztreppe knarrte, als die Kinder sie emporstiegen. Christina zog sich an den Sprossen des Geländers hoch. Das war auch aus Holz, dunkelbraun gestrichen, hier und da war schon die Farbe abgeplatzt. Die Luft war stickig, es roch nach Essen. Oben gab es drei weiß gestrichene Türen, links und rechts wohnte jemand, die mittlere Tür führte zum Dachboden. Roland drückte auf den schwarzen Klingelknopf. Nichts regte sich. Der Junge schellte noch mal. Niemand da. Nun standen sie vor der Wohnung, die rechts vom Treppengeländer abging. An der Tür klebte ein Schild. Den mit krakeliger Schrift geschriebenen Namen konnten sie nicht lesen, die beiden gingen noch in den Kindergarten. Hier wohnte der Mann, der Tanja zwei Stunden zuvor vom Dachboden aus beobachtet hatte.
Christina schellte, sie durfte jetzt auch mal. Als die Kinder schon wieder kehrtmachen wollten, wurde die Tür einen Spaltbreit geöffnet. Das verschwitzte Gesicht des Mannes wurde kaum sichtbar, und er sagte nichts. Aber sein Blick flackerte, wanderte zwischen den Kindern hin und her. Es schien so, als fühle er sich nicht wohl, als behage ihm etwas nicht. Von all dem bemerkten die Kinder nichts. Roland fragte schüchtern nach. Der Mann antwortete mürrisch mit leiser, kaum verständlicher Stimme: »Das Mädel hab’ ich nich’ gesehen!« Sofort wurde die Tür wieder geschlossen, und der Mann ging zurück in die Küche. Was Christina und Roland nicht gesehen hatten, was sie nicht hatten bemerken können: Das weiße Unterhemd des Mannes war auffallend schmutzig, er hatte sich offenbar die Hände daran abgewischt.
Eine knappe Stunde später. Tanja war immer noch verschwunden. Die Hoffnung der Eltern, ihre Tochter bald und wohlbehalten zu finden, hatte sich nicht erfüllt. Mit jeder Minute, die ohne ein Lebenszeichen von Tanja verstrich, wurde die Befürchtung konkreter, die nackte Angst fühlbar. Hans Bracht wurde es zu bunt: »Wir müssen zur Polizei, da stimmt was nicht!«
Auf der Wache des »Schutzbereichs II« war nicht viel los. Zwei betrunkene Randalierer mussten ausgenüchtert werden, eine Streifenwagenbesatzung hatte einen Verkehrsunfall zu bearbeiten, die übrigen Beamten erledigten Papierkram oder spielten Karten. Dann kamen die Brachts.
»Unsere Tochter ist verschwunden«, begann Petra Bracht aufgeregt zu erzählen, »wir haben schon Stunden nach ihr gesucht. Nur ihr rot geblümtes Schürzenkleid haben wir gefunden; und ihre Schuhe, bei uns im Hinterhof. Dort war sie zuletzt.« Die 33-Jährige war den Tränen nahe, ihr Mann ergänzte: »Wir wollten eigentlich zu meiner Schwester nach Mannheim fahren, unser erster Urlaub. Ich hab’ unseren Wagen morgens noch schnell zur Inspektion in die Werkstatt gebracht. Wir warteten auf gepackten Koffern. Unseren Kindern wurde es in der Wohnung zu heiß, sie wollten raus. Seitdem haben wir Tanja nicht mehr gesehen.«
Schnell wurde dem Polizeibeamten klar, dass kein Routinefall vorlag. Da aber Tanjas Aufenthaltsort nebulös blieb, wurde zunächst die Standardmaßnahme eingeleitet – eine »Nahbereichsfahndung«. Alle Streifenwagen des Duisburger Präsidiums erhielten per Funk den Auftrag, »im Rahmen der Streife« nach Tanja Ausschau zu halten. »Mitfahndungsersuchen« wurden an Taxiunternehmen und öffentliche Verkehrsbetriebe gerichtet. Die Beamten des Reviers wurden nach kurzer Lagebesprechung angewiesen, bestimmte Örtlichkeiten in regelmäßigen Abständen anzufahren. Das waren insbesondere die nähere Umgebung der Friesenstraße, die nur einen halben Kilometer entfernten Rheinwiesen, Sportanlagen und Kinderspielplätze. Auch die Laarer Bürger wurden über Lautsprecherdurchsagen »um Mithilfe« gebeten.
Es war 18.54 Uhr, als die Polizei den ersten Hinweis erhielt. »Ich glaube, ich habe das Kind gesehen«, mutmaßte ein männlicher Anrufer, »oben auf dem Rheindamm.« Ein Boot der Wasserschutzpolizei raste los, zusätzlich zwei Streifenwagen, ein Hubschrauber überflog das Gebiet. Eine halbe Stunde später kam die Rückmeldung: »Fehlalarm.«
Um 20.16 Uhr meldete sich telefonisch eine Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte. »Ich möchte niemanden verdächtigen«, begann sie schüchtern, »aber in der Nummer 11 in der Friesenstraße, da wohnt ein Mann, gleich unter dem Dach. Da sind schon mal Kinder zu dem gegangen! Ich weiß nicht, ob das wichtig ist …« Der Polizeibeamte wusste es auch nicht, aber er gab den Hinweis weiter. Zwanzig Minuten später hielt ein Streifenwagen in der Friesenstraße. Die Eingangstür von Haus Nummer 11 stand offen. Wenig später schellten die Polizisten in der zweiten Etage; an der Wohnungstür des Mannes, der Tanja am selben Tag längere Zeit beobachtet hatte. Als sich nichts rührte, wurde angeklopft. Es blieb still, und die Beamten zogen ab. Anschließend überprüften sie die Kellerräume des Hauses und der Nachbarschaft – von Tanja keine Spur.
Als die Dunkelheit eine weitere Suche unmöglich machte, wurde abgebrochen. Petra und Hans Bracht waren erschöpft – körperlich, vor allem aber seelisch. Die Erfolglosigkeit, die Ungewissheit, die Hilflosigkeit, die Unsicherheit, alles kam zusammen. Nichts war mehr so wie vorher. Die Nachbarn spendeten zwar Trost, machten Mut und boten auch für den nächsten Tag ihre Hilfe an. Aber all dies half nicht wirklich. Denn mittlerweile gewann ein Gedanke überhand, und der Eintritt dieser Befürchtung war nun wahrscheinlicher geworden als ihr Ausbleiben: Tanja muss etwas zugestoßen sein! Fraglich war nicht mehr, ob, sondern was passiert war.
Am Samstagmorgen wurde die Suche gegen 7 Uhr fortgesetzt. Die »Vermisstensache Tanja Bracht« war jetzt auch ein Fall für den Bereitschaftsdienst der Duisburger Kripo. Die Ermittler bewerteten zunächst die Aussagen der Eltern, der Nachbarn, die Berichte der Schutzpolizisten. Es folgten Routine-Recherchen, anschließend eine »Beurteilung der Lage«. Das Ergebnis: Ein Verdacht gegen die Eltern erschien »unwahrscheinlich«, ein Unglücksfall »möglich«, ein Kapitalverbrechen »wahrscheinlich«. Gleichwohl fehlten für alle Hypothesen Beweise. Also mussten zunächst tatsächliche und potentielle Zeugen befragt werden: die Familie Bracht, Verwandte, Nachbarn und alle Bewohner der Friesenstraße. Gegen 9.30 Uhr wurden drei Teams gebildet. Ihr Auftrag: »Verbesserung der Informationslage«.
Fünf Minuten später meldete sich auf der Kriminalwache des Präsidiums telefonisch Franz Falenski. Der Mann wohnte in der Friesenstraße 11. »Es geht um das vermisste Mädchen, die Tanja Bracht«, begann der 71-Jährige etwas verlegen zu erzählen, »ich hab’ mit meiner Frau lange drüber geredet. Wir sind uns nicht ganz sicher, komisch ist das aber schon …« Der Kriminalbeamte hörte aufmerksam zu, stellte Fragen, machte sich eifrig Notizen. Es ging um ein verstopftes Abflussrohr und einen unbescholtenen Nachbarn, der »etwas Merkwürdiges« in einer Mülltonne versteckt haben sollte. Dann wiederholte Franz Falenski seine Bedenken: »Wir können uns das nicht vorstellen, und wir wollen auch niemanden anschwärzen, aber vielleicht hat das ja doch was mit dem Kind zu tun.«
Wenige Minuten später erschienen zwei Kriminalhauptkommissare der »Rufbereitschaft« in der Friesenstraße. Sie befragten die Eheleute Falenski und ließen sich die Mülltonne zeigen. Was die Ermittler dort unter Abfällen versteckt fanden, nahm ihnen den Atem. Derartiges hatte keiner von beiden zuvor je gesehen. Doch sie erkannten sofort, worum es sich handelte, woher es stammte. Und sie wussten nun, was zu tun war. Es gab jetzt einen ungeheuerlichen Verdacht – und einen Verdächtigen. Der wohnte im zweiten Stock. Es war der Mann, der Tanja tags zuvor längere Zeit beobachtet hatte. Und der hatte bis zu diesem schwül-heißen Samstagmorgen des 3. Juli 1976 so unauffällig gelebt, als gäbe es ihn gar nicht.
Um 10.05 Uhr klopften die Beamten an seine Tür. Die Kommissare hatten noch keine konkrete Vorstellung von dem, was sie in der Wohnung vorfinden würden. Aber wenn sich nur annähernd bewahrheiten sollte, was sie vermuteten, so erwartete sie die Hölle.
Es verging noch eine Weile, dann wurde geöffnet.
4
Reumütig stand er da, in geduckter Haltung, den Kopf gesenkt, die Hände tief in die Hosentaschen vergraben. Er hatte ein ungutes Gefühl, er fürchtete sich. Dann die Erleichterung, seine Mutter stand in der Tür. Von seinem Vater hätte er Senge bekommen – wie so viele Male zuvor schon.
»Wo warst du denn so lange?«
Er antwortete wie immer, kurz und bündig: »Och, bin so rumgelaufen.«
»Komm rein, wasch’ dir die Hände, es gibt gleich Essen.«
Der Junge wohnte in Hindenburg, einer knapp 200 000 Einwohner zählenden Industriestadt in Oberschlesien. Es war gerade drei Wochen her, da hatte er seinen sechsten Geburtstag gefeiert, am 17. April 1939. Er hatte acht Geschwister, davon fünf Brüder, er war als sechstes Kind geboren worden. Sein Vater schuftete als Bergarbeiter von 4 bis 16 Uhr für den Unterhalt der Familie, seine Mutter versorgte den Haushalt. Die elfköpfige Familie teilte sich drei kleine Zimmer in einem typischen Bergarbeiterhaus. In der Doppelhaushälfte im Finkenweg 23 herrschte qualvolle Enge, die Familie lebte in äußerst dürftigen bis ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter nächtigte mit seinem jüngsten Bruder in der Wohnküche, der Vater mit den übrigen Söhnen im Zimmer hintenraus, die drei Mädchen im Schlafzimmer zur Straße hin.
Das Geld war stets knapp, der Lohn des Vaters reichte gerade für die notwendigsten Anschaffungen. Die jüngeren Kinder hatten die Kleidung der Älteren aufzutragen, Spielzeug, Süßigkeiten oder andere Annehmlichkeiten blieben die Ausnahme. Die Eltern mussten ihre Kinder vernachlässigen. Notgedrungen. Dennoch entwickelten die sich altersentsprechend, sie zeigten auch in der Schule keine Auffälligkeiten – bis auf ihn.
Im Sommer 1939 kam er in die Volksschule. Anfangs waren seine Leistungen »durchschnittlich«. Aber er ging nicht gerne zur Schule. Da waren Mädchen, die ihn wegen seiner »Segelohren« auslachten, und für viele Jungen war er einfach »nur doof«. Die anderen beachteten ihn nicht. Das schmerzte. Zu Hause blieb er stumm, konnte sich nicht mitteilen. Auch dort war er nicht mehr als ein geduldeter Mitläufer, ein Außenseiter, der Sündenbock, das Schlusslicht. Nur von seiner Mutter Hedwig durfte er Hilfe und Zuwendung erwarten. Doch die damals 38-Jährige hatte kaum Zeit für ihn; die Familie, der große Haushalt wollten versorgt werden.
Dann rutschte er auch in der Schule ab, die Leistungen in »Schreiben«, »Rechnen« und »Lesen« waren »ungenügend«. Noch in der dritten Klasse wurde er in eine Sonderschule abgeschoben. Der schmächtige, kleinwüchsige Bursche konnte sich aber auch hier nicht behaupten, zwei Mal blieb er sitzen. Als ihm seine zwei Jahre ältere Schwester Elisabeth bei den Hausaufgaben zu helfen begann, ging es bergauf. Seine schulischen Leistungen besserten sich. Im Frühjahr 1943 wurde er nach bestandener Prüfung wieder in seiner ehemaligen Schule aufgenommen.
Aber das Verhältnis zu seinen nun jüngeren Mitschülern war auch jetzt angestrengt. Er war der »Sitzenbleiber«, der »Hilfsschüler«, der »Depp«. Doch hatte er sich mittlerweile an seine Außenseiterrolle gewöhnt, sich hiermit arrangiert, damit abgefunden. Prügeleien ging er konsequent aus dem Weg. Nur ein einziges Mal wurde es ihm zu bunt: Er ohrfeigte ein Mädchen, zu dem er sich eigentlich hingezogen fühlte. Sie hatte ihn einen »Blödmann« geschimpft.
Zu Hause ging es allerdings weniger glimpflich ab. Besonders seine älteren Brüder schoben ihn immer wieder vor, stempelten den »Kleinen« zum Übeltäter, wenn sie etwas ausgefressen hatten. Seinem Vater, allgemein geachtet und beliebt, kam dies durchaus gelegen. Er, unbeirrbarer und konsequenter Verfechter der Prügelstrafe als wirksames Erziehungsmittel, hielt seinen Sohn eh für einen »Taugenichts«, einen »Versager«. Und er war unnachgiebig – insbesondere dann, wenn er nachmittags von der Schicht kam und nur noch seine Ruhe haben wollte. »Strafe muss sein!« Da kannte »der Alte« keinen Pardon, dann setzte es reichlich Dresche: mit dem Rohrstock, mit dem Hosengürtel. In dieser Zeit versuchte der Junge seinem Peiniger aus dem Weg zu gehen, das Vater-Sohn-Verhältnis war geprägt von Unverständnis, Misstrauen, Aggressionen, Gewalt.
Als einzige Bezugsperson akzeptierte er seine Mutter. »Anständig«, »fromm«, »fleißig«, so wurde sie überwiegend charakterisiert. Bei ihr suchte er Zuflucht, Geborgenheit, menschliche Wärme. Aber seine Mutter sah sich in erster Linie dem Wohl der gesamten Familie verpflichtet, da gab es »keine Extrawurst«. Und dieser vermeintliche Liebesentzug, diese fortwährende Vernachlässigung, diese als ungerecht empfundene Zurücksetzung machten ihm schwer zu schaffen. Das tat weh.
Als Zehnjähriger wurde er zum »Jungvolk« eingezogen. Die »Pflichtdienststunden« waren ihm höchst unangenehm, er schwänzte den Unterricht so oft es ging. Das hatte Gründe: Auch bei den »Pimpfen« wurde der »Waschlappen« regelmäßig geschurigelt, weil er teilnahmslos dastand, kein Interesse zeigte, nicht mitmachen wollte, nichts zu sagen hatte. Dann wurde er angebrüllt: »Du hast ja keinen Mumm!« Oder er war einfach nur ein »verdammter Schlappschwanz«. Später musste er strafexerzieren.
Überhaupt hatte er für die Ideologie der Nazis weder Verständnis noch Interesse. Schon in dieser frühen Phase seines Lebens wurde deutlich, dass er kaum Eigeninitiative entwickelte, für Ideen und Anregungen nicht empfänglich war. Er lebte für sich. Allein. Freundschaften mit Gleichaltrigen schloss er nicht. Nicht ein einziges Mal. Allerdings war da auch niemand, der sich mit diesem »Hohlkopf« und »Schwächling« hätte abgeben wollen. Er blieb lieber außen vor, um den sonst drohenden Streitigkeiten, Unannehmlichkeiten und Demütigungen aus dem Weg zu gehen. Er begehrte nicht auf – zu Hause nicht, in der Schule auch nicht. Der streng katholisch erzogene Junge tat alles, was von ihm verlangt wurde: widerspruchslos, lautlos, klaglos. Sein bester Spielkamerad blieb er selbst, Zerstreuung und seelische Entspannung fand er nur bei ausgedehnten Spaziergängen und Erkundungen in der Umgebung Hindenburgs.
Im Verlauf des Krieges wurden seine beiden älteren Brüder zum Militär eingezogen. Seinem Vater blieb dies zunächst erspart, er war als Bergmann »unabkömmlich«. Als Ende 1944 der Einmarsch der Roten Armee unmittelbar bevorstand, verließen seine Mutter, er und die übrigen Geschwister Hindenburg. Der Vater musste bleiben, Beruf und Befehl verpflichteten ihn. Sie fanden Unterschlupf in der schlesischen Gemeinde Dittersdorf, auf dem Bauernhof der Großeltern. Aber auch hier blieb er, jetzt 12 Jahre alt, von einschneidenden Kriegserlebnissen nicht verschont: zusammengeschossene Flüchtlingstrecks, totes Vieh, Leichenteile, grausam verstümmelte Menschen. Und er musste mit ansehen, wie zwei junge Burschen förmlich zerfetzt wurden. Sie hatten nichtsahnend mit scharfen Handgranaten gespielt.
Während der Zeit in Dittersdorf bekam er Typhus. Längere Zeit blieben die Beine gelähmt, sein Allgemeinzustand war streckenweise »bedrohlich«, die Eltern befürchteten das Schlimmste. Der behandelnde Arzt vermutete zudem eine Hirnhautentzündung. Erst nach knapp einem Jahr begann der Junge sich langsam zu erholen. Allerdings war er weitestgehend hilflos, wie ein Kleinkind – er musste jetzt mühsam lernen, wieder auf eigenen Füßen zu stehen, zu laufen. Insbesondere sein Großvater half ihm dabei. Seine Mutter hingegen gab sich zugeknöpft, kümmerte sich nicht weiter um ihn. Die Unbeholfenheit ihres Sorgenkindes kommentierte sie nur lakonisch: »Der hat sie doch nicht mehr alle.«
Nach Ende des Krieges kam Dittersdorf unter polnische Verwaltung. Mutter und Kinder mussten den Bauernhof verlassen, sie wurden in kargen Holz- und Steinbaracken untergebracht. Nur das Nötigste hatten sie mitnehmen dürfen. Der Vater war kurz vor Kriegsende doch noch eingezogen worden, später in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Mehr wusste man nicht. Mutter und Kinder waren nun mittellos, auf sich allein gestellt.
Anfang 1947 wurden auch sie Teil des »Umsiedlungsplans«. Den Bürgern »deutscher Volkszugehörigkeit« war das Wohnrecht entzogen worden, die so genannten Repatrianten (polnische Umsiedler) sollten die »wiedergewonnenen Gebiete« bevölkern. Die Familie entschloss sich, die Heimat zu verlassen. Zunächst fand man Unterschlupf in einem Lager bei Helmstedt, gut 40 Kilometer von Braunschweig entfernt. Sechs Wochen später ging es weiter in die 800-Seelen-Gemeinde Oesdorf, in der Nähe von Brilon im Sauerland.
Der jetzt 14-Jährige wurde, wie die anderen Familienmitglieder auch, auf einem Bauernhof untergebracht. Der Tagesablauf war monoton: um 5 Uhr aufstehen, Kühe melken, dann zur Schule; nachmittags das Vieh zusammentreiben, der Bäuerin im Stall helfen, den Hof fegen. Danach hatte er ein wenig Zeit für sich, meistens besuchte er seine Mutter. Als der Bauer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, wurde der Junge nicht mehr gebraucht, er musste den Hof verlassen. Er hatte sich insgesamt so unauffällig, so unscheinbar geführt, dass niemand nach ihm fragte, ihn niemand vermisste. Der Bäuerin war lediglich aufgefallen, dass das Bett des Jungen jeden Morgen klamm war und stark roch. Der »Schleicher« – so nannten sie ihn, weil er äußerst schweigsam war und sich nahezu lautlos an jemanden heranpirschen konnte – nässte immer noch ein. Er konnte sich das nicht erklären, und er konnte auch nichts dagegen tun. Er ließ es einfach passieren.
Obwohl er in »Deutsch«, »Rechnen« und »Religion« mit »ausreichend«, in »Leibesübungen« gar mit »befriedigend« benotet worden war, musste er nach der vierten Volksschulklasse entlassen werden. »Zu alt«, hieß es. Wieder stand er vor einem Scherbenhaufen. Das war im Herbst 1948.
Nun begann eine Odyssee als Hilfsarbeiter über verschiedene sauerländische Bauernhöfe. Der junge Mann, der so gerne Elektriker gelernt hätte, musste Schweineställe ausmisten oder Bäume schlagen – für ein Dach über dem Kopf, ein paar Mahlzeiten und 50 Mark Lohn. Das Geld musste er bei seinen Eltern abliefern, die ihn dafür einkleideten. Unterdessen waren sein Vater und seine beiden älteren Bruder wohlbehalten aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Er wusste nicht recht, was er davon halten sollte. Darüber nachdenken mochte er aber auch nicht. Es war ihm einfach egal.
Die eintönige Maloche auf dem Bauernhof war ihm zuwider. Er hatte sich sein Leben anders vorgestellt. Als er zufällig in einem Gespräch mitbekam, dass der älteste Sohn des Bauern auf die Landwirtschaftsschule gehen sollte, wurde er hellhörig. Plötzlich hatte er wieder eine Perspektive, er sah eine Möglichkeit, der nervtötenden Monotonie zu entfliehen, endlich etwas tun zu dürfen, das ihn interessierte, anspornte.
Und es klappte, die Schule nahm ihn. Aber schon nach drei Monaten ereilte ihn das nächste Fiasko. »Aufgrund der bisherigen Leistungen muß davon ausgegangen werden, dass Ihr Sohn den Lernstoff nicht wird bewältigen können (…)«, hieß es in einem Brief an seine Eltern. Er wurde geschasst.
Es blieben ihm die Bauernhöfe von Oesdorf und Umgebung. Aber er hatte einfach keine rechte Lust zu malochen – der Dreck, der Gestank, das Gemaule des Bauern, der karge Lohn. Obwohl er sich für nichts zu schade war, fand er kaum Anerkennung. Allerdings bemühte er sich auch nicht sonderlich. Immer wieder gab es Ärger, auch beim Melken. Weil er schummelte. Er schaffte fast immer nur die Hälfte, und dann schüttete er Wasser in die Milch, damit der Eimer voll war. Irgendwann wurde es dem Bauern zu viel: »Du hast se doch wohl nicht mehr alle!« Als sein Knecht wutentbrannt den Eimer umtrat, gab es kein Halten mehr. Der Bauer schnappte sich den nächstbesten Holzknüppel und prügelte den Jungen vom Hof.
Obwohl die Empfindungen für seine Familie zwiespältig waren, sehnte er sich nach ihr. Er wollte heim. Die ständige Trennung, der anstrengende, schwierige Umgang mit fremden Menschen, das fortwährende Hin-und-her-geschubst-Werden machten ihm schwer zu schaffen. Er war nur ein Spielball. Jeder durfte über ihn verfügen. Und es gab weder eine Belohnung noch Dank. Er hatte zu funktionieren – wehe ihm, wenn nicht! Verzweifelt sehnte er sich nach Mitgefühl und ein wenig Anerkennung. Doch sein ständiger Wegbegleiter blieb die Entbehrung. Er besaß keine Individualität, er hatte kein Profil, keine Ausstrahlung. Er war einfach nur ein x-beliebiger Stallbursche, ein komischer Kauz, für den sich niemand interessierte. Weil er nicht sprach, weil er nichts zu sagen hatte. Weil er sich nicht traute, weil er sich nichts zutraute. Mehr und mehr verfestigte sich bei ihm der Gedanke, er sei ein Niemand, eine Null, ein Nichts. Der junge Mann wusste auch, warum: Er war hässlich, zu klein, zu dumm, hatte nichts Vernünftiges gelernt, war komisch angezogen, konnte nicht so flüssig reden wie die anderen, wurde gemieden, nicht für voll genommen. Das waren Argumente genug.
Aber das war noch nicht alles. Da regte sich jetzt etwas, da nahm etwas Gestalt an, das hatte es so in den Jahren zuvor nicht gegeben; jedenfalls hatte er nicht weiter darüber nachgedacht. Nun war es aber da, und er konnte es nicht einfach verscheuchen wie eine lästige Fliege. Es war ein Gefühl, ein Verlangen, ein Wunsch, eine vage Vorstellung. Er wollte Kontakt bekommen zu Mädchen, sie anfassen – und mehr.
Mit 15 hatte er immer noch keine Vorstellung davon, was da zwischen Jungen und Mädchen, zwischen Mann und Frau vor sich ging. Er hätte Kontakt haben können, Mädchen in seinem Alter gab es auf den Bauernhöfen genug. Aber er war zu schüchtern. Er hätte zu Tanzveranstaltungen gehen, Mädchen dort ansprechen können. Aber er ging nicht hin. Er hätte sich bei seinen älteren Brüdern Rat holen können. Aber er fragte nicht nach. Schließlich war ihm immer wieder eingebläut worden, er sei ein Versager. Und jemand wie er scheute Intimitäten. Denn dieser Zustand erforderte Vertrautheit, Verbundenheit, Vertraulichkeit. Ingredienzen der Intimsphäre, die unverrückbar, unantastbar bleiben sollten. Er spürte instinktiv, dass seelische und körperliche Nähe auch Verfehlung, Verwirrung, Verdruss und Verlust bedeuten konnten. Und er hatte schlechte Erfahrungen gemacht: Wenn ihm jemand zu nahe gekommen war, hatte es meistens Ärger gegeben. Er war ein Ritter ohne Rüstung, allem und allen schutzlos ausgeliefert.
Und doch loderte da ein Feuer in ihm, das gelöscht werden wollte. Also onanierte er, erst sporadisch, dann regelmäßig. Immer vor dem Schlafengehen. Er stellte sich den nackten Körper eines Mädchens vor; allerdings nicht den eines bestimmten Mädchens. Dabei war er vollkommen auf seine Phantasie angewiesen, den unbekleideten Intimbereich eines Mädchens oder einer Frau hatte er bis dahin nicht gesehen. Und aufgeklärt worden war er auch nicht. Sexualität war in seiner Familie eine verminte Tabuzone, darüber wurde nicht gesprochen. Er wusste nur so viel: Kinder werden vom Klapperstorch gebracht.
Er war kein junger Mann, der für ein bestimmtes Mädchen schwärmte. Überhaupt wusste er nichts über das weibliche Geschlecht zu sagen. Mädchen waren für ihn eine janusköpfige Unbekannte: reizvoll und aufreizend, vor allem aber undurchschaubar, unberechenbar und unerreichbar. Mädchen übten auf ihn zunächst eine lediglich sexuelle Anziehungskraft aus. Er wollte mit ihnen zu tun haben, aber nicht um ihrer selbst willen. Sie waren Objekte. Und Sexualität war für ihn etwas Handfestes. Er wollte nicht reden, er wollte anfassen. Er wollte nur wissen, wie sich das anfühlt. Körperlichkeit wollte er zulassen, nicht mehr.
Über Ursprung und Tragweite seiner Gefühle war er sich nie ganz im Klaren. Deshalb konnte er auch die Empfindungen seiner Mitmenschen nicht beurteilen, nicht einordnen. Und seine Bedürfnisse wurden übersehen, meistens aber einfach nicht akzeptiert. Ihm war die Rolle des Befehlsempfängers, des Handlangers zugedacht worden. Mit der Zeit hatte er sich abgewöhnt, Vorstellungen und Vorlieben zu artikulieren. Der So-gut-wieAnalphabet fand keine Worte. Er blieb stumm.
Aber das Verlangen hielt ihn in Atem. Es arbeitete in ihm, es gärte. Er suchte verzweifelt nach Möglichkeiten, um endlich all das erleben zu dürfen, wovon er mittlerweile schon so oft gehört und geträumt hatte. Kurz vor seinem 17. Geburtstag nahm er all seinen Mut zusammen. Helga, eine Magd auf dem Hof, saß nach dem Melken auf einer Holzbank. Sie machte Pause. Er setzte sich neben sie. Sein Puls raste, als er der 17-Jährigen die rechte Hand auf den Oberschenkel legte. Ohne Worte, einfach so. Es vergingen einige Sekunden, die ihm wie eine Ewigkeit vorkamen. Er war fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Es konnte einfach nichts schiefgehen. Er hätte das Mädchen auch anschauen wollen, aber er konnte sich nicht überwinden. Sie musste es so verstehen. Dann passierte doch etwas: Helga schob seine Hand beiseite – und knallte ihm eine. Wortlos stapfte sie davon. Er war schockiert, ratlos. Alles hätte passieren dürfen, nur das nicht.
Bis hierhin war seine sexuelle Entwicklung weitgehend unauffällig geblieben. Dass er regelmäßig masturbierte, dass er in der Pubertät aus seiner emotionalen Zwangsjacke noch nicht herauskam, das war sicher nicht ungewöhnlich, und dass er noch keinen Intimkontakt hatte, das konnte sich noch ändern.
Das tat es aber nicht. Der ungewollte Verzicht auf Intimitäten hielt an, und das Verlangen nach einem Sexualpartner wuchs. Er wollte sich abreagieren. Er musste.
Mit der Zeit entwickelte er eine Vorstellung, die Abhilfe versprach: Wenn es mit Mädchen nicht klappte, dann wollte er sich eben an Tieren schadlos halten. Seit geraumer Zeit hatte er als Stallbursche immer wieder Deckvorgänge beobachtet, insbesondere bei Kühen, Schweinen oder Hunden. Häufig musste er die Kühe des Bauern von der Weide holen, damit sie von den Stieren gedeckt werden konnten. Weil er das Vieh an den Hörnern zu packen und festzuhalten hatte, konnte er nicht alles sehen; aber er bekam so viel mit, um verstehen zu können, was dort prinzipiell passierte. Und dieses Wissen machte er sich zunutze. Er stellte sich auf einen Schemel, hob den Schwanz einer Kuh und drang ein. Dabei stellte er sich vor, das Rindvieh sei ein Mädchen. So kam er zum Höhepunkt. Er versuchte es auch bei Schweinen. Aber die liefen immer vor ihm weg oder entglitten seinen Händen. Die sodomitischen Akte halfen ihm, seine verkrüppelte Sexualität zu kaschieren, seine soziale Frigidität zu vergessen. Scham oder Reue empfand er dabei nicht. Unangenehm war ihm nur, dass seine Klamotten danach arg verdreckt waren.
5
Eine unheilvolle, dramatische Wendung nahm die Entwicklung seiner Sexualität, als er mehrfach beobachten musste, wie Vieh und anderes Getier geschlachtet wurden. Er war jetzt sechzehneinhalb. Regelmäßig half er beim Entdärmen der Kadaver. Erst war es nur ein diffuses, aber angenehmes Gefühl, insbesondere wenn Schweine getötet und ausgenommen wurden. Später, es waren einige Monate vergangen, empfand er schon mehr. Das verzweifelte Zappeln der Tiere, das schrille Gequieke, der aussichtslose Todeskampf, das hervorquellende Blut, das Versterben, die letzten Zuckungen, all das erregte ihn – seelisch und körperlich. Er bekam Schweißausbrüche, Herzrasen und ein eigenartiges Kribbeln im Magen und auf der Brust, so, als wenn Ameisen über seinen Oberkörper krabbelten. Erst viele Jahre später sollte er diesem diffusen Erregungszustand einen Namen geben: das »komische Gefühl«.
Die hiermit einhergehende sexuelle Stimulation war gewaltig, er konnte sie nicht zurückweisen, nicht kontrollieren. Das wollte er auch nicht. Es war eine abenteuerliche, faszinierende Erfahrung, der er sich nicht verschließen wollte. Die körperlichen Symptome verschwanden erst, wenn er unmittelbar nach den Schlachtungen masturbierte. Danach war er nicht nur körperlich befriedigt.
Als er die Schlachtvorgänge vollständig sexualisiert hatte, begann er sich Dinge auszumalen, die seine Erregung immens steigerten. Aus Schweinen wurden Mädchen, die er gnadenlos niedermetzelte. Finalen Genuss verschaffte ihm die Horrorvision, den Körper der Opfer aufzuschneiden und sich an diesem Anblick zu ergötzen. In seiner bizarren Parallelwelt hatte er nun endgültig jedes Maß verloren. Die sozialen Gefühle des Alltags wurden ausgeblendet: kein Mitleid, keine Schuld, keine Scham. Er delirierte in einem psycho-sexuellen Ausnahmezustand. Und er war mächtig.
6
In der Realität hingegen war er machtlos. Immer wieder drängte er seine Mutter: »Ich will nach Hause!“ Und jedes Mal wurde er abgewiesen: »Du weißt doch, das geht nicht.« Grund waren die angeblich beengten Wohnverhältnisse: zwei kleine Zimmerchen für neun Personen. Aber dass ein Bewohner mehr keinen wesentlichen Unterschied gemacht hätte, erkannte auch er. Doch er reagierte wie immer – und fügte sich in sein Schicksal.
Wenige Monate später fand sein Vater einen Job im Bergbau und eine neue Wohnung. Im Sommer 1952 verzog die Familie ins Ruhrgebiet, in die knapp 100 000 Einwohner zählende Industriestadt Bottrop – nur er musste weiterhin bei einem Bauern in Oesdorf schuften. Wieder wurde er ausgegrenzt, wieder wurde auf seinen Gefühlen achtlos herumgetrampelt. Wenn sein Leben eine Wand gewesen wäre, sie hätte tausend Risse gehabt.
Drei Monate vor seinem 21. Geburtstag endlich eine gute Nachricht. Seine Mutter schrieb ihm: »Vater ist Dir nicht mehr gram. Komm, sobald Du kannst (…).« Anfang März 1953 kehrte er dem verhassten Oesdorf den Rücken. Seine stille Sehnsucht, Radio- und Fernsehmechaniker zu werden, flammte wieder auf. Einmal durfte er sogar vorsprechen, der Ladeninhaber war mit seinem Vater gut bekannt. Als er gefragt wurde, welchen Schulabschluss er vorweisen könne, lächelte er nur gequält. Er hatte immer noch keinen. Nach fünf Minuten war alles vorbei.
Schließlich kam er doch in Brot und Lohn. Wieder hatte sein Vater ein gutes Wort für ihn eingelegt. Auf der Zeche »Prosper II« in Bottrop fand er eine Anstellung, als Schlepper im Streckenbau. Knochenarbeit. Zwischen 1000 und 1500 Mark netto bekam er monatlich, den größten Teil des Lohns hatte er aber zu Hause abzuliefern. Sein Vater hatte so entschieden. Er wohnte immer noch bei seinen Eltern, schlief mit drei Brüdern in einem Zimmer.
Auf den Bauernhöfen rings um Bottrop fand er wieder Gelegenheit, sich an Tieren zu vergehen. Aber das klappte nicht so gut. Mal fand er keinen Schemel oder Stuhl, auf den er sich hätte stellen können, mal war das Vieh auf der Weide. Oder ein Wachhund schlug an. Einmal wurde es brenzlig, als eine Kuh herhalten musste. Aber er konnte sich noch rechtzeitig die Hose hochziehen, und der Bauer hatte sich wohl auch nicht vorstellen können, was da in seinem Stall vor sich ging. So blieb es bei einem »Mach’ dich weg hier!«
Obwohl er nicht darauf vertrauen durfte, dass es gelingen würde, zog er es in Erwägung. Er wollte Sex – mit einem Mädchen. Eine andere Möglichkeit sah er nicht. Und wie er es anfangen sollte, war ebenso ungewiss. Dabei hatte er doch schon alles ausprobiert, glaubte er. Ihm war allerdings auch so gut wie nichts eingefallen, und er hatte sich noch weniger zugetraut. Er hatte es verdrängen wollen, aber immer wieder war sie da, sie hatte sich förmlich in sein Bewusstsein hineingefressen – die Erinnerung an Helga und das, was passiert war; wie sie reagiert hatte, als er mutig alles auf eine Karte gesetzt hatte. Der Lohn: eine schallende Backpfeife. Bitter. Das war nun Vergangenheit, gewiss. Aber er befürchtete, dass dies auch die Zukunft sein könnte – abgewiesen zu werden oder schlimmer noch: nicht seinen Mann stehen zu können.
Die allgegenwärtige Versagensangst wirkte wie ein Gift, sie lähmte seinen Körper, seine Willenskraft. Ob »bei Belbe« im Kolonialwarenladen um die Ecke, auf dem Weg zur Arbeit, in der Kneipe oder in der Straßenbahn – nur in Gedanken sprach er sie an: Willst’ mit mir poppen? Das war seine Art, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. Manchmal wünschte er sich, dass Frauen seine Gedanken lesen könnten. Dann hätte er nicht reden müssen. Dann hätte alles wie von selbst gehen können. Dann hätte es geklappt. Aber er bekam den Mund nicht auf. Nicht ein einziges Mal.
Die bluttriefenden Gewaltphantasien wurden seltener und verblassten merklich, als er nicht mehr für das Schlachten von Schweinen herangezogen wurde. Aber das »komische Gefühl« blieb. Regelmäßig überkam es ihn. Er wusste nicht genau, was zuerst da war: der schnelle Puls, das Kribbeln und die feuchten Hände oder die monströse Trugwelt, in die er sich flüchten konnte. Die Reihenfolge war ihm aber auch egal. Besänftigen konnte er diesen unspezifischen Drang jedenfalls nur, wenn er masturbierte. Dabei stellte er sich vor, wie es hätte sein können – in den Armen eines halb nackten Mädchens.
Seine Mutter machte sich Sorgen. Sie war der Meinung, es wäre Zeit, der Junge müsse unter die Haube. Ihr Sohn hatte auch etwas angedeutet, der Beweis aber stand noch aus. Deshalb wurde hin und wieder nachgefragt, zunächst zaghaft: »Wann stellst du sie uns vor?« Später dann energisch: »Wann stellst du sie uns denn endlich mal vor?« Mit gesenktem Blick kam immer dieselbe Antwort: »Och, bald.«
Sie war »Gertrud«, seine »Freundin«. Die gab es allerdings nicht wirklich, sie wurde nur dann ins Leben gerufen, wenn er sich nicht anders zu helfen wusste. Insbesondere im Kollegenkreis. Er hätte dick auftragen können, aber er schwieg lieber. Denn er konnte nicht sicher einschätzen, ob das, was er zum Besten geben würde, auch glaubhaft war. Ihm fehlten einschlägige Erfahrungen. Der einzige körperliche Kontakt zu einem Mädchen war bis dahin eine Ohrfeige gewesen. Und nackte Frauen kannte er nur aus Pornoheften, die seine Kumpels unter Tage in Umlauf brachten. Allerdings interessierte und inspirierte ihn dies kaum.
Aber dann passierte es doch. Eine junge Frau hatte sein Interesse geweckt – und mehr. Roswitha kellnerte in der »Bergmannsklause«, einen Steinwurf von der Wohnung seiner Eltern entfernt. Die 17-Jährige, die alle nur »Rita« riefen, stand in der Woche abends hinter dem Tresen. Er war kein Kneipengänger. Das änderte sich schlagartig, nachdem er Rita das erste Mal gesehen hatte. Jetzt kam er regelmäßig, fast jeden Tag saß er hinten rechts in einer dunklen Ecke. Dort fühlte er sich unbeobachtet und sicher.
Er kam immer gegen halb sechs und bestellte ein Glas Apfelsaft. Bier mochte er nicht. Dann wartete er auf Rita. Wenn sie das Lokal betrat, klebten seine Augen an ihr, und er bekam feuchte Hände. Das, was er in der schummrigen Kaschemme erkennen konnte, gefiel ihm: die blond gefärbten Haare, schulterlang; die kräftigen, knallrot geschminkten Lippen; vor allem aber die üppige Figur, durch eine viel zu enge Bluse und eine noch engere Hose nur notdürftig verhüllt. Die pummelige junge Frau mit der schwarzen dickglasigen Hornbrille erregte ihn. Und er mochte sie – eine für ihn vollkommen neue Erfahrung. Das behielt er natürlich für sich.
Woche um Woche verging. Er hockte auf seinem Stammplatz, natürlich allein, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt, die Hände arbeiteten in seinem Gesicht. Und immer wenn er sich sicher sein konnte, dass ein Blickkontakt ausgeschlossen war, glotzte er Rita an. Einmal passierte es doch: Er bekam seine Augen nicht von ihr los, und ihre Blicke trafen sich; für den Hauch eines Augenblicks. Ertappt! durchfuhr es ihn. Blitzartig begann er die Decke anzustarren, er hatte Mühe, seine Verlegenheit zu verbergen. Sein Herz raste. Nach einigen Minuten, die qualvoll langsam verstrichen, Entwarnung – Rita hatte nicht reagiert. Jedenfalls war sie nicht zu ihm gekommen und hatte ihm eine geschmiert. Genau das hatte er befürchtet.
Zwei Tage später sprachen sie sogar miteinander. »Das macht 50 Pfennig.« Rita war zum Kassieren gekommen. Das war ungewöhnlich, das hatte sie noch nie getan. Mit zittrigen Händen fingerte er das Geld aus seiner Hosentasche. »Da«, mehr brachte er nicht heraus und zeigte auf das Geldstück. Vor lauter Aufregung vergaß er, ihr Trinkgeld zu geben. Sie blieb noch einen Moment neben ihm stehen, und er hatte das Gefühl, als wollte sie ihm etwas sagen. Aber sie schaute ihn nur an. Sekunden später verschwand sie hinter dem Schanktisch.
Am nächsten Tag verließ er das Lokal nicht um halb zehn, wie sonst. Diesmal war alles anders. Er trank Bier, ein Glas nach dem anderen. Wie viele es werden würden, war ihm egal. Es mussten aber so viele sein, dass er es fertigbrachte. Er wollte Rita etwas fragen. Kurz vor dem Zapfenstreich kam sie endlich. »Wir machen gleich Feierabend. Acht Bier. Macht vier Mark.« Das Geld lag bereits abgezählt auf dem Tisch. Er schob es zu ihr hinüber. Auch an das Trinkgeld hatte er gedacht. 20 Pfennig.
»Was gibt’s denn zu feiern?«
Er musste einmal kräftig schlucken, bevor er antworten konnte. »Och, nichts Besonderes.«
Zum ersten Mal lächelte sie ihn an. Er grinste verlegen zurück. Dann nahm er all seinen Mut zusammen: »Willst’ mal ins Kino? Äh, ich mein’, mit mir.«
Sie lachte laut. »Klar, warum nicht. Ja.« Sie verabredeten sich für den nächsten Tag.
Rita wohnte noch bei den Eltern und teilte sich mit ihrer zwölfjährigen Schwester ein Zimmer. Sie hatte sich mächtig rausgeputzt, war mittags noch beim Friseur gewesen. Pünktlich um halb sieben schellte es. Dann stand er in der Tür. Der schwarze Anzug passte nicht ganz, die Hose war zu lang, die Ärmel zu kurz. Er hatte »das gute Stück« von seinem älteren Bruder Klaus geborgt, für 2 Mark. Die dunkelgraue Krawatte, auch von Klaus, hatte er sich von seinem Vater binden lassen. Das weiße Oberhemd war von ihm. Eine Viertelstunde hatte er vor dem Spiegel zugebracht, jetzt saß alles perfekt: Die dunkelbraunen Haare waren akkurat gescheitelt, streng nach hinten gekämmt, und sie glänzten matt.
Im »Scala« wurde »Singin’ in the Rain« gezeigt, mit Gene Kelly und Debbie Reynolds in den Hauptrollen. Auf dem Weg dorthin sagte er so gut wie nichts. Rita aber plauderte munter drauflos, erzählte von den Querelen mit ihrer Schwester, vom tragischen Tod ihres Hundes »Charly« (er war überfahren worden), von ihrer verkorksten Schulzeit und von »Freddy«. Ihren ehemaligen Freund hatte sie jüngst abserviert. Rita war eine kontaktfreudige, resolute Frau, im Umgang mit Männern nicht unerfahren.
Im Kino saß er stocksteif neben ihr und starrte auf die Leinwand. Gerne hätte er sich ihr genähert, aber er hatte keine rechte Vorstellung, was und wie und wann und wo es passieren sollte. Rita war da anders. Nach einer guten Stunde legte sie ihre Hand auf seine. Keine Reaktion. Sie machte noch einen Versuch. Wieder nichts. Dann küsste sie ihn einfach auf die Wange. Jetzt konnte er nicht anders, er musste etwas tun. Er griff nach ihrer Hand und drückte fest zu.
»Hast wohl nicht viel Erfahrung, wie?«
Seine Antwort kam zögerlich: »Och, geht so.«
Sie küsste ihn auf den Mund. Er ließ es geschehen. All das kam ihm irgendwie unwirklich vor, als wenn er sich selbst beobachten oder träumen würde. Aber es war aufregend.
Nach der Vorstellung schlenderten sie noch eine Weile durch die Bottroper Innenstadt. Eng umschlungen. Sie waren jetzt ein Liebespaar, »gingen« miteinander. Um 23 Uhr brachte er sie nach Hause.
Erst während des Heimwegs löste sich die Verkrampfung, die ihn daran gehindert hatte, das zu sagen, was er hätte sagen wollen, das zu tun, was er hätte tun wollen. Die Benommenheit war wie weggeblasen. Immer stärker begann ein Gefühl von ihm Besitz zu ergreifen, das er nicht kannte, das aber wie eine Droge wirkte: Euphorie. Am liebsten hätte er Rita sofort geheiratet. Er dachte an ein eigenes Häuschen, auch an Kinder. Und er war unendlich erleichtert, die Pechsträhne war vorbei. Endlich. Es kam ihm so vor, als sei ein Raum geöffnet worden, aus dem er nicht hatte entweichen können, der einmal seine Zelle gewesen war. Jetzt war er frei. Nun würde alles anders werden, besser. Am liebsten hätte er jemandem davon erzählt, er war so aufgekratzt. Aber da war niemand, der ihm wirklich hätte zuhören wollen. Seine Eltern ließ er im Ungewissen, seine Geschwister, die »Tratschen«, sowieso. Nur im Kollegenkreis offenbarte er sich. Aus »Gertrud« wurde Rita.
Die hatte nach gut einer Woche sturmfreie Bude. Was dann geschehen sollte, war unausgesprochen geblieben. Aber beide wussten, worum es sich drehte.
Schließlich passierte es. Ihr Kommentar: »Das ging aber ’n bisschen fix!« Er war enttäuscht, er schämte sich, er wusste nicht, was er sagen sollte. Am liebsten hätte er sich irgendwo verkrochen. Jetzt litt er wieder unter dieser überwunden geglaubten Beklemmung, dieser sein Selbstwertgefühl bedrängenden Schreckensvision: dass es nochmal so kommt. Drei Tage später versuchten sie es erneut. Dasselbe Ergebnis. Wieder ein Desaster. Rita war stocksauer: »Was soll das denn!« Und als es beim dritten Mal nicht besser wurde, war er nur noch die »Pulle«, die »Lusche«. Rita hatte genug: »Jetzt reicht’s aber, du bringst es ja eh nicht. Hau ab!« Diese Worte trafen wie Keulenschläge – die Hoffnungen zerschmettert, sein Gefühlsleben ein Scherbenhaufen. Die Tür zu seiner Zelle war jetzt wieder fest verrammelt. Und er wagte es nicht, daran zu rütteln, es wäre doch ein aussichtsloses Unterfangen. Rita war für ihn fortan nicht mehr zu sprechen. Er war wieder sein eigener Gefangener.
Das zarte Pflänzchen Hoffnung war nicht einfach verblüht, es war ausgerissen worden – mit Stumpf und Stiel. Er konnte sich das nicht erklären. Er war ratlos, fassungslos. Immer kurz bevor er mit Rita hatte verkehren wollen, war er zum Höhepunkt gekommen. Unversehens. Ungewollt. Unwiderruflich. Er hatte sich gründlich blamiert. Daran zweifelte er nicht. Beim letzten Mal war er unter der Last ihres Hohngelächters, ihres beißenden Spotts eingeknickt, zusammengebrochen. Nur die Tränen hatte er unterdrücken können. Das ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Wieder einmal hatte er verloren – seine Freundin, seinen Mut, seine Selbstachtung.
Er hätte es weiterhin probieren können; wenn nicht mit Rita, dann mit einem anderen Mädchen. Aber er wollte sich neuerliche Enttäuschungen und Demütigungen ersparen. Er war überzeugt, es würde ihm partout nicht gelingen. Er hatte genug davon. Auf die Idee, einen Arzt zu konsultieren, kam er nicht.