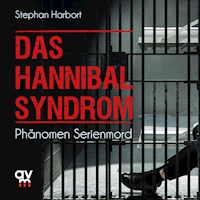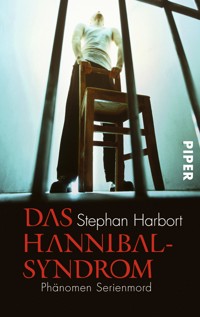7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stephan Harbort ist Deutschlands bekanntester Serienmord-Experte und True-Crime-Autor. In seinem neuen Buch nach "Killerfrauen" erzählt er wieder von wahren Kriminalfällen, zum ersten Mal aber von Kindern, die getötet haben. Ein sechsjähriger Junge findet bei seinem Onkel eine Pistole und erschießt damit zwei Stunden später seine Klassenkameradin. Das Motiv: Sie hat ihm zugeflüstert, dass sie ihn nicht mag. Die Polizei überführt einen 13-jährigen Jungen, der zwei gleichaltrige Jungen auf dem Gewissen hat. Er wird zum jüngsten Serienmörder Deutschlands. Ein zwölf Jahre altes Mädchen tötet, gemeinsam mit ihrem Freund, Vater, Mutter und Bruder, weil ihre Familie mit der Beziehung nicht einverstanden gewesen ist. Stephan Harbort erzählt acht spektakuläre Fälle von Kindern, die zu Mördern wurden. Er erklärt, was die Kindheit der Täter beschwerte, was sie außer Kontrolle geraten ließ und was sie dazu brachte, Taten zu begehen, die sonst nur Erwachsene verüben. Dabei stellt der Kriminalexperte fest, dass die Motive der kindlichen Täter denen der erwachsenen Mörder sehr ähnlich sind - es geht um Alltags- und Beziehungskonflikte, Macht, Habgier und sexualisierte Gewalt. Und obwohl die Kinder strafunmündig sind und juristisch nicht zur Verantwortung gezogen werden können, bedeutet das nicht, dass sie bei ihren Taten kein Schuldbewusstsein hatten oder nicht wussten, was sie taten. "Er ist der Kartograph des Serienmords." Frankfurter Allgemeine Zeitung "Stephan Harbort weiß, wie Mörder denken." Badische Neueste Nachrichten "Stephan Harbort ist einer der führenden Kriminalexperten Deutschlands." Markus Lanz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Stephan Harbort
Wenn Kinder töten
Wahre Verbrechen. Deutschlands bekanntester Serienmordexperte klärt auf
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Junge hat mit 13 zwei gleichaltrige Jungen auf dem Gewissen. Er vergewaltigte seine Opfer, erstach sie anschließend und ist damit der jüngste Serienmörder Deutschlands. Ein zwölf Jahre altes Mädchen tötet Vater, Mutter und Bruder, weil die Familie mit ihrer Beziehung nicht einverstanden gewesen ist.
Stephan Harbort erzählt acht spektakuläre Fälle von Kindern, die zu Mördern wurden. Dabei stellt der Kriminalexperte fest, dass die Motive der kindlichen Täter denen der erwachsenen Mörder sehr ähnlich sind – es geht um Alltags- und Beziehungskonflikte, Macht, Habgier und sexualisierte Gewalt. Und obwohl die Kinder strafunmündig sind, bedeutet das nicht, dass sie bei ihren Taten kein Schuldbewusstsein hatten oder nicht wussten, was sie taten.
Für Amelie und David und Katharina
»Es gibt leider nicht sehr viele Eltern,
deren Umgang für ihre Kinder wirklich ein Segen ist.«
Marie von Ebner-Eschenbach
Die in diesem Buch geschilderten Verbrechen sind authentisch und entsprechen dem Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen bzw. der prozessualen Wahrheit. Die Namen der handelnden Personen sind teils pseudonymisiert. Auch biografische Angaben oder örtliche und zeitliche Bezüge wurden mitunter verfremdet. Diese Verfahrensweise ist dem Schutz der Persönlichkeitsrechte geschuldet.
Vorwort
»Es gibt nur die Tat, nicht den Täter;
bestimmte Umstände rufen
eine bestimmte Tat unabwendbar hervor.«
Erik Wolf
»Ich habe Dad erschossen.
Diese Vater-und-Sohn-Geschichte musste enden.«
Joseph Hall (zehn Jahre alt)
Im August 2013, São Paulo, Brasilien.
Eine Überwachungskamera filmt das Auto am Montagmorgen um genau 1.25 Uhr, als es in der Nähe einer Schule abgestellt wird. Wer das Auto benutzt hat, ist nicht zu erkennen, weil der Fahrer merkwürdigerweise nicht aussteigt. Und auch in den folgenden fünf Stunden das Fahrzeug nicht verlässt. Erst um 6.32 Uhr zeichnet dieselbe Überwachungskamera auf, wie jemand aus dem Wagen aussteigt und in Richtung der Schule geht. Es handelt sich augenscheinlich um eine kleinwüchsige Person, die einen Rucksack auf dem Rücken trägt. Oder ist es vielleicht ein Schulranzen? Später wird die Polizei annehmen, es habe sich bei dieser Person um Marcelo Pesseghini gehandelt, den 13-jährigen Sohn der Fahrzeughalterin.
Marcelo nimmt an diesem Vormittag wie gewöhnlich am Unterricht teil, gibt sich wie immer ungezwungen und fröhlich, lässt sich aber entgegen der sonst üblichen Gepflogenheiten nach Schulschluss nicht von seiner Mutter abholen, sondern bittet den Vater eines befreundeten Klassenkameraden, ihn doch freundlicherweise nach Hause zu fahren, seine Mutter, von Beruf Polizeibeamtin, habe infolge der Nachtschicht wohl verschlafen. Einverstanden. Als sie eine Viertelstunde später vor dem Haus seiner Eltern stoppen und Marcelo aussteigt, spricht er seine letzten Worte – »Tschüs, bis morgen« –, verschwindet im Hauseingang – und schießt sich wenige Minuten später mit der Dienstpistole seines Vaters eine Kugel in den Kopf.
Gegen Mittag desselben Tages bietet sich den Ermittlern im Haus der Familie Pesseghini ein Bild des Grauens: Marcelo findet man auf einer Matratze, die Tatwaffe noch in der Hand haltend. Daneben liegen die toten Körper seiner Mutter Andreia (36) und seines Vaters Luis (40). In einem Nachbarhaus stoßen die schockierten Polizisten auf die Leichen der Großmutter und der Großtante des Jungen – alle Opfer sind, dies wird sich später herausstellen, mit derselben Pistole im Schlaf jeweils mit Kopfschüssen förmlich hingerichtet worden. Warum Marcelo diese unfassbare Tat begangen und seine gesamte Familie ausgelöscht hat, bleibt letztlich ungeklärt.
Wenn Kinder wie Marcelo töten, vereinzelt sogar in Serie töten oder ihre Waffen wahllos auf andere Menschen abfeuern und Amok laufen, gerät auch die Experten-Welt regelmäßig in Erklärungsnot. Denn bei solch gravierenden, irritierenden, den Verstand überfordernden Ereignissen werden berechtigterweise immer wieder dieselben bohrenden Fragen gestellt, die nicht nur auf den bedauerlichen Einzelfall abzielen: Wer hat versagt? Wer ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden? Wer hat Schuld? Sind es die Eltern? Familienangehörige? Pädagogen? Die Schulen? Die Gesellschaft? Warum passiert so etwas? Was treibt Mädchen und Jungen zum Äußersten?
Allein bei dem Gedanken an solche Taten sträubt sich alles. Für Kinder, Sinnbilder der Unbedarftheit und der Unschuld, passen weder die gängigen Sanktionen der Justiz noch die üblichen Erklärungs- bzw. Feststellungsmodelle der Juristen. Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Raub, inkriminierte Handlungen, die sich nach entsprechenden Merkmalen als Tatbestände des Strafgesetzbuches subsumieren lassen und somit selbsterklärend sind, dürfen bei Kindern keine Anwendung finden und stehen demzufolge als Ausgangspunkt für Forschungsvorhaben nicht zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass mitunter Lehrmeinungen vertreten und verbreitet werden, die sich bei näherer Betrachtung als unzutreffend erweisen – wenn Kinder töten, soll es sich beispielsweise ganz überwiegend um Taten zwischen Geschwistern handeln, die angeblich durch eine emotionale Krise ausgelöst werden. Ich werde mit dem vorliegenden Buch nachweisen, dass diese spezielle Erscheinungsform der Tötungsdelinquenz wesentlich facettenreicher und dementsprechend differenzierter zu betrachten ist.
Die einzige unumstößliche wissenschaftliche Erkenntnis zu diesem Gewaltphänomen fußt indes lediglich auf den jährlich durchzuführenden statistischen Erhebungen. Nach den amtlichen Zahlenkolonnen des Bundeskriminalamtes handelt es sich nicht nur hierzulande zweifellos um ein sehr seltenes Ereignis: In den vergangenen Jahrzehnten lag der prozentuale Anteil von kindlichen »Tatverdächtigen« im Bereich von »Mord und Totschlag« lediglich bei durchschnittlich 0,16 Prozent. Im Jahr 2016 waren es genau zehn Jungen und ein Mädchen. Wahrscheinlich sind diese extrem geringen Fallzahlen auch einer der Hauptgründe dafür, dass Tötungen durch Kinder wissenschaftlich bislang kaum Beachtung gefunden haben.
Und eben diese stiefmütterliche Behandlung, dieses Nichtwissen, hat mich neugierig werden lassen und dazu inspiriert, einmal genauer hinzuschauen und solche Fälle zusammenzutragen, die möglichst alle Erscheinungsformen und Facetten dieser extremsten Form von Kinderdelinquenz abbilden. In den vergangenen 25 Jahren hatte ich mit den grausamsten Verbrechen und den schlimmsten Mördern Deutschlands zu tun, aber allein die Taten der Kinder haben mich sprachlos gemacht.
Was unter dem Begriff »Kind« verstanden werden soll, ist keine soziologische, psychologische oder kriminologische, sondern in erster Linie eine juristisch zu beantwortende Frage. Erste Hinweise darauf, ab welchem Alter Kinder für ihr Verhalten verantwortlich gemacht werden können, ergeben sich aus Paragraf 828 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Darin heißt es: »Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.« Demzufolge besteht für Sechsjährige und jüngere Kinder eine absolute Schuldunfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit.
Anders verhält es sich indes, wenn darüber zu entscheiden ist, ab welchem Mindestalter Sanktionen im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) verhängt werden dürfen bzw. verhängt werden sollen. Um eine Person beispielsweise mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe belegen zu können, muss sie schuldfähig im Sinne des Paragrafen 20 StGB sein. Gemeint ist damit die Fähigkeit, »das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln«. Ihr Fehlen wird in Paragraf 19 StGB für Kinder unwiderleglich vermutet. Und weil die Bestrafung ein persönliches Verschulden voraussetzt, können Kinder, die jünger als 14 Jahre sind, in Deutschland grundsätzlich nicht belangt werden.
Das Einsetzen der Strafmündigkeit wird aufgrund geschichtlicher, politischer oder kultureller Faktoren international höchst unterschiedlich festgelegt. Während in vielen mittel- und westeuropäischen Staaten ein Kind erst dann bestraft werden kann, wenn es bei Begehung der Tat das 14. Lebensjahr vollendet hat (indes Belgien: 18), dürfen in England bereits ab dem Alter von zehn Jahren auch Freiheitsstrafen verhängt werden. Kürzlich ist in Israel die Altersgrenze der Strafbarkeit auf zwölf Jahre herabgesenkt worden. Die amtliche Begründung: »Für diejenigen, die mit einem Messerstich ins Herz ermordet werden, ist es belanglos, ob der kindliche Täter 12 oder 15 Jahre alt ist.« Eine überaus fragwürdige Argumentation, denn gerade Kinder lassen sich entwicklungsbedingt noch viel weniger von verschärften Strafandrohungen beeindrucken oder abschrecken als Erwachsene. Aus diesem Grund ist auch die weltumspannend praktizierte Todesstrafe nicht nur eine menschenunwürdige, sondern auch eine dumme Strafe.
Besonders verwirrend erscheint die Rechtslage in den USA: Einerseits dürfen Kinder erst frühestens mit sieben Jahren strafrechtlich verfolgt werden, andererseits gibt es aufgrund des föderalen Prinzips keine einheitliche Rechtsauslegung, sodass in vielen Bundesstaaten teils höchst unterschiedliche Altersgrenzen der Strafmündigkeit Anwendung finden sollen – nämlich zwischen dem vollendeten sechsten und dem vollendeten zwölften Lebensjahr –, obwohl sich die betroffenen Kinder bezüglich ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit, aber auch sonst nicht plausibel begründbar unterscheiden lassen. Juristischer Wildwuchs, der zu Lasten der Kinder geht, die im Einzelfall längere Haftstrafen verbüßen müssen als Erwachsene, die eine ähnliche Tat verübt haben. Auch hiervon wird dieses Buch handeln.
Im Zuge meiner Recherchen, aber auch bei der Analyse und Bewertung der einzelnen Fälle (Studienergebnisse siehe Anhang), ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass bei jeder vorsätzlichen Tötung eines Menschen, die einem Kind zugeschrieben werden muss, die inneren und äußeren Abläufe der kollektiven Wahrnehmung, Einordnung und Bewertung stereotyp sind: ungläubiges Erstaunen, maßloses Entsetzen, allgemeines Unverständnis, inquisitorisch anmutende Fragen zu Verantwortlichen, reflexartige Vorverurteilungen, zeitnahe Schuldzuweisungen, gemeinschaftliches Verdrängen – als wäre das alles nicht passiert, als wäre die böse Tat nur ein böser Traum gewesen.
Dieses ubiquitäre und wiederkehrende Verhaltensmuster ist nur allzu verständlich. Denn Tötungen durch Kinder sind weder in unseren Lebensentwürfen noch in unserem Selbstverständnis vorgesehen, wir nehmen vielmehr an, Mädchen und Jungen, die sich noch auf dem Spielplatz tummeln und Räuber und Gendarm spielen, sind aus vielerlei Gründen zu extremen Gewalttaten gar nicht fähig. Wir können sie uns mit einer Waffe in der Hand oder später in Handschellen vor einem Richter nicht vorstellen. Vielleicht ist dieser weitverbreitete Irrglaube einer der Gründe dafür, warum solche Taten überhaupt erst möglich werden.
Stephan Harbort
Düsseldorf, im Juni 2018
Das Ende der Unschuld
»Er beschloss, das Leben des Jungen zu beenden,
und er entschied sich dafür, es auf eine Weise zu tun,
die weit mehr war, als nur zu töten.«
»Da ist eine Sache, die macht mir besonders Angst.
Wäre er nicht erwischt worden,
hätte er ganz sicher wieder gemordet.
Und das ist erschreckend.«
»Das Schwierigste ist für mich, wenn jemand fragt:
›Wie viele Kinder hast du?‹
Am häufigsten antworte ich so:
›Ich habe einen Jungen, hier zu Hause.
Und ich habe einen Jungen,
der im Himmel auf mich wartet.‹«
Montag, 2. August 1993
Savona, ein Dorf mit 942 Einwohnern im Steuben-County, etwa 120 Kilometer südöstlich von Rochester, im US-Bundesstaat New York. Die Straße, in der die vierköpfige Familie Robie ihr Steinhaus gebaut hat, wird von großen Ahornbäumen gesäumt. Das Rathaus der Gemeinde ist nur etwa 200 Meter entfernt, gegenüber steht die Kirche, dann folgen die Grundschule auf der linken Seite und ein Freizeitpark auf der rechten. Ein idyllischer, beschaulicher, friedfertiger, sicherer Ort.
9.15 Uhr. Der Himmel ist wolkenverhangen. Es sieht so aus, als würde es in der nächsten Viertelstunde regnen. Doreen Robie (27) muss sich nun entscheiden. Entweder sie bringt ihren Sohn Derrick, vier, zum Feriencamp, bis dorthin sind es gerade einmal 300 Meter, oder sie lässt den Jungen dieses eine Mal alleine gehen, ausnahmsweise; andernfalls müsste sie den 18 Monate alten Dalton, der gerade nach Leibeskräften schreit, weil er zahnt, auf den Arm nehmen, versuchen, ihn zu beruhigen, um zu dritt zum Camp zu marschieren.
»Kein Problem, Mom, ich gehe alleine.«
Derrick hat wohl das Dilemma seiner Mutter erkannt und will ihr die Entscheidung abnehmen, sie entpflichten. Doreen überlegt trotzdem noch einige Augenblicke. Sie hat kein gutes Gefühl bei der Sache.
Was soll denn schon passieren auf der kurzen Strecke? Der Junge kennt den Weg. Es sind doch nur zwei Blocks. Es geht immer nur geradeaus. Er muss keine Straße überqueren. Außerdem sind zu dieser Zeit viele Nachbarn in der Gegend unterwegs, die ihre Kinder zum Camp bringen. Da kann Derrick doch mitgehen. Hier ist noch nie etwas passiert. Hier kennt jeder jeden. Außerdem weiß er, dass er mit einem Fremden nicht mitgehen darf. Das habe ich ihm schon so oft gesagt.
Der Junge mit den blonden Haaren und den hellblauen Augen ist für sein Alter schon recht selbstständig, ausgesprochen unternehmungs- und lebenslustig. Die Nachbarn kennen ihn als regelrechten Wirbelwind und lachen gerne über seine Späße, wenn er etwa eine giftgrüne Plastikschlange auf den Bürgersteig legt, sich erwartungsvoll hinter einem Busch unsichtbar macht und hofft, dass jemand vorbeikommen und sich erschrecken möge. Häufig sieht man »DJ« (steht für Derrick Joseph) – den Spitznamen hat ihm sein Opa gegeben – mit seinem Basketball tippend vor dem Elternhaus herumlaufen, oder er steht mit seinem knallroten Fahrrad an der Straßenecke und winkt den vorbeifahrenden Autos freundlich zu. Jeder, der ihn kennt, mag den Jungen. Er ist ein geborener Sympathieträger.
Doreen gibt Derrick einen Abschiedskuss auf die Wange. »Ich liebe dich!«
»Ich liebe dich auch, Mom!«
Seine Mutter drückt ihm noch seine Frühstücksbox in die Hand, und im nächsten Moment sieht sie ihren Sohn schon die Auffahrt vor dem Haus hinunterlaufen. Sie winkt ihm schweigend hinterher, Sekunden später biegt Derrick um die Ecke und ist aus ihrem Blickfeld verschwunden. Doreen kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass sie ihren Sohn soeben das letzte Mal lebend gesehen hat. Später wird sie sich erinnern: »Kurz darauf zogen Sturmwolken auf. Ich geriet in Panik. Ich glaube, das war der Moment, an dem er gestorben ist. Ich denke, er wollte uns ein Zeichen geben.«
»An dem Tag, als die Sache mit dem Jungen passierte, hatte ich sehr schlechte Gefühle. Ich zitterte vor Erregung am ganzen Körper, ging am frühen Morgen zu meinem Vater und fragte ihn: ›Papa, ich bin so wütend! Ich möchte jemanden verletzen! Du musst mir helfen! Was soll ich bloß machen?‹ Er sagte zu mir: ›Wenn ich früher sauer war, nahm ich ein Kissen mit in unsere Scheune und schlug so lange darauf ein, bis ich zu müde war, um noch etwas anderes zu tun.‹
Ich ging raus und stellte mich vor einen Baum. Dann schlug ich mit meiner Faust so lange gegen den Baum, bis die Haut aufplatzte und meine Finger blutig waren. Es hat nicht besonders wehgetan. Danach ging ich zurück ins Haus. Es war okay. Mein Vater hat nichts dazu gesagt. Er hat nur blöd geguckt. Als ich wenig später das Haus verließ, wollte ich trotzdem jemanden verletzen.«
Gegen 11 Uhr. Als der bereits für den frühen Vormittag angekündigte Sturm erst anderthalb Stunden später losbricht und Starkregen bringt, muss das Ferienprogramm abgebrochen werden. Wie alle anderen Mütter und Väter auch fährt Doreen Robie zum Camp, um ihren Sohn abzuholen. Nach und nach steigen Dutzende Kinder vollkommen durchnässt zu ihren Eltern ins Auto. Der Parkplatz vor dem Camp leert sich. Doch keine Spur von Derrick. Doreen Robie fragt einen der Erzieher, wo ihr Sohn sei. Der Mann stutzt, überlegt kurz – und fragt leicht verdutzt zurück:
»Derrick?«
Doreen nickt.
»Der ist doch heute gar nicht hier gewesen, ganz bestimmt nicht.«
Wie bitte? Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht wahr sein! Doreen glaubt ihm erst mal nicht und fragt alle übrigen Mitarbeiter des Camps, ob sie Derrick nicht gesehen haben, wenn auch nur kurz, wo auch immer. Kopfschütteln. Derrick, wo steckst du nur? Oh mein Gott, dir wird doch nichts passiert sein?! Mit einem Mal schlägt Doreen das Herz bis zum Hals. Ein bis dahin nicht gekanntes Gefühl erfasst sie mit ungeheurer Wucht: Panik.
Doreen ruft ihren Mann Dale (34) an, der als Produktassistent in einer Druckerei im Zentrum der Stadt arbeitet. Sie sprechen nur kurz, sie setzt ihn in Kenntnis darüber, dass sie Derrick nicht finden kann, und ihnen beiden ist klar, dass die Zeit drängt, dass sie schnell handeln müssen. Minuten später steht Doreen im Büro des Sheriffs und berichtet aufgelöst vom mysteriösen Verschwinden ihres Sohnes.
Etwa zur selben Zeit kommt nur anderthalb Kilometer entfernt ein Junge nach Hause. Er ist für sein Alter eher klein, hat rote Haare, Sommersprossen und trägt normalerweise eine Brille, die ihm aber anderthalb Wochen zuvor beim Sportunterricht kaputtgegangen ist. Der 13-Jährige wohnt mit seiner Mutter Tammy Smith, seinem Stiefvater Ted und zwei Schwestern an der Westseite von Savona in einem grauen renovierungsbedürftigen Holzhaus. Seine Ankunft wird nur von Ted bemerkt. Er begrüßt den Jungen, ihm fällt aber nicht auf, dass Eric seine Hände vor ihm versteckt – weil sie blutbesudelt sind. Und Ted reagiert auch nicht, als der Junge kurz zu ihm spricht.
»Das war schon eine komische Situation. Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, was ich angestellt hatte. Aber trotzdem sagte ich ihm etwas, weil ich es unbedingt loswerden wollte: ›Papa, es geht mir jetzt besser!‹ Dann habe ich mir die Hände gewaschen und eine Runde Nintendo gespielt. Am Nachmittag, als keiner im Haus war, habe ich das Blut aus meinen Klamotten rausgewaschen.«
Alle verfügbaren Polizisten des Distrikts, Feuerwehrleute, Dutzende Freiwillige, aber auch Freunde und Bekannte der Familie Robie durchkämmen die Gegend, immer wieder ist der auffordernde Ruf nach »D-e-r-r-i-c-k!« zu hören, er möge doch antworten, sich zu erkennen geben. Doch es bleibt still, der Junge scheint nur noch auf den Fahndungsfotos zu existieren, die Polizisten vor der Suchaktion an alle Helfer verteilt haben.
Viereinhalb Stunden, geprägt von Hoffen und Bangen und gegenseitigen Ermunterungen, vergehen, für Doreen und Dale Robie eine halbe Ewigkeit.
15.45 Uhr. Der Moment der Wahrheit, zugleich aber auch der Beginn eines hässlichen Dramas, als Polizeibeamte am Rand eines Waldgebietes auf einer wilden Wiese den leblosen Körper eines kleinen Jungen bemerken, bekleidet mit roten Shorts und einem gelben T-Shirt, auf dem geschrieben steht: »Ich bin ein kleiner Teufel«. Diese Merkmale passen zur Beschreibung des Vermissten, die Haarfarbe auch. Wenige Minuten später gibt es keinen Zweifel mehr, aber auch keine Hoffnung: Es ist Derrick Robie, und er ist tot.
»Fünf Minuten später bin ich zu dem Jungen zurückgefahren. Ich hatte Angst, dass der vielleicht doch nicht tot ist. Ich hatte Angst, dass er nicht mehr im Gebüsch sein könnte. Ich wollte unbedingt sichergehen, dass der Junge auch wirklich tot ist. Weil ich dachte, wenn der tot ist, dann muss ich mir um nichts mehr Sorgen machen, dann wird alles gut. Ja, und dann lag der da immer noch. Ich war sehr erleichtert und fuhr wieder weg.«
Derrick liegt auf einem Teppich von Moos neben einem Brombeergebüsch in der Nähe einer Baumgruppe, als hätte er sich dort hingelegt und wäre friedlich eingeschlafen.
»Nachdem ich den Jungen getötet hatte, bin ich nach einer halben Stunde noch einmal zu ihm hingefahren, weil mir das so nicht mehr gefiel. Ich wollte nicht, dass er schnell gefunden werden kann. Deshalb habe ich den Körper bis zu dem Brombeergebüsch gezogen.«
Erst bei näherem Hinsehen werden die gravierenden Kopfverletzungen erkennbar. Neben dem toten Körper liegen mehrere Steine, klein wie ein Baseball, aber auch groß wie ein Basketball. Vom Fundort der Leiche bis zum Haus der Familie Robie sind es nur knapp 300 Meter.
»Als ich mit dem Jungen fertig war, schleppte ich ihn zu der Stelle mit den Bäumen und ließ ihn dort liegen. Mir war es zu dem Zeitpunkt egal, ob ihn jemand finden würde. Ich kannte den Jungen ja nicht. Dann bin ich zu meinem Fahrrad gelaufen, das ich vorher im hohen Gras versteckt hatte, und bin weggefahren, erst mal ein paar Zigaretten rauchen.«
Als Derricks Eltern die Todesnachricht überbracht wird, will Doreen spontan zum Leichenfundort laufen, um bei ihrem Sohn sein zu können, ein letztes Mal. Wenigstens das. Sie muss von den Polizisten sanft zurückgehalten werden. Derweil sitzt Dale Robie wie geistesabwesend und schweigend in einem Sessel. Der 34-Jährige ist in Gedanken bei seinem Sohn, der nicht mehr wiederkommen wird, den er nicht mehr in den Arm nehmen kann, mit dem es keine Gespräche mehr geben, den er nicht mehr aufwachsen sehen wird. Nur eins ist in diesem Moment höchster seelischer Beanspruchung gewiss: Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war.
Die überaus bizarr anmutende Auffindesituation des Leichnams bereitet nicht nur den Spezialisten für die Tatortarbeit einiges Kopfzerbrechen, denn der Täter hat offenkundig Dinge getan, die keinen Sinn zu ergeben scheinen: Neben Derricks totem Körper liegt etwa in Hüfthöhe eine zerquetschte Banane; nicht weit davon entfernt wird die leere Verpackung eines Getränkepulverkonzentrats (Kool-Aid) gefunden, das dem Opfer sowohl ins Gesicht als auch in die Wunden gespritzt worden ist; und rechts neben dem Oberkörper des Leichnams liegt eine zerknüllte Papierserviette. Merkwürdig ist auch, dass die Schuhe des Opfers neben seinen Händen platziert worden sind; außerdem hat der Täter Derrick Hose und Unterhose heruntergezogen, am After des Opfers dürfte dem äußeren Anschein nach gewaltsam manipuliert worden sein; Spuren von Sperma werden jedoch nicht gefunden.
»Als der tot war, habe ich mir sein Lunchpaket genommen. Da war eine Banane drin. Ich mag aber keine Bananen. Deshalb habe ich die gleich kaputt gequetscht. Warum ich das mit dem Kool-Aid gemacht hab, weiß ich nicht genau. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, den Jungen bestrafen zu müssen, ihm noch mal richtig wehzutun. Ich war einfach so wütend. Den Stock hab ich ihm hinten reingesteckt. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Wie ich darauf gekommen bin, keine Ahnung.«
Dem Ergebnis der Obduktion zufolge muss Derrick einen grausamen Tod gestorben sein – multiple Schädelfrakturen, zerebrale Prellungen und Quetschungen am Kopf, ausgedehnte Einrisse und Blutungen im Brustgewebe sowie eine Perforation der Darmwand sind stumme Zeugen brachialer Gewalt. Der Todeskampf muss zwischen sechs und sieben Minuten gedauert haben, schätzen die Experten.
»Ich wollte unbedingt, dass der tot ist. Der machte aber immer noch so komische Geräusche. Deshalb hab ich einen kleineren Stein genommen und ihm damit mehrfach auf seine rechte Kopfseite geschlagen. Das gab keine großen Verletzungen. Deshalb holte ich einen viel größeren, schwereren Stein und ließ ihn dreimal auf den Kopf fallen. Danach hab ich den Stein zweimal auf die Brust fallen lassen.«
Punktförmige Blutungen im Gewebe von Hals, Gesicht und Augen des Toten deuten laut vorläufigem Gutachten darauf hin, dass es neben »stumpfer Gewalt«, die mit todesursächlich gewesen sei, einen »länger andauernden Angriff gegen den Hals« des Opfers gegeben haben muss. Als Todesursache wird dementsprechend »ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma mit Asphyxie (Atemdepression)« angenommen.
»Ich packte ihn am Hals und würgte ihn. Der Junge schrie und schlug mit den Händen und trat mich. Ich schätze, der Kampf hat so ungefähr eine Minute gedauert. Dann hat er sich nicht mehr gewehrt. Ich lockerte den Haltegriff, und der Junge begann nach Luft zu schnappen. Dann hab ich wieder zugedrückt, bis er sich nicht mehr bewegt hat. Ich hab die Papierserviette aus seinem Lunchpaket geholt und wollte sie ihm in den Rachen stopfen. Das hat aber nicht geklappt, weil er mir plötzlich in den Finger biss. Der hat sich einfach zu stark gewehrt. Da hab ich ihn wieder gewürgt, immer weiter gewürgt, bis er endlich ruhig war.«
Die Ermittler rekonstruieren zunächst den Ablauf dieses besonders abscheulichen Verbrechens. Sie schlussfolgern aus dem Tatortbefund, den Zeugenaussagen, dem Obduktionsbericht und den Lebensumständen des Opfers, dass der Mörder Derrick zufällig begegnet sein und sich bei günstiger Gelegenheit spontan zur Tat entschieden haben dürfte, denn niemand außer Doreen Robie, die als Verdächtige nicht in Betracht kommt, hätte wissen können, dass sich der Junge an diesem Tag zu dieser Zeit am Begegnungsort aufhalten würde.
»Ich kannte den Jungen nicht, wusste auch nicht, wie er heißt. Ich hatte ihn vorher einige Male gesehen. Als er an dem Tag an mir vorbeiwollte, sagte ich zu ihm: ›Hey, du!‹ In dem Moment hat der Junge sich umgedreht. Da wusste ich, dass ich ihn irgendwohin bringen wollte, um ihm wehzutun. Ich wollte ihn schlagen, ihm Schmerzen bereiten. Er sollte leiden, richtig leiden.«
Derrick ist in einem kleineren Waldgebiet gefunden worden, das von den Bewohnern Savonas üblicherweise nicht für Freizeitzwecke genutzt wird; auch seine Mutter hat ausgesagt, dass ihr Sohn am Leichenfundort oder in der näheren Umgebung zuvor niemals gespielt hat und auch sonst keinen Grund gehabt haben dürfte, sich dort aufzuhalten. Demzufolge wird der Täter den Jungen in den Wald gelockt haben, glauben die Ermittler; auch ergibt sein dortiger Aufenthalt im Kontext des Ferienprogramms keinen Sinn, jedenfalls dann nicht, wenn er, wie anzunehmen ist, sich auf direktem Weg zum Feriencamp befunden haben soll.
»Ich habe ihn gefragt, wo er hinwollte. Er sagte, er würde zum Freizeitprogramm gehen. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich ihm sagen könnte, damit er mit mir kommt. Da kam mir die Idee, ihm zu sagen, ich würde eine Abkürzung kennen. Ich fragte ihn, ob er nicht mitkommen wolle. Aber der Junge wollte nicht, weil ihm seine Mutter verboten hätte, mit Fremden mitzugehen.
Deshalb habe ich versucht, ihn zu beruhigen: ›Hey, ist doch okay, ich bin doch dabei, du musst keine Angst haben.‹ Aber der wollte einfach nicht. Da habe ich nicht lange überlegt. Ich wollte den Jungen unbedingt haben. Da habe ich ihn gepackt, meine Hand über sein Genick gelegt und ihn so gezwungen, mitzukommen. Vorher habe ich mein Fahrrad versteckt. Wir sind dann zu diesem Waldstück gegangen. Das war nicht weit. Da kannte ich mich aus. Plötzlich hat der angefangen, sich zu wehren. Er hat seine Tasche fallen gelassen, mit den Füßen nach mir getreten und mich mit den Fäusten geschlagen. Er wollte weg. Ich wurde wütend.«
Arbeitshypothese Nummer drei: Mit großer Sicherheit dürfte es sich bei dem Gesuchten um einen älteren Erwachsenen handeln – sehr wahrscheinlich kein Bürger von Savona –, der pädophil ist und bei der Tat trotz fehlenden Spermas am Leichnam ein sexuelles Motiv realisieren wollte. Was es mit der seltsamen Anordnung der Schuhe des Opfers, dem verspritzten Kool-Aid, der Papierserviette, der zerquetschten Banane und der analen Verletzung auf sich hat, bleibt indes rätselhaft – diese Handlungen des Täters erscheinen aus Sicht der Ermittler wenig plausibel. Vielleicht ist der Mörder ein Psychotiker, ein Verrückter?
»Nachdem ich den Jungen getötet hatte, fühlte ich mich nicht schlecht. Ich fühlte mich eher gut, irgendwie befreit. Als ich an dem Tag abends ins Bett ging, habe ich geschlafen wie ein Baby.«
Die Nachricht von Derricks gewaltsamem Tod trifft alle Bewohner von Savona gleichermaßen wie ein grollender Donnerschlag, den jemand von »Rattlesnake Hill« auf sie heruntergeschleudert hat, jenem bewaldeten, steil aufragenden Gebirgskamm, der die Gemeinde wie ein Schutzwall nach Osten natürlich begrenzt. Ein Dorf, in dem jeder jeden kennt, in dem man sich gegenseitig vertraut, die Haustüren nicht abgeschlossen werden müssen und Verbrechen den Menschen wesensfremd sind, genau an diesem Ort der Friedfertigkeit hat das Böse Einzug gehalten und präsentiert seine hässliche Fratze.
Die zweite Schockwelle erschüttert die Gemeinde, als gerüchteweise weitererzählt wird, der Junge sei sogar sexuell missbraucht und somit Opfer einer dieser hemmungslosen »Sex-Bestien« geworden, von denen vielleicht mal etwas in der Zeitung gestanden hat, wenn über schreckliche Morde aus fernen Großstädten berichtet wurde – diese »Monster« und »Ungeheuer« kannte man aber sonst nur aus schlechten Kriminalromanen oder üblen Kriminalfilmen. Bis jetzt. Und weil man so eine »Schandtat« keinem Mitbewohner zutrauen mag, muss der Täter ein Fremder sein, jemand, der jedenfalls nicht in Savona wohnt, schlimmstenfalls ein Mann aus einem der Nachbardörfer, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher ein übler Bursche mit einem ellenlangen Vorstrafenregister aus einem anderen Bundesstaat, der rein zufällig im Ort gewesen ist und niemals zurückkehren wird.
Nicht nur der Name des Opfers, sondern auch die seiner Eltern sind in aller Munde. Viele Menschen leiden still mit und bieten ihre Hilfe an, was auch immer es sein mag. Es gibt aber auch solche Leute, die sich Gedanken darüber machen, wer neben dem Täter noch Schuld hat an dieser Tragödie. Das Ergebnis dieser Überlegungen wird Doreen Robie prompt mitgeteilt, jedoch nicht persönlich, sondern schriftlich, natürlich anonym. »Du verdammte Schlampe!«, heißt es in einem dieser Schmähbriefe. »Wie konntest du dein Kind nur alleine lassen?!«
Doreen Robie tigert jeden Tag gedankenverloren durchs Haus und sucht verzweifelt nach Derrick. Sie weiß sehr wohl, dass sie den Jungen nicht finden wird, doch gibt ihr dieses Umherlaufen Gelegenheit, sich einer verlockenden Vorstellung hinzugeben, die zwar letztlich fast immer implodiert, aber wenigstens für eine kurze Dauer eine berauschende und schmerzlindernde Wirkung entfaltet. Und dann gibt es, wenn auch nur sehr selten, diese magischen Momente, in denen Doreen »DJ« vor sich glaubt: in Shorts und T-Shirt, lachend, zum Greifen nah – ein wahres Wunder, das aber jedes Mal jäh endet, wenn sie Derrick in den Arm nehmen möchte.
Während die Ermittler der zuständigen Staatspolizei mehr als 500 Zeugen befragen und die üblichen Verdächtigen überprüfen (polizeibekannte Sexual- und Gewalttäter aus der Region), keimt andernorts ein beunruhigender Verdacht auf. Es sind die Großeltern des 13-jährigen Eric aus Savona. Sie gehen zwar nicht davon aus, dass ihr Enkel der Täter sein könnte, allerdings haben sie nach Bekanntwerden der Tat beobachtet, dass er sich seltsam verhält. Vor allem aber haben sie seine merkwürdigen Fragen argwöhnisch gemacht: »Was passiert denn, wenn herauskommt, dass der Täter ein Kind ist? Was ist ein DNA-Test? Was kann die Polizei damit herausfinden? Kommen Kinder für Mord ins Gefängnis? Wie lange?«
Ihr Enkel hat den Jungen nicht getötet, das kann gar nicht sein, außerdem passt er nicht einmal ansatzweise in das polizeiliche Täterprofil, das jüngst in der Zeitung veröffentlicht wurde (gesucht wird nach einem pädophilen Erwachsenen). Man zieht Erics Tante ins Vertrauen, die mit dem Jungen in den vergangenen Tagen ähnliche Erfahrungen gemacht hat und deshalb vermutet, er könnte unbeabsichtigt Zeuge des Mordes geworden sein und von dem Täter nunmehr unter Druck gesetzt oder vielleicht sogar erpresst werden, sich wie gefordert zu verhalten bzw. zu schweigen.
Wie auch immer es gewesen sein könnte, die resolute Tante findet, es bestehe dringender Handlungsbedarf, sie will Gewissheit. Mittlerweile hat die 34-Jährige jeden Zeitungsartikel zum »DJ-Mord« studiert, kennt alle grausigen Details des mutmaßlichen Tatverlaufs, die öffentlich geworden sind. Und sie weiß um die Vorlieben und Abneigungen ihres Neffen.
Eric bekommt alsbald überraschend Besuch. Seine Tante hat eben im Supermarkt eingekauft und dabei, angeblich, an ihren lieben Neffen gedacht, behauptet sie, Vitamine seien gerade für junge Menschen wie ihn ungemein wichtig und so weiter. Die Tante reicht ihm, natürlich nur aus Fürsorge und Gefälligkeit, ein bestimmtes Stück Obst.
»Magst du eine Banane?«
Eric verzieht das Gesicht. »Ich hasse Bananen!«
»Ach so …« Seine Tante erstarrt förmlich, lässt sich aber nichts anmerken, packt die Banane wieder in ihren Einkaufskorb und verlässt das Haus. In den kommenden Stunden gibt es innerhalb der Familie Smith kein anderes Thema mehr. Man überlegt, was Erics Reaktion bedeuten könnte und welche Konsequenzen daraus abzuleiten sind. Es wird hart und hitzig diskutiert, doch zu einer Lösung, die alle überzeugt, gelangen sie nicht.
Etwa 150 Trauergäste sind zu Derricks Beerdigungszeremonie in der überfüllten altehrwürdigen Savona Federated Church erschienen und nehmen Abschied, fünf Tage nach seinem gewaltsamen Tod. Der Grabstein auf dem Friedhof zeigt ein Bild des Jungen, so fröhlich und lachend, als gäbe es gar keinen Grund zur Trauer. Daneben die Gravur: »In unseren Herzen wirst du für immer jung bleiben.« Beerdigt wird er in seinem Lieblingsbaseballtrikot. Darauf steht: »Gewidmet als sanfte Erinnerung an das, was seine Kindheit hätte sein sollen«. Niemand will an diesem Ort über den Täter sprechen, doch alle Anwesenden verbindet nicht nur an diesem Tag ein und dieselbe Frage: Wer hat das getan?
Kreuzverhör. Tammy Smith misstraut ihrem Sohn. Obwohl Eric in vielerlei Hinsicht ein eher gewöhnlicher Teenager ist, der Videospiele mag, am liebsten Stephen-King-Romane liest, Schlagzeug in der Schulband spielt und gerne seine Hausaufgaben vernachlässigt, wird sie das Gefühl nicht los, er könnte wesentlich mehr über den Tod des Jungen wissen, als er bislang preisgegeben hat. Deshalb stellt sie ihm gebetsmühlenartig immer wieder dieselben Fragen: »Kennst du den Jungen? Wo warst du am Montagvormittag? Was hast du gemacht? Ist dir der Junge begegnet? Hast du etwas Verdächtiges gesehen? War da vielleicht ein fremder Mann? Ein fremdes Auto? Hast du etwas mit der Sache zu tun? Gibt es jemanden, der dich bedroht? Ist alles in Ordnung mit dir?«
Das Ergebnis dieser peinlichen Befragung ist aus Tammys Sicht nicht besorgniserregend. Nichtsdestotrotz hält sie es für geboten, ihren Sohn den in diesem Fall ermittelnden Beamten vorzustellen, denn Eric will nun, entgegen seinen bisherigen Beteuerungen, sogar mehrmals zur tatrelevanten Zeit in der Nähe des Tatortes gewesen sein, jedoch ohne dabei verdächtige Beobachtungen gemacht zu haben.
Gedankenspiele. Kann das sein? Möglicherweise hat Eric doch etwas gesehen oder gehört und sieht nur keinen Zusammenhang. Er ist doch noch ein Kind! Wie soll er das beurteilen können? Das kann nur die Polizei. Dieses Monster läuft noch frei herum und sucht vielleicht schon nach einem neuen Opfer. Es muss alles getan werden, um diesen Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Und wir helfen dabei!
Noch am selben Tag auf der örtlichen Polizeistation. Erics Eltern erklären den Beamten, warum sie gekommen sind, und übergeben ihren Sohn in die Obhut eines Detectives. Der Junge hat offenbar weder Bedenken noch Angst, vielmehr wirkt er stolz und ist sichtlich hocherfreut, sich mit einem echten Polizisten alleine über einen Mordfall unterhalten zu dürfen. Eric genießt die ungeteilte Aufmerksamkeit, das Interesse an ihm als Person, an dem, was er zu sagen hat – das ist nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern gerade für ihn eine ganze neue Lebenserfahrung.
Eine Viertelstunde später, die ersten Fragen sind bereits gestellt worden.
»Kennst du dich in der Gegend aus?«
»Klar, ich bin da häufiger mit meinem Fahrrad unterwegs.«
»Und an diesem Morgen auch?«
»Ja.«
»Was hast du da gemacht?«
»Och, bin so rumgefahren, hab geguckt, ob da was los ist, ob ich jemanden treffe.«
»Und, hast du jemanden getroffen?«
»Nein.«
Eric wird das Foto des Opfers zu Lebzeiten vorgelegt.
»Das ist der Junge, der getötet worden ist. Kennst du den?«
»Nein.«
»Hast du den Jungen an diesem Morgen gesehen?«
»Nein.«
Die nächsten Fragen ähneln jenen, die ihm seine Mutter, sein Stiefvater, seine Großeltern und seine Tante bereits häufiger gestellt haben, damit hat er kein Problem, so kann es gerne weitergehen. Erst als ihm der Detective eine Viertelstunde später zu verstehen gibt, nun alle Fragen gestellt zu haben und die Anhörung beenden zu wollen, will Eric dieses abrupte Ende nicht akzeptieren – das muntere Frage-Antwort-Spiel darf nicht aufhören, es ist so aufregend, besser als alles, was er bisher erlebt hat. Er muss dem Detective einen Grund geben, sich weiter mit ihm zu beschäftigen.
»Ähm, Sir …«
»Ja?«
»Mir ist da noch was eingefallen …«
»Ja, bitte …«
»Es geht um den Jungen …«
Der Detective sagt nichts, nickt nur kurz.
»Ich habe ihn doch gesehen.«
»Den getöteten Jungen?« Der Detective ist mit einem Mal wieder hoch konzentriert.
»Ja.« Erics Augen beginnen zu leuchten.
»Aha. An diesem Montagmorgen?«
»Ja.«
»Wo hast du den Jungen denn gesehen?«
»Da, wo noch keine Bäume stehen, auf dieser großen Wiese.«
»Und wo warst du zu diesem Zeitpunkt?«
»Auf der anderen Straßenseite.«
Eric werden Fotos von der Umgebung des Leichenfundortes vorgelegt, er soll zeigen, wo genau er Derrick gesehen haben will. Der Junge bezeichnet, ohne die Bilder länger betrachten zu müssen, auf der wilden Wiese am Rand des Waldes eine Stelle, etwa 50 Meter von jener Position entfernt, an der das Opfer gefunden worden ist: »Da hat der gestanden.« Und Eric kann sowohl den getöteten Jungen als auch dessen Bekleidung zutreffend beschreiben.
Der Detective ist einerseits überrascht, andererseits ist es eher die Regel, dass gerade kindliche Zeugen zunächst widersprüchliche Angaben machen oder ihre Aussage korrigieren, sich erst später an Details erinnern. Nichtsdestotrotz ist Eric Smith nun ein eminent wichtiger Zeuge, mit dem man sich weiter zu befassen haben wird. Vielleicht weiß er noch mehr über die äußeren Umstände der Tat und erinnert sich bei entsprechenden Vorhalten spontan an Dinge, die er, aus welchen Gründen auch immer, bislang noch nicht gesagt hat. Nach einer kurzen Pause wird die Anhörung fortgesetzt.
»Er hatte also rote Shorts an und ein gelbes T-Shirt. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?«
»Ja, der hatte so eine Frühstücksbox dabei, ein geiles Ding!«
Eric steht unvermittelt auf, tanzt wie Rumpelstilzchen um das Feuer herum, er ist offenkundig begeistert, klatscht in die Hände, strahlt vor Freude, will dem Detective aber nicht verraten, warum er sich so verhält, was dieser Gefühlsausbruch zu bedeuten hat. Nach etwa einer halben Minute ist der Spuk vorbei. Die nächste Frage, bitte.
»Welche Farbe hatte die Frühstücksbox?«
»Grün.«
»War der Junge allein unterwegs?«
»Ja.«
»Kannst du mal bitte beschreiben, wie es da aussieht, ich meine die Stelle, an der du den Jungen zum letzten Mal gesehen hast?«
Eric schaut den Detective unverwandt an und bleibt die Antwort schuldig. Er ist jetzt nicht mehr der auskunfts- und tanzfreudige, fröhliche Junge von eben. Mit einem Mal springt er auf, fuchtelt mit den Armen herum, schreit mit sich überschlagender Stimme Unverständliches, ballt die Hände zu Fäusten, legt sie an die Ohren, verharrt für einen Moment, setzt sich unvermittelt wieder hin und sagt – nichts.
»Alles okay?«
»Sie glauben …« Eric ist irritiert.
»Was glaube ich?«
Der Junge sieht den Detective mit weit aufgerissenen Augen an. Er braucht eine Weile, bis er so weit ist, bis er sich traut, bis er es sich zutraut.
»Sie glauben, dass ich ihn getötet habe, nicht wahr?«
»Nein«, antwortet der Detective spontan, »das tue ich nicht. Das geht schon in Ordnung.«
»Können wir bitte eine Pause machen?«
Während der Detective sich am Automaten eine Tasse Kaffee besorgt, wird Eric von seinen Eltern, die während der Anhörung draußen gewartet haben, in Empfang genommen. »Ich will ein Kool-Aid!« Ted geht in den Supermarkt gegenüber und besorgt das gewünschte Getränk. Kurz darauf wird die Anhörung fortgesetzt.
»Okay, Eric, können wir weitermachen?«
»Klar.«
»Noch mal zu dieser Frühstücksbox …«
Bevor die Frage zu Ende formuliert werden kann, klatscht das Kool-Aid auf den Fußboden. Eric hat es dort wutentbrannt hingeschmissen. Kein Wort mehr! – So jedenfalls interpretiert der Detective das Verhalten des Kindes und bietet nach Rücksprache mit den Eltern an, die Anhörung erst am nächsten Tag fortzusetzen. Einverstanden.