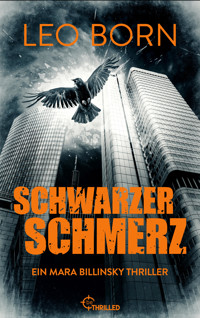9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein Einbruch ohne Diebstahl. Eine Mordserie ohne Spuren. Ein toter Journalist, der kurz davor war, eine brisante Story zu enthüllen. Mara Billinsky sieht sich mit mehreren mysteriösen Verbrechen konfrontiert. Zugleich wird sie von einem Schatten aus der Vergangenheit verfolgt, der ihr ebenfalls Rätsel aufgibt. Als sie erkennt, dass alle Ereignisse in Verbindung stehen und wer im Hintergrund die Fäden zieht, ist es fast zu spät: Ab jetzt kämpft Mara um ihr Leben ...
"Extraklasse! Ein Thriller, der einem unter die Haut geht!" (Gina 1627, thalia.de über "Lautlose Schreie")
"Achtung: Suchtgefahr!" ('Tweed, Lesejury über "Lautlose Schreie")
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil 1: Totes Fleisch1234567891011121314151617181920Teil 2: Nackte Angst2122232425262728293031323334353637383940414243444546Teil 3: Einsame Krähe474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879Über dieses Buch
Ein Einbruch ohne Diebstahl. Eine Mordserie ohne Spuren. Mara Billinsky sieht sich mit mehreren mysteriösen und grausamen Morden konfrontiert. Gleichzeitig wird sie von einem Schatten aus der Vergangenheit verfolgt, der ihr ebenfalls Rätsel aufgibt – bis sie begreift, dass alle Ereignisse in Verbindung zueinander stehen. Als sie erkennt, wer im Hintergrund die Fäden zieht, ist es fast zu spät: Ab jetzt kämpft Mara nicht mehr nur um ihr eigenes Leben …
Über den Autor
Leo Born ist das Pseudonym eines deutschen Krimi- und Thriller-Autors, der bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Der Autor lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Dort ermittelt auch – auf recht unkonventionelle Weise – seine Kommissarin Mara Billinsky.
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Textredaktion: Bernhard Stäber
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Unter Verwendung von Motiven von
© shutterstock: Dmitriev Lidiya | Midiwaves | KHIUS
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6895-6
wwww.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Teil 1
Totes Fleisch
1
Grauschwarz lag der Abend über der Stadt. Nebelschwaden umhüllten die Straßenlaternen und nahmen ihrem Licht die Kraft. In den Morgenstunden würde sich gewiss der erste Frost bilden. Der Herbst war mit der jähen Heftigkeit eines Peitschenhiebs über Frankfurt gekommen.
Peter Johannsen stand regungslos am Fenster und blickte auf die ruhige Wohnstraße. Er fühlte die Aufregung, die in Wellen in ihm anstieg, das Adrenalin, die Bedeutsamkeit der vor ihm liegenden Stunden und Tage.
Tief atmete er ein und aus.
Monatelang hatte er alles vorbereitet, unermüdlich recherchiert. Er hatte beobachtet, Fragen gestellt, sich Notizen gemacht, Fotos angefertigt. Er hatte Geduld bewahrt und seine Schlüsse gezogen, so lange, bis es keine Lücken mehr gab. Wasserdicht. Genau das war es.
Jetzt würde sein Moment kommen.
Es war schön, von dem Eindruck überwältigt zu werden, etwas Nützliches zu tun. Nicht nur einem verdammten Job nachzugehen, sondern etwas zu bewirken, der Allgemeinheit zu helfen.
Dazu gehörte Courage. Und darauf war er stolz.
Ein Blick zur Uhr.
Es wurde Zeit.
Johannsen wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war groß und schlank, bekleidet mit praktischer Cargohose und einem Baumwollpullover. Er war achtunddreißig Jahre alt. Und er war bereit. Bereit für den großen Coup.
Rein in die Schuhe, rein in die Jacke. Dann erst nahm er von dem inzwischen wieder ordentlich aufgeräumten Schreibtisch einen USB-Stick. Er betrachtete ihn, als besäße der Gegenstand unerklärliche Kräfte, und wog ihn mehrere Sekunden in der Hand, bis er ihn in einer winzigen Geheimtasche verstaute, die an der Innenseite seines rechten Hosenbeins, direkt über dem Saum, eingenäht war.
Auf dem Stick war alles abgespeichert, was er herausgefunden hatte. Seine gesamten Recherchen. Heute würde er zum ersten Mal etwas davon preisgeben. Es gab noch mehrere solcher Sticks, alle an sorgfältig ausgewählten Orten in der Wohnung versteckt. Johannsen war ein vorsichtiger Mann. Einmal hatte er wichtige Dateien durch eine dumme Unachtsamkeit verloren – das würde ihm nie wieder passieren.
Mit entschlossenen Schritten verließ er seine Wohnung. Kälte empfing ihn, er bekam eine Gänsehaut. Seine Schritte hallten durch die leere Straße, an deren Ende er innehielt und wartete.
Noch ein Blick zur Uhr.
Er war auf die Minute pünktlich, wie immer schon, sein ganzes Leben lang. Auf ihn war Verlass.
Gleich darauf ertönte der Motor eines sich nähernden Autos. Ein schwarzer Audi, wie es angekündigt worden war. Offenbar legte nicht nur Peter Johannsen Wert auf Pünktlichkeit.
Der Wagen stoppte am Rand des Bürgersteigs, die hintere Tür sprang auf. Johannsen nahm auf der Rückbank Platz. Ein solcher Abholservice war nicht üblich, aber Johannsen nahm ihn gern in Anspruch. So konnte er auf den eigenen Wagen verzichten und sich im Anschluss an das Gespräch noch zur Entspannung in einer Bar einen Drink genehmigen. Der Fahrer sah nach hinten, nickte ihm zu und fuhr los.
Wieder atmete Johannsen tief durch. Anspannung und Konzentration hielten sich die Waage, so wie es sein sollte. Was für eine Erleichterung, dass es endlich losging. Die Reaktion in der Öffentlichkeit würde gewaltig sein, ein wahres Beben, davon war er überzeugt. Nun stand das erste von mehreren Gesprächen an, zu denen er sich mit verschiedenen Print- und TV-Redakteuren verabredet hatte.
Rechts und links flogen die erleuchteten Fenster der Stadt vorbei, vermischten sich zu einer grellen, vom Nebel verschleierten Collage. In Gedanken war er bereits bei der Unterredung, sodass es eine Weile dauerte, bis ihm klar war, dass der Audi der Hanauer Landstraße folgte.
Irritiert runzelte er die Stirn. Sollte er nicht in die City gebracht werden, in die Lounge eines Hotels?
»Entschuldigung«, sagte er. »Äh, wohin …?«
»Kleine Planänderung«, unterbrach ihn der Fahrer gelassen. »Ihr Meeting wird hier stattfinden.«
»Hier?« Johannsen betrachtete die Umgebung, noch skeptischer als zuvor.
Der Fahrer bog in eine Querstraße ab, von dort in die Ferdinand-Happ-Straße und weiter in eine noch engere, dunklere Gasse. Zu beiden Seiten ragten leere, noch nicht fertiggestellte Gebäude auf, düstere Hüllen aus Stein. Eine kleine Geisterstadt für sich und doch inmitten der Stadt.
»Ganz schön verrückt, wie viel in dieser Gegend gebaut wird«, bemerkte der Fahrer mit jovialer Stimme.
Noch ehe Johannsen etwas erwidern konnte, hielt das Auto an. Die hintere Tür wurde von außen geöffnet, und ein Mann spähte ins Wageninnere. »Herr Johannsen? Freut mich. Wir haben miteinander telefoniert. Ich bin Franke.«
Immer noch irritiert sah Johannsen den Mann an. »Äh, Sie haben doch gesagt, dass wir uns im Hotel …«
Lächelnd zog Franke etwas aus der Innentasche seines Herbstmantels. »Herr Johannsen, steigen Sie aus! Sofort.«
Johannsens Augen weiteten sich, als er in die Mündung einer Pistole starrte.
Keine zwei Minuten später durchschritt er einen langen Gang im dritten Stock einer jener leeren Steinhüllen, steif und unsicher, vor ihm der Fahrer, dessen Stabtaschenlampe den Weg ausleuchtete, hinter ihm der Mann mit der Waffe.
Nacheinander betraten sie einen etwa zwanzig Quadratmeter großen Raum. Nackte Betonwände. Ein Generator brummte leise. Eine Industrieleuchte wurde angeknipst, die Taschenlampe ausgeschaltet und auf einem unverputzten Fenstersims abgelegt.
Das grelle Licht machte Johannsen die Ausweglosigkeit seiner Lage noch bewusster.
Er stand regungslos da. Schweiß strömte ihm aus den Poren, nicht mehr ausgelöst durch Aufregung und Adrenalin, sondern durch eine Angst, die größer und mächtiger war als alles, was er jemals im Leben gefühlt hatte. Sein Mut, vorhin noch so intensiv, war zusammengeschrumpft, eine kleine, verdorrte Dattel, die irgendwo in seiner Magengrube festsaß.
Der Fahrer ergriff Johannsens Arme, riss sie nach hinten und fesselte ihn an den Handgelenken mit Kabelbindern, die tief in die Haut einschnitten.
»Setzen Sie sich auf den Boden!«, befahl der Mann, der sich Franke nannte, aber sicher einen ganz anderen Namen hatte. Nun fiel Johannsen auf, wie kräftig, wie muskelbepackt die beiden Fremden waren.
Mechanisch gehorchte er. Durch den Hosenstoff drang eisige Kälte. Sie fuhr ihm unter die Haut. Vorsichtig sah er nach oben, wiederum in die Mündung der Waffe. Er hatte sich oft weit vorgewagt, Risiken auf sich genommen, aber diese Situation war etwas anderes.
Eine Falle. Und er war so arglos wie ein Amateur hineingetappt.
Wie hatte es dazu kommen können?
War er einmal zu unvorsichtig gewesen?
Wie hatte man von seinen Recherchen erfahren?
Diese Angst, diese verdammte Angst. Sie lähmte ihn, machte jeden einzelnen Gedanken zu einer Kraftanstrengung, als würde sein Gehirn nur noch schwerfällig, wie in Zeitlupe funktionieren.
Franke stellte sich vor ihn, ein Grinsen auf den Lippen.
Erst jetzt bemerkte Johannsen den kleinen dunkelgrünen Kunststoffkoffer, den der Fahrer aus einer Ecke geholt hatte und auf dem Boden abstellte. Wie für eine Bohrmaschine.
»Lassen Sie uns reden«, sagte Franke.
»Worüber?«, brachte Johannsen zaghaft heraus. Der USB-Stick fiel ihm ein. Es kam ihm vor, als wäre es Tage her, seit er den Stick im Hosenbein versteckt hatte, und nicht erst eine halbe Stunde.
»Über alles.« Franke sah auf ihn herab. »Alles, was Sie herausgefunden haben.«
»Keine Ahnung, was Sie meinen«, antwortete er leise.
Mit dem Lauf der Waffe deutete Franke auf den Koffer. »Wissen Sie, was sich darin befindet?«
Johannsen spürte, dass er zu zittern begann. Er schämte sich dafür. Mut, Courage. Darauf geschissen, er litt Todesängste.
»Eine Nagelpistole«, beantwortete Franke die Frage selbst. Er öffnete die Knöpfe seines Mantels und schob die Pistole in den Hosenbund. Dann ging er in die Knie, um den Koffer aufzuklappen und ein Heft mit der Gebrauchsanweisung hervorzuholen.
»Das angewinkelte Magazin«, las er mit gespielt sonorer Stimme vor, »liefert Zugang zu schwierig erreichbaren Stellen. Schnell, leicht, zuverlässig. Tackert sechs Längen von Nägeln bis zu vierzig Millimetern mit absoluter Präzision.« Er nahm das Werkzeug in die Hand und erhob sich wieder.
Sekunden vergingen, ohne dass ein Wort fiel. Die Stille zerrte an Johannsens Nerven. Seine Furcht war so gewaltig, dass sie wie etwas, das mit den Händen zu greifen war, im Raum zu stehen schien.
Der Fahrer holte aus einer anderen Ecke eine Sporttasche und zog mehrere Gegenstände daraus hervor. Johannsen wagte es nicht, alles genauer zu betrachten. Messer waren dabei, deren Anblick genügte ihm.
»Haben Sie wirklich nichts herausgefunden, über das es sich zu plaudern lohnt?«, fragte Franke.
Peter Johannsen zitterte noch heftiger. Er brachte keinen Ton hervor und starrte verzweifelt den Boden an.
Ein Knebel aus rauem Stoff wurde ihm angelegt.
Wie hatte es nur so weit kommen können?
2
Die Bilder vermischten sich. Das Dorf, in dem sie aufgewachsen war. Das Haus ihrer Kindheit. Ihre Eltern, auf einmal wieder jung. Und sie selbst? Sie war plötzlich das schüchterne dürre Ding von damals.
Sie sah sich, wie sie dastand, fünf oder sechs Jahre alt, in dem Wohnzimmer aus ihrer Vergangenheit. Doch auch ihr Gatte war dabei, er allerdings nicht auf unerklärliche Weise verjüngt, sondern mit seinem grau melierten Haar und den scharfen Fältchen um die Augen.
Alle schimpften mit ihr, jeder hatte etwas auszusetzen. Sie wand sich unter den Anschuldigungen, empfand sie als ungerecht, und das Glas Wasser, das sie in der Hand hielt, rutschte ihr aus den Fingern und zersplitterte in etliche Scherben. Noch mehr Vorwürfe waren die Folge. Als sie zu weinen begann, löste sich der Traum auf, und sie erwachte.
Die Dunkelheit des Schlafzimmers umhüllte sie, verschmolz mit dem Duft der Bettwäsche, die jeden Tag vom Personal erneuert wurde, und dem dumpfen Pochen, das inzwischen fast pausenlos Ellen Degeners Kopf erfüllte.
Sie blinzelte, lauschte ins Nichts, verfluchte das Xanax, das sie eingenommen hatte, um ungestört schlafen zu können, am liebsten tagelang. Es wurde Zeit, die Dosierung zu erhöhen. Wozu stand sie eigentlich jeden Morgen auf? Sie konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand auf der Welt ein sinnloseres Dasein führte als sie.
Ein Geräusch, leise, beinahe unwirklich, brachte sie dazu, die Augen zu öffnen und zum schwarzen Fleck der Zimmertür zu starren.
Oder hatte sie sich getäuscht?
Auf dem Display des Digitalweckers las sie die Uhrzeit: erst 22:32. Sie ging immer früher schlafen, immer benebelter und gleichgültiger.
Der Traum kehrte in ihr Bewusstsein zurück, das Klirren des Glases. Es war ein derart eindringlicher Laut gewesen, und plötzlich wurde Ellen klar, dass sie das Zersplittern nicht geträumt hatte.
Erneut ein Geräusch aus dem Erdgeschoss. Schritte?
Sie erstarrte.
Jetzt war wieder alles still.
Einbildung?
Nein, sie hatte etwas gehört, kein Zweifel.
Sie knipste die Nachttischlampe an. Schob sich aus dem Bett. Raffte mit steifen Fingern das Seidennachthemd vor ihrem Körper. Dreiundfünfzig war sie mittlerweile, sie fühlte sich zu alt und zu eingerostet, um sich um eine Scheidung und einen Neuanfang zu kümmern. Ihr Leben war vorbei, aber warum hatte sie auf einmal Angst darum?
Oder überreagierte sie? Das Xanax? Der Grauburgunder? Lag es daran?
Unschlüssig stand sie da. Die urplötzliche Klarheit in ihrem Schädel bereitete ihr ebenso viel Furcht wie die Geräusche von gerade eben. Sie löste sich aus der Starre und bewegte sich auf nackten Sohlen über den flauschigen Teppich. So leise wie möglich öffnete sie die Tür.
Ihr Herz trommelte wild in der Brust, es kam ihr vor, als hätte es nie zuvor wirklich geschlagen.
Kalt der Ahornparkettboden unter ihren Füßen, kalt die Wand, an der sie sich mit der Hand abstützte. Am Treppenkopf angekommen, hielt sie inne. Lauschte von Neuem.
Nichts.
Fröstelnd ging sie nach unten, Stufe für Stufe, bis in den Flur, der zum Wohnzimmer führte. Ihre Furcht wurde schwächer, verschwommener, wie der Traum, den sie längst abgeschüttelt hatte.
Da war nichts. Außer der üblichen Ruhe, die dieses Haus fest im Griff hatte.
Ellen schaltete die Deckenleuchte ein, dieses mehrere Tausend Euro teure Designwunderwerk. Die Helligkeit stach ihr in die Augen.
Sie atmete erleichtert auf. Keine Geräusche. Also doch nur Einbildung.
Wovor hatte sie sich eigentlich gefürchtet? Was hatte sie zu verlieren, ausgerechnet sie? Es war lächerlich.
Sie drehte sich um und wollte zurück ins Bett, als sie wie versteinert innehielt. Glasscherben. Auf dem Parkett. Von dem Weinglas, aus dem sie den Grauburgunder getrunken hatte.
Aber … sie hatte es nicht umgestoßen. Nein, daran hätte sie sich doch erinnern können, so betrunken war sie auf keinen Fall gewesen.
Ellen spürte den Blick auf sich wie eine Berührung. Sie wirbelte herum. Erneut war sie wie versteinert. Paralysiert.
Da stand er. Groß, breitschultrig. Mehr noch als sein zerklüftetes, unrasiertes Gesicht fielen ihr seine Hände auf, so breit und groß waren sie, wie von einem Riesen.
Ellen vermochte nicht mehr zu atmen, ihre Stimme war weg, das Trommeln ihres Herzens nicht mehr spürbar.
Der Fremde glotzte sie an. In seinen Augen schimmerte etwas auf, das nicht zu der Angst passte, die er in Ellen auslöste: eine Verzweiflung, eine Unsicherheit, die der Situation etwas geradezu Paradoxes gaben.
Sie konnte ihn riechen. Seinen Schweiß. Die Zigaretten, die er geraucht hatte. Die kalte Herbstluft, die in seinen zerknautschten Klamotten steckte.
Ein Moment tiefer Lautlosigkeit, das ganze Haus wie eine eigene Welt für sich.
Und dann war Ellens Stimme zurück, sie wuchs in ihrer Brust, wühlte sich hinauf und entlud sich in einem Kreischen, das unnatürlich grell durch das große, sterile und sündhaft teuer eingerichtete Wohnzimmer hallte. Der Mann zuckte zusammen, erschrocken, vielleicht auch wütend, sie hätte es nicht sagen können.
Ihr Schrei hing noch in der Luft, als der Fremde sich in Bewegung setzte. Mit langen Schritten kam er auf sie zu, diese monströsen Hände erhoben, und im nächsten Moment spürte sie seine Finger wie Schraubstöcke um ihren Hals.
Ellen wehrte sich, sie versuchte es zumindest, doch alles war umsonst, und sie wusste es. Der Fremde drückte zu, immer fester, seine Hände wie aus Eisen, kalt und unerbittlich.
Ellen Degener sank zu Boden, fühlte das harte Parkett unter sich. Erst entwich ihrem Körper Urin, dann das Leben, ganz langsam, jedoch unaufhaltsam. Auf einmal fühlte sie gar nichts mehr, sah nur noch diese verwirrten, zornigen Augen, eine Fratze aus der Hölle, und alles um sie herum wurde dunkel.
3
Sie bildeten ein eigenwilliges Duo. Die schwarz gekleidete Frau mit den stechenden dunklen Augen, dem hellen Teint und der aufsässigen Punk-Ausstrahlung – und der gutmütige, gemütlich wirkende Altachtundsechziger.
Weder vom Aussehen noch vom Alter her passten sie auch nur annähernd zusammen, aber es gab wohl kaum jemanden, in dessen Gesellschaft Kommissarin Mara Billinsky sich wohler fühlte. Hanno Linsenmeyer war für sie immer eine wichtige Stütze gewesen – die einzige. Ihr Halt in den harten Zeiten, als sie als Teenager, einsam, orientierungslos und rebellisch, beinahe auf die schiefe Bahn geraten wäre.
Hanno war inzwischen deutlich über fünfzig, mit zu langen, strähnigen mausgrauen Haaren, schlaffen, stoppelbärtigen Wangen und abgetragener Kleidung. Er war als Sozialarbeiter tätig, seit Urzeiten, wie es schien, und engagierte sich auch weit über den Feierabend hinaus, vor allem für straffällig gewordene Jugendliche. Ein Mensch mit Idealen und dem großen Herzen, sich für diese einzusetzen. Das Leben hatte sie beide in seiner Unvorhersehbarkeit nicht nur zusammengeführt, sondern regelrecht zusammengeschweißt.
Sie befanden sich in einem von Bornheims rustikalen Fachwerkkästen, dem Restaurant Sonne, gelegen im oberen Teil der Berger Straße, die den Stadtteil wie eine Lebensader durchzog. Schief aufgehängte Gemälde aus vergangenen Zeiten zierten die Wände. Eine tief hängende wuchtige Holzdecke drückte den Gastraum zusammen. Kerzen leuchteten auf roh gezimmerten Langtischen, die auch spät am Abend meistens voll besetzt waren. In jeder Ecke erschallte der breite hessische Zungenschlag. Echte Frankfurter kehrten hier ein, kaum Touristen. Es roch nach Sauerkraut, Rippchen und gekochter Ochsenbrust.
Mara und Hanno sprachen über den inzwischen fast achtzehnjährigen Rafael Makiadi. Noch so ein Teenager, der zunächst den falschen Weg eingeschlagen hatte: Wohnungseinbrüche und einiges mehr hatte er auf dem Kerbholz gehabt, als er im letzten Moment von Hanno und Mara vor einer trostlosen Zukunft bewahrt worden war. In einem Förderprogramm für jugendliche Straftäter, in das er dank Hannos Fürsprache aufgenommen worden war, erhielt er Unterricht, um die größtenteils verpasste Schulzeit nachzuholen. Und die kürzlich aufgrund der Einbrüche erfolgte Verurteilung war zum Glück auf Bewährung ausgesetzt worden.
»Also, was meinst du? Müssen wir uns Sorgen um Rafael machen?« Maras Stirn war nachdenklich gerunzelt.
Hanno lächelte schmal. »Hast du noch nie Liebeskummer gehabt?«
»Sprich mit mir nicht über Liebe, Hanno, das weißt du doch.«
»Die Geschichte mit Shaqayeg setzt Rafael verdammt zu.«
»Das ist mir auch klar. Aber deswegen stoppt doch nicht das ganze Leben.«
»Für ihn fühlt es sich eben so an.« Hanno musterte sie. »Du findest, ich sollte härter mit ihm umspringen, was?«
»Manchmal schon.«
»Wäre ich härter, würde er sich noch mehr abkapseln.« Schmunzelnd fügte er an: »Und wäre ich früher schon härter gewesen, dann würdest du heute bestimmt nicht mit mir essen gehen.«
Natürlich verstand sie, wie er das meinte. »Touché.«
»Lass ihn uns einfach im Auge behalten, Mara.«
Shaqayeg war Rafaels erste Liebe, ein aus der iranischen Heimat geflüchtetes Mädchen, das in die Fänge einer Bande der Organmafia geraten, knapp mit dem Leben davongekommen war und nun nach einer längeren Zeit in quälender Ungewissheit Deutschland wieder verlassen musste.
Während des Gesprächs ertappte sich Mara dabei, wie sie beiläufig aus dem Fenster spähte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, im Schutz einer Hofeinfahrt, hielt sich jemand auf. Eine Gestalt, die an Ort und Stelle verharrte und aufgrund der dunklen Kleidung nahezu mit der Umgebung verschmolz. Lediglich der glühende Punkt einer Zigarette hatte Mara auf die Silhouette aufmerksam gemacht.
Daran war nichts Außergewöhnliches, jemand wartete eben darauf, abgeholt zu werden, oder was auch immer. Dennoch blickte Mara gelegentlich durch die Scheibe, die getönt war, was die Sicht ebenso erschwerte wie die vorbeiziehenden Fetzen aus Nebel.
Eine Bedienung erschien am Tisch, um Teller und Besteck abzuräumen. Mara und Hanno hatten sich bei den typischen hessischen Spezialitäten nicht zurückgehalten. Handkäs mit Musigg, Bernemer Krabbenröstbrot und Himmel und Erd’, Maras Leibgericht in der Sonne: gebratene Blutwurst mit Zwiebeln, Püree und hausgemachtem Apfelmus. Sie mochte es deftig, und es kam viel zu selten vor, dass sie es schaffte, sich zu einem entspannten Abend mit Hanno zu treffen.
»Wenigstens sind jetzt Herbstferien«, nahm Hanno den Faden wieder auf. »Da hat Rafael keinen Druck in der Schule und schafft es vielleicht eher, den Kopf wieder freizubekommen.«
»Hat er noch seinen Job?«
Hanno nickte. »Ich habe ihm eindringlich geraten, nicht das Handtuch zu werfen.«
»Du weißt also auch, dass ihm die Arbeit stinkt.«
»Klar.«
Maras Handy ertönte. Nicht gerade vergnügt betrachtete sie das Display.
»Lass den Job einfach Job sein«, schlug Hanno vor. »Wenigstens für heute Abend.«
»Job? Falsch geraten.« Sie nahm den Anruf mit einem abwartenden Hallo entgegen. Doch schon nach wenigen Worten, die gewechselt wurden, beendete sie das Gespräch.
»Wohl kein Verehrer«, merkte Hanno ironisch an.
»Ein Verwandter«, gab Mara leise zurück, ohne seinen Blick zu erwidern.
»Verstehe.« Er nickte. »Der Herr Papa.«
»Oder wie ich ihn nenne: der egoistische Mistkerl.«
»Cool bleiben, Mara«, versuchte Hanno sie zu bremsen, wie immer, auch damals schon, als sie noch ein Teenager gewesen war. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.
»Ich wünschte, das könnte ich. Cool und abgefuckt sein wie er selbst.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich wollte unbedingt nach Frankfurt zurück. Wirklich, ich möchte diese Stadt für nichts in der Welt gegen eine andere eintauschen, so knallhart sie manchmal sein mag. Aber wenn er von hier verschwinden würde, ich hätte nicht das Geringste dagegen.«
»Den Gefallen wird dir Edgar Billinsky kaum tun.« Hanno trank von seinem gespritzten Apfelwein. »Auch wenn es dir nicht passt, er gehört nun mal zu dir.«
»Einen Scheiß gehört er.«
»Ich dachte, es würde besser laufen mit euch. Gab es nicht eine Art Waffenstillstand? Oder gar eine Annäherung?«
Widerwillig nickte sie. »Ja, zuletzt kamen wir besser miteinander aus. Aber er ist schon wieder dabei, alles kaputtzumachen. Er ruft öfter an – allerdings nur, wenn er zu viel Rum gebechert hat. Wie gerade eben. Dann suhlt er sich in Selbstmitleid. Das nervt.«
»Du wirst ihn nicht aus deinem Leben herausschneiden können wie eine Figur in einem Film.«
Mara rollte mit den Augen. »Spar dir dein schlaues Gerede, ich bin keine fünfzehn mehr.«
»Ich würde mich freuen, wenn ihr beide besser miteinander auskämt. Das ist alles.«
»Du gibst die Hoffnung nie auf, stimmt’s?«
»Du kennst mich doch.«
Sie schmunzelten einander an.
Mara spähte nach draußen. Von der Gestalt, die sich zuvor dort aufgehalten hatte, war nichts mehr zu entdecken.
Kurz darauf bezahlten sie und Hanno ihre Rechnung. Als sie sich vor dem Gasthaus voneinander verabschiedeten, sah Mara ihm noch hinterher, wie er auf seinen in der Nähe geparkten, beinahe schrottreifen VW-Bus zuschlenderte und davonfuhr.
Dann überquerte sie die Straße, um sich die Hofeinfahrt anzusehen, die nur schwach beleuchtet war. Sie zog ihr Handy aus der Jackentasche und erhellte damit den Boden. Fünf ausgetretene Kippen von selbst gedrehten Zigaretten lagen an der Stelle, wo vorher jemand gestanden hatte.
Nach wie vor: nichts Außergewöhnliches. Jemand hatte gewartet. Na und? Du siehst wohl Gespenster, sagte sie sich.
Sie steckte das Handy weg und machte sich auf den Weg zu ihrer Wohnung, die nur ein paar Fußminuten entfernt lag.
Ziemlich spät war es geworden. Durch die Straßen pfiff ein rauer Herbstwind, immer mehr Nebelschwaden zogen auf. Es war kaum jemand unterwegs, Maras Doc-Martens-Stiefel raschelten im Laub der Kastanienbäume auf dem Weg.
Ein merkwürdiges Gefühl veranlasste sie dazu, mehrmals über die Schulter nach hinten zu sehen. Eigentlich hatte sie ihre Nerven immer im Griff, doch die Ermittlungen gegen eine russische Gruppierung des organisierten Verbrechens einige Monate zuvor hatten Mara ziemlich zugesetzt – auch wenn sie sich das nur ungern eingestand. Sie war ins Visier der Gangster geraten und gefangen genommen worden. Man hatte sie misshandelt.
Letztlich hatte nicht viel gefehlt, und es wäre aus gewesen mit ihr. Ein Erlebnis, das jedes Mal, wenn sie annahm, es abgeschüttelt zu haben, doch wieder unter ihre Haut kroch. Hinzu kamen die alltäglichen Blicke in den Spiegel, die ihr die Narbe auf der Wange offenbarten – zugefügt mit einem Gasanzünder, ein hässlicher kleiner Krater, der nicht an ihrer kaum vorhandenen Eitelkeit kratzte, aber manchmal an ihrer Selbstsicherheit.
In ihrer kleinen düsteren Altbauwohnung angekommen, verspürte sie kaum Müdigkeit. Während der vergangenen Wochen, als der Sommer in den letzten Zügen gelegen hatte, war es auf dem Revier eher ruhig gewesen, was dazu führte, dass sie sich unausgelastet fühlte. Sie verabscheute Verbrecher und Verbrechen, doch sie liebte es, Polizistin zu sein, im Brennpunkt des Geschehens zu stehen. Nervenkitzel und Gefahr zogen sie auf eine Weise an, die sie selbst nicht zu erklären vermochte, und zu viel Entspannung bekam ihr nicht, sie wusste das.
Um den säuerlichen Geschmack des Apfelweins zu vertreiben, schenkte sie sich von dem staubtrockenen sizilianischen Rotwein ein, den sie sehr mochte. Sie drehte die Musik auf, ziemlich laut, was nachbarliche Beschwerden zur Folge haben würde, aber jetzt gerade brauchte Mara den Krach. The Clash, Jimi Hendrix, Black Rebel Motorcycle Club. Die Wohnung erbebte förmlich von dem eigenwilligen Mix.
Das Weinglas in der Hand, stellte Mara sich ans Fenster, den Blick ins Nichts gerichtet. Plötzlich stutzte sie. Ihre Augen verengten sich.
Dort hinten, an der Hausecke auf der anderen Seite der schmalen Wohnstraße: das Glimmen einer Zigarette in der Finsternis.
Sie konzentrierte sich noch stärker.
Ja, da stand jemand, halb verborgen von der Hauswand. Also doch keine Gespenster.
Rasch drehte sie sich von der Fensterscheibe weg. Sie stellte das Glas auf dem kleinen Tisch ab, einem der wenigen Möbelstücke in ihrem Wohnzimmer, und zog flink Schuhe und Lederjacke an. Aus dem zuvor abgestreiften Holster zog sie ihre Dienstwaffe, die P30L, eine Version mit verlängertem Lauf und Griffschalen, die sie sich extra hatte anfertigen lassen.
Gut möglich, dass sie sich zum Narren machte, aber in den letzten Dienstjahren hatte sie gelernt, den kleinen Warnlämpchen, die zuweilen in ihrem Kopf aufleuchteten, Beachtung zu schenken.
Sie verließ die Wohnung, eilte durchs Treppenhaus nach unten und betrat die Straße. Die Pistole hatte sie sich hinten in den Hosenbund geschoben, ließ aber die Hand auf dem Griff.
Kälte, Nebel, Stille. Nur aus der Entfernung drang gedämpft der übliche Frankfurter Verkehrslärm zu ihr, der auch nachts kaum abnahm. Ihr Blick suchte die Stelle an der Hausecke. Entschlossen ging sie darauf zu, aber keine glimmende Zigarette war mehr zu sehen.
Nein, da war niemand.
Mara suchte den Boden neben dem Haus ab. Im Schein einer Straßenlaterne entdeckte sie zwei ausgetretene Kippen von selbst gedrehten Zigaretten.
Zufall?
Ihr Blick wanderte die Straße hinauf und wieder hinab. Parkende Autos, feucht schimmernder Asphalt, wuchtige, dunkle Häuser und der immer dichter werdende Nebel, der das Licht der Laternen schwächte. Mara spürte eine Gänsehaut.
Und dann nahm sie die Silhouette eines Mannes wahr, der in einiger Entfernung davonging, ein lautloser, geschmeidiger Schatten. Sofort setzte sie sich in Bewegung.
Der Unbekannte schien es zu bemerken. Seine Schritte wurden schneller.
Mara beschleunigte ebenfalls.
Der Kerl sah sich nach ihr um, bog um die Ecke in eine Seitengasse.
Sie hetzte ihm hinterher, ebenfalls um die Ecke. Inzwischen lag die Pistole in ihrer Hand, die Finger schlossen sich fest um die Griffschalen. Die Luft stach in ihre Lungen.
Der Mann bog erneut ab, seine Schritte hallten in der Stille.
Sie folgte ihm weiterhin, konzentriert, angespannt, und auf einmal lag die Straße vollkommen leer vor ihr. Kein Laut ertönte, nichts bewegte sich.
Er war verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Wie weggezaubert.
Mara stand reglos da, eine einsame Gestalt auf dem nackten Asphalt. Ihr Atem tanzte in Wölkchen vor ihrem Gesicht.
»Wer zum Teufel bist du?«, fragte sie kaum hörbar in das kalte Nichts, das sie umgab.
4
Ein einziger Klumpen aus Blut und Schweiß und Qual. Das war von ihm übrig geblieben. Ein Klumpen, in dem noch immer ein letzter Rest Leben flackerte.
Er zitterte, er jammerte, er flehte.
Schmerz.
Dieser Schmerz. Jede Faser seines Körpers brannte.
Die beiden Männer hatten ihm die Kleidung mit Messern vom Leib geschnitten.
Dann hatten sie ihr grauenvolles Werk begonnen, ohne Regung, mit beinahe erschütternder Gelassenheit, als würden sie das tagtäglich hinter sich bringen.
Schläge, Tritte. Und vor allem diese Nagelpistole.
Unentwegt war es so weitergegangen.
Jedes Mal, wenn Peter Johannsen ohnmächtig zu werden drohte, hatten sie ihm eine Spritze in den Oberarm gejagt. Wahrscheinlich ein Cocktail aus Amphetaminen, der verhindern sollte, dass ihm die Gnade des Schlafs zuteilwurde.
Der Generator brummte nicht mehr. Die Lampe war ausgeschaltet. Fahles Morgengrauen erhellte den Raum, überzog alles mit düsteren Schatten. Das Gerippe dieses entstehenden Gebäudes war zu seiner Todeskammer geworden.
Alles hatte er preisgegeben. Alles, was er in langwieriger, mühevoller Recherchearbeit herausgefunden hatte. Mittlerweile besaßen die Männer den USB-Stick aus seinem Geheimversteck im Hosenbein. Und sie wussten, dass es noch weitere Sticks gab, auch wenn Johannsen in seiner Verwirrung gar nicht mehr sicher hatte sagen können, wo genau sich die verdammten Dinger befanden.
Das Signal eines Mobiltelefons erklang, die Männer stoppten erneut. Der Fahrer rauchte mit gelangweiltem Gesichtsausdruck eine Zigarette, während derjenige, der sich Franke nannte, in aller Ruhe ins Handy sprach.
»Weißt du, wie spät es ist?«, fragte er, jedoch nicht verärgert ober überrascht, sondern mit sachlicher Stimme. »Oder besser gesagt, wie früh?«
Die Unterhaltung dauerte an, er behielt seinen Tonfall bei. »Alles läuft bestens«, versicherte er jovial, beinahe heiter.
Johannsen kam das Gerede angesichts des Gestanks von Blut und Schweiß völlig surreal vor. Langsam senkten sich seine Lider, schwer wie aus Blei.
Dann spürte er etwas an seinem Schienbeinknochen.
Die Nagelpistole.
Der Fahrer hatte sie angesetzt, die Kippe lässig im Mundwinkel. Johannsen begann zu wimmern, ein jämmerlicher, beschämender Laut, den der Knebel unterdrückte.
Franke hatte sein Telefonat beendet. Er betrachtete Johannsen wie ein Tier, das geschlachtet werden sollte. »Also, Herr Johannsen, gehen wir gleich noch mal alles durch.« Er sprach ruhig und gelassen, wie schon die ganze Zeit über, was eine noch entsetzlichere Wirkung auf Johannsen hatte als jede bösartige Drohung. »Vielleicht fällt Ihnen ja doch noch irgendetwas ein, das Sie uns bisher verschwiegen haben.«
Der Fahrer krümmte den Zeigefinger. Der Plopplaut der Nagelpistole. Im selben Moment das widerliche Knirschen des Knochens. Und von Neuem dieser glühende Schmerz.
5
Ein trostloses Industriegebiet, dort, wo Frankfurts Stahl und Beton sich allmählich auflösten und flachem Land mit tristen Feldern und Waldstücken Platz machten.
Der Linienbus hielt an und spuckte Leute aus, die sich auf den Weg zur nahen Fleischfabrik Baltzer machten, während andere darauf warteten, wieder in die Stadt befördert zu werden, damit sie sich die zurückliegende Nachtschicht aus den Knochen schlafen konnten.
Es waren fast ausnahmslos Männer. Müde Gesichter, müde Gespräche in mehreren, zumeist osteuropäischen Sprachen. Polen, Ungarn, Balten, die Arbeiter kamen aus allen möglichen Ländern, Deutsche waren in der Unterzahl. Schlurfende Schritte auf Asphalt. Zigarettenqualm stieg dem unfreundlichen bleigrauen Himmel entgegen.
Rafael Makiadi war als Letzter dem Bus entstiegen. Anders als die Übrigen, die sich bei ihrem morgendlichen Weg in Grüppchen zusammenschlossen, blieb er für sich, die Hände in den Jackentaschen vergraben, den Nacken eingezogen, als könnte er sich so unter der kalten Luft hinwegducken, die der langsam verschwindende Nebel zurückließ.
Rafael war nicht sonderlich groß. Schmale Schultern, zarte Hände, Irokesenhaarschnitt, dessen Ränder ausfransten. Hose mit Tarnmuster, Nike-T-Shirt, darüber ein dicker Pullover und eine Sportjacke in leuchtenden Farben. Besonders auffällig waren seine Augen, die aus einem fast mädchenhaft hübschen Gesicht mit dunklem Mischlingsteint hervorstarrten: misstrauische, verletzliche Augen, die schon zu viel im Leben mit angesehen hatten.
Die Kollegen mochten ihn nicht, machten keinen Hehl daraus, und er mochte sie nicht, womit er gleichsam nicht hinter dem Berg hielt. Er stänkerte nicht, gab ohnehin kaum einen Ton von sich, aber seine Blicke und Gesten ließen keinen Zweifel, dass er diesen lausigen Job nur wegen des Geldes angenommen hatte – und mangels besserer Alternativen.
Auf dem großen Platz seitlich der Fabrik standen bereits die ersten Lkws. Die lebende Ware wurde schon früh am Tag angeliefert, um hier geschlachtet zu werden. Man hörte das gequälte Grunzen und Quieken der dicht an dicht eingepferchten Kreaturen, die von Schweinemästern aus dem gesamten Bundesgebiet kamen. Rafael fand diese Laute nur schwer zu ertragen, und er war froh, ihnen durch die stählerne Doppeltür des Personaleingangs entfliehen zu können.
Die nach wie vor schlurfenden Schritte, die immer gleichen Stimmen im immer gleichen Tonfall. Dann die Umkleidekabine. Die Gerüche von Schweiß und billigen Deos stiegen in Rafaels Nase. Die weiße Hygieneschutzkleidung aus dünnem Kunststoff, die traurigen Hauben, die sich alle auf die Köpfe stülpten, die Plastikhandschuhe.
Rafael war eine einfache Aushilfe, er musste tun, was gerade anfiel, an diesem Morgen gefrorene Schinken an einem Schneidegerät mit rasiermesserscharfen Klingen von der Schwarte befreien. Er schien den Gestank von totem Fleisch gar nicht mehr loswerden zu können. Seit er die Fabrik kannte, hatte er beschlossen, vegetarisch zu leben.
Teilweise übernahmen moderne Maschinen die Arbeit: In Sekundenbruchteilen wurden computergesteuert Fleischstücke zu exakt gleich großen Scheiben geschnitten. Riesige Kettensägen zerteilten Schweine in Hälften, voll automatisch wurden die Füße abgetrennt. Dennoch blieb Muskelkraft ein wichtiger Faktor, fast jeder Handgriff erforderte großen körperlichen Einsatz.
Rafael hob immer wieder den Kopf, um die Bilder ringsum auf sich wirken zu lassen, angewidert, aber auch beeindruckt von den Arbeitern, denen das Fließband die Geschwindigkeit vorgab. Jeder Handgriff musste sitzen. Schulter an Schulter wuchteten Männer pausenlos schwere Fleischstücke auf dem Band in die richtige Position, damit sie von Kollegen in nahezu aberwitziger Schnelligkeit in Stücke geschnitten werden konnten.
Der Krach der Maschinen, die Stimmen, die dagegen anschrien, die roten Leiber der Tiere, das Zischen, wenn die riesigen Messer gewetzt wurden.
Am liebsten wäre Rafael jedes Mal nach Schichtbeginn wieder aus der Fabrik gerannt, doch er hatte sich vorgenommen, die Sache durchzuziehen. Er brauchte das Geld. Und was ebenso wichtig war: In der Fabrik konnte er sich leichter dazu zwingen, nicht mehr an Shaqayeg zu denken. Die Erinnerungen an sie waren schön – und zugleich quälend. Sie hatte das Land verlassen müssen und befand sich inzwischen wohl wieder in ihrer iranischen Heimat. Er hatte kein Lebenszeichen mehr von ihr erhalten. Was sollte aus ihr werden?
Einen Schinken nach dem anderen schob er zu den Klingen hin, darauf bedacht, seine Fingerspitzen zu behalten, und sein Blick, halb konzentriert, halb leer, fiel von Zeit zu Zeit auf die abgelösten Schwarten, die in einem schmutzigen Plastikbehälter aufgefangen wurden.
Der Lärm, der Geruch. Die Zeiger auf der runden Industrie-Wanduhr wirkten wie festgeschweißt.
Auf einmal hielt Rafael inne. In die gewohnte Geräuschkulisse hatten sich andere Laute gemischt. Gebrüll, das Stampfen von Schritten.
Er sah sich in der Fabrikhalle um und stellte verwundert fest, dass durch den Hauptzugang Fremde hereinstürmten. Schwarz gekleidete Männer, die ihre Gesichter unter Sonnenbrillen und dem Stoff von Motorradhauben verbargen. Vier waren es, nein, fünf.
Wer war das? Was wollten sie?
Noch erschrockener war Rafael, als er sah, dass die Unbekannten Baseballschläger trugen, mit denen sie auf die wehrlosen Arbeiter einschlugen.
Was ging hier vor?
Schreie. Die dumpfen Laute, wenn die Schlagwaffen auf Arme, Schultern, Beine trafen.
Einer der Typen, groß und kräftig, tauchte vor Rafael auf, und er rannte los. Auf einmal war er fast wieder so schnell wie früher, wenn irgendwelchen Mistkerle auf der Straße ihn wegen seines dunklen Teints in die Zange genommen hatten.
Er hetzte auf die Seitentür zu, die schweren Schritte des Verfolgers im Ohr, hinaus auf den Flur, von dort Richtung Ausgang, vorbei am Umkleideraum, der andere ihm immer noch auf den Fersen, und dann ins Freie, wo ihn die Herbstluft umhüllte.
Er rannte über den Hof, dann spürte er den schweren, kaum von Gras bewachsenen Boden unter seinen Sohlen. Ein paar kahle Sträucher, in einiger Entfernung der Wald, der angesichts des wie aus heiterem Himmel hereingebrochenen Überfalls Schutz versprach.
Im Rennen sah Rafael über die Schulter nach hinten. Der schwarz gekleidete Hüne hatte aufgeholt, hob in diesem Moment den Baseballschläger an.
Der Hieb erfolgte, Rafael tauchte zur Seite weg und entging dem Schlag, doch er geriet aus dem Gleichgewicht, stolperte, fiel der Länge nach hin.
Sofort kam er wieder auf die Beine.
Der nächste Schlag. Diesmal gelang es ihm nicht, auszuweichen.
Ein wilder Schmerz, die Erde raste auf ihn zu. Er schmeckte Dreckklumpen und abgestorbene Grashalme auf der Zunge. Plötzlich war alles um ihn herum seltsam weit entfernt. Dunkelheit erfasste ihn, deckte ihn zu wie ein riesiges Tuch.
6
Die Villa lag am Rande Kronbergs, ein puristischer Kubus in Weiß, zwei Stockwerke hoch. Zu der breiten Haustür aus schwerem, in Kassetten gearbeitetem Holz führten drei Stufen einer marmornen Freitreppe. An einigen Fenstern waren die Jalousien heruntergelassen.
Ein fast zwei Meter hoher Holzzaun trennte das Grundstück von der Straße. Geometrisch gestutzte Zierbüsche und ein perfekt gemähter Rasen, das Grün stark verblasst, zwei Marmorstatuen, eine Doppelgarage. Über allem lastete eine bleierne Ruhe. Kein Auto fuhr, keine Stimme ertönte.
Wie leblos solche Villengegenden immer wirkten, stellte Mara Billinsky beiläufig fest. Sie stand auf der Dachterrasse, die den Blick über die Stadt und den nahen Wald eröffnete. In Gedanken sah sie noch die Frau vor sich, die auf dem Parkettboden gelegen hatte. Das Seidennachthemd, die violett verfärbten Druckstellen auf dem Hals, die starren toten Augen.
Ellen Degener, dreiundfünfzig Jahre, nicht berufstätig, verheiratet, keine Kinder.
Nur ein Name, nur ein paar Daten. Doch dahinter verbarg sich ein Leben. Ein Mensch mit Träumen, Wünschen, Sehnsüchten. Egal, wie viele Leichen man betrachten musste, der Tod verlor nie an kalter Eindringlichkeit. Man erstarrte immer wieder aufs Neue davor, wie endgültig und gnadenlos er doch war. Die Gewissheit des eigenen Endes wurde einem ein Stück bewusster. Jedenfalls erging es Mara in diesem Moment so, und sie hasste es, sich in solchen Grübeleien zu verlieren.
Es war jetzt eine gute Stunde her, seit der Leichnam nach einer ersten Untersuchung abtransportiert worden war, damit die Obduktion durchgeführt werden konnte.
Als ihr Kollege Jan Rosen die Dachterrasse betrat, drehte Mara sich zu ihm um. Er hatte erneut mit der Putzfrau gesprochen, die am frühen Morgen mit ihrem eigenen Schlüssel ins Gebäude gekommen und völlig unvermittelt auf die Tote gestoßen war. Zwar hatten Mara und er die Frau zuvor gemeinsam befragt, aber Rosens zurückhaltende Art kam oft gut an, und sie hatten es sich angewöhnt, dass er bei Zeugen, die unter Stress oder Schock standen, ein zweites Mal Fragen stellte. Mara schätzte ihn dafür. Wenn Bedachtsamkeit gefragt war, stand ihr ihre Ungeduld zuweilen im Wege.
»Und?«, fragte sie ihn gewohnt knapp.
Vage zuckte er mit den Schultern. »Es kam nicht mehr dabei heraus als vorher. Die Ärmste ist ganz schön durcheinander.«
»Hast du ihr erlaubt, nach Hause zu gehen?«
»Was dagegen?« Zweifelnd runzelte er die Stirn. »War das etwa falsch?«
»Schon okay, Rosen, es war nur eine Frage.«
»Bei dir weiß man nie.«
Mara betrachtete ihn von der Seite, wie er den Blick über die Stadt wandern ließ, genau wie sie selbst vorhin.
Sein helles Haar war schütter, die Stirn hoch, sein Gesichtsausdruck ernst und in sich gekehrt, wie üblich. Er wirkte älter, als er eigentlich war: Anfang dreißig, genau wie Mara. Unter seiner Jacke leuchtete das Purpurrot eines Rollis – die aufdringlichen Farben seiner Pullover standen in starkem Gegensatz zu Rosens vorsichtigem Wesen, das es ihm oft schwer machte, in seinem Team Anerkennung zu finden.
»Was hältst du von der Geschichte, die sich hier abgespielt hat?«, wollte Mara wissen.
»Eine eigenartige Sache.« Erneut hob Rosen die Schultern. »Die Frau wurde erwürgt, daran besteht kein Zweifel.«
»Ansonsten gibt’s eine Menge Zweifel, wie mir scheint.«
»Absolut.« Er nickte nachdenklich. »Die Putzfrau hat gesagt, dass Ellen Degener sehr zurückgezogen gelebt hat. Einige lose Freundschaften, kaum Verwandtschaft.«
»Und meistens verbrachte sie ihre Zeit wohl allein.«
»Alles in diesem Haus riecht nach Einsamkeit. Nicht gerade ein sehr wahrscheinliches Mordopfer.«
»Noch wissen wir zu wenig über sie.« Mara musterte ihn. »Ellen Degeners Mann ist anscheinend häufig auf Geschäftsreisen unterwegs.«
»Ja, das hat die Putzfrau mir gegenüber gerade noch mal bestätigt. Ständig weg, sehr erfolgreich. Auch jetzt ist er unterwegs – bereits seit mehreren Tagen.«
»Das heißt, ihn können wir als eigentliches Ziel einer geplanten Tötung ausschließen, oder was immer es war.«
»Das sehe ich genauso«, stimmte Rosen zu. »Hätte jemand Degener gegenüber Mordabsichten gehegt, dann hätte die Person das Anwesen gewiss eine Weile beobachtet, um sicherzugehen, dass er zu Hause ist. Der Täter wäre nicht willkürlich hereingestürmt, um ihn umzubringen. Und dann hätte er ja wohl auch eine Waffe dabeigehabt. Er hätte Degener kaum erwürgen wollen.«
»Offenbar wurde nichts gestohlen. Keine einzige durchwühlte Schublade, eine Rolex liegt für jeden gut sichtbar in einem der Badezimmer, eine Wagenladung teurer Klunker befindet sich im Schrank in Ellen Degeners Schlafzimmer.«
»Also gehen wir nicht von einem Raubüberfall aus«, ergänzte er.
»Was hat die Putzfrau gesagt, wann wird Degener zurückerwartet?«
»Morgen oder übermorgen. Ich werde das noch verifizieren. Dazu muss ich mit Degeners Assistentin sprechen, einer gewissen Corinna Grünberg. Den Namen habe ich von der Putzfrau.«
Nach einer Pause bemerkte Mara: »Wir müssen Degener verständigen.«
»Ja«, erwiderte Rosen zögerlich.
»Ich übernehme das.« Sie wusste, wie sehr es ihm zu schaffen machte, derartige Nachrichten an Verwandte von Opfern zu überbringen.
Er wich ihrem Blick aus. »Danke, Billinsky!«
»Bevor wir gleich wieder hineingehen und uns noch mal gründlich umsehen: Was ist deine Theorie, Rosen? Spontan, aus dem Bauch heraus.«
»Wir sollten noch warten, was die Spurensicherung …«
»Na los, Rosen«, unterbrach sie ihn auf eine etwas ruppige Art, die sie nicht immer abzustellen vermochte. »Sag, was du denkst.«
»Tja, ich glaube, dass wir es doch mit einem Einbrecher zu tun haben. Er ging davon aus, dass niemand in der Villa zugegen war, und verschaffte sich Zutritt. Ellen Degener schlief zu der Zeit schon, wurde allerdings durch ihn aufgeweckt.«
»Stichwort Weinglas.«
»Das ganze Haus ist extrem ordentlich aufgeräumt. Da liegt nichts herum. Und dann sind da diese Splitter. Der Einbrecher stößt aus Versehen gegen das Glas, die Frau wacht auf, sie steht vor ihm, er bekommt Panik, erwürgt sie …«
»Und vor Schreck über die eigene Tat«, fuhr Mara fort, »verliert er derart die Nerven, dass er nichts stiehlt, sondern nur noch wegwill von dem Ort, an dem er unversehens zum Mörder wurde.« Sie zog eine Augenbraue in die Höhe. »Ich weiß nicht recht.«
»Er bekommt Panik«, wiederholte Rosen, bestimmter als sonst. »Er steht vor der Toten, ist geschockt, rennt los.«
»Zuvor ist er durch das Fenster an der Rückseite der Villa eingedrungen. Jedenfalls müssen wir davon ausgehen.«
»Offenbar war es gekippt gewesen. Er hat es geschafft, es komplett zu öffnen, und ist eingestiegen.«
»Und dann ist er durch dasselbe Fenster wieder abgehauen.« Mara sprach die Worte mit skeptischem Unterton aus.
»Vielleicht ist er in seiner Panik auch zur Haustür gerannt, musste aber feststellen, dass sie abgeschlossen war. Also ist er zurückgelaufen.«
»Die Putzfrau sagt aus, dass öfter vergessen wurde, dieses Fenster zu schließen. Das fiel ihr häufig auf, wenn sie morgens für Ordnung sorgte.«
»Richtig.«
»Und sie sagt außerdem aus, dass Frau Degener recht nachlässig war. Sie vergaß auch ständig, abends die Alarmanlage einzuschalten. Wenn Herr Degener auf Reisen war, blieb die Villa zumeist ungesichert.«
»Richtig.«
»Demnach hat Ellen Degener keinerlei Angst verspürt. Im Gegenteil, der Putzfrau zufolge wirkte sie eher lustlos, desinteressiert.«
»Das würde die Sache mit dem Einbrecher bestätigen.«
»Woher wusste er, dass die Alarmanlage ausgeschaltet war?«
»Er wusste es vielleicht gar nicht. Ein Amateur, der die Villa beobachtet hat, und das nicht sehr gewissenhaft. Womöglich war ihm durch Zufall aufgefallen, dass das Fenster manchmal offen stand. Jedenfalls ging er am entscheidenden Abend davon aus, dass beide Degeners nicht anwesend waren, und hoffte darauf, mit relativ kleinem Einsatz große Beute machen zu können.«
Mara erwiderte nichts. Sie ging, gefolgt von Rosen, zurück ins Haus, zunächst durch das obere Stockwerk, wo sich unter anderem die beiden getrennt liegenden Schlafzimmer des Ehepaars befanden. Die Kollegen der Spurensicherung in den lichtgrauen Schutzanzügen waren mittlerweile auch hier oben beschäftigt.
Sie nahmen den Weg, den wohl auch Ellen Degener zurückgelegt hatte, kurz bevor sie ermordet worden war: die Treppe nach unten, den Gang entlang, dann ins Wohnzimmer, wo noch immer weitere Beamte der Spurensicherung zu tun hatten. In die zuvor fast steril wirkende Ordnung, die der Villa eine gewisse leblose Atmosphäre verliehen hatte, war unweigerlich Chaos eingetreten. Schranktüren standen offen, Schubfächer waren herausgezogen und auf dem Boden übereinandergestapelt. Überall Papierstapel und Zellophanbeutel mit beschrifteten Etiketten. Tischplatten, Sessellehnen, Türen und Griffe waren mit grauem Pulver beschmiert.
»Ziemlich wenig Fingerabdrücke«, sagte einer der Spezialisten zu Rosen. »Jedenfalls verglichen mit anderen Wohnhäusern. Entweder man hat penibel sauber gemacht, oder hier haben sich die Leutchen nicht gerade die Klinke in die Hand gegeben.«
»Oder beides«, bemerkte Mara knapp.
Der Beamte nickte nur und machte sich wieder an die Arbeit. Nicht ohne vorher einen Seitenblick auf Maras Aufmachung zu werfen: ihre abgewetzte Motorradlederjacke, die knallengen schwarzen Jeans und die Doc-Martens-Stiefel. Auch ihre Piercings an Oberlippe und Braue, die mit Kayal betonten dunklen Augen und ihr glattes, pechschwarz glänzendes Haar hatte er betont unauffällig gemustert. Er war ihr nie zuvor begegnet, aber gewiss war es bis zu ihm durchgedrungen, dass in der Mordkommission jemand beschäftigt war, der nicht gerade dem üblichen Erscheinungsbild eines Kriminalbeamten entsprach.
Anfangs war Mara in ihrer Abteilung mit reichlich Häme bedacht worden, offener wie versteckter, inzwischen war jedoch allgemein bekannt, dass sie sich trotz ihrer grazilen Statur zu wehren wusste und weder auf den Mund noch auf den Kopf gefallen war. Ihre Alleingänge hatten sich herumgesprochen, ihre Unangepasstheit, ihr Dickschädel, ihre derart raue Schale, dass die Vorstellung schwerfiel, es könnte darunter auch ein weicher Kern vorhanden sein. Jedenfalls gab es kaum noch Spott für Mara, eher eine Art wachsamen Respekt. Sie hatte sich ihr Jagdgebiet erkämpft. Sie war die Billinsky, sie war die Kommissarin, die man die Krähe nannte.
Zusammen mit Rosen stellte sie sich nun in eine Ecke des riesigen Wohnzimmers. An der Wand hingen mehrere gerahmte Fotografien. Jede davon zeigte Ellen Degener mit ihrem Mann, darunter das Hochzeitsbild, wohl aus den Achtzigerjahren, und mehrere Aufnahmen, die auf Urlaubsreisen entstanden sein mussten: Asien, Afrika, Kalifornien, auch Wandern im Hochgebirge, wohl den Alpen.
»Übrigens«, sagte Rosen beim Betrachten der Fotos, »ich habe mir die Einrichtung genauer angesehen. Leder, Marmor, Edelholz, hier und da echte Designerstücke. Da ist nichts, aber auch gar nichts, das nicht schweineteuer wäre.«
»Kein Wunder, wenn der Herr Geschäftsmann so erfolgreich ist, wie die Putzfrau nicht müde wurde zu betonen.«
»Ja, sicher. Und trotzdem … Also, ich weiß es wohl selbst nicht genau, aber irgendetwas …«
»… kommt dir komisch vor«, beendete Mara den Satz für ihn.
Er nickte. »So ist es.«
»Und deine Theorie von vorhin? Der Einbrecher, der auf einmal zum Mörder wird?«
»Tja, daran würde ich durchaus festhalten«, erwiderte Rosen auf seine spröde Art. »Aber dennoch …« Er verstummte.
»Mir geht’s ja auch so.« Sie hob erneut eine Augenbraue. »Irgendetwas kommt mir hier genauso spanisch vor wie dir.«
7
Pawel Kadzior betrachtete seine gefalteten Hände, die leicht zitterten. Er saß gekrümmt auf einer der Sitzschalen an der mit Graffiti beschmierten U-Bahn-Station. Unter der Erdoberfläche zu sein, hatte etwas Befremdliches für ihn. Diese ganze Stadt kam ihm unheimlich vor, ein Labyrinth, aus dessen wilder Unübersichtlichkeit ihm Feindseligkeit entgegenschlug wie ein ständiger unerbittlicher Wind.
Nie hatten seine Hände gezittert. Jetzt taten sie das unaufhörlich. Nicht nur wegen der Kälte. Nicht nur wegen des Hungers.
Seit wie vielen Stunden hatte er nicht mehr gegessen? Seit wie vielen Nächten nicht mehr als zwei oder drei Stunden geschlafen? Er war zu einem Gespenst geworden. Sein Leben lang hatte er alles im Griff gehabt. Sicher, er hatte hart arbeiten, hart kämpfen müssen, wie Millionen andere Menschen auch. Aber er war stets Herr seiner Situation gewesen. Und nun? Vor ihm tat sich ein Abgrund auf, in den er hilflos hinunterstarrte.
Vorhin war er mit der S-Bahn zurück nach Frankfurt gefahren, anschließend ziellos durch die Straßen geirrt, bis ihn die Kälte hierher getrieben hatte. Obwohl er auch hier fror wie ein Hund.
Eine U-Bahn näherte sich und hielt an. Niemand stieg aus, kaum jemand ein, und weiterhin starrte Pawel Kadzior auf seine Hände. Er war müde. Und doch würde er, hätte er ein Bett gehabt, keinen Schlaf finden. Er war schmutzig. Muffelnder Schweiß lag getrocknet auf seiner Haut, seine Klamotten stanken, seine Fingernägel waren schwarz. Immer war er stolz gewesen auf seine Reinlichkeit. Und jetzt hockte er da wie ein Dreckschwein. Er schämte sich. Auch weil er seinen Geldbeutel verloren hatte. Nicht wegen der paar verbliebenen Münzen, sondern weil sich darin sein Ausweis befunden hatte. Das fiel nicht ins Gewicht angesichts seiner anderen Probleme, aber es besaß symbolische Kraft. Keine Papiere mehr. Er war ein Namenloser. Ein streunender Köter.
»Schau mich nicht so an, Jakub«, flüsterte er in seiner Muttersprache. »Du solltest mich nicht so sehen, nein, das solltest du wirklich nicht.«
Ein tiefes Rauschen aus dem Schacht kündigte die nächste U-Bahn an. Als sie einfuhr, stellte Pawel fest, dass sie fast leer war. Der große Schwung an Leuten, die zur Arbeit mussten, war längst schon unterwegs, deshalb gab es nur wenige Fahrgäste. Umso besser für ihn. So konnte er mögliche Ticketkontrolleure leichter ausmachen.
Er glitt durch die Schiebetüren. Ohne sich auf einen der vielen freien Plätze zu setzen, legte er die Strecke bis zum Hauptbahnhof zurück. Dort stieg er aus. Ganz in der Nähe gab es eine Armenküche, wo in den Morgenstunden Tee, Pulverkaffee und Brötchen verteilt wurden. Es war ein Zufall, dass er die Einrichtung in einem Hinterhof entdeckt hatte – und er war verdammt froh darüber.
Er folgte der Kaiserstraße und ging in der Masse unter. Geschäftsleute, Bettler, Jugendliche, die die Schule schwänzten, und einige der letzten Betrunkenen, die von den ringsum gelegenen Bars und Stripschuppen ausgespuckt wurden. Pawel verachtete das Vergnügungsviertel, er gehörte nicht hierher. Aber alles war schiefgelaufen. Und er hatte es zu lange nicht bemerkt. Ja, alles. Seit jenem viele Jahre zurückliegenden Tag, an dem Jakub diese Nadja kennengelernt hatte.
So blind war Pawel gewesen. Vollkommen naiv.
Nadja, das hübsche Ding mit blondem Engelshaar und Unschuldsblick. Sie hatte die Drogen in Jakubs Leben gebracht. Zunächst hatten sie gemeinsam Haschisch geraucht, dann damit gedealt. Sie hatte den Stoff besorgt, auch die härteren Sachen, zu denen sie rasch gewechselt waren. Amphetamine, Morphium, Ecstasy. Der letzte Schritt war Heroin gewesen.
Jakub und Heroin. Unglaublich. Es war auch heute noch völlig unfassbar für Pawel, der sich nicht sicher war, was verabscheuungswürdiger war: der Eigenkonsum oder der Handel mit den verfluchten Drogen. Nadjas Schuld. Sie brachte Jakub dazu, dass er sich ihren Namen auf den Oberarm tätowieren ließ. Dieser dumme verliebte Narr.
Die Erinnerung an das Tattoo schnitt Pawel tief ins Herz. Selbst jetzt noch, als er an einem trockenen Brötchen knabberte und auf seinen Pappbecher starrte, aus dem Dampf aufstieg.
Obdachlose standen um ihn herum, manche schwatzten, andere suchten das Alleinsein, genau wie Pawel. Nie hätte er für möglich gehalten, dass einmal Heroin – Gott bewahre! – eine Rolle in seinem Leben spielen würde. Aber so war es gewesen. Jakub tänzelte auf einem dünnen Seil, abgemagert, apathisch, so bleich, als wäre er tot.
Doch das hatte Pawel nicht zugelassen. Nein, Jakub hatte sein Leben nicht einfach so wegwerfen dürfen. Pawel war eingeschritten. Hatte Nadja mit der Kraft seiner Fäuste zum Teufel gejagt und Jakub in einem Zimmer eingesperrt wie in einer Knastzelle.
Grauenhafte Wochen.
Jakub hatte sich an den Wänden die Fäuste blutig geschlagen, den Kopf dagegengerammt, bis auch aus der Stirn das Blut floss. Er hatte gezittert, gekotzt, geweint, gefleht, gebrüllt. Nächtelang. Nie würde Pawel diese Schreie vergessen können.
Irgendwann in jener Zeit hatten Pawel und seine Frau Helena dann von Piękny Widok gehört. Schöne Aussicht bedeutete das, doch Pawel hatte große Zweifel, ob es für Jakub je wieder so etwas wie eine Perspektive geben würde.
Mit gesenktem Blick ließ er sich an diesem kalten, nebligen Frankfurter Herbstmorgen von dem dünnen Kaffee nachschenken und wandte sich ab. »Schau mich nicht so an, Jakub«, flüsterte er, ganz leise, wie zuvor schon einmal.
Die Scham war wieder da, sie wütete in seinem Körper wie ein Fieber. Nicht nur zu einem jämmerlichen Bettler war Pawel Kadzior geworden. Noch weitaus schlimmer war, dass Blut an seinen Händen klebte. Er war ein Morderca.
Ein gottverdammter Mörder.
Aber genau deswegen war er doch dorthin gegangen, oder nicht?
Um zu töten. Um Leben zu zerstören.
Nicht nur Scham, auch Wut loderte in ihm. Dieser Zorn, als würde in seinem Bauch ein ständiges Feuer brennen, das niemals gelöscht werden konnte. Er klammerte die Finger um den Becher und stierte ins Nichts. »Schau mich nicht so an, Jakub.«
8
Die Tür wurde ihnen geöffnet, und sie betraten ein großes Eckbüro, das auf zwei Seiten von einem irritierenden Nichts umschlossen zu sein schien. Perfekt gereinigtes Glas reichte vom Boden bis zur hohen Decke. Es war, als könnte man aus dem sechzehnten Stock einfach so, ohne Hindernis in einen schwindelerregenden Abgrund springen.
Nach einer kurzen Begrüßung und einem Händedruck stellte sich Mara Billinsky dicht vor die gläserne Fassade und betrachtete die Stadt. Die Türme der Banken, den Dom, die Paulskirche, das Gewirr der Straßen und Gassen, die unzähligen Gebäude der Wohnviertel, die das Stadtzentrum so eng umgaben, als würden sie es beinahe erdrücken.
In Maras Rücken begann Rosen das Gespräch mit Kai Degener, der sich nach ihrem Eintreffen gleich wieder hinter seinem Drehstuhl und Kirschbaumschreibtisch postiert hatte, auf dessen blank polierter Oberfläche sich nur ein Laptop und ein Telefon befanden. Es roch nach dem Leder der Besuchersessel, Chrom blitzte.
Mara drehte sich um, als ihr Kollege bei den letzten bekannten Details angekommen war, die die Nacht betrafen, in der Degeners Frau ermordet worden war. Sie musterte den Geschäftsmann, der einen eleganten Anzug, Hemd und straff gebundene Seidenkrawatte trug, von der Seite. Schon am Vortag hatte sie mit ihm telefoniert. Gerade eben, bei der Begrüßung, hatte er seine Irritation über ihre Aufmachung nicht verbergen können, aber daran war sie gewöhnt.
Degener legte seine manikürten Hände auf die Lehne des vor ihm stehenden Stuhls. Wie bereits beim Telefonat wirkte er, als würde er sich größte Mühe geben, beherrscht zu erscheinen. Seine Haltung war aufrecht, in dem glatt rasierten Gesicht regte sich kein Muskel. Er war Mitte fünfzig. Falten um die Augen, graue Geheimratsecken, mittelgroß, sportliche Figur, nicht der Hauch eines Bauchansatzes. Offensichtlich ein Herr, der Wert auf Fitness legte.
Auf der Fahrt in Maras schwarzem Alfa zu dem riesigen Bürokomplex hatte Rosen erläutert, was er über Kai Degener herausgefunden hatte, einen echten Selfmade-Businessmann, dessen Karriere nach einer schlichten Lehre als Industriekaufmann einen steilen Aufstieg genommen hatte und der mittlerweile Beteiligungen in ganz unterschiedlichen Unternehmen vorweisen konnte. Ein höchst angesehener Herr, dessen Rat gefragt war, der sich aus den Schlagzeilen heraushielt und allem Anschein nach einen unauffälligen, zurückgenommenen Lebensstil bevorzugte.
Doch wie er jetzt so dastand, mit zuckenden Schultern, bebenden Lippen, und seine Beherrschung doch noch einbüßte, da war er eben nur ein ganz gewöhnlicher Trauernder.
Rosen, der sichtlich mitfühlte, sprach ihm zum zweiten Mal das Beileid aus, während Mara ihr Schweigen beibehielt. Degener nahm die Bekundung mit einem Nicken entgegen und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. »Wie konnte das nur passieren?«, fragte er mit dünner Stimme. »Ausgerechnet ihr? Unbegreiflich. Sie hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können.«
»Wir gehen davon aus«, sagte Rosen, »dass es sich um einen Einbruchsversuch gehandelt hat. Und dass es dann …«
»Aber es ist doch nichts gestohlen worden«, unterbrach ihn Degener abrupt, um sich gleich dafür zu entschuldigen. »Verzeihen Sie. Aber es stimmt doch: Es fehlt nichts, rein gar nichts.«
»Sicher.« Rosen nickte eifrig. »Deshalb sagte ich versuchter Einbruch. Der Täter hat …«
»Ich verstehe das einfach nicht«, fiel Degener ihm erneut mit bekümmerter Stimme ins Wort. »Ellen war die Sanftmut in Person. Wenn wir mal Streit hatten, was nicht oft passierte, war das jedes Mal allein meine Schuld. Sie hat nie ein böses Wort für mich gehabt. Oder für sonst jemanden.« Seine Augen schimmerten feucht.
»Es tut uns sehr leid«, drückte Rosen noch einmal sein Mitgefühl aus.
Nach einem langen Moment der Stille meldete sich Mara zu Wort: »Herr Degener, Sie können sich also niemanden vorstellen, der etwas gegen Ihre Frau hatte?«
Degener maß sie mit einem Blick, der nur kurz seine Missbilligung über ihre Kleidung zu kaschieren verstand. »Ich sagte es ja gerade: Ellen konnte keiner Fliege …« Mitten im Satz brach er ab, um sich wieder zu fassen. »Tut mir leid, aber Ihre Frage ist einfach absurd, wirklich. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, der Ellen etwas antun wollte. Ihr Tod muss ein Unfall sein, ein Zufall. Wie immer man es ausdrücken mag. Er kann einfach nichts mit ihrer Person an sich zu tun haben.«
»Wie ist es mit Ihnen? Haben Sie Feinde? Gibt es jemanden, der …«
»Nein, keineswegs«, lautete die Antwort.
»Als ein Mann in Ihrer Position …«, versuchte Mara abermals anzusetzen.
»Ich weiß schon, dass Sie das in Betracht ziehen müssen, aber dafür gibt es nicht das geringste Anzeichen. Sehen Sie, manchmal mache ich ein gutes Geschäft, manchmal die Konkurrenz. Und hin und wieder ist man wütend aufeinander. Mehr aber auch nicht. Das ist nun mal so, das ist Business. Doch dass jemand mir gegenüber …« Er stockte kurz. »Nein, völlig undenkbar. Ich habe keine Feinde, ich bin ein rechtschaffener Mensch.«
»Herr Degener, ist Ihnen bekannt, dass die Alarmanlage in Ihrer Villa öfter nicht eingeschaltet worden ist?«
Degener sah zu Rosen, als würde er sich lieber mit ihm unterhalten. Er löste die Hände von der Stuhllehne. Ohne Mara zu betrachten, antwortete er: »Ellen neigte zu Vergesslichkeit. Und gewiss auch zu Sorglosigkeit. Sie wäre nicht im Traum darauf gekommen, dass ihr ausgerechnet daheim etwas Schlimmes geschehen könnte.«
»Und wenn Sie ebenfalls zu Hause waren?«, fragte Mara.
»Dann habe ich die Alarmanlage vor dem Zubettgehen eingeschaltet. Ellen hat sich nie um solche Dinge gekümmert.«
»Ihre Frau hatte nicht viele Freunde. Nicht viel Kontakt zu anderen Menschen. Kann das sein?«, erkundigte sie sich weiter.
»Bitte?« Eine unüberhörbare Irritation, vielleicht sogar Verletzlichkeit mischte sich in Degeners Tonfall. Und auch Rosen warf Mara einen pikierten Blick zu.
»Nun ja, wir wissen, dass sie sich häufig allein zu Hause aufhielt.«
»Meine Frau ist das Opfer, richtig? Deshalb kommt mir die Art der Fragestellung ein wenig unpassend vor, wenn ich das sagen darf.«
»Gewiss, sie ist das Opfer. Deswegen ist es wichtig für uns, möglichst viel über sie zu erfahren«, entgegnete Mara gelassen.
»Sie sollten versuchen, mehr über den Täter zu erfahren, junge Dame«, kam es über seine Lippen, nicht einmal herablassend, sondern wieder eher traurig.
»Ich bin weder jung noch eine Dame …«
»Herr Degener«, schaltete sich Rosen ein, die Wangen gerötet. »Bitte glauben Sie uns, wir setzen alles daran, den Schuldigen zu finden.«
Degener erwiderte Rosens Blick, offenbar froh über dessen entschuldigenden Ton. »Missverstehen Sie mich nicht. Ich bin Ihnen dankbar für Ihren Einsatz. Es ist für mich einfach nur …« Abermals kämpfte er mit den Tränen. »… schwer zu akzeptieren, was Ellen zugestoßen ist.«
»Selbstverständlich ist es für Sie nicht leicht, das ist uns absolut klar«, sagte Rosen.
»Wenn Sie davon ausgehen, dass es ein Einbrecher war, der meine Gattin ermordet hat, werden Ihnen Informationen über Ellen kaum nützen. Das ist es, was ich lediglich meinte.« Erst jetzt wandte er sich wieder Mara zu. »Und ja, es mag sein, dass ich meine Frau oft allein gelassen habe und dass sie darunter gelitten hat, aber ich versichere Ihnen noch einmal, dass es auf unserem Planeten niemanden gibt, der Ellen den Tod gewünscht hat.«
»Das ist angekommen«, erwiderte Mara unverändert gelassen. »Und dennoch müssen wir …«
Diesmal war es der Klingelton ihres Handys, der sie aufhielt. »Entschuldigung«, murmelte sie und zog es aus der Jackeninnentasche. Sie drehte sich weg, um den Anruf entgegenzunehmen, während sie mit halbem Ohr mitbekam, dass Rosen das Gespräch mit Degener fortsetzte.
»Billinsky? Wo sind Sie?«, schnarrte ihr die Stimme ihres Chefs entgegen: Hauptkommissar Rainer Klimmt. Antipathie, Streit, Feindschaft. Es gab viele Begriffe, die für Maras Verhältnis zu ihm treffend gewesen waren, zumindest zu Beginn. Nach und nach jedoch hatte sich eine Art gegenseitiger Respekt zwischen ihnen gebildet.
Leise schilderte sie ihm, wo sie und Rosen sich befanden. Zwei Minuten unterhielten sie sich, nicht länger, danach sagte Mara zu Rosen: »Wir müssen los. Augenblicklich.«
Verdattert musterte sie ihr Kollege. »Wir sind mitten im Gespräch.«
»Tut uns leid, Herr Degener.« Maras Blick richtete sich auf den Geschäftsmann. »Falls wir noch Fragen haben sollten, werden wir uns erneut an Sie wenden.«
Damit verließ sie den Raum, gefolgt von Rosen, der noch rasche Worte des Dankes an Degener richtete.
Im Fahrstuhl, der lautlos nach unten fuhr, schüttelte Rosen vorwurfsvoll den Kopf, hielt die Lippen aber geschlossen.
»Na los, Rosen, was passt dir nicht? Raus mit der Sprache!«
»Die Ehefrau dieses Mannes ist umgebracht worden«, betonte er.
»Das weiß ich.«
»Ach? Es gelingt dir vortrefflich, das zu verbergen.«
»Was willst du mir mitteilen?«
»Was schon? Dass du auch mal ein bisschen einfühlsamer vorgehen könntest.«
»Dafür bist du zuständig.«
Die Fahrstuhlkabine öffnete sich, und Mara und Rosen betraten nebeneinander die Eingangshalle des Bürohauses.
»Billinsky, wir beide sollten dafür zuständig sein. Das sind wir unserem Job schuldig, finde ich. Und den Menschen, mit denen wir es in solchen Fällen zu tun haben.«