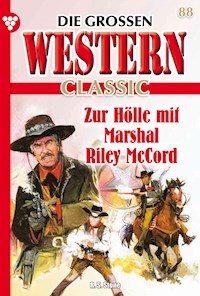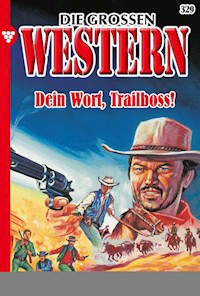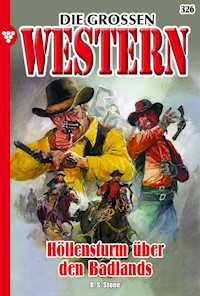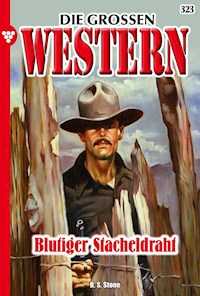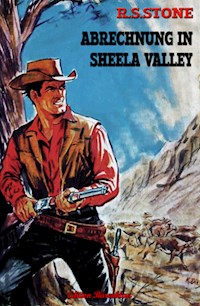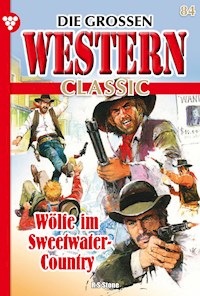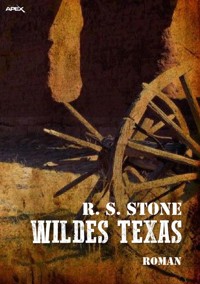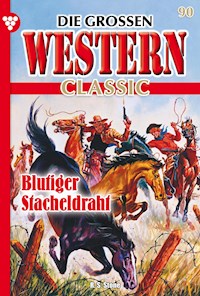
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Ben Wade sah durch das schmutzige Fenster hinaus in die Dunkelheit. Er zerbiss einen wilden Fluch auf den Lippen. Seine Rechte umspannte den 45er. Langsam legte sein Daumen den Abzugshahn zurück. Sie waren da. Zehn hartbeinige Reiter. In geschlossener Formation näherten sie sich der Weidehütte. Dann blieben sie stehen. Im sicheren Abstand zur Hütte, damit keine Revolverkugel sie erreichen konnte. Das nervöse Schnauben der Pferde und Klirren der Gebissketten drang unnatürlich laut an Bens Ohren. Einige der Reiter hielten Fackeln in den Händen. Dann drang die giftige Stimme laut zu ihm herüber: »Kommt da raus, ihr Ratten. Das Spiel ist aus. Es gibt keine Crescent-Ranch mehr. Kommt raus oder wir werden euch da drinnen ausräuchern.« Luke Pierce! Nur schemenhaft konnte Ben dessen hagere Gestalt des verhassten Mannes draußen im Sattel erkennen. Aber die schneidende Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen. Es war Luke Pierce. Sie hatten also gewonnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 90 –Blutiger Stacheldrahn
R. S. Stone
Ben Wade sah durch das schmutzige Fenster hinaus in die Dunkelheit. Er zerbiss einen wilden Fluch auf den Lippen. Seine Rechte umspannte den 45er. Langsam legte sein Daumen den Abzugshahn zurück.
Sie waren da.
Zehn hartbeinige Reiter.
In geschlossener Formation näherten sie sich der Weidehütte. Dann blieben sie stehen. Im sicheren Abstand zur Hütte, damit keine Revolverkugel sie erreichen konnte.
Das nervöse Schnauben der Pferde und Klirren der Gebissketten drang unnatürlich laut an Bens Ohren.
Einige der Reiter hielten Fackeln in den Händen.
Dann drang die giftige Stimme laut zu ihm herüber: »Kommt da raus, ihr Ratten. Das Spiel ist aus. Es gibt keine Crescent-Ranch mehr. Kommt raus oder wir werden euch da drinnen ausräuchern.«
Luke Pierce!
Nur schemenhaft konnte Ben dessen hagere Gestalt des verhassten Mannes draußen im Sattel erkennen. Aber die schneidende Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen. Es war Luke Pierce.
Sie hatten also gewonnen.
Ben warf einen Blick auf Tom Crown. Der lag auf dem schmutzigen Fußboden. Mit dem Kopf lehnte er an der Bretterwand und sah aus glasigen Augen zu seinem Partner auf.
»Hör zu, Ben. Es hat keinen Sinn mehr. Ich hab nicht mehr lange. Draußen im Hinterhof steht das Pferd. Lass mich hier liegen und …«
»Einen Dreck werde ich, Partner. Wir ziehen das hier gemeinsam durch.«
Tom Crown hustete. Ein dünner Blutfaden zog sich vom Mundwinkel bis zum Kinn herunter.
»Du Narr. Begreifst du es nicht? Wir haben das Spiel verloren. Pierce hat gewonnen. Verdammt, Ben, du bist der Einzige, der noch mit heiler Haut davonkommen kann. Mir steckt ’ne Kugel in der Lunge. Hab nur noch wenige Minuten. Aber ich kann diese Brut da draußen aufhalten. Für ’ne Weile. Nimm du das Pferd und reite. Hölle, Junge! Reite, solange du noch kannst und lass dieses verdammte Land hinter dir. Gib dem Gaul die Sporen und folge dem Nordstern, Cowboy.«
Ben schüttelte den Kopf.
Dennoch wusste er, dass Tom Crown die Wahrheit sagte. Sie hatten gemeinsam gekämpft und dabei verloren. Das war bitter. Aber so war’s nun mal. Und jetzt war Luke Pierce gekommen, um auch noch die letzten beiden Überlebenden der Crescent-Ranch zu holen.
Pierce, dieser verdammte Vormann der Bar X.
Die verdammte Dürre1 ist daran schuld. Yeah, damit fing alles an. Und der verfluchter Stacheldraht, dachte Ben düster, alles nur wegen achtzig Meilen Stacheldraht …
»Hau ab, zur Hölle. Was willst du denn? Etwa mit mir hier krepieren? Oh, Ben Wade, schleich dich durch die Hintertür. Oder soll ich dich etwa dorthin prügeln?« Tom Crown lächelte schwach bei seinen Worten. Das konnte Ben trotz der Dunkelheit in der muffigen Hütte deutlich erkennen. Nein, eigentlich war es kein Lächeln. Eher ein Grinsen. Das Grinsen eines harten und verwegenen Reiters, der bis zur letzten Stunde tapfer durchgehalten hatte. Trotz starker Schmerzen.
Dann drang wieder die hässliche Stimme von Luke Pierce zu ihnen in die finstere Weidehütte: »Ich geb euch noch zwei Minuten. Dann räuchern wir euch aus. Zwei Minuten! Hört ihr! Keine Sekunde länger!«
Ben Wade biss sich auf die Unterlippe, dass sie schmerzte. Er hörte seinen Partner röcheln. Noch hatte die Pierce-Mannschaft die Hütte nicht umstellt. Möglich, dass sie nicht wussten, dass es eine Hintertür gab. Und dass draußen das einzige Pferd stand, das ihnen, Tom und Ben, geblieben war.
Möglich …
Aber er sträubte sich, Tom allein zu lassen. Obwohl er wusste, dass sein Partner nicht mehr lange zu leben hatte.
Da nahm Tom Crown ihm die schwere Entscheidung ab. Mühsam richtete er sich auf. In beiden Händen seine Colts haltend, die Abzugshähne nach hinten gerissen. Ja, Tom wollte es riskieren. Nichts würde ihn aufhalten.
Sein Leben, sein noch kurzes Leben, für das des Partners.
»Tom. Leg dich wieder da hin und …«
Zwecklos.
Tom scherte sich einen Dreck um Ben Wades Flehen. Torkelnd erreichte er die Holztür. Sein Atem ging rasselnd. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten.
»Wir seh’n uns, Partner«, presste er zwischen den Zähnen hervor.
Dann wagte er es.
Sein gellender Schrei ging durch die Nacht: »Pierce! Du verdammter Hurensohn. Pass jetzt auf. Ich zeig dir was!«
Er stieß die Holztür auf und stürmte nach draußen. Dann krachten auch schon seine Colts.
Ben Wade machte einen Satz. Er hechtete zur Hintertür, trat sie auf und rannte ins Freie. Hinter ihm knallten die Schüsse, Männer schrien.
Das Pferd war lose angepflockt und stand unter einem Baum. Es legte den Kopf in seine Richtung. So, als hätte es darauf gewartet, dass er endlich kommen würde. Für einen kurzen Moment verharrte Ben in seiner Position. Er hielt seinen 45er im Anschlag. Seine Blicke schnellten nach links und rechts.
Nichts!
Seine Vermutung war also richtig. Hier hinten befand sich niemand von Luke Pierces Männern.
Sie wissen also nichts davon, dass es eine Hintertür gibt, drang es durch Bens Kopf.
Eine Welle der Erleichterung durchströmte Ben, als er auf das Pferd losstürmte. Er warf sich mit einem Satz in den Sattel. Ein heftiger Schenkeldruck, das Tier machte einen Satz und galoppierte durch die Dunkelheit davon.
Hinter Ben krachten immer noch die Schüsse. Dann war es plötzlich still. Er wusste, was das zu bedeuten hatte.
Sein verzweifelter Schrei hallte durch die Nacht. Während die Hufe des Braunen unter ihm raumgreifend über den Boden pflügten.
In der Ferne sah er den flackernden roten Schimmer vor sich zum dunklen Himmel steigen. Der Wind kam aus dieser Richtung. Er brachte unverkennbar den beißenden Geruch von Rauch herüber. Die Crescent-Ranch ging in diesen Augenblicken in hellen Flammen auf.
Hinter Ben blieb es noch immer ruhig. Das bedeutete, sie hatten noch nicht mit der Hetzjagd auf ihn begonnen.
Dennoch trieb er den Braunen unermüdlich an. In seinem Kopf gab es nur noch einen Gedanken: Weit, weit fort von hier.
Und so verließ Ben Wade in dieser Nacht Texas. Zurück blieben die schmerzhaften Erinnerungen an eine verlorene Sache. Und an den toten Freund.
*
Nun, Ben Wade konnte in jener Nacht Luke Pierce und dessen Männern entkommen. Er floh aus Texas und zog eine Zickzackfährte durch das Land. Ja, aus Ben Wade wurde ein Ruheloser, ein Staatenreiter. In den ersten Jahren verging kaum ein Tag, an dem er nicht sorgenvoll zurückgeblickt hatte. Doch es schien, als hätte man es aufgegeben, ihn zu verfolgen. Dennoch hielt er es nirgendwo lange aus.
»Folge dem Nordstern, Cowboy«, hatte Tom Crown in jener Nacht gesagt.
Ben Wade tat es.
Viele Jahre lang.
Eine Zeit lang folgte er dem Lauf des Missouri hinauf. So kam es, dass er im Frühling des Jahres 1888 die Grenze von Kansas nach Nebraska überschritt. Ein bestimmtes Ziel hatte er nicht. Das hatte er nie. Nebraska kannte er halt noch nicht, also zog es ihn dorthin.
Es führte eine Straße direkt zu dem Städtchen Falls City im Richardson-County. Aber die benutzte Ben nicht. Aus alter Gewohnheit schlug er den Weg über unwegsames Gelände ein, das aus zahllosen Felsformationen und Buschreihen bestand. Ben Wade war ein vorsichtiger Mann geworden, der die Einsamkeit vorzog.
Aber diese Entscheidung kostete seinem Pferd das Leben. Das Tier geriet mit dem rechten Vorderhuf in ein Erdloch und brach sich das Bein.
Ben Wade konnte nichts anderes tun. Er musste sein Tier erschießen. Mit losen Steinen deckte er den Leichnam des Braunen zu, der jahrelang sein einziger Begleiter gewesen war. Dann nahm er seinen Spencer-Karabiner in die Linke, schulterte sich die Satteltasche und lud den Sattel auf den Rücken.
Einige Zeit später marschierte er los.
*
Er war bestimmt noch keine fünf Meilen gelaufen.
Doch ihm kam es so vor, als wären es hundert gewesen. Sein Mund war ausgetrocknet und fühlte sich an wie mit Watte ausgestopft. Seine Füße schmerzten höllisch. Er hatte sich ein paar tüchtige Blasen gelaufen. Wie alle Reiter war auch Ben Wade ein Mann, der es gewohnt war, ständig im Sattel zu sitzen. Statt diesen auf seinem Rücken zu tragen.
Fußmärsche waren Ben verhasst. Aber er hatte keine Wahl.
Ben Wade war ein harter, zäher Bursche. Blond mit rauchgrauen Augen, etwas über mittelgroß, kräftig. Schmal in den Hüften, breit in den Schultern.
Trotzdem war er ziemlich erledigt, als er endlich auf die Quelle stieß. Die tauchte wie auf dem Nichts vor ihm auf und weckte neue Lebensgeister in ihm. Eine Quelle, wie es sie in diesem Land zahlreich gab und die unterirdisch mit Wasser gespeist wurden.
Ben ließ den schweren Texas-Sattel und seine Packtaschen von den Schultern in den Staub fallen. Ebenso seinen Spencer-Karabiner. Mehr torkelnd als gehend erreichte er die Quelle, auf deren Wasseroberfläche eine rötlich braune Alkalischicht lag. Es war wohl schon eine Zeit lang her, dass sich jemand an ihr versucht hatte. Das störte Ben Wade nicht. Mit einer einzigen Handbewegung wischte er die Alkalischicht beiseite. Er tauchte sein Gesicht ins Wasser und trank.
Als er nach einigen Minuten seinen höllischen Durst gestillt hatte, nahm er seinen Spencer-Karabiner auf und suchte sich ein schattiges Plätzchen zwischen den Felsen. Dort streckte er seine müden Knochen aus. Den Karabiner legte er griffbereit neben sich.
Die Füße schmerzten höllisch, Ben fragte sich, wie es nun weitergehen würde. Bis nach Falls City waren es nach seiner Schätzung noch zehn Meilen. Verdammte zehn Meilen ohne einen Gaul unterm Hintern. Wenn er dort ankommen sollte, würden seine Füße nur noch aus rohem Fleisch bestehen.
Höllisch rosige Aussichten, dachte er bitter.
Eine bleierne Müdigkeit überkam ihn, und er döste ein. Doch nicht lange. Der scharfe Knall einer Winchester schreckte ihn auf. Mühsam rappelte er sich hoch und langte sofort nach seinem Gewehr. Wieder krachte ein Schuss. Dann noch einer. Wer auch immer dieses jähe Feuerwerk veranstaltete, es befand sich in unmittelbarer Nähe. Ben pirschte sich in geduckter Haltung zwischen einigen Felsen und Büschen hindurch. Er fluchte dabei, als sich der Schmerz in seinen Füßen wieder bemerkbar machte.
Dann vergaß er seinen Schmerz.
Zwischen Felsgestein und Buschgestrüpp spähte er den Hang hinunter. Dort unten stand eine Abbott & Downing Postkutsche. Mitten auf der schmalen, holprigen Fahrbahn. Mit einem Sechsergespann vorweg. Die Tatsache hätte Ben Wade zum Entzücken bringen können.
Wenn da nicht die drei Hombres auf ihren Gäulen gewesen wären. Die hatten ihre Halstücher bis zur Nasenwurzel hochgezogen. Jeder des Trios hielt ein Gewehr im Anschlag. Einer von ihnen trug eine auffallende Weste. Die war schwarz-weiß gemustert.
Ein Überfall!
Der Bursche in der Mitte rief mit merkwürdig schrill klingender Stimme: »Raus aus der Kutsche. Alle Mann. Pronto! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und lasst ja die verdammten Hände oben!«
Aus der Kutsche kletterten nun einige Passagiere mit erhobenen Händen. Zuerst ein stämmiger Bursche in einem mausgrauen Anzug. Dem folgte eine Brünette. Die war mächtig hübsch. Das konnte Ben von seiner Position sehr gut erkennen. Ein hagerer Hombre im Priestergewand schob sich hinter der Schönen aus der Downing & Abbott. Den Schluss bildete ein schmächtiges Männlein, das aussah wie ein Handelsvertreter. Es hatte ein auffallend rotes Gesicht und schwitzte stark unter seinem Bowlerhut.
All diese Leute stellten sich der Reihe nach nebeneinander auf und stierten zu den drei maskierten Reitern.
Der Bandit mit seiner schwarz-weißen Weste hielt die beiden Fahrer in Schach, die oben auf dem Bock saßen. Die hatten ebenfalls die Arme gen Himmel gestreckt. Die anderen beiden konzentrierten sich auf die Passagiere.
Der mittlere Reiter, offensichtlich der Anführer des Trios, wies mit dem Lauf der Winchester auf den Mann im grauen Anzug.
»Du da! Vortreten. Alle anderen bleiben hübsch und brav stehen. Rührt euch ja nicht vom Fleck.«
Der Grauanzug machte keinerlei Anstalten, der barschen Aufforderung nachzukommen. Im Gegenteil. Er hob nur trotzig sein kantiges Kinn und sah den drei Hombres kampflustig entgegen.
Der hat keine Angst, entschied Ben Wade. Er nahm seinen Spencer-Karabiner in beide Hände und schob sich vorsichtig ein Stückchen weiter heran. Das maskierte Trio hatte ihn im Rücken, konnte ihn also nicht sehen. Aber auch die Passagiere hatten ihn da oben zwischen den Felsen und Büschen noch nicht entdeckt.
Wieder hörte Ben die schrille Stimme des Banditen: »Mister, wir wissen, dass du ’ne Menge Zaster bei dir trägst. Den wollen wir dir jetzt abnehmen. Also rück die Kohle raus. Dann lassen wir euch vielleicht am Leben.«
Der Mann im grauen Anzug schien ein ganz Harter zu sein. Die Worte des Banditen machten keinen Eindruck auf ihn. Im Gegenteil.
Ben verzog staunend den Mund, als er hörte: »Ich habe nicht einen Penny in der Tasche. Versucht euer Glück woanders. Und jetzt wollen wir den Spaß hier beenden und in Ruhe weiterfahren. Schert euch also zum Teufel!«
Donnerwetter, der Mann hatte Mut. Oder war er nur einfach dumm? Nein, wie ein Dummkopf sah er nicht aus. Aber seine Hartnäckigkeit machte die Banditen wild. Besonders den Kerl in der Mitte. Der Repetierhebel seiner Winchester sauste vor und zurück. Die Waffe machte einen kleinen Schwenker und zeigte genau auf den Kopf der Brünetten, die neben dem Grauanzug stand. Ihr Gesicht wurde weiß wie eine Wand.
»Ich blase deiner Tochter das Gehirn aus dem Schädel, wenn du nicht sofort das verfluchte Geld rausrückst. Ich mache ernst.«
Der Mann im grauen Anzug gab auf.
»Ich habe es in der Tasche. Die liegt noch in der Kutsche.«
»Herholen. Aber versuchst du ein krummes Ding, ist’s aus mit deiner Tochter.«
Ben hatte genug gesehen und gehört. Er erhob sich aus der Deckung, brachte seinen Spencer-Repetierer in Anschlag und rief: »Das reicht jetzt, Hombres! Lasst eure Gewehre fallen.«
Zuerst zuckten sie zusammen. Dann drehten sie sich in ihren Sätteln herum und starrten zu ihm hoch.
Aber die Überraschung hielt nur eine kurze Weile. Oha, ihre Augen drückten es deutlich aus. Sie blitzten tückisch zu Ben Wade hoch. Er war allein da oben. Sie waren zu dritt. Und gewiss keine Anfänger.
Sie wägten ihre Chancen ab. Dann wagten sie es. Was immer der Grauanzug in seiner Tasche hatte, sie wollten es unbedingt haben und waren bereit, eine Menge zu riskieren.
Doch sie wagten zu viel.
Der Mann in der Mitte warf jäh seinen Schecken herum, riss die Winchester hoch und feuerte sogleich. Doch er traf nicht. Das Geschoss sauste wirkungslos neben Ben Wade ins Gebüsch. Ben zog durch. Seine Kugel holte den Burschen aus dem Sattel. Noch ehe die beiden anderen einen Schuss abgeben konnten, katapultierte ein weiteres 50er Geschoss der Spencer den zweiten Banditen vom Pferd.
Der Dritte gab auf. Der mit seiner schwarz-weißen Weste. Er trat seinem Pferd brutal in die Weichen und preschte im Galopp davon. Ben schickte ihm zwei Kugeln hinterher. Aber der Bursche entkam.
*
Ben kletterte den Hang hinunter. Dabei kniff er die Lippen zusammen. Er spürte wieder die Schmerzen, die seine wundgelaufenen Füße bereiteten. Als er den Fahrweg betrat, näherte er sich schleppend der Kutsche und den Passagieren. Die sahen ihn alle staunend an.
Der Mann im grauen Anzug fand als Erster die Sprache wieder. Sein dröhnender Bariton schlug Ben Wade mit grollender Freude entgegen: »Mister, wo auch immer Sie gerade hergekommen sind: Sie schickt der Himmel. Genau im richtigen Augenblick. Verdammt, Sie sind mächtig fix da mit dem Gewehr. Alle Achtung.«
Ben nickte nur. Sein Interesse galt den beiden Burschen, die er gerade aus dem Sattel geschossen hatte. Sie lagen mit dem Gesicht im Staub und rührten sich nicht. Er drehte einen von ihnen mit der Stiefelspitze auf den Rücken. Es war derjenige, der zuerst geschossen hatte und von dem Ben vermutete, dass er der Anführer des Trios gewesen war. Starre, leere Augen stierten zum Himmel empor. Ben zog ihm das Halstuch vom Gesicht herunter. Das tat er auch bei dem anderen.
Beide Banditen waren tot.
Der Kutscher und dessen Begleitmann waren inzwischen vom Bock geklettert und traten heran und stierten in die verzerrten Gesichter der Toten.
Sie wechselten einen Blick miteinander.
»Kommen dir diese Visagen bekannt vor, Drew?«
Der hagere pferdegesichtige Kutscher Drew Padden kratzte sich sein langes Kinn.
»In letzter Zeit wimmelt’s in der Gegend nur so von Fremden. Seit die XIV-Ranch diese neue Besitzerin hat. Verdammt, die stellt ja alles ein, was irgendwie hartbeinig aussieht und mit ’nem Sechsschüsser umgehen kann. Aber die hier kommen mir unbekannt vor. An diese Galgenvogelgesichter könnte ich mich bestimmt erinnern.« Drew wandte sich an den Grauanzug. Der war inzwischen auch an die Leichen herangetreten und betrachtete intensiv ihre Gesichter. »Haben Sie diese Hombres schon mal gesehen, Mister Barrows?«
Barrows schüttelte den Kopf.
»Weder den einen noch den anderen.«
Er war ein mittelgroßer, stämmiger Mann. Mitte fünfzig. In den Jahren hatten sich hier und da leichte Fettpölsterchen angesetzt. Und der graue Anzug, den er trug, hätte nicht enger geschnitten sein dürfen. Er besaß ein kantiges Gesicht mit energischem Kinn mit zwei kühnen, rauchgrauen Augen. Die lagen unter buschigen, grau gewordenen Brauen verborgen. Sein fester Mund, etwas schmallippig unter dem eisgrauen Schnurrbart, verriet die Entschlossenheit eines Mannes, der gewohnt war, sich im Leben zu behaupten.