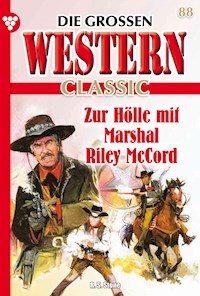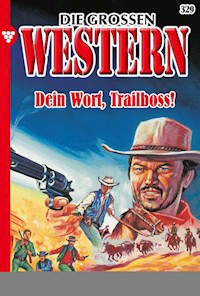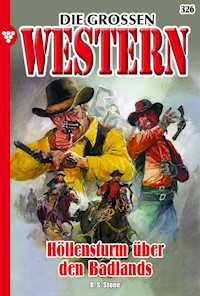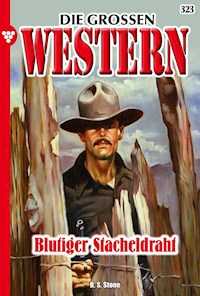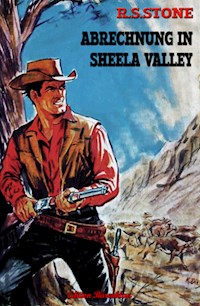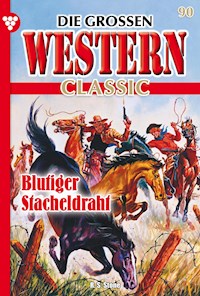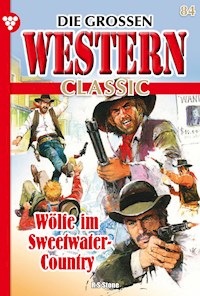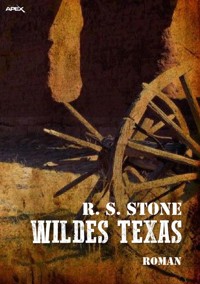
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach Ende des blutigen Bürgerkrieges zwischen Nord- und Südstaaten liegt Texas geschlagen am Boden. Unions-Truppen haben das Land besetzt, und es herrscht nach wie vor das Kriegsrecht. Wer sich zur Wehr setzt, wird gnadenlos verfolgt, verurteilt und eingesperrt. Hohe Steuern ruinieren zahlreiche Rancher und Farmer.
Auch Jedrow Nolan ist gegen Ende des Krieges nach Spanish Crossing zurückgekehrt und muss erkennen, dass die Ranch seiner Familie längst einen neuen Besitzer hat. Und die Frau, die er einst liebte, hat einen anderen geheiratet – Stuart Conroy, der sich auch die Nolan-Ranch unter den Nagel gerissen hat.
In dieser Notlage muss Jed Nolan handeln.
Gemeinsam mit einigen Gefährten beschließt er, Rinder zusammenzutreiben und dann mit der Herde auf den Trail nach New Orleans zu gehen. In Texas ist ein Rind nichts mehr wert – im fernen New Orleans hingegen schon.
Aber auf dem Weg dorthin lauern noch zahlreiche Gefahren auf Jed Nolan und seine Kameraden – und der Hass Stuart Conroys verfolgt ihn ebenfalls...
Dies ist der Auftakt eines ebenso spannenden wie epischen Western-Romans aus der Feder von R. S. Stone (TRAIL-LEGENDEN, SAN ANGELO COUNTRY).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
R. S. STONE
Wildes Texas
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
WILDES TEXAS
Erster Teil: GLÜHENDE EISEN
Zweiter Teil: DIE NOLAN-BRÜDER
Dritter Teil: DIE SAAT DES ZORNS
Das Buch
Nach Ende des blutigen Bürgerkrieges zwischen Nord- und Südstaaten liegt Texas geschlagen am Boden. Unions-Truppen haben das Land besetzt, und es herrscht nach wie vor das Kriegsrecht. Wer sich zur Wehr setzt, wird gnadenlos verfolgt, verurteilt und eingesperrt. Hohe Steuern ruinieren zahlreiche Rancher und Farmer.
Auch Jedrow Nolan ist gegen Ende des Krieges nach Spanish Crossing zurückgekehrt und muss erkennen, dass die Ranch seiner Familie längst einen neuen Besitzer hat. Und die Frau, die er einst liebte, hat einen anderen geheiratet – Stuart Conroy, der sich auch die Nolan-Ranch unter den Nagel gerissen hat.
In dieser Notlage muss Jed Nolan handeln.
Gemeinsam mit einigen Gefährten beschließt er, Rinder zusammenzutreiben und dann mit der Herde auf den Trail nach New Orleans zu gehen. In Texas ist ein Rind nichts mehr wert – im fernen New Orleans hingegen schon.
Aber auf dem Weg dorthin lauern noch zahlreiche Gefahren auf Jed Nolan und seine Kameraden – und der Hass Stuart Conroys verfolgt ihn ebenfalls...
Dies ist der Auftakt eines ebenso spannenden wie epischen Western-Romans aus der Feder von R. S. Stone (TRAIL-LEGENDEN, SAN ANGELO COUNTRY).
WILDES TEXAS
Erster Teil: GLÜHENDE EISEN
Erstes Kapitel
Jedrow Nolan sah mit ausdruckslosem Gesicht auf das Treiben der Main Street von Spanish Crossing. Müßiggänger und Heimkehrer des Krieges lungerten auf den Gehsteigen, Frachtwagen standen an den Straßenrändern und wurden be- und entladen. Menschengruppen hatten sich hier und da gebildet und in ihren Gesichtern spiegelten sich Resignation und Unzufriedenheit wider, die das gesamte Land in Texas dieser Zeit beherrschte.
Es war zur Mittagszeit und Nolan hatte seinen Texashut tief in die Stirn gezogen, um seine Augen vor dem gleißenden Sonnenlicht zu schützen, das von den Dächern der zahlreichen Adobebauten reflektiert wurde. Lässig lehnte seine hagere, hochgewachsene Gestalt mit den breiten Schultern und den schmalen Hüften eines Mannes, der die meiste Zeit seines Lebens im Sattel verbracht hatte, an einem verwitterten Stützpfeiler vor Ben Curwoods Store. In seinem rechten Mundwinkel klemmte eine dünne Zigarette, an der er ab und zu zog, ohne sie aus seinem schmallippigen Mund zu nehmen. Er inhalierte dann den Rauch tief ein und stieß ihn aus der Nase wieder aus.
Er trug die unverwechselbare Kleidung der Buschreiter von Süd-Texas. Über seinem grauen, verschlissenen Baumwollhemd trug er eine braune Wildlederweste. In seinem Patronengurt lugte der abgenutzte Griff eines .45er Colts heraus und seine langen Beine steckten in speckigen, abgetragenen Chaparajos aus schwerem Rohleder, auf denen das Fett von tausend Mahlzeiten glänzte. Ohne diese Chaparajos wäre jeder Reiter da draußen im Busch den mörderischen Stacheln der wild wuchernden Chaparrals, Stachelbirnen, Katzenklauen, Mesquite und dutzend anderer Pflanzen hilflos ausgeliefert.
Nolans Gesicht war durch die erbarmungslos harte Arbeit draußen im Busch hager geworden. Unter seinen rauchgrauen Augen und Wangenknochen lagen dunkle Schattenlöcher. Zahllose Lassonarben zeigten sich an seinen rauen, großen Händen, die nie etwas anderes gekannt hatten, als harte Arbeit.
»Wir sind fertig, Boss.«
Nolan wandte seinen Kopf Luis Santero zu, der plötzlich neben ihm auf dem staubigen Gehsteig stand und erwartungsvoll zu ihm aufsah. Dabei hatte er seine Hände zu Fäusten geballt in die Hüften gestemmt. Luis Santero war mindestens einen Kopf kleiner als Jed Nolan und wirkte wesentlich schmächtiger. Sein jugendliches Gesicht, das ein schmales, schwarzes Oberlippenbärtchen zierte, war von der Süd-Texassonne ebenfalls tiefbraun gefärbt. Zwei wachsame, helle Augen lugten unter seinem Sombrero hervor. Wer Luis Santero nicht kannte, hätte ihn unmöglich für einen der harten und zähen Burschen gehalten, der die meiste Zeit draußen im Buschland verbrachte und wild umherstreunende Rinder zusammentrieb. Es gab nur ganz wenige Männer, die sich auf diese Knochenarbeit verstanden. Und das waren Männer, die hier aufgewachsen waren und sich von frühen Kindesbeinen an das Leben in der Brasada vertraut gemacht hatten – eben Männer wie Jed Nolan und Luis Santero.
Jed Nolans tiefe, sonore Stimme drang an Santeros Ohren: »Fein, dann können wir ja aufbrechen, Amigo!«
Nolan sprach diesen Satz, ohne dabei seine dünne Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Der Mund des Mexikaners verzog sich enttäuscht nach unten.
»Boss, es ist verdammt heiß und die Kehlen sind trocken. Wir sollten doch wenigstens noch etwas trinken, bevor wir die Stadt verlassen.«
Nolan wandte den Blick nach hinten. Dort stand Chico Morales, Luis Santeros Vetter, und rieb sich erwartungsvoll die Hände. Er lehnte am Hinterrad des Chuckwagens, den sie eben mit frischem Proviant aus Curwoods Store beladen hatten. Nolan wandte sich Santero zu, nahm einen Zug aus der Zigarette und warf den Stummel dann auf den Bretterboden. Mit dem von Alkalistaub überzogenem Stiefel trat er sie aus und meinte: »All right, einen Drink, Jungs. Dann müssen wir zurück ins Camp. Wir haben noch vier Stunden Fahrt vor uns, bis wir es erreicht haben. Und die Männer da draußen haben nichts zu essen.«
Luis Santeros Mundwinkel zogen sich nach oben zu einem erfreuten Grinsen, das urplötzlich erstarb. Er sah an Nolan vorbei über die Main-Street und seine Hand legte sich plötzlich auf Nolans Schulter. Jed Nolan folgte dem Blick des Mexikaners und sah den schwarzen Zweispänner aus nördlicher Richtung in die Stadt fahren. Sofort pressten sich Nolans Lippen zusammen und sein Gesichtsausdruck verdüsterte sich. Unwillkürlich sank seine Rechte herab und berührte den Kolben seines .45ers. Er stieß sich vom Holzpfeiler ab und seine gesamte Haltung spannte sich. Neben ihm stieß Luis Santero den Atem geräuschvoll aus. Aber das nahm Jed Nolan nur unbewusst wahr. Sein steinerner Blick war auf den herannahenden Zweispänner gerichtet, in dem zwei Personen saßen, gefolgt von einer Reiterschar von ungefähr fünfzehn Mann.
Stuart Conroy saß majestätisch gerade auf dem Bock und sein Gesicht zeigte die typische Arroganz eines Mannes, der es gewohnt war, Macht auszuüben und Befehle zu erteilen. Er war wie immer elegant gekleidet und seine Finger, fest die Zügel des Gespanns haltend, steckten in schwarzen, ledernen Handschuhen. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen, randlosen Hut, der seinem Gesicht rundliche Züge verlieh. Neben Stuart Conroy saß June Walsh in einem weißen Kleid und einem passenden Hut, den sie keck schräg auf dem Kopf trug. Ihre langen, kastanienbraunen Haare fielen lose auf die Schultern herab. Sie hielt ihre Hände im Schoß gefaltet und als sie Jed Nolan vor dem Store stehen sah, biss sie sich unwillkürlich auf die Lippen. Nolan sah von Stuart zu June und bei ihr blieb sein Blick eine Zeitlang haften. Fast gebannt sah er ihr entgegen und dabei fiel ihm auf, dass sie zu einer wahren Schönheit herangereift war. Er konnte sich nicht dagegen wehren, den Blick von ihr zu nehmen. Etwas krampfte sich in ihm zusammen.
Nolan wusste nur zu gut, was dieser Aufmarsch bedeutete: es war der Hochzeitstag von Stuart Conroy und June Walsh.
June senkte ihre Augen unter seinem Blick, als der Zweispänner ihn passierte. Conroy hatte Jed Nolan nicht eines einzigen Blickes gewürdigt, obwohl Jed haargenau wusste, dass er ihn dort vor dem Store stehen gesehen hatte.
Eine unbändige Wut keimte in ihm auf und am liebsten hätte er seinem Ärger Luft gemacht, indem er Conroy vom Bock des Zweispänners geholt hätte, um ihn in den Staub der Main-Street zu treten.
In den meisten Gesichtern der Reiter, die dem Zweispänner folgten, lag ein hämischer Ausdruck, als sie Nolan und Santero passierten.
Unter ihnen waren Whitey Albrigt, Les Pandero, Stagg Ogrum, Leach Van Allen und Conroys Verwalter Phil Jordan – Nolan kannte sie kaum, aber ihre Namen hatten sich wie Säure in ihn hineingefressen. Es waren ehemalige Yankee-Soldaten, die sich jeder vor dem Krieg als Revolvermänner einen Namen gemacht hatten und nun im Dienste von Stuart Conroy standen.
Diese verdammte Yankee-Brut, dachte Nolan bitter. Sie fielen wie Heuschrecken in Texas ein und bluteten das ohnehin schon vom Krieg schwer getroffene Land bis zum Letzten aus: Beutelschneider, Spekulanten und Landräuber – Landräuber wie Stuart Conroy, dem es gelang mit Hilfe der militärischen Herrschaft der Unionssoldaten sich das Nolan-Anwesen anzueignen, das während des Krieges herrenlos war.
Jeds Eltern waren tot. Big Dan starb wenige Monate vor Kriegsausbruch und Myra im Jahr 1864, ein Jahr vor Kriegsende. Das hatte Jed durch Zufall erfahren, als er in einem Lazarett eine Verwundung auskurierte, die ihm beinahe das rechte Bein gekostet hätte. Jeds Brüder Amos, Tom und Johnny waren nacheinander ebenfalls in den Krieg gezogen. Von ihnen hatte Jed bis zum heutigen Tag nichts mehr gehört.
Als Nolan vor etwa einem Dreivierteljahr aus der Südstaatenarmee entlassen wurde, fand er die Ranch, die sein Vater Big Dan lange vor dem Krieg gegründet hatte, mit Fremden besetzt vor und Stuart Conroy hatte ihm noch ins Gesicht gelacht und ihn der Ranch verwiesen. Es war der Piratenstreich eines Mannes, der aus dem Norden kam, viel Geld mitbrachte und es sich in Texas nun auf der Nolan-Ranch gemütlich machte.
Mit Hilfe der Armee ließ sich das machen.
Viele texanische Rancher wurden durch die Besatzungsmächte enteignet oder mussten derart hohe Steuern aufbringen, dass sie freiwillig aufgaben. Das war für Jed Nolan ein bitterer Tag, dessen Beigeschmack immer noch auf der Zunge lag. Rechtlich ließ sich da nichts machen, zumal die Verwaltung und Behörden in der Hand der Unionstruppen lagen. Dan Nolan hatte seinen Besitz nicht eintragen lassen, folglich hatte Jed also keinen Anspruch auf den Besitz. So wurde ihm die Sache erklärt und damit musste er sich nun einmal abfinden.
Umso härter traf es ihn, als er einige Tage später erfuhr, dass sich June Walsh mit Stuart Conroy verlobt hatte. Seit diesem Tag keimte ein unüberwindbarer Hass in Jed Nolan. Und er hatte sich geschworen, die Ranch wiederzuholen.
Stuart Conroy thronte wie ein König auf der Nolan Ranch und hatte sich inzwischen eine unumstrittene Machtposition um Spanish Crossing aufgebaut. Das machte die Sache für Jed Nolan schwierig. Er besaß zwar die unbedingte Eigenschaft eines Kämpfers – aber er hatte kein Geld.
So wie die meisten Menschen in diesem Land.
Und so blieb ihm bis zum jüngsten Tag nichts anderes übrig, als hart zu arbeiten, um seine Ziele, die er sich gesteckt hatte, zu verfolgen.
Eines Tages, dachte er bitter, eines Tages...
Nolan ballte seine Fäuste zusammen, so dass die Knöchel weiß wurden. Er hatte die Lippen fest aufeinandergepresst und wie aus weiter Ferne hörte er Luis Santero sagen: »Boss! Dieser Hombre macht es wirklich wahr! Noch ist es Zeit. Noch kannst du June...«
Nolan schüttelte den Kopf.
»Nein, Luis, mein Freund«, sagte er rau, »es ist ihre Entscheidung und die ist zu akzeptieren.«
Das war endgültig. Keinem der beiden Männer, am wenigsten Nolan, passte diese unumwindbare Tatsache. Dennoch ließ sich nicht daran rütteln.
Luis Santero sah zu seinen Boss hoch und schüttelte leicht den Kopf.
»Er stiehlt dein Land und nimmt dein Mädchen. Was soll noch alles geschehen, Boss?«
Nolan zog seinen ledernen Tabaksbeutel aus der Hemdbrusttasche und drehte sich gemächlich eine neue Zigarette. Er entfachte ein Streichholz am Holzpfeiler und hielt es mit der hohlen Hand an die Zigarette, bis diese aufglomm. Dann warf er das Streichholz achtlos auf den Boden, wo es erlosch.
Nolan legte Santero die Hand auf die Schulter. »Du weißt, weshalb wir uns die Mühe machen, diese verdammten Rinder aus dem Busch zusammenzutreiben, nicht wahr?«
Luis nickte. »Es ist ein langer und beschwerlicher Weg, um sich etwas aufzubauen, Boss. Unterdessen demütigt Conroy dich immer weiter. Was muss ein Mann denn noch ertragen? Wann werden wir diesen üblen Hombre in den Staub treten? Ihn und seine Mannschaft von Yankee-Revolverschwingern?«
»Der Tag wird kommen, Freund.«
Der Zweispänner hatte inzwischen direkt vor der alten Missionskirche gehalten, ebenso die Reiter. Das Gebäude war vor etwa hundert Jahren von den Spaniern erbaut worden und bestand – so wie die meisten Häuser dieser Stadt auch – aus rotem Adobelehm.
Nolan sah, dass viele Leute ihn beobachteten, gespannt darauf, was er unternehmen würde. Die Menschen, die in Spanish Crossing lebten, hassten genauso wie er die Yankees, aber keiner konnte etwas unternehmen. Der Krieg war für den Süden verloren. Die Texaner hatten sich zwar bis zum bitteren Ende gewehrt, aber auch das letzte, verzweifelte Aufbäumen von Palomito Hill konnte nichts daran ändern. Es war die letzte Schlacht des Krieges, die nahe der mexikanischen Grenze gefochten worden war.
Die laute Stimme Stuart Conroys drang über die Main-Street: »Hört her, ihr Leute aus Spanish Crossing! Heute ist ein ganz besonderer Tag! Miss June Walsh und ich werden heute heiraten. Es ist ein ganz besonderer Tag – für uns beide. Ihr seid alle eingeladen. Nach der Trauung wird es im Chronicle ein Fest geben. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Esst und trinkt auf meine Kosten!«
Santero wandte sich an Nolan: »Er hat Mut dieser Gringo, das muss man ihm lassen. Er traut sich viel. Glaubt er denn, dass die Leute diese Einladung annehmen?«
Nolan zuckte mit den Schultern. »Wenn es um freie Kost und Getränke geht, dann vergessen viele Menschen für einen Augenblick ihren Hass.«
»Die Menschen haben kein Rückgrat, Boss.«
Nolan antwortete nicht. Er sah stumm zu June herüber, die in ihrem strahlend weißen Hochzeitskleid neben Stuart Conroy vor der alten Mission stand. Ihr Gesicht wirkte ausdruckslos und Nolan fragte sich in diesem Augenblick, ob eine Frau an ihrem Hochzeitstag nicht glücklicher aussehen sollte. Sie lächelte. Aber dieses Lächeln erreichte ihre Augen nicht..
Inzwischen hatten sich viele Menschen vor der alten Mission versammelt. In vielen Gesichtern konnte Nolan den Hass auf Stuart Conroy erkennen. Für sie verkörperte dieser Mann all das, was zu ihrer augenblicklich schlechten Lage dazugehörte. Nolan wusste, dass es für June schwer war und noch werden würde. Sie war hier im Land geboren und hatte durch ihre Bindung mit Conroy die Menschen und auch ihr Land verraten – so sah man es an. Und auch Jed Nolan konnte nicht umhin, dem beizustimmen, obgleich er eine tiefe Zuneigung für das Walsh-Mädchen empfunden hatte. Das Walsh-Anwesen grenzte einige Meilen südlich an die Nolan-Ranch, einst ebenfalls stolz und reich an großen Baumwollfeldern.
Reverend Algernon Nightingale bahnte sich einen Weg durch die Menschentraube und schritt auf das Brautpaar zu. In wenigen Augenblicken würde in der alten Missionskirche die Trauung stattfinden und June Walsh würde als Mrs. Conroy die Kirche wieder verlassen. Zusammen mit dem Mann, den Jed Nolan abgrundtief hasste.
Diese Tatsache nagte an Jed und fraß sich wie eine Säure durch seinen Körper. Und dennoch: June hatte ihre Wahl getroffen.
Nolan wandte sich Santero zu. »Kommt, Jungs, wir trinken einen Whisky. Hab nen verdammt bitteren Geschmack auf der Zunge.«
Ein flüchtiges Grinsen huschte über Santeros jugendliches Gesicht. Chico Morales stieß sich vom Wagenrad des Chuckwagens ab und schlenderte lässig auf die beiden Männer zu. Er kickte dabei einen kleinen Stein über die Straße. Gemeinsam schritten sie über die Main-Street in Richtung des Opera-Saloons, der in südlicher Richtung in einer kleinen Nebengasse lag. Ein kleines, unauffälliges Etablissement, das von Ma Leona geführt wurde und wohin sich kein Yankee sich verirren würde. Der Opera-Saloon galt insgeheim als Treffpunkt der vielen Kriegsheimkehrer und Männer, die unter sich sein wollten.
»Nolan!«
Nolan verhielt inmitten der Bewegung und wandte sich um. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen ein grauhaariger Mann und eine zierliche Frau vor dem Chronicle, einem dreistöckigen Gebäude, das Charles Blaisdell gehörte. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bauten bestand das Restaurant und gleichzeitig als Hotel dienende Haus komplett aus massivem Holz, welches durchgehend mit roter Farbe gestrichen war. Die Aufschrift auf einem prunkvollem Schild bestand aus goldfarbenen Buchstaben.. Über der dritten Etage war eine falsche Fassade angebracht, so dass dieses Gebäude einen noch größeren Anschein erweckte, als es ohnehin schon hatte.
Nolan erkannte den Grauhaarigen, der verlegen zu ihm herübersah und dabei nervös an den Rockaufschlägen seines schwarzen Anzuges zupfte.
»Hallo, Mort«, grüßte Nolan kühl, sah zu der Frau und lüftete den Hut. »Miss Walsh.«
Die Frau nickte Nolan stumm zu, während sie dicht hinter dem Grauhaarigen stehenblieb. Mortimer Walsh räusperte sich und sagte: »Auf ein Wort, Nolan.«
Mort Walsh zupfte verlegen an den Rockaufschlägen seines schwarzen Anzuges und ging zögernd auf Nolan zu. Jed erkannte das nervöse Flackern in den blassen Augen und er sah noch etwas: Mortimer Walsh war über Jahre gealtert. War er einst ein vitaler und vor Kraft strotzender Mann gewesen, so wirkte er in diesem Augenblick eingefallen. Die Jahre waren auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Tiefe Furchen hatten sich in sein faltenreiches Gesicht gegraben, tiefe, dunkle Ringe lagen unter seinen Augen verborgen und gaben dem Mann ein kränkliches Aussehen.
Gwyn Walsh blieb drüber vor dem Chronicle stehen. Unentwegt sah sie zu dem hochgewachsenen Jed Nolan herüber. Ihre Augen lagen im Schatten ihres Hutes verborgen, so dass Jed ihren Blick nicht erkennen konnte.
Mort Walsh räusperte sich und sagte mit spröder Stimme: »Es ist viel geschehen, Jed. Und vieles davon war nicht gut. June heiratet heute, wie du sicherlich weißt. Gwyn und ich sind bereits gestern angereist.«
Er machte eine Pause und wartete, dass Nolan etwas sagen würde. Doch der blieb stumm. Walsh holte tief Luft und sagte dann: »Was wirst du unternehmen, Nolan? Ich will, dass es zwischen uns keine Missverständnisse gibt.«
Nolan schüttelte leicht den Kopf. Er hatte beide Hände zu Fäusten geballt in die Hüften gestützt und sah dem Vater von June geradewegs in die Augen.
»Wir beide sind all right, Mort. Du hast dir einen reichen Schwiegersohn ins Haus geholt und wahrscheinlich denkst du, dass damit deine Ranch gerettet ist. Deine Sache, Mort. Damit habe ich nichts zu schaffen. Und dass June heute heiratet ist vollkommen ihre Entscheidung. Ich muss es akzeptieren.«
Mort Walsh nickte leicht. Doch bei Jed Nolans folgenden Worten zuckte er etwas zusammen:
»Was deinen Schwiegersohn betrifft, Mort, so kann ich für nichts garantieren. Er sitzt auf Eigentum, was ihm nicht gehört. Er sitzt auf der Nolan-Ranch. Und zur Hölle, da wird er nicht mehr lange sitzen bleiben. Die Ranch gehört ihm nicht, auch wenn die verdammten Yankees glauben können, dass ich es mir gefallen lasse, einfach so enteignet zu werden. Ich werde mir die Ranch zurückholen, Mort Walsh, und zwar mit jedem Millimeter, der dazu gehört. Und das schreibe dir hinter die Ohren: Ich werde keine Rücksicht auf Stuart Conroy nehmen. Weder auf ihn, noch auf irgendjemand anderen, der sich mir dabei in den Weg stellten sollte.«
Während er sprach, drangen Jed Nolans Worte laut zu Mort Walsh herüber.
Etwas leiser sagte Nolan: »Ebenso wenig wie auf June, wenn der Tag kommen wird, an dem die Nolan-Ranch wieder zum rechtmäßigen Besitzer gelangt.«
Mort Walsh schluckte schwer und sein Gesicht nahm eine wächserne Farbe an. Er räusperte sich und brachte mühsam hervor: »Mein Gott, Jed Nolan! Es ist schon so viel gekämpft worden und zu viel Blut geflossen. Du wirst alleine nicht gegen Stuart Conroy ankommen können. Wähle den Weg der Vernunft und...«
»Du meinst, lieber mit den Wölfen heulen, als untergehen?« Nolan lachte rau auf. »Nein, Mort! Das mag vielleicht auf dich zutreffen. Du hast dem Teufel deine Seele verkauft und wahrscheinlich einer Hochzeit mit June und Conroy nur zugestimmt, damit er dich in Ruhe lässt. Der Mann ist gierig und es ist bekannt, dass er auch die Fühler nach deiner Ranch ausgestreckt hast. Gratuliere, Mort! Aber auf einen Nolan trifft das nicht zu. Niemals. Conroy mag zur Stunde noch die Oberhand haben. Aber ein Nolan lässt sich nicht von seinem Land vertreiben – schon gar nicht mit solch üblen Tricks. Schade, Mort, ich dachte, du hättest meinen Vater besser gekannt, denn sonst wüsstest du, dass Big Dan das gleiche gedacht und gesagt hätte. Und ich bin Big Dans ältester Sohn. Vergiss das nicht.«
»Ich will keinen Ärger«, antwortete Mort Walsh lahm und Jed Nolan kam es im Augenblick so vor, als hätte dieser einst so vitale Mann auch den Rest seines Stolzes verloren. Mort Walsh war nur noch ein Schatten seiner selbst und er tat Nolan leid. Trotzdem klangen Jeds Worte hart, als er sagte: »Dann stell dich mir nicht in den Weg.«
»Du hast deinen Standpunkt klar dargelegt, Jed Nolan«, antwortete Mort Walsh und straffe seine Schultern zurück.
»Geh zur Hochzeit, Mort und lass dir weiter Sand in die Augen streuen.«
Jed Nolan wandte sich abrupt ab und ließ Mortimer Walsh einfach stehen. Er ging an Luis Santero und Chico Morales vorbei und deutete mit einem energischen Kopfnicken, ihm zu folgen, was sie dann auch stumm taten.
Zweites Kapitel
Vom Fenster seines Büros sah Charles Blaisdell hinunter auf die Straße. Zwischen seinen fleischigen Lippen klemmte eine lange, dünne Zigarre und in seinem Gesicht, das von einem rabenschwarzen Bart umrahmt war, zeigte sich ein zufriedener Ausdruck ab. Er rieb sich die Hände, paffte ein paar Züge und sagte: »Ist ein schwarzer Tag für Jed Nolan. Conroy drückt ihm mächtig seinen Stempel auf.«
»Und das freut dich sehr, nicht wahr, Charley?« Lilly Gant stand hinter ihm. Ihre schmalen Finger massierten seine Schulterblätter. Ohne den Blick vom Fenster zu nehmen, meinte Blaisdell:
»Natürlich, mein Täubchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das erfreut.«
»Du hasst diesen Nolan, nicht wahr?«
»Nicht nur ihn – die ganze, verdammte Nolan-Sippe. Ich hatte gehofft, der Krieg hätte sie allesamt ausgelöscht, diese Brut. Aber Jed Nolan ist zurückgekommen. Er ist zäher, als ich dachte.«
Ein grimmiger Ausdruck erschien in seinem Gesicht. »Aber er steht jetzt ganz alleine und gegen Conroy ist er machtlos. Der wird ihn an die Wand drücken, sollte er irgendetwas unternehmen.?«
»Du meinst, dass er das tun wird, Charley?«, fragte Lilly spitz. »Bislang hat er doch noch keinen Finger gerührt, um etwas zu unternehmen.«
Jetzt erst wandte sich Blaisdell vom Fenster ab und sah sie an.
»Honey«, sagte er und strich über ihr feuerrotes Haar, »du kennst die Nolans nicht, und du kennst erst recht Jed Nolan nicht. Glaube mir, der wird sich das nie und nimmer gefallen lassen, dass ihm jemand sein Eigentum wegnimmt. Der brütet etwas aus, sei dir dessen sicher.«
»Meinst du mit Eigentum die Ranch – oder diese June Walsh?«
Ein lauerndes Lächeln umspielte Lillys rot angemalte Lippen. »Sowohl das eine, als auch das andere. Aber das Walsh-Mädchen hält es eher mit der Gewinner-, statt der Verliererseite.«
»Ich kann diese June Walsh irgendwie verstehen«, sagte Lilly. Sie wandte sich von Blaisdell ab und ging mit hüftschwingenden Bewegungen hinüber zu dem Glastisch, auf dem mehrere Flaschen und einige Gläser standen, wobei der Saum ihres enganliegenden, trägerlosen Samtkleides raschelte. Blaisdell beobachtete dabei jede ihrer graziösen Bewegungen. Lilly war eines der höchstbezahltesten Saloonmädchen und Blaisdell hatte sie für sich persönlich auserkoren, um ihm das Leben etwas mehr zu versüßen. Anfänglich hielt er sie für naiv, gestand sich von Zeit zu Zeit allerdings immer mehr ein, dass sie über einen messerscharfen Verstand verfügte. Das war etwas, was ihn verunsicherte, aber auch ein gewisses Interesse an ihr steigern ließ. Sie verstand es ausgezeichnet, die Männer um ihre Finger zu wickeln. Zudem war sie außergewöhnlich hübsch und diese Kombination war natürlich gut für das Geschäft.
»Dieser Stuart Conroy ist ein reicher und einflussreicher Mann, Charley. Er hat viel Geld und ist dabei, sich sehr zu vergrößern..«
Lilly sah mit listigen Augen zu Blaisdell herüber, der am Fensterrahmen stand und die Arme ineinander verschränkt hielt. Sie war sich seiner gierigen Blicke bewusst, die er ihr zusandte, während sie sich ein Glas nahm, es spielerisch in den Fingern drehte, um es dann mit Whisky zu füllen. Bei ihren Worten zeigte sich eine Falte auf seiner Stirn und er fragte unvermittelt: »Wie meinst du das?«
»Mister Stuart Conroy ist ein sehr ehrgeiziger und auch gefährlicher Mann, Charley. Wie stehst du zu ihm?«
Sie füllte ein zweites Glas, wobei ihre listigen Augen auf ihn gerichtet waren.
»Ich koche mein eigenes Süppchen, Honey«, antwortete Blaisdell. »Das solltest du doch längst gemerkt haben.«
Mit schwingenden Hüften ging sie auf ihn zu und reichte ihm das halbgefüllte Whiskyglas. Er nahm es ihr aus den Händen, nahm einen Schluck und stellte das Glas dann auf die Fensterbank, ohne den Blick von ihr abzuwenden. Lilly hatte ihre roten Lippen halb geöffnet und sah zu ihm empor. Sie war eine verführerische Frau, der sich kaum ein Mann entziehen konnte. Und sie war sich ihrer Wirkung vollkommen bewusst. Blaisdell umfasste ihre nackten Schultern. Seine Lippen formten sich zu einem seltsamen Grinsen, während er sie ansah. Plötzlich stieß er sie von sich weg. Das Grinsen erlosch und der Ausdruck seiner Augen verdunkelte sich.
»Du stellst zu viele komische Fragen, mein Täubchen«, sagte er rau. »Was bezweckst du damit?«
Unschuldig hoben und senkten sich ihre nackten Schultern.
»Ich weiß nicht, was du meinst, Charley.«
Er machte einen langen Schritt auf sie zu. Seine Hand presste sich um ihre Wangen. »Du denkst zu viel, Honey«, zischte er. »Das gefällt mir nicht.«
»Ich habe Augen im Kopf, Charles – das ist alles«, sagte sie. Plötzlich war ihr Gesicht eine ausdruckslose Maske. »Du tust mir weh, Charley.«
»Ich bin der Boss«, sagte er und sein rechtes Auge zuckte nervös. Ein Zeichen dafür, dass Charles Blaisdells Jähzorn aufflammte. Lilly hatte es schon einige Male bei ihm beobachten können und wusste, dass dieser Mann dann sehr gefährlich werden konnte. Sein Griff um ihre Wangen löste sich und er ließ den Arm sinken.
»Ich bin der Boss«, wiederholte er, »vergiss das nicht. Vergiss es niemals.« Er machte eine abweisende Handbewegung. »Geh jetzt. Lass mich allein.«
Lilly fuhr sich über ihre Wangen, an denen sich zwei rote Druckstellen gebildet hatten. Ohne ein Wort zu sagen, wandte sie sich ab und ging zur Tür.
»Warte.«
Sie drehte sich um. Ihre Hand, die sie bereits auf die Türklinke gelegt hatte, fiel lose herab.
»Sage Brick Wilson, dass er zu mir ins Büro kommen soll.« Sie nickte leicht und verließ das Büro. Für einige Augenblicke starrte Blaisdell auf die Tür, wandte sich dann abrupt ab und ergriff sein Whiskyglas. Er kippte den Drink in einem Zug und knallte das Glas auf die Fensterbank. Das Flackern in seinem Auge ließ nach und er spürte die warme Wirkung des Alkohols in seinem Körper. Lilly hatte mit ihrer Frage vorhin einen wunden Punkt getroffen, und er wusste haargenau, dass sie es absichtlich tat. Sie war berechnend und spielte mit dem Feuer. Jedoch war Charles Blaisdell nicht der Mann, der mit sich spielen ließ.
»Ich bin der Boss«, sagte er erneut und warf wieder einen Blick aus dem Fenster hinunter auf die Main-Street, über die gerade in diesem Augenblick ein Trupp Soldaten geritten kam.
Zehn der elf Reiter waren Unionssoldaten. Sie trugen blaue, gelbgefütterte Umhänge über ihren Uniformen. Ihre schweren Kavalleriesäbel waren am Sattelfutter festgeschnallt. Ihre müden Pferde waren über und über mit einer rötlichen Staubschicht bedeckt, die auch an den Uniformen der Soldaten haftete.
Auf einem abgehetzten Pferd saß inmitten der Kavalkade ein Reiter, dem die Hände an das Sattelhorn gefesselt waren. Der Reiter hatte mutlos seinen Kopf gesenkt, hellbraunes Haar hing ihm wirr in die Stirn. Er trug eine schmutzige, an den Ärmeln gerissene, graue Jacke und eine graue Reithose mit gelben Streifen.
Jed Nolan, der gerade im Begriff stand, sich in den Sattel seines Braunen zu schwingen, zog den Fuß wieder aus dem Steigbügel und beobachtete mit argwöhnischen Blicken die Kavalkade über die Main-Street reiten. Seine Hände umschlossen den Revolvergurt und seine Lippen pressten sich unweigerlich zusammen. Der Bursche in der verschlissenen, grauen Uniform hob für einen Augenblick den Kopf und Nolan sah den blutverkrusteten Streifen über der Stirn des Mannes. Unter dem Jochbein seines scharfgeschnittenen Gesichtes zeichnete sich eine bläuliche Verfärbung ab.
Auch Luis Santero glitt aus dem Sattel und blieb neben Nolan stehen. Ein grunzender Laut aus seiner Kehle gab zu verstehen, dass auch er die Misshandlungen im Gesicht des Reiters gesehen hatte. Chico Morales nahm seinen Fuß vom Tritt des Chuckwagens und stierte gebannt in die Richtung der Soldaten, die vor dem Stadtgefängnis ihre Pferde zum Stehen brachten. Das Stadtgefängnis war zusammen mit dem Büro des hiesigen Marshals in einem gedrungenen, aus roten Adobeziegeln erbauten Gebäude mit vergitterten Fenstern untergebracht. Von allen Seiten zeigten sich Schaulustige. Es waren Menschen, die kein Interesse an der in der alten Militärmission abgehaltenen Trauung hegten.
Neugier und Hass vermischten sich in den einzelnen Gesichtern. Den Soldaten entging nicht die Welle des Hasses, die ihnen in diesem Augenblick entgegenschlug. Sie hielten ihre Hände nahe an den Waffen. Einer der Reiter – ein bulliger Kerl mit dem Rangabzeichen eines Lieutenants – glitt schwerfällig aus dem Sattel. Er stampfte ein paarmal auf den Boden auf, um die Steifheit seiner Glieder zu vertreiben. Dabei wanderten seine Augen immer wieder in drohender Wachsamkeit nach links und rechts. Seine Stiefel polterten schwerfällig auf den Planken des Gehsteigs, als er sich auf das Marshal-Büro zubewegte. Ohne vorher anzuklopfen, drückte er die Türklinke nach unten und wollte mit dem Schwung, den er innehatte, die Tür nach innen aufstoßen. Doch er prallte zurück. Die Tür war verschlossen. Der Lieutenant stieß einen wilden Fluch aus und hämmerte dann mit der Faust energisch gegen die Tür. Dabei brüllte er: »Marshal! Machen Sie die verdammte Tür auf. Wir haben hier einen Gefangenen, der morgen nach Huntsville gebracht werden soll.«
Aus dem Inneren des Gebäudes kam keine Reaktion. Der Lieutenant wartete einen Augenblick, dann schlug er erneut ungeduldig gegen die Tür.
»Aufmachen!«, brüllte er. »Sitzen Sie auf Ihren Ohren, verdammt?«
Als immer noch keine Reaktion kam, erkannte der bullige Lieutenant endlich, dass das Büro nicht besetzt war. Sein massiger Körper vollzog eine Drehung und seine Blicke glitten über die vielen Schaulustigen auf dem Gehsteig gegenüber.
»Habt ihr in diesem verdammten Nest keinen Marshal?« brüllte er ihnen entgegen. »Wo steckt der Kerl. Wir haben hier einen Gefangenen, der für diese Nacht ins Gefängnis gesteckt werden soll.«
Der Lieutenant nahm seine blaue Mütze vom Kopf, hielt sie in der Linken und wischte sich mit dem Ärmel seiner staubigen Uniform den Schweiß von der Stirn. Seine Rechte ruhte nahe seiner schwarzen Pistolentasche, die geöffnet war und aus der der Griff eines.36er Navy-Colts ragte. Er stülpte die Mütze auf den Kopf, stemmte die Hände in die Hüften und sah drohenden Blickes in die Menschenmenge. Eine schweigende, feindselige Atmosphäre schlug ihm entgegen. Sie war zum Greifen nahe, aber dennoch schien sie wirkungslos von dem bulligen Lieutenant vor dem Office abzuprallen.
Kein Mensch war bereit, Auskunft zu geben.
Jedrow Nolan wechselte einen kurzen Blick mit Luis Santero und sah dann flüchtig zu Chico Morales herüber, der breitbeinig vor dem Chuckwagen stand. Die Soldaten saßen gespannt auf ihren abgekämpften Pferden und der Lieutenant vor dem Marshal-Office stehend, hatte immer noch seine massigen Fäuste in die Hüften gestemmt. Er hatte ein brutales Gesicht, das jetzt vor Zorn und hilfloser Wut dunkelrot angelaufen war. Die feindselige Stimmung lastete über Spanish-Crossing und glich einem Pulverfass. Die Soldaten wirkten übermüdet und gereizt und Nolan spürte, dass ein Funke genügen würde, um den Ansturm der schweigenden Rebellion gewaltsam zu durchbrechen.
Der Gefangene in der grauen Uniform hatte sein Haupt erhoben. Ein seltsames Grinsen umspielte seine Lippen. Die hasserfüllten Augen wanderten zu dem Lieutenant herüber. Unwillkürlich zog er an den Fesseln, die tief in seine Handgelenke schnitten. Dann glitt der Blick seiner blutunterlaufenen Augen durch die Menge und es schien, als wäge er in diesem Augenblick all seine Chancen ab. Dennoch war eine Flucht unmöglich. Er war eingekeilt zwischen den Unionssoldaten, die ihn beim geringsten Fluchtversuch sofort aus dem Sattel geschossen hätten.
Nolan sah, wie sich die Lippen des Mannes fest zusammenpressten. Er schien darauf zu lauern, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen würde, die ihm die Chance auf eine schnelle Flucht ermöglichen könnte. Die dröhnende Stimme des Lieutenants pflügte erneut über die Main-Street: »Ich bin es nicht gewohnt, mich zu wiederholen. Aber für euch Sturköpfe mache ich einmal eine Ausnahme! Also: wo, zum Teufel, steckt der Marshal dieser Stadt?«
Weit hinter dem Geschehen öffneten sich die großen, schweren Tore der Militärmission und einige Menschen traten heraus. Die Trauung war beendet. Vor der Mission sammelte sich eine Traube von Menschen, die sich in eine Zweierreihe formierte, um das frisch vermählte Brautpaar passieren zu lassen.
Nolans Augen wanderten zur Mission herüber und er sah, wie Stuart Conroy plötzlich abrupt stehenblieb und sich dem Geschehen vor dem Marshal-Office widmete. Er wies mit dem Zeigefinger in die Richtung. June Walsh hatte ihre Hände in den Schoß gelegt und stand ruhig neben ihrem Ehemann. Die Entfernung war zu weit, deshalb war es Nolan nicht möglich, ihren Gesichtsausdruck zu erkennen. Jemand rief aus der Hochzeitsgruppe heraus: »Marshal Donnahue!«
Die kleine, gedrungene und fettleibige Gestalt Marshal Wayne Donahues löste sich aus der Traube. Es wirkte, als würde ein Fass mit zu kurz geratenen Armen und Beinen über die Main-Street laufen. Mit unsicheren Schritten schritt er den Unionssoldaten entgegen. Dicht vor dem Lieutenant blieb Donahue stehen. Er zog ein Taschentuch aus der Innentasche seines braunen Jacketts und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein rundlicher Schädel, auf dem ein Bowler-Hut thronte, glühte wie ein Lampion. Tapfer stierte er zu dem massigen Lieutenant hoch und sagte mit kehliger Stimme: »Ich bin Marshal Wayne Donahue. Darf ich fragen, um was es hier geht?«
»Mein Name ist Lieutenant Roscoe MacAllister, Marshal. Ich habe Befehl, den entflohenen Sträfling Jim Harland nach Huntsville zu überführen, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.« Der Lieutenant wies mit seinem behandschuhten Finger auf den Gefangenen, der mit zusammengepressten Lippen und mutlos wirkenden Augen auf seinem Pferd saß.
»Was wird ihm zur Last gelegt, Lieutenant?« wollte Donahue wissen.
»Dieser Hundesohn hat in Galveston auf zwei Unionssoldaten geschossen und sie getötet. Dann ist er geflohen. An der Furt des Rio-River haben wir ihn dann geschnappt, wobei er einen weiteren Soldaten aus dem Sattel schoss. Wir bringen ihn nach Huntsville. Dort soll das Schwein hängen!«
Die Worte MacAllisters drangen laut über die Straße, so dass jeder sie hören konnte. Donahue sah an Mac Allister vorbei auf den Gefangenen, der sich etwas im Sattel aufgerichtet hatte, und entschied, dass dieser einen stark mitgenommenen Eindruck machte. Bevor Donahue etwas sagen konnte, sagte MacAllister: »Die Männer und Pferde brauchen eine Nacht Ruhe. Deshalb muss der Gefangene diese Nacht in Ihrem Gefängnis in Gewahrsam genommen werden. Morgen früh geht es dann weiter nach Huntsville.«
»Du vergisst, Yankee, dass diese Burschen in Galveston Streit gesucht und dann zuerst zu den Waffen gegriffen haben. Ich hatte keine andere Wahl, als mich zu verteidigen. Mein Glück war, dass ich schneller zog, als die beiden verdammten Blaubäuche.«
Es waren die ersten Worte aus dem Munde Jim Harlands. Und alle Blicke richteten sich nun auf ihn.
»Halt dein verlogenes Maul, Rebellen-Schwein!«, stieß der Soldat, ein Sergeant, links neben Harland hervor. Er riss seinen .44er heraus und schlug mit dem Lauf nach Harlands Gesicht. Harland sah den Schlag kommen und riss seinen Kopf nach hinten. Der Schlag verfehlte sein Gesicht nur um Millimeter und traf mit voller Wucht seine Schulter. Harland stieß einen lauten Schrei aus und sank nach vorne. Der Sergeant holte abermals zum Schlag aus, als ein Schuss krachte. Der Sergeant spürte einen heißen Luftzug und seine Mütze wurde ihm vom Kopf gerissen.
Jed Nolan trat mit rauchender Waffe näher und rief: »Noch ein Schlag, Blaubauch und der nächste Schuss trifft deinen verdammten Schädel!«
Ein Tumult entstand in der Gruppe. Die Pferde scheuten und die Soldaten hatten Mühe, sie schnell wieder zur Räson zu bringen. Der Sergeant stierte mit aufgerissenen Augen zu Nolan herüber und Lieutenant MacAllisters Hand sauste an den Kolben seines.36er Navys. Aber zum Ziehen kam er nicht, denn er blickte plötzlich in die Mündung von Luis Santeros Waffe.
Auch Chico Morales war schnell in Aktion getreten. Als er sah, dass Nolan schoss, hatte er sich schnell die auf dem Fahrerbock des Chuckwagens befindende Schrotflinte heruntergerissen und sie sofort in Anschlag gebracht.
Das alles geschah innerhalb weniger Sekunden und als die Soldaten es gerade geschafft hatten, ihre Pferde wieder zu beruhigen, sahen sie drei Männer mit ihren Waffen im Anschlag auf dem Gehsteig stehen.
»Wenn einer von euch Yankees jetzt zur Waffe greift, ist euer Lieutenant der erste, den's erwischt!« rief Luis Santero. Der schwitzende Kugelkopf des Marshals fuhr nach links und rechts. Die Soldaten sahen hilfesuchend zum Lieutenant herüber, dessen Haltung wie aus Eis erstarrt zu sein schien. Er hielt zwar immer noch seine behandschuhte Rechte in der Nähe seiner Waffe, aber er ließ sie dort ruhen.
Er fasste sich schnell und rief: »Was ist das? Eine Revolte? Hier herrscht das Kriegsrecht. Dafür könnt ihr drei Vögel an den Galgen kommen!«
Nolan, der immer noch den Sergeanten mit seinem .45er in Schach hielt, verzog sein Gesicht zu einem zynischen Grinsen. »Sie sind ja ein richtig mutiger Mann, Sergeant. Einen Gefangenen mit dem Revolverlauf zusammenzuschlagen – dazu gehört wirklich eine große Portion Mut. Ja, jetzt wundert es mich natürlich nicht mehr, dass ihr Yankees uns Südstaatler besiegt habt. Sie sind ein tüchtiger Bursche, Sergeant. Davor ziehe ich sogar den Hut.«
Einige laute Lacher kamen aus der Menschenmenge. Das Gesicht des Sergeanten lief vor Wut rot an.
Marshal Donahue rief: »Nolan! Es ist genug! Stecken Sie Ihre Waffe wieder weg. Das gleiche gilt auch für ihre beiden mexikanischen Freunde. Lieutenant, bringen Sie um Himmels Willen den Gefangenen ins Gefängnis rein, bevor es hier noch zu weiteren Tumulten kommt.«
Donahue ergriff wieder sein Taschentuch, um sich den Schweiß, der in Strömen lief, aus seinem feisten Gesicht zu wischen.
Nolan sagte: »Wer sagt denn, dass diese mutige Yankeebande nicht auf uns ballern wird, wenn wir die Eisen wegstecken, Donahue?«
Lieutenant MacAllisters Blicke wanderten von Nolan zu Santero und dann zu den vielen Menschen, die auf den Gehsteigen standen. Durch das plötzliche Einmischen dieser drei Männer hatte sich das Blatt nun völlig gegen ihn und seine Soldaten gewendet. Jede weitere Aktion würde nur die Operation gefährden. Dessen war es sich bewusst. Sein scharfer Befehl drang zu seinen Männern herüber: »Sergeant Lane! Corporal Winthrope! Bringen Sie den Gefangenen ins Jail.«
Nolan ließ die Trommel des .45ers aufschnappen und warf die leere Patronenhülse aus der Kammer. Er ersetzte sie durch eine neue aus der Gürtelschlaufe und ließ die Waffe dann mit einer geschickten Drehung in den Halfter gleiten.
Der Sergeant warf Nolan einen bitterbösen Blick zu. Der pure Hass stand in seinem stupiden Gesicht geschrieben. Schwerfällig ließ er sich aus dem Sattel gleiten.
Nur widerwillig löste er dem Gefangenen Harland die Fesseln. Er raunte ihm zu: »Runter vom Gaul, Rebell. Und mache keine falsche Bewegung. Ich würde nur darauf warten.«
Mühsam glitt Harland vom Pferd und wurde dann vom Sergeanten und dem Corporal zum Jail geführt.
»Den Burschen müssen wir im Auge behalten, Mister Conroy.«
Stuart Conroy sah an Phil Jordan vorbei in die Richtung von June, die von einer kleinen Menschentraube umringt, etwas abseits stand. Stuart Conroys Hände umschlossen die Rockaufschläge seines teuren, schwarzen Anzuges. Er war ein Mann, der sich stets seiner Sache sicher war. In Bezug auf Jedrow Nolan hatte er sich kaum Gedanken gemacht. Dieser Fall war für ihn sonnenklar und bislang hielt er den Mann für ungefährlich.
Was sollte auch schon ein Bursche, der nichts besaß außer seinem Sattel, den Waffen und dem Pferd, gegen ihn ausrichten können? Gegen ihn, Stuart Conroy, der über Einfluss, Macht und einer Mannschaft kampferprobter Männer verfügte?
Conroy sah die steile Falte in dem hageren, vogelartigen Gesicht des Vormannes.
»Sie haben doch nicht etwa Angst vor Jed Nolan, Phil?«, fragte er.
Jordan schüttelte den Kopf. »Nein, Mister Conroy. Ich habe vor niemandem Angst, das sollten Sie wissen. Aber Sie unterschätzen den Mann gewaltig. Das sollten Sie nicht tun.«
»Zugegeben, sein Auftritt vorhin war recht imposant.«, erwiderte Conroy und ein arrogantes Lächeln breitete sich in seinem Gesicht aus, das ein dünnes, schwarzes Schnurrbärtchen zierte. »Aber er ist enteignet worden – und er steht völlig alleine da. Er hat weder Geld noch die nötigen Männer, um sich mit uns anlegen zu können. Eine bittere Medizin, die der Mann schlucken muss, zugegeben. Aber er wird sich letzten Endes damit abfinden müssen. Ich unterschätze ihn keinesfalls, Jordan. Aber der Mann hat nicht die geringste Chance. Also kein Grund, sich unnötige Sorgen zu machen. Ich habe weitgreifende Ziele vor Augen, mein Lieber. Und da wäre es die reinste Zeitverschwendung, wenn ich mich um die Belange eines einzelnen Mannes kümmern würde, dem mal auf die Zehen getreten wurde.« Er klopfte dem Vormann auf die Schulter und fügte hinzu: »Außerdem ist heute mein Hochzeitstag, Jordan. Ich muss mich um meine Frau kümmern.« Er lachte dabei laut und ließ Phil Jordan stehen.
Dieser zuckte nur mit den Schultern. Seine harten Augen wanderten in Richtung Stadtausgang. Nur drei kleine schwarze Punkte am Horizont waren von Jed Nolan und den beiden Mexikanern noch zu erkennen.
»Sie irren sich«, sagte Jordan leise vor sich hin, »und das werden Sie bald merken, Mister Stuart Conroy.«
Drittes Kapitel
Südlich vom Nueces River bis zum Rio Grande dehnt sich das Buschland von Texas, eine von Kakteen, Chaparral- und Mesquitebüschen und Dornbüschen bedeckte Wildnis. Die Brasada. Ein fast undurchdringlicher Trockendschungel, der in der Zeit nach dem Krieg voll von ungebrannten Rindern war, die keinen Besitzer hatten.
Es war eine qualvolle Arbeit, diese Rinder aus dem Dickicht zu treiben. Monatelang hatten Jed Nolan und seine Handvoll Männer unter Aufbringung sämtlicher Kräfte geschuftet. Unermüdlich kämpften sie gegen die sengende Hitze, unüberwindbares Gestrüpp und die spitzen, gefährlichen Dornen an.
Jedrow Nolan war peinlich darauf bedacht, dass dieses Unterfangen nicht an die große Glocke gehängt wurde. Das war ein Teil seines Planes.
In einer Talsenke inmitten dieses dornenüberwucherten Dschungels und nahe der ersten Ausläufer des Rio Grande, waren die Tiere zusammengetrieben und mit einem Brandzeichen versehen worden – mit dem Nolan-Brand, einem N in einem Kreis. Mittlerweile waren es fast tausendzweihundert Tiere.
In diesem Landstrich lebten nur wenige Menschen. Unter ihnen die Familie von Luis Santero und Cico Morales, die in der Nähe des Nueces ihr kleines Reich geschaffen hatten und von dem lebten, was das Buschland hergab.
Die Abenddämmerung im Busch war von einer ganz eigenwilligen Stimmung erfüllt. Um diese Zeit lastete eine seltsame Stille über der Brasada. Ein ganz leichter Wind trug den würzigen Geruch der verschiedenen Pflanzen zu den Männern vom Rio Grande herüber. Die Männer saßen am Lagerfeuer. Eine Eule schrie ein paarmal aus einem Beerenbusch in einer kleinen Schlucht. Ab und zu muhte eines der Rinder und der monotone Gesang der mexikanischen Nachtwache drang zu den Männern am Feuer herüber. Jed Nolan kauerte auf seinen Absätzen und hielt seinen Becher Kaffee in beiden Händen. Stumm blickte er zu Luis Santero herüber, der an einem Stück Holz schnitzte. Mit Nolan umfasste die kleine Mannschaft sechs Mann – es waren bis auf Nolan und den kleinen Burschen namens Pecos ausschließlich Mexikaner und der Familie von Luis Santero angehörig. So waren also Luis, der Vetter Chico Morales, Diego und Gonzales, die beiden Brüder von Luis dabei. Die beiden letzteren ritten gerade Herdenwache. Die Freundschaft mit dieser Familie reichte bis weit vor dem Krieg. Der alte Dan und Luis Vater Rafaelo hatten sie einst gegründet und an Jed und seine verschollenen Brüder weitergeben. Als Kinder waren sie bereits unzertrennlich; Jed Nolan und Luis Santero durchkämmten die wilde Brasada und kannten beinahe jeden einzelnen Strauch.
Chico Morales, der dünne Bursche mit seinem spitzen Gesicht und dem buschigen Schnurrbart, hatte sich etwas abseits ins Gras gesetzt. Sein Kopf lehnte an der Wagendeichsel des Chuckwagens und seine Augen blickten gedankenverloren zum sternenüberhangenen Himmel empor. Es war eine klare, wolkenlose Nacht.
In die Stille der Männer hinein sagte Nolan: »Bevor wir mit dem Auftrieb beginnen, werde ich mich nach einem neuen Koch umsehen müssen. Chicos Kaffee schmeckt, als solle er Tote zum Leben erwecken.« Er schüttete den Rest aus seinem Zinnbecher ins Feuer.
Ein leichtes Kichern drang aus Pecos Kehle. Jed Nolan hatte die letzten beiden Kriegsjahre mit Pecos zusammen verbracht. Gemeinsam kehrten sie zurück in dieses Land, nachdem Lee bei Appomattox seine Waffen gestreckt hatte.
Pecos war ein schweigsamer Mann mit abenteuerlicher Vergangenheit. Das einzige, was Nolan über die Herkunft dieses Mannes wusste war, dass er aus El Paso stammte, seine Eltern frühzeitig verlor und bei einem mexikanischen Ranchero aufgewachsen war, der ihm – aus welchen Gründen auch immer – den Namen Pecos gab. Der Ranchero war ein strenger, religiöser Mann. Und irgendwann hatte Pecos es bei ihm nicht mehr ausgehalten. In einer Nacht hatte er sein Pferd gesattelt und war davongeritten.
»Tejanos«, stieß Chico hervor, »ihr seid nie zufrieden mit dem, was ihr habt. Wenn euch Amigos mein Kaffee nicht schmeckt, braucht ihr ihn nicht zu trinken.« Er unterstrich seine Worte mit einer nachfolgenden Welle von mexikanischen Flüchen und begann, sich eine Pfeife zu stopfen.
»Noch dringender als ein neuer Koch wären Pferde, Jed«, sagte Pecos grinsend, aber er meinte die letzten Worte ernst. »Wenn wir noch ein paar Dollar an den Rindern verdienen wollen, müssen wir bald aufbrechen. Aber das, was wir an Pferden haben, dürfte nie und nimmer ausreichen.«
Nolan nickte und starrte düster in die Flammen. In den letzten Monaten waren sie ausnahmslos damit beschäftigt gewesen, Rinder aus der Brasada zu treiben und ihnen den Brand aufzudrücken. Sie hätten sich längst um Pferde kümmern müssen. Es gab genügend Wildpferde, die man einfangen konnte. Aber sie mussten auch zugeritten werden. Und dazu waren sie einfach zu wenig. Hinzu kam die Zeit. Der nächste Markt, den es für Rinder gab, war New Orleans. Hier in Texas war ein Rind derzeit kaum 2 Dollar wert. In New Orleans konnte man immerhin noch bis zu 15 Dollar pro Stück erzielen, wenn man schnell genug war. Die Armee zahlte in Forth Worth vielleicht 8 Dollar pro Rind. Aber Jed Nolan hätte die Tiere lieber verschenkt, als sie den verhassten Yankees zu überlassen.
»Wir brechen in drei Tagen nach New Orleans auf«, sagte Nolan. »Es geht nicht anders. Wenn wir zu spät eintreffen, haben andere schon das Geschäft gemacht. Und dann könnte man die gesamte Herde schon fast verschenken. Wir müssen unterwegs Pferde einfangen und sie zureiten. Wir sind halt zu wenige Männer. Es geht nicht anders.«
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Pecos, zog einen glühenden Ast aus dem Feuer und zündete sich damit eine Zigarette an.
»Ich habe von Anfang an gesagt, dass es kein Spaziergang werden wird, Pecos«, meinte Nolan.
»Ich bin's gewohnt, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen, Jed. Du kennst mich«, antwortete Pecos. Er warf den Ast wieder ins Feuer und ließ seine Zigarette aufglimmen. »Wir haben uns in diesem verdammten Krieg mächtig tapfer geschlagen, meinst du nicht auch? Und da sollte uns doch ein kleiner Viehtrieb mit mangelnder Ausrüstung nicht gleich aus der Bahn werfen.«
»Das sind die Worte, die ich von dir hören will, Partner«, brummte Nolan. Er sah von Pecos zu Luis, der bislang schweigend zu seinem Platz saß und nachdenklich in das prasselnde Feuer starrte. Ohne den Blick von den Flammen abzuwenden, nickte er. Luis Santero war ein Mann, der nie besonders viel Worte machte. Für ihn zählten die Freundschaft und die damit verbundene Treue. Jed Nolan wusste, dass er auf Luis Santero zählen konnte.
Und er wusste auch, dass die anderen Männer seiner kleinen Mannschaft in dem Punkt Santero nicht viel nachstanden.
Der Morgen graute. Purpurne Farben zeichneten sich bereits am dunklen Himmel ab. Gil Fuller fühlte, wie sich das Pferd unter ihm wie eine Bogensehne spannte, als er es den steil ansteigenden Hang hinaufzwang. Pferd und Reiter waren völlig am Ende ihrer Kräfte angelangt. Das Tier keuchte in kurzen Stößen. Der flockige Schaum legte sich wie ein weißer Teppich um den Hals. Gil Fuller beugte sich weit über das Sattelhorn, um dem keuchenden Tier eine Hilfe zu geben, damit es den Anstieg leichter schaffen konnte. Obwohl es zu dieser Stunde noch sehr kühl war, lief auch ihm der Schweiß in Strömen vom Gesicht. Fuller presste seine Zähne hart aufeinander. Sein Gesicht war verzerrt, während er mit den Enden der Zügel auf den vorgestreckten Hals seines Pferdes peitschte.
»Du schaffst es!«, schrie er auf das Tier ein, »verdammt! Es sind noch ein paar Yards bis zum Fluss. Komm, Grauer! Leg dich noch einmal ins Zeug!«
Als wenn das Tier die Worte des Reiters verstanden hätte, zog es noch einmal an. Kleine Steinlawinen lösten sich unter den Hufen und sausten polternd nach unten. Der Graue holte seine letzten Kraftreserven aus sich heraus. Gerade hatten sie den höchsten Punkt des Hanges erreicht, als plötzlich das Pferd unter Fuller zusammenzuckte. Den Knall der Schüsse hörte er einige Sekunden später, als der Boden unter den Hufen des Tieres schon nachzugeben schien. Das Pferd stieß ein lautes Wiehern aus und wurde wie von einer unsichtbaren Faust herumgewirbelt. Instinktiv riss Fuller seine Stiefel aus den Steigbügeln. Er zog seinen Henry aus dem Scabbard. Im allerletzten Moment warf er sich aus dem Sattel. Er schlug hart auf. Neben ihm krachte der schwere Körper des Grauen zu Boden und überschlug sich. Fuller warf sich mit einem Aufschrei zur Seite, um nicht von dem Pferd überrollt zu werden. Dabei hielt er das Gewehr fest in beiden Händen. Das Tier sauste den Hang hinunter, Steine und Geröll mit sich reißend. Es überschlug sich ein paar Male und blieb dann unten regungslos liegen. Keuchend richtete sich Fuller auf. Er war vom Sturz noch ganz benommen, als ein Schuss krachte und dicht neben ihm ein paar Kieselsteine hochspritzten. Fullers Kopf flog herum. Die Reiter waren bereits auf Gewehrschussweite herangekommen und preschten in voller Karriere auf ihn zu. Ein Windhauch trieb den Geruch des Wassers zu Fuller herüber. Der Fluss war zum Greifen nahe. Noch hatten sie ihn nicht gestellt.
Fuller überlegte nicht lange. Zum Überlegen blieb auch keine Zeit mehr. Wenn er den Rio Grande erreichen würde, wäre er gerettet. Das schoss ihm blitzartig durch den Kopf. Er konnte es schaffen. Es war nicht mehr weit. Hundert Yards vielleicht, oder hundertfünfzig.
Fuller begann zu laufen. Mühsam zwang er sich wieder den Hang hinauf. Sein Atem ging keuchend und stoßweise. Sein Hals war trocken.
Immer näher kam der Geruch des Wassers. Er hörte es unten schon rauschen und die leichten Wellen ans Ufer klatschen. Schüsse krachten. Die Geschosse fuhren in den Boden, rissen Steinsplitter hoch, die ihm an die Füße und Beine schlugen. Querschläger jaulten. Plötzlich verhakte sich sein rechter Stiefel unter einer Pflanzenwurzel. Fuller stolperte und schlug der Länge nach hin. Ein Geschoss jagte dicht über seinem Kopf hinweg und pflügte in den Boden.
Die Entfernung zwischen ihm und dem vordersten Verfolger mochte vielleicht noch neunzig Yards betragen. Und zwischen diesem und den sechs anderen Burschen lagen vielleicht noch etwa dreißig oder vierzig Yards.
Fuller rappelte sich auf die Knie, brachte den Henry in Anschlag. Er versuchte seinen Atem ruhig zu halten. Sein Herz pochte wild. Seine Hände zitterten leicht, als er den Finger um den Abzug legte. Er visierte den vordersten Reiter an, der sein Pferd brutal den Hang hinauftrieb. Fuller sah, dass der Bursche einen Säbel aus der Scheide gerissen hatte. Er fluchte in mexikanischer Sprache auf das Tier ein.
Fuller spürte den Rückstoß an seiner Schulter. Pulverrauch stieg auf. Der Kopf des Mexikaners ruckte nach hinten. Der Mann drehte einen Salto und stürzte vom Pferd. Der Säbel flog durch die Luft und landete klirrend auf einem Haufen Geröll. Während der Mexikaner den Hang hinunterrollte, sprang Fuller auf. Für den Bruchteil einer Sekunde zog er es in Erwägung, zu dem reiterlosen Pferd zu laufen. In wilder Hast schätzte er die Entfernung zwischen ihm un den restlichen Verfolgern ab. Er schüttelte den Kopf. Das Pferd würde er nicht mehr erreichen, dazu waren die Mexikaner schon zu nah. Die ersten Reiter erreichten den unteren Anstieg des Hanges. Fuller riss das Gewehr an die Wange und feuerte das ganze Magazin leer. Die Reiter stoben auseinander, zwei Mann sprangen von ihren Pferden. Das hielt sie für einige wertvolle Sekunden auf.
Fuller warf das leergeschossene Gewehr weg und begann zu laufen. Er stolperte einige Male, weil seine Stiefel immer wieder über glattes Gestein glitten. Schüsse krachten hinter ihm, begleitet von dem wilden Fluchen der Verfolger, die ihre Pferde in blinder Wut den Hang hinauftrieben.
Fuller erreichte den Hügelrücken. Nun ging es bergab. Mehr stolpernd als laufend sauste er den Hang abwärts. Er stürzte, überschlug sich und rollte den Rest des Hanges herunter, fing sich und landete wie eine Katze auf allen Vieren. In seinem Kopf pulsierte das Blut, das Herz schlug bis zum Hals. Sein Mund war trocken und die Sinne drohten zu schwinden. Dennoch rappelte er sich hoch. Er wagte es nicht, sich nach den Verfolgern umzudrehen. Er wusste auch so, dass sie da waren. Und als wieder Schüsse krachten, wusste er, dass sie den Hügelrücken erreicht hatten. Er war am Ende seiner Kraft und trotzdem trieb es ihn vorwärts.
Überall vor ihm waren dürre Büsche zu sehen; Mesquite, Kreosot, Katzenkrallen und Chaparrals, dazwischen Felstrümmer und loses Gestein. Der Geruch von Wasser stieg ihm deutlicher denn je in die Nase. Er zwang sich durch das dornige Gebüsch. Die scharfen, spitzen Stacheln bohrten sich durch seine Kleidung, drangen in die Haut. Sie pieksten, stachen und rissen. Schützend hielt Fuller die Arme vors Gesicht, während es ihn immer weiter durch dichter werdendes Buschwerk trieb. Und dann tauchte vor ihm der Fluss auf. Wie eine rauschende, schwarzglänzende Masse floss er dahin, trennte Mexiko von den Staaten. Schemenhaft konnte er das andere Ufer erkennen. Keuchend stolperte er auf den Rio Grande zu. Am Ufer blieb er stehen und verschnaufte für eine kurze Weile. Sein Atem ging rasselnd und er hatte das Gefühl, sein Herz würde ihm aus dem Hals springen wollen.
Von der augenblicklichen Stelle bis zum rettenden, anderen Ufer betrug die Entfernung kaum fünfzehn oder zwanzig Yards. Er hatte also Glück, denn der Übergang war sehr schmal.
Hinter ihm brachen die ersten Verfolger durch die Büsche. Er hörte das Getrappel der Hufe, das Knacken von Geäst und das laute und wilde Fluchen der Reiter. Gil Fuller war nie ein guter Schwimmer gewesen. Und mit seiner Kleidung, dem Colt und den Stiefeln war es fraglich, ob er die Stromrinne bis zum rettenden Ufer überqueren konnte. Da krachten die ersten Schüsse und pflügten in den Boden. Und nun zögerte Gil Fuller keine Sekunde mehr, kämpfte seine Erschöpfung nieder und sprang in das dunkle Wasser. Er dachte in dieser Sekunde gar nicht daran, dass ihn die Strömung wegtreiben oder ein Strudel ihn erfassen und durch den Sog nach unten ziehen könnte. Er wollte nur noch ans andere Ufer. Das war sein Ziel. Mehr gab es für ihn nicht.
Das Wasser war eiskalt und die Kälte drohte, ihn zu lähmen. Er japste nach Luft, eine Panik durchflutete ihn. Ihm war, als würde sein Kopf zerspringen.
Er kämpfte seine Panik nieder und begann zu schwimmen. Dicht neben ihm schlugen die Geschosse seiner Verfolger ins Wasser. Fontänen spritzten hoch. Fuller tauchte unter und schwamm unter Wasser weiter, bis seine Lungen zu platzen drohten und er wieder an die Oberfläche musste.
Und hinter ihm trieben die Mexikaner ihre Pferde in das kalte Wasser des Rio Grande.
Das Krachen vereinzelter Schüssen riss ihn aus seinem Schlaf. Jed Nolan schreckte hoch und warf mit einem Ruck die Decke vom Körper. Die Kälte des frühen Morgens erfasste ihn und er fluchte. Seine Hand griff instinktiv zum Revolvergurt und er schnallte ihn um. Gleichzeitig waren auch die anderen Männer wach und blitzschnell auf den Beinen.
»Was, zum Teufel, ist los?« brummte Pecos, während er sich mit gezogener Waffe nach allen Seiten umsah. Einige der Rinder gaben unruhige Laute von sich und Bewegung kam in die träge Masse, die in der Talsenke weidete. Das Krachen der Schüsse hatte auch sie aufgeschreckt und nervös gemacht. Nolan sah die schattenhaften Gestalten von Diego und Gonzales, wie sie die Herde umritten und mit sonorem Gesang zur Ruhe brachten.
Dann trat Stille ein. Die wachsamen Blicke der Männer wanderten umher. Nichts war zu sehen, was auf eine unmittelbare Gefahr deuten konnte.
»Die Schüsse kamen vom Fluss und waren ganz nah«, stellte Luis Santero fest. Er überprüfte das Magazin seines Henry-Gewehres, nahm die Waffe in die Rechte und lauschte angestrengt in die Stille hinein. Und in diesem Augenblick krachten wieder einige Schüsse dicht hintereinander.
»Hört sich verdammt nicht gut an«, bemerkte Pecos trocken. »Wir sollten uns das mal ansehen.«
»Los, Jungs, in die Sättel«, rief Jed Nolan kurzerhand. »Chico, du bleibst hier bei Diego und Gonzales und hilfst ihnen dabei, die Herde ruhig zu halten. Nicht, dass die Biester noch in eine Stampede geraten.«
In Windeseile warfen sie ihren Pferden die Sättel über und galoppierten dann durch dichtes Buschwerk hindurch in die Richtung, aus der die Schüsse fielen. Sie brauchten nicht lange reiten. Als sie das Ufer des Flusses erreichten, stoppten sie ihre Pferde und spähten hinüber zum anderen Ufer. Dort sahen sie fünf Mexikaner, deren Pferde bis zu den Bäuchen im Wasser standen. Mündungsfeuer ihrer Gewehre blitzten auf. Ungefähr in der Mitte des Flusses lugte der Kopf eines Mannes auf, der in verzweifelter Hast das Ufer der amerikanischen Seite zu erreichen versuchte. Die Geschosse der Mexikaner schlugen ins Wasser und in unmittelbarer Nähe des Schwimmers sausten kleine Wasserfontänen nach oben. Plötzlich bewegten sich drei Pferde der mexikanischen Verfolger weiter durch den Fluss auf den Fliehenden zu.
Die Burschen wollten unbedingt seinen Skalp, das erkannte Nolan sofort. Die Bewegungen des Fliehenden wurden langsamer. Der Mann war am Ende seiner Kraft. Sein Kopf tauchte plötzlich unter Wasser. Nolan befürchtete schon, dass der Mann von einer Kugel seiner Verfolger, die sich nun auf schwimmenden Pferden der amerikanischen Grenze näherten, getroffen wurde. Immer wieder blitzte das Gewehrfeuer der Mexikaner auf. Und immer wieder spritzten kleine Wasserfontänen hoch. Da tauchte der Kopf des Mannes wieder auf. Nolan erkannte das erschöpfte Gesicht. Er sah, wie die Bewegungen des Mannes erlahmten und die Mexikaner immer näher kamen. Es würde nicht mehr lange dauern, und die Burschen hätten ihn eingeholt.
»Jed! Der Hombre braucht Hilfe«, stellte Pecos in seiner trockenen Art fest. Er riss seine Sharps aus dem Scabbard. Nolan nickte grimmig. Er wusste, dass der Bursche dort im Wasser kaum eine Chance hatte, das Ufer lebend zu erreichen. Und die Mexikaner scherten sich einen Dreck um die Grenzverletzung. Er rief seinen Männern zu: »Aus den Sätteln, Jungs. Verteilt euch hinter den Büschen und treibt die Burschen zurück!«
Jed Nolans Männer ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie alle hatten ihre Gewehre in den Händen, waren aus den Sätteln gesprungen und verteilten sich hinter schützendes Buschgestrüpp, das am Ufer wucherte.
Nolan hatte sich hinter einem Granitblock geworfen. Seine Hände umklammerten sein Henry-Gewehr. Er spähte zum Kampfgeschehen hinüber und beobachtete, dass sich einer der Mexikaner nur noch einige Yards hinter dem Flüchtenden befand. In seiner Hand hatte er eine Machete erhoben und trieb sein schwimmendes Pferd immer näher an den Mann heran, dessen schwimmende Bewegungen inzwischen aufgehört hatten. Gegen den Mexikaner mit seiner Machete hatte er keine Chance.
Nolan riss sein Gewehr an die Wange. Er visierte den Kopf des Mexikaners an. Sein Finger krümmte sich um den Abzug und drückte ab. Pulverrauch wölkte auf und im gleichen Augenblick ruckte der Kopf des Mexikaners nach hinten. Die Machete entglitt der schlaffen Hand und fiel ins Wasser. Der leblose Körper des Mexikaners kippte nach vorne und rutschte vom Pferd.
Und in diesem Augenblick nahmen Nolans Männer die anderen vier Burschen unter heftigen Beschuss. Aufgebrachte Schreie drangen zu ihnen herüber, als die Mexikaner unter plötzliches Gewehrfeuer gerieten. Einer von ihnen stieß einen gellenden Schrei aus und wurde vom Pferd katapultiert. Die anderen drei rissen Hals über Kopf ihre Pferde herum und trieben sie in panischer Hast zurück ans mexikanische Ufer.
Wenige Augenblicke später zog Jed Nolan den total erschöpften Mann aus dem Wasser, dem gerade das Leben gerettet worden war.
Viertes Kapitel
Chico Morales hatte sich breitbeinig vor Gil Fuller gestellt, der auf einem Baumstumpf vor dem Lagerfeuer saß. In seiner Rechten hielt Chico eine dampfende Kanne Kaffee.
»Noch etwas Kaffee, Señor?«
Fuller hielt ihm grinsend seine leere Blechtasse hin und Chico füllte sie bis zum Rand. Fuller hatte sich innerhalb von einigen Stunden wieder recht gut erholt. Er war ein hochgewachsener, sehniger Mann mit breiten Schultern und einer schmalen Taille, etwas größer noch als Jed Nolan. Kurzes, dunkles Haar lugte widerspenstig unter seinem verbeulten Stetson hervor, den er weit in den Nacken geschoben hatte. Sein hageres Gesicht mit dem ausgeprägten Kinn war von Bartstoppeln übersät. Er hatte dunkle Augen, die im Augenblick von der Erschöpfung gerötet waren, und einen schmallippigen Mund, um den sich zwei Kerben gegraben hatten. Seine Kleidung war verschlissen. Es war nicht die typische Kleidung eines Weide- oder Buschreiters. Sein Revolvergurt war aus braunem Leder, aus dem der mit Perlmutt versehene Kolben eines .51er Navy-Colts herausragte. Er trug eine abgewetzte, blaue Baumwollhose und an seinen Stiefeln befanden sich zwei großrädrige Sporen, die verrieten, dass Gil Fuller aus Texas stammte.