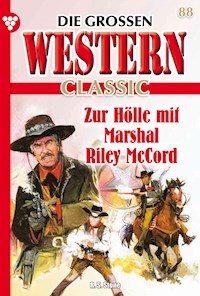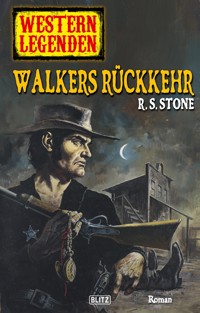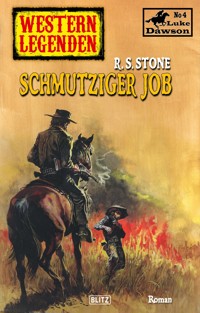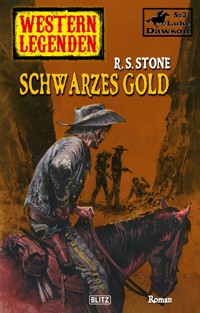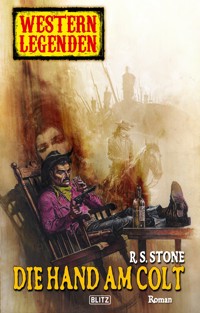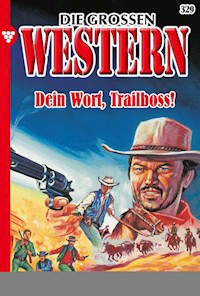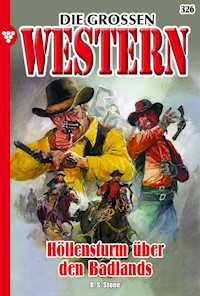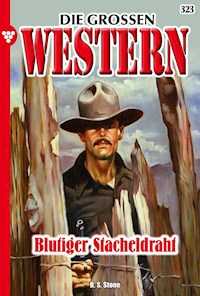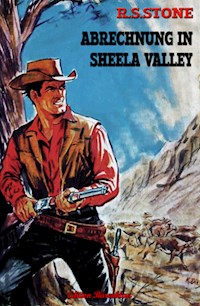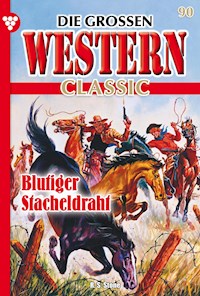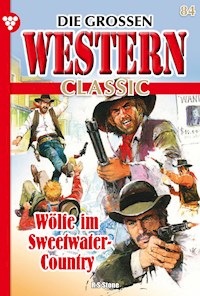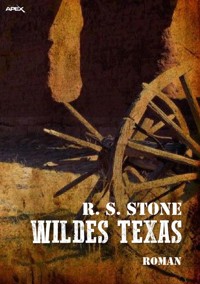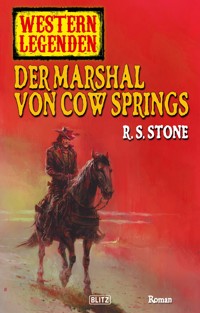
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der ehemalige Revolvermann Ben Stryker kehrt zurück nach Cow Springs. Dort versucht er den Tod seines besten Freundes, dem Marshal von Cow Springs, aufzuklären. Dabei stößt er in ein Wespennest voller Hass und dunkler Intrigen.Schon bald gerät Stryker in den Sog dieser Machenschaften. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.Die Printausgabe umfasst 198 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WESTERN LEGENDEN
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
R. S. Stone
Der Marshalvon Cow Springs
Historischer Western
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-411-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
1. Kapitel
Arizona kannte er noch nicht. Nur vom Hörensagen. Vermutlich war es hier auch nicht anders, als unten in Texas. Oder anderswo. Für ihn spielte das keine Rolle. Und im Grunde war es ihm auch völlig egal. Er war sattelmüde und sehnte sich nach einem heißen Bad, einer Rasur und einem vernünftigen Mahl. Seine eigene Küche hatte er gründlich satt, die fast ausschließlich nur aus Bohnen, Speck und Trockenfleisch bestand. Zählte man noch den Kaffee dazu, war das wirklich alles, was er sich selbst anzubieten hatte.
Nach einem langen Ritt durch staubiges und menschenleeres Land lagen nun die ersten Häuser von Cow Springs vor ihm. Früher gehörte dieses Land den Apachen. Aber diese Zeit war seit einigen Jahren vorbei.
Nun, in Cow Springs, so wusste Ben Stryker, würde er einem Mann begegnen, den er lange Zeit nicht mehr gesehen hatte, der ihm aber immer noch sehr viel bedeutete.
Seinen Auftraggeber kannte er persönlich nicht. Auch nicht den Job, der ihn erwartete. Ben Stryker wusste nur, dass es sich um eine lukrative Sache handeln sollte, bei der ein Mann wie er dringend gebraucht wurde.
Ja, ein Mann wie er.
Schon längst machte er sich keine Illusionen mehr darüber, dass es wieder mal nicht ohne Pulverrauch abgehen würde. Denn auch hier in Arizona eilte ihm sein Ruf bereits voraus. Und der hinterließ einen bitteren Geschmack auf der Zunge.
Irgendwann, so schwor er sich, würde er seinen Remington an den Nagel hängen und friedlich seines Weges ziehen.
Nun, möglicherweise nur noch dieser eine Job, und dann wäre es so weit.
Ja, vielleicht.
Aber wer wusste das schon ...
*
Doc Rulltyre schob seine rundliche Gestalt durch die Pendeltüren des Sugarhead-Palace hinaus ins Freie. Sein Gesicht war verschwitzt und gerötet. Die Folge einiger Drinks, die er sich eben noch nach einem üppigen Mittagsmahl einverleibt hatte. Mit einer fahrigen Bewegung wischte er sich den Schweiß von der Stirn und trat auf die schmutzigen Gehsteigbohlen. Dabei schwankte er ein wenig und spürte sogleich einen lästigen Druck in der Magengegend.
„Verdammter Brandy“, fluchte er leise vor sich hin. „Ich sollte nicht schon mittags damit anfangen.“
Mit dieser Erkenntnis, die er bereits öfter getroffen hatte, sah er sich verstohlen zu beiden Seiten um. Niemand war in der Nähe. So hob er sein rechtes Bein, verzog das Gesicht und drückte ungeniert die Luft geräuschvoll aus seinem Darm. Übler Gestank hüllte ihn ein. Aber er fühlte sich befreit. Ein erleichtertes Stöhnen folgte, und er fischte eine von seinen dicken Zigarren aus der Rocktasche, kramte in den Hosentaschen nach einem Streichholz, fand eins und zündete die Zigarre an. Dann lehnte er sich an einen schlanken, von Pferden angeknabberten Stützpfeiler. Paffend zog er an seiner Zigarre, bis dichter Tabakqualm sein schwammiges Gesicht umwölkte. Und durch diese Schwaden hindurch sah er den Reiter, der aus südlicher Richtung über die Main Street geritten kam.
Pferd und Reiter waren staubbedeckt, schienen einen langen Ritt hinter sich zu haben. Der Mann hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen, sodass dieses vor Rulltyres Augen verborgen blieb. Seine Kleidung war vom vielen Waschen ausgeblichen und wirkte abgetragen.
Aber das tat nichts zur Sache.
Doc Rulltyre hatte diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Und doch ahnte er, wer er war, und weshalb ihn sein Weg in diese Stadt geführt hatte.
Die Blicke aus rot geränderten Augen folgten dem Reiter, bis dieser hinter der Biegung der Straße verschwunden war.
Noch vor ein paar Minuten hatte der Doc beabsichtigt, den Weg zu seiner Praxis einzuschlagen, die sich ein paar Häuserreihen weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand. Diesen Gedanken verwarf er ganz schnell. Stattdessen verharrte er eine Weile auf dem Gehsteig und paffte heftig an seiner Zigarre.
Eine kurze Zeit lang später sah er den Mann wieder auftauchen, zu Fuß und ohne Pferd, um in Fentons Barbierladen zu verschwinden.
Rulltyre war sich seiner Sache jetzt sicher. Er warf seine halb gerauchte Zigarre in den Straßenstaub, löste sich vom Haltebalken und setzte sich in Bewegung. Mit schnellen, unsicheren Schritten überquerte er die Straße, erreichte das Marshal Office und trat ein, ohne anzuklopfen.
Rulltyre fand den Marshal zusammengesunken auf einem Stuhl hinter dem Schreibtisch vor. Seine langen Beine lagen übereinandergeschlagen auf der narbigen Schreibtischplatte.
Er schien ein Nickerchen gemacht zu haben. Jetzt schrak er plötzlich hoch, und sogleich dröhnte Rulltyre des Marshals Reibeisenstimme entgegen: „Verdammt noch mal, Doc Rulltyre! Kannst du nicht anklopfen, wie’s jeder normale Mensch auch tun würde? Zum Teufel mit dir, du verfluchter Quacksalber!“
Rulltyre schenkte der barschen Zurechtweisung keine Beachtung. Schließlich kannte er den Marshal lange genug, um für dessen unsensible Äußerungen empfänglich zu sein.
„Er ist angekommen, Keith“, kam es stattdessen über Rulltyres Lippen.
Marshal Keith Holbrooks Beine verschwanden von der Tischplatte. Langsam zog sich seine hagere Gestalt aus dem Stuhl und richtete sich auf, starrte dem Doc stirnrunzelnd und verschlafen entgegen.
„Von wem redest du?“
Rulltyre trat dicht an den Schreibtisch heran, bis sein rundlicher Bauch die Tischplatte berührte.
„Von dem Kerl, nach dem Broderick Rodeen geschickt hat. Von wem wohl sonst?“
„Hm ...“, machte Holbrook und rieb sich übers unrasierte Gesicht. „Bist du sicher?“
Rulltyre nickte. „Ziemlich.“
„Wie sah der Bursche aus?“
„Hager und abgerissen. Wie ein Wüstenwolf. Ungefähr deine Größe. Er kam vor wenigen Minuten auf ’nem langbeinigen Falben die Straße entlang geritten. Jetzt sitzt er bei Fenton. Brauchte wohl dringend ’ne Rasur.“
„Ach, sieh mal einer an! Verdammt noch mal, Doc! Die Beschreibung könnte auf jeden Zweiten hier in der Gegend passen.“
„Ich habe den Mann vorher noch nie gesehen. Also ein Fremder. Aber eins und eins lassen sich prima zusammenzählen, nicht wahr? Fremde verirren sich selten in unsere Stadt. Es sei denn, sie werden gerufen. Und der Kerl wirkte nicht wie einer, der nur so auf der Durchreise ist.“
„Na, dann werde ich mir den Vogel mal genauer ansehen“, brummte der Marshal. Er ging um Rulltyre herum zum Waffenständer. Dort blieb er stehen und langte nach einer Winchester, zog sie heraus und riss den Repetierer einmal vor und zurück. Dann klemmte er sich die Waffe unter den Arm.
Rulltyre, der den Marshal die ganze Zeit beobachtete, verzog sein Gesicht.
„Denkst du, dass es nötig ist? Das Gewehr, meine ich.“
„Nur zur Sicherheit. Bis ich weiß, ob es wirklich der Kerl ist, den wir erwarten.“
„Soll ich mitkommen?“
Holbrook, der sich schon fast an der Tür befand, drehte den Kopf in Rulltyres Richtung.
„Danke. Aber mit meinem Job werde ich schon allein fertig. Dafür werde ich bezahlt. Kümmere du dich lieber um deine Patienten.“
Das klang nicht freundlich und Doc Rulltyre sandte dem Marshal einen grimmigen Blick hinterher, als dieser aus dem Office verschwand.
„Du eingebildetes Arschloch“, kam es über seine Lippen, ohne dass Holbrook es hätte hören können. „Der Teufel soll dich holen!“
Aber er grinste dabei. Das nahm den Stachel aus seinen Worten.
Wieder spürte er, dass es in seinen Därmen drückte. Wie vorhin auf dem Gehsteig, ließ er seinen Druck ab, hinterließ eine übel riechende Duftwolke und folgte Marshal Holbrook nach draußen.
*
Keith Holbrook erreichte Roscoe Fentons Frisiersalon. Er legte die Winchester in seine rechte Hand und spähte durch das große Fenster hinein. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich im Fensterglas. Erkennen konnte er also nicht viel. Der Marshal stieß die Tür nach innen auf. Ein schrilles Glöckchen kündigte seine Ankunft an. Frischer, seifiger Duft stieg ihm in die Nase. Aber den beachtete er nur am Rande. Vielmehr interessierte ihn der Mann, der sein frisch rasiertes Gesicht und den neuen Haarschnitt im Spiegel betrachtete.
Denn den erkannte er sofort.
Holbrook stieß die Tür mit dem Absatz ins Schloss und lehnte sich an den Türrahmen. Er hob die Waffe, richtete den Lauf auf den breiten Rücken des Mannes. Er grinste schief. Aber der schroffe Ton in seiner Stimme strafte diesem Grinsen Lügen, als er sagte: „Du bist jetzt hübsch genug, Ben Stryker. Dreh dich langsam zu mir herum. Und lass die Finger da, wo ich sie sehen kann.“
Roscoe Fenton, der neben dem Frisierstuhl stand, starrte Holbrook entgeistert an. Dabei machte er unweigerlich einen Schritt zur Seite.
Ben Stryker wandte sich dem Marshal zu. Er schob das Frisiertuch achtlos beiseite, erhob sich aus dem Frisierstuhl und trat auf Holbrook zu. Sein breites Schmunzeln zog sich durch sein frisch rasiertes, wettergebräuntes Gesicht. Zwei wasserblaue Augen lagen darin verborgen, die einen scharfen Kontrast zu seiner Gesichtshaut bildeten. Es waren Augen, die sich je nach Gemütsfassung stark verändern konnten. In diesem Augenblick waren sie hell – Holbrook bemerkte den amüsierten Ausdruck darin. Aber auch eine leichte Spur von Gefahr.
Etwa zwei Meter vor Holbrook blieb Stryker stehen. Sein dunkles Timbre wehte zu ihm heran: „Keith Holbrook, hol’s der Teufel. Hast ja ’n hübsches Abzeichen auf deiner Brust. Alle Achtung. Aber wozu die verdammte Artillerie? Begrüßt man so etwa alte Freunde, die sich lange nicht gesehen haben?“
„Nur zur Sicherheit, mein Junge. Bis ich weiß, auf wessen Seite du stehst.“
„Was meinst du damit?“
„Wie ich hörte, arbeitest du jetzt für die Rafter-R-Ranch, die einem Mann namens Broderick Rodeen gehört.“
„Rodeen? Nun, das steht noch nicht fest. Jedenfalls nicht, bis ich weiß, worum es genau geht.“
„Du willst mir doch nicht weismachen, Rodeen hätte dir nichts gesagt? Ben, das kaufe ich dir nicht ab.“
„Ich soll ’nen Job übernehmen, bei dem eine ganze Menge Geld zu verdienen ist. Das ist alles, was ich weiß.“
„Und was du dabei zu tun hast, hat Rodeen nicht gesagt?“
Ben Stryker schüttelte den Kopf. „Werd’s wohl noch früh genug erfahren.“
Holbrook trat einen Schritt näher an ihn heran, bis er in etwa auf gleicher Höhe mit ihm war. Der Lauf der Winchester senkte sich. Allerdings nur um ein paar Zoll.
„Dann will ich dich mal aufklären, mein Junge. Also: Broderick Rodeen kam vor etwa einem Jahr hier an. Zusammen mit einer Herde von über fünftausend Stück Vieh und einer harten Mannschaft. Er baute sich eine hübsche Ranch, vergrößerte sie und machte sich mächtig breit. Aber das alles reicht ihm noch nicht. Er will sich den ganzen Landstrich hier unter den Nagel reißen. Einige Fünfzig-Cent-Rancher und Farmer hat er schon vertrieben. Aber da gibt es ein paar, die sich das nicht gefallen lassen. Die sind stur. Ebenso ein gewisser Dan Gillette. Der kam mit seiner Sippe bereits ein paar Jahre vorher ins Land. Zu ’ner Zeit, als es von Apachen und Coyoten nur so wimmelte. Die Gillettes haben hart schuften müssen – wie die Tiere. Denen hatte man’s verdammt nicht leicht gemacht. Jetzt kommen sie einigermaßen zurecht. Außerdem beanspruchen sie eine Quelle, auf die Rodeen besonders scharf ist. Wasser ist in diesem Territorium von Arizona ein verdammt wichtiges Element. Und Gillettes Quelle würde ausreichen, um Brod Rodeens gesamtes Vieh tränken zu können. Mehr noch – er könnte es verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen.“
Ben Stryker rieb sich nachdenklich übers Kinn. „Verstehe. Dieser Gillette bremst ihn tüchtig aus, was?“
„Was Rodeens Pläne betrifft – auf jeden Fall! Wenn Brod Rodeen die Quelle besäße, würde ihn praktisch nichts mehr aufhalten können. Aber die Gillettes denken nicht im Traum daran, nachzugeben. Jetzt, wo sie zurechtkommen, geben sie ihren Besitz nicht auf. Ums Verrecken nicht.“
„Das würde ich an deren Stelle wohl auch nicht. Und was meinen Job betrifft – ich soll für Rodeen wohl die Kastanien aus dem Feuer holen, was? Revolverlohn, damit ich die Gillettes und die Übrigen ausschalte. So ähnlich ist es doch, nicht wahr?“
„Mhm. Aber das ist noch nicht alles, Ben. Ich sagte ja bereits: Broderick Rodeen ist ein verdammt ehrgeiziger Bursche. Der gibt sich mit Kleinigkeiten nicht zufrieden.“
„Soll heißen?“
„Er streckt sogar seine Fühler nach der Stadt aus. Und ich bin der Mann, der ihm dabei im Weg stehen könnte. Aber ich spiele da nicht mit, verstehst du? Nicht, solange ich Marshal von Cow Springs bin. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich bin für Recht und Ordnung in der Stadt verantwortlich. Und hier ziehe ich deutlich meine Grenzen.“
„Bedeutet, dass ich mich zu guter Letzt auch noch mit dir beschäftigen müsste, stimmt’s?“
Holbrook nickte. „Jetzt bist du vollkommen im Bilde. Was soll’s also sein?“
Ben Stryker hakte die Daumen hinter seinen Revolvergürtel, blickte Holbrook dabei fest ins Gesicht. Der Ausdruck seiner Augen war klar. Es gab nichts Falsches darin.
„Ich kenne jetzt deine Version, Keith, und weiß, dass sie stimmt. Für kein Geld der Welt würde ich mich gegen dich stellen. Wir waren früher Freunde, sind es heute noch. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich reite zu Rodeen und sage ihm, dass nichts aus dem Job werden wird. Kannst du jetzt besser schlafen?“
Holbrooks grinste bis über beide Ohren. „Worauf du einen lassen kannst.“
Ben Stryker wies auf Holbrooks Winchester, deren Mündung immer noch auf ihn gerichtet war. „Dann kannst du das verdammte Ding ruhig runter nehmen. Übrigens – das Gewehr kommt mir bekannt vor.“
„Natürlich. Hab’s damals so machen lassen wie deins, Ben. Hier – fang auf!“ Er warf Ben Stryker die Winchester zu, der sie geschickt auffing und einen prüfenden Blick auf die Waffe warf.
„73er Modell in vollständig brünierter Ausfertigung. Trägt ’ne hübsche Verzierung am Schaft. Wenn ich’s nicht besser wüsste ...“
„Nicht wahr? Junge, das Ding hat schon prächtige Dienste geleistet.“
„Das will ich gern glauben.“
Stryker gab Holbrook das Gewehr zurück. Der Marshal legte die Waffe über die Schulter und sagte: „Da wir uns jetzt ja einig sind, könnten wir ’nen kleinen zur Brust nehmen. Was meinst du, Ben?“
„Darauf komme ich gern zurück. Aber vorher habe ich noch eine Kleinigkeit zu erledigen.“ Ben nahm seinen Hut vom Haken, stülpte ihn auf und rückte ihn zurecht. „Wo finde ich Rodeens Ranch?“
„Du reitest aus der Stadt, hältst dich Richtung Norden, bis der Weg anzusteigen beginnt und du an zwei große Felsen kommst. Die kannst du gar nicht verfehlen. Dort beginnt das Weideland der Rafter-R. Bei diesen Felsen biegst du scharf rechts ab und kommst dann nach ein paar Meilen direkt zur Ranch.“
Stryker tippte lässig an die Hutkrempe. „Wir seh’n uns später, Ben“, sagte er und drehte sich in Fentons Richtung. „Was bin ich schuldig?“
Der kleine, kahlköpfige Barbier, der die ganze Zeit stumm da gestanden hatte, räusperte sich kräftig. „Rasieren und Haare schneiden, Mister. Das macht zwei Dollar.“
Die angelte Stryker aus der Brusttasche seines Hemdes und warf sie Fenton zu. Der fing das Geld geschickt auf und bedankte sich mit einem Lächeln.
Stryker verschwand durch die Tür nach draußen.
Fenton verstaute die Münzen in seiner Hosentasche und wandte sich dem Marshal zu. „Ben Stryker – von dem habe ich bereits allerhand gehört. Wusste gar nicht, dass Sie mit diesem Mann befreundet sind, Marshal. Wird Rodeen nicht gefallen, dass Stryker den Job hinschmeißt.“
„Besser so, als andersrum.“ Holbrook strich sich über die unrasierte Wange. „Wenn ich’s mir recht überlege, könnte ich auch ’ne Rasur gebrauchen. Und ’nen Haarschnitt dazu. Roscoe, wetz das Messer.“
Sprach’s und nahm auf dem Frisierstuhl Platz.
2. Kapitel
Ben Stryker warf seinem Falben den Sattel über, zurrte die Gurte zurecht und führte das Tier aus der Box. Der Stallmann bedachte Ben mit neugierigen Blicken. „Sie wollen schon wieder weiter?“
„Sieht so aus.“
„Nun, Mister, Sie werden Broderick Rodeen auch selten in der Woche hier in der Stadt antreffen. Der ist die meiste Zeit draußen auf seiner Ranch“, bemerkte der Alte und ein listiger Ausdruck erschien in seinem zerfurchten Baumrindengesicht, das von einem struppigen Vollbart gerahmt war.
Stryker grinste dem Alten zynisch ins Gesicht. Der unsichtbare Telegraf des Landes funktionierte wieder einmal tadellos, wie es schien.
„Danke für den Hinweis“, antwortete Ben nicht ohne Spott.
„Sie seh’n mir gar nicht wie ein Revolverheld aus. Eigentlich schade ...“
„Du hast dich prächtig um mein Pferd gekümmert, Alter. Und dabei wollen wir’s auch so belassen.“ Stryker fischte ein Dollarstück aus der Brusttasche. Er warf es dem Alten zu und führte seinen Falben an den Zügeln aus dem Mietstall hinaus ins Freie. Mit einem Satz zog er sich in den Sattel, zog das Tier herum und lenkte es auf die Straße.
Für sein Vorhaben war keine Eile erforderlich. Und so ritt er gemächlich in seichtem Trab über die staubbedeckte Straße. Es war um die Mittagszeit. Die Arizona-Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht und brannte mit schonungsloser Hitze auf die Häuserreihen links und rechts nieder. Nur ganz wenige Menschen befanden sich auf der Straße und den Gehsteigen, und diese wenigen bedachten ihn mit verstohlenen Blicken, die ein Mann wie Ben Stryker folgerichtig zu deuten wusste.
Man wusste über ihn Bescheid. So etwas ging schnell und verbreitete sich in Windeseile. Wie ein ansteckender Virus. Und noch etwas lag deutlich spürbar in der Luft. Über den Dächern von Cow Springs lastete ein Druck, und man schien nur darauf zu warten, dass sich dieser entladen würde – in welcher Form auch immer. Ein Mann wie Ben Stryker spürte so etwas sofort. Schon bei seiner Ankunft in Cow Springs hatte er dies getan.
Vor dem Gemischtwarenladen sah er die Frau stehen. Gerade noch war sie im Begriff, einzutreten. Sie blickte zu ihm hinüber und verharrte auf dem Gehsteig.
„Ben!“, hörte er sie rufen. „Ben Stryker!“
Er zog den Falben herum und ritt an sie heran. Zunächst war er sich nicht sicher. Erst, als er sein Pferd vor ihr zum Stehen gebracht hatte, wusste er Bescheid.
Ihr rechter Arm war erhoben. Mit der Hand schirmte sie ihre Augen vor der Sonne ab und blinzelte zu ihm auf – eine hübsche Frau in einem modischen Kostüm, welches ausgezeichnet ihre Proportionen zur Geltung brachte. Der dazu passende Hut saß keck auf ihrem Kopf, verdeckte nur teilweise ihr dunkelblondes Haar. Ein leichtes Lächeln erschien auf ihren Lippen, die so rot waren wie die Farbe wilder Kirschen. Der Ausdruck ihrer dunklen Augen blieb eher glanzlos und kühl.
Mit sanft klingendem Timbre wehte es zu ihm heran, als sie sagte: „Ein großer Mann auf einem schwarzen Pferd. Es ist lange her. Aber dich habe ich sofort erkannt, Ben Stryker.“
Ben legte seine Hände auf das Sattelhorn. „Rhonda Dale! Was für eine Überraschung! Bist mächtig weit weg von Kansas, wie ich sehe. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt, mit deinem modischen Hut und in dem hübschen Kostüm. Du siehst prächtig aus, Mädchen. Die Jahre haben dir scheinbar nichts anhaben können.“
„Immer noch der gleiche Schmeichler von früher, wie?“ Mit einem ersten Unterton setzte sie hinzu: „Aber mein Name ist nicht mehr Dale, Ben. Ich heiße jetzt LaVerne.“
Ben Stryker zog die Stirn in Falten. „Du hast geheiratet?“
„Ja, vor etwa einem Jahr.“
Sie sprach ihre Worte kühl und gelassen. Ben entging nicht der dunkle Schatten, der über ihre Augen zog.
Verheiratet – aber nicht glücklich, schoss es ihm durch den Kopf. Eine glücklich verheiratete Frau sieht anders aus.
Er sprach den Gedanken nicht aus.
Rhonda wechselte schnell das Thema. „Du hast dich auch nicht verändert. Jedenfalls nicht äußerlich. Übrigens – ich war nicht überrascht, dich zu sehen. Ich wusste, dass du nach Cow Springs kommen würdest.“
„Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell, was?“, bemerkte er mit zynischem Humor. „Wie’s aussieht, scheint hier wohl jeder von meiner Ankunft gewusst zu haben.“
„Broderick Rodeen schickte nach einem tüchtigen Mann, Ben. So was macht schnell die Runde und bleibt selbst in so ’ner miesen Stadt wie Cow Springs nicht lange verborgen.“
„Kommt nicht gerade freundlich von deinen Lippen.“
Rhonda schüttelte den Kopf. „Das ist es auch nicht. Ich hätte mir wahrhaftig einen besseren Anlass gewünscht, dich wiederzusehen, Ben.“
„Verstehe. Dieser Rodeen ist nicht sehr hoch im Kurs bei dir, was?“
Sie verzog verächtlich ihr Gesicht. „Nein, ganz sicher nicht. Jetzt bist du sicherlich auf dem Weg zur Rafter-R, um deinen neuen Job anzutreten, nicht wahr?“
„Was den Ausritt betrifft – ja.“
Jetzt legte sich eine steile Falte zwischen ihre geschwungenen Augenbrauen. „Wie meist du das?“
„Ich denke, ich werde nicht für Rodeen in den Sattel steigen, falls es dich beruhigt.“
„Nicht? Nun, das überrascht mich. Was hält dich davon ab? Es heißt, dass Rodeen Spitzenlöhne für seine Dienste bezahlt – Blutgeld!“
„Blutgeld?“ Ben Stryker machte eine lapidare Handbewegung. „Wie auch immer. Ich hatte vorhin eine Unterredung mit dem Marshal. Keith Holbrook ist ein alter Freund von mir. Jedenfalls konnte der mich überzeugen, die Finger von der Sache zu lassen.“
Sie setzte zu einer Antwort an, die unausgesprochen blieb. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Ein Mann in einem samtschwarzen Anzug kam energischen Schrittes über den Gehsteig gelaufen, hielt direkt auf sie zu. Dicht neben Rhonda blieb er stehen. Zornig, wie dieser Bursche war, bedachte er Ben mit einem schnellen, giftigen Blick und wandte sich sogleich Rhonda zu.
„Verdammt noch mal! Wie lange willst du mich noch warten lassen? Wir sind verabredet. Schon vergessen? Stattdessen stehst du hier rum und quatscht mit diesem dahergelaufenen Kerl da!“
„Komm zu dir, Floyd!“
„Komm zu dir Floyd? Ich werd dir gleich zeigen – von wegen komm zu dir! Ich kann’s nicht aussteh’n, wenn du dich mit fremden Kerlen abgibst. Und was Sie betrifft, Mister ...“
Mit einer Stimme, viel zu schrill, um echt zu sein, rief Rhonda dazwischen: „Floyd, Ben Stryker ist ein alter Freund von mir. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Ben, das ist mein Mann – Floyd LaVerne.“
Ben Stryker warf dem Mann einen messerscharfen Blick zu. Ihm gefielen weder der herablassende Ton noch der Mann. Folglich dachte er nicht im Traum daran, jetzt einzulenken. Seine Stimme klirrte eisig, als er sagte: „Sie mögen Rhondas Ehemann sein, so weit, so gut, Mister. Aber zügeln Sie Ihr loses Maul. Ich bin nicht der Mann mit einer großen Geduld. Ist das deutlich angekommen?“
Mit dieser scharfen Zurechtweisung schien Floyd LaVerne nicht gerechnet zu haben. Ein großer Teil von seiner Überheblichkeit schmolz wie Butter in der Sonne, und in seinen Augen flackerte es unsicher auf. Um seine Mundwinkel begann es zu zucken. Schließlich hielt er Strykers zwingendem Blick nicht lange stand. Er hob beschwichtigend die Hände nach oben. „Schon gut, Stryker. Machen wir keine große Sache daraus. Manchmal geht mein Temperament halt etwas mit mir durch.“
Er versuchte, die Sache mit einem schiefen Lächeln abzutun. Dieses Lächeln war allerdings so falsch wie fünf Asse beim Pokern. Ben Stryker erkannte es in den Augen des Mannes. Denn darin tanzte der Teufel.
„Dann halten Sie es besser im Zaum“, raunte er LaVerne zu und beachtete den Mann nicht weiter. Er richtete sich an Rhonda, tippte mit dem Zeigefinger an die Hutkrempe. „Alles Gute, Rhonda. Nett, dich mal wiedergetroffen zu haben.“
Sie hatte etwas auf den Lippen, ließ es aber unausgesprochen.
Ben zog den Falben herum, lenkte ihn auf die Straße zurück und ritt aus der Stadt.
*
Floyd LaVerne starrte Ben Stryker eine kurze Weile hinterher. Sein hübsches, fast weibisch wirkendes Gesicht glich in diesen Augenblicken eher einer wutverzerrten Fratze. Die Zurechtweisung Strykers fraß sich wie eine gallige Säure durch seine Därme.
Er sandte einen wilden Blick zu Rhonda hinüber.
„Alter Bekannter, was? Der hat ’n ziemlich loses Maul, dieser Revolverheld. Das nächste Mal werde ich ...“
„Gar nichts wirst du, Floyd LaVerne. Du hast nur bekommen, was du verdient hast. Es gab keinen Grund, dich wieder mal wie ein wilder Büffel aufzuspielen. Deine verdammten Eifersuchtsszenen – ich habe sie so satt!“
„So? Dann hör endlich damit auf, jedem dahergelaufenen Kerl schöne Augen zu machen. Oh, ich weiß Bescheid, meine Liebe! Hinter deiner Fassade, die du hier jedermann glauben machen willst, steckt was ganz anderes. Mich täuschst du nicht. Ich weiß, wie du wirklich bist. Ja, ich weiß Bescheid, du Luder.“ Seine Hand zuckte vor und legte sich wie ein eiserner Griff um ihren Oberarm. „Mir setzt du keine Hörner auf. Mir nicht, hörst du?“
LaVerne verstärkte seinen Griff. Rhondas Körper zog sich zusammen, die Augen weiteten sich. „Lass mich los!“, stieß sie gepresst hervor. Schmerzverzerrt starrte sie ihm ins Gesicht. LaVerne dachte nicht daran, den Griff zu lockern. Er fletschte die Zähne, drückte noch fester zu. „Ich bin dein Ehemann! Vergiss das nicht – niemals!“
„Du sollst mich ...“
Eine kehlige Whiskystimme drang zu ihnen heran: „Hallo, ihr beiden. Ist doch wirklich ein mächtig heißer Tag heute, was?“