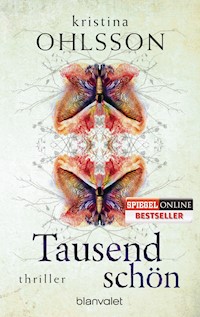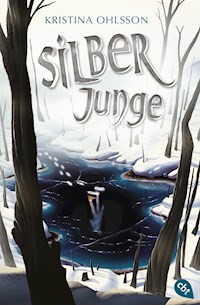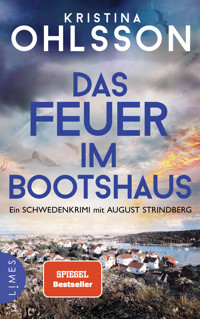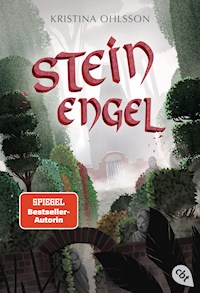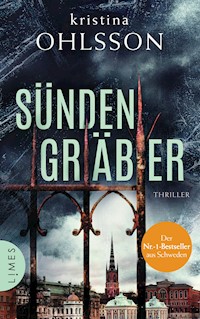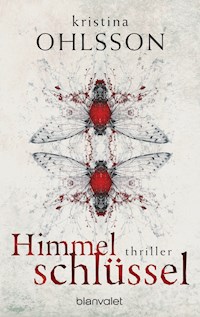9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Martin Benner
- Sprache: Deutsch
Ein Antiquitätengeschäft voller Kostbarkeiten. Ein toter Freund mit einem fragwürdigen Testament. Und eine Ermittlung, die sich gewaschen hat ... Martin Benners neuer Fall!
Anwalt Martin Benner liebt Kostbarkeiten, allen voran Frauen, Wein und Antiquitäten. Als sein Freund Henry stirbt, hinterlässt er Martin eine Überraschung – seinen Anteil an Henrys Antiquitätengeschäft in New York. Doch Martins Freude ist kurzlebig: Ein Mann sucht ihn auf, der behauptet, Henry sei nicht an einer Krankheit gestorben, sondern wurde Opfer eines Mordes. Bald wird Martin in eine fiebrige Jagd verwickelt, in der es die Wahrheit zu finden gilt. Wer war Henry Schiller? Und was ist an dem Tag geschehen, als er starb?
Alle Bücher der Serie:
Schwesterherz. Martin Benner 1
Bruderlüge. Martin Benner 2
Blutsfreunde. Martin Benner 3
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Anwalt Martin Benner liebt Kostbarkeiten, allen voran Frauen, Wein und Antiquitäten. Als sein Freund Henry stirbt, hinterlässt er Martin eine Überraschung – seinen Anteil an Henrys Antiquitätengeschäft in New York. Doch Martins Freude ist kurzlebig: Ein Mann sucht ihn auf, der behauptet, Henry sei nicht an einer Krankheit gestorben, sondern Opfer eines Mordes geworden. Bald wird Martin in eine fiebrige Jagd verwickelt, in der es die Wahrheit zu finden gilt. Wer war Henry Schiller? Und was ist an dem Tag geschehen, als er starb?
Autorin
Kristina Ohlsson, Jahrgang 1979, arbeitete im schwedischen Außen- und Verteidigungsministerium als Expertin für EU-Außenpolitik und Nahostfragen, bei der nationalen schwedischen Polizeibehörde in Stockholm und als Terrorismusexpertin bei der OSZE in Wien. Mit ihrem Debütroman »Aschenputtel« gelang ihr der internationale Durchbruch und der Auftakt zu einer hochgelobten Thrillerreihe um die Ermittler Fredrika Bergman und Alex Recht, die mit »Sündengräber« spektakulär ausklingt. Neben der Veröffentlichung zahlreicher Jugendbücher schuf Kristina Ohlsson außerdem einen neuen Ermittler: Anwalt Martin Benner, der in den Bestsellern »Schwesterherz«, »Bruderlüge« und »Blutsfreunde« die Herzen von Ohlssons Lesern weltweit im Sturm erobert hat.
Von Kristina Ohlsson bereits erschienen:
Aus der Serie mit Fredrika Bergman und Alex Recht:
Aschenputtel
Tausendschön
Sterntaler
Himmelschlüssel
Papierjunge
Sündengräber
Aus der Serie mit Martin Benner:
Schwesterherz
Bruderlüge
Blutsfreunde
Kristina Ohlsson
Blutsfreunde
Thriller
Deutsch von Susanne Dahmann
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Henrys Hemlighet« bei Pirat Förlag, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © by Kristina Ohlsson 2019
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Leena Flegler
Umschlaggestaltung: Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Mark Owen/Trevillion Images; plainpicture/Tim Robinson
BL · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26169-6V001
www.limes-verlag.de
Vor der Verlobung
So sah mein Leben vor der Verlobung aus: Ich hatte fast alles. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre es anders gewesen – ich hatte es verdammt gut. Weil ich einmal um ein Haar alles verloren habe, bin ich jemand, der spürt, wenn er glücklich und erfolgreich ist. In den Jahren vor der Verlobung hatte vieles gepasst. Auf beinahe magische Weise war es mir gelungen, das Beste von fast allem miteinander zu kombinieren. In Stockholm war ich immer noch als Verteidiger gefragt und besaß meine eigene gut laufende Kanzlei. Zudem hatte ich aus zwei meiner großen Interessen im Leben – teure Weine und Antiquitäten – ein Geschäft gemacht, und dieses Geschäft betrieb ich am liebsten in New York. Außerdem besaß ich ein schönes Haus draußen in Djursholm und eine Stadtwohnung. Und ich hatte mein Kind: ein bildschönes und richtig nettes Kind, das die zweite Klasse der Englischen Schule in Stockholm besuchte.
Das waren die Eckdaten, das war das große Ganze: die perfekte Grundlage, um das Leben zu genießen. Dann kam jener ewig lange Winter, und nichts war mehr wie zuvor. Bis weit in den Mai hinein lag Schnee und verstärkte die Untergangsstimmung, die mein Leben in der Zeit bestimmte.
Alles in allem kann man die Missgriffe und Fehleinschätzungen, die ich damals beging, in zwei niederschmetternden Feststellungen zusammenfassen: Zunächst einmal bin ich ein Mann, der Schwierigkeiten anzieht. Und wenn ich »Schwierigkeiten« sage, dann meine ich nicht die Art, von der die große Mehrheit heimgesucht wird. Ich gerate in Situationen, die ebenso unbehaglich wie unwahrscheinlich sind. Es ist, als könnte ich keinen Erfolg mein Eigen nennen, ohne zuvor durch die Hölle gegangen zu sein.
Zum anderen sollte man niemals darauf vertrauen, dass das Grenzland zwischen dem zu Erwartenden und dem Unwahrscheinlichen zu schmal wäre, um sich darin aufzuhalten, im Gegenteil: Es ist weit wie die Wüste Sinai. Und gerät man erst in dieses Grenzland, dann ist es im Grunde unmöglich, dort wieder rauszukommen. Deshalb möchte ich eines nachdrücklich betonen: Wir vermögen die Launen des Zufalls nicht zu steuern. Glauben Sie mir, ich hab es versucht und bin gescheitert. Ich habe dafür bezahlt. Und zwar teuer.
So. Das Wichtigste ist gesagt. Lassen Sie mich deshalb wieder zu der Verlobung zurückkehren. Vor der Verlobung lebte ich ein Leben, das der Perfektion gefährlich nahekam. Dann ging alles binnen eines Wimpernschlags zum Teufel, und statt zur Hochzeit durfte ich auf eine Beerdigung gehen.
Teil I»Da hängt was im Kirschbaum.«
1
Der Schnee war es, der den Tod mit sich brachte. Pflaumengroße Schneeflocken fielen über Stockholm, und es sah herrlich winterlich aus. Seit Neujahr war es ununterbrochen kalt gewesen und hatte geschneit; inzwischen hatten wir Ende April. Sämtliche Züge des öffentlichen Nahverkehrs, die eine noch so kurze Fahrtstrecke überirdisch fuhren, standen stunden-, ja tagelang still. Die Fernzüge sowieso. Draußen in den Schären war das Eis so dick, dass die Inselbewohner der Inseln vom Festland abgeschnitten waren. Zu allem Übel zog ein Schneesturm über die Hauptstadt und brachte den Flugverkehr in Arlanda zum Erliegen.
Der Mensch braucht seine Prüfungen und Widerstände, doch auf ebendiesen Schneesturm hätte ich gut verzichten können. Ich erwartete nämlich Besuch aus New York, und jetzt sah es ganz so aus, als würden meine Besucher nicht wie geplant in Stockholm landen können. Das war ungeschickt; wir sollten einer Trauerfeier beiwohnen, und dergleichen Veranstaltungen kann man nun mal nicht verschieben. Das sagte die Frau zu mir, die die Feier ausrichten sollte, die Bestatterin, wie sie sich offiziell nannte. Ich fand, sie klang gelangweilt und teilnahmslos.
»Natürlich ist es schade, wenn nicht alle dabei sein können«, sagte sie. »Aber so ein Termin lässt sich nicht einfach kurzfristig verlegen.«
»Gilt das auch, wenn einer von denen, die nicht erscheinen können, der Verstorbene ist?«, fragte ich.
»Wie bitte?«
Ich konnte ihre Verwunderung nachvollziehen. Es ist eher selten, dass Verstorbene per Flugzeug zu ihrer eigenen Beerdigung anreisen. Aber Henry Schiller war nicht wie andere, das war er schon im Leben nicht gewesen. Das kann ich, ebenso wie seine Ehefrau Magda, bestätigen.
Ich hatte Magda und Henry einige Jahre zuvor auf einer Auktion in London kennengelernt. Es war meine allererste gewesen, und ich war dort, um ein Puppenhaus für meine Tochter Belle zu kaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir ins Gespräch kamen, aber das Ehepaar Schiller war es, das mich zu der nachfolgenden Weinauktion mitnahm, und ohne die beiden hätte ich nie ernsthaft angefangen, mich für Antiquitäten zu interessieren. Die Begegnung mit Magda und Henry sollte mein Leben verändern.
Und jetzt war Henry tot.
Kurz nach seinem siebzigsten Geburtstag war er in einem Krankenhaus in New York gestorben. Er und Magda hatten seit Jahrzehnten in New York ihr gemeinsames Zuhause gehabt. Beide stammten ursprünglich aus Europa, aber das war wie ausradiert. Magda erwähnte ihre Kindheit in Spanien nur in Ausnahmefällen, und noch viel seltener sprach Henry von seiner französischen Mutter und dem schwedischen Vater. Das meiste war wie ausgelöscht, in ihrem Leben zählte nur noch, was ihnen als Erwachsenen widerfahren war. Doch dann starb Henry, und es veränderte sich etwas. Magda beschloss, sämtliche Freunde zu einer weltlichen Trauerfeier in Schweden einzuladen und ihren Mann dort kremieren zu lassen. Ich war erstaunt. Warum nicht in New York?
»Das wollte Henry nicht«, erklärte Magda, als ich sie fragte. »Und ich wollte seinen Tod nicht erst bekannt machen, wenn er schon begraben worden wäre. Besser, wir tun so, als wären Henrys Wurzeln in Schweden tiefer gewesen, als man es sich vorstellen kann. Ich meine, es werden doch sowieso nur wenige wegen einer Trauerfeier nach Stockholm reisen.«
Grundsätzlich ein kluger Plan, allerdings hatte sie nicht die heftigen Schneestürme in Betracht gezogen.
»Es wird schon gut gehen, Martin«, sagte Magda, als sie mich vom Flughafen in New York anrief.
Und das tat es auch – in gewisser Weise. Der Schneesturm zog weiter, Arlanda öffnete wieder. Magdas und Henrys Flugzeug landete bloß mit acht Stunden Verspätung.
»Das hätte ins Auge gehen können«, sagte Magda, als ich sie in Arlanda abholte.
Wir sprechen Englisch miteinander, so ist es schon seit unserer ersten Begegnung. Magda hat zwar mal in Schweden gearbeitet, aber ihr Schwedisch ist schlecht, und das Gleiche gilt für mein Spanisch.
»Aber ihr habt es geschafft«, erwiderte ich. »Das ist die Hauptsache.«
Ich möchte nicht verschweigen, dass Henrys Tod auch eine gute Seite hatte. Magda würde endlich aus dem Schatten ihres Mannes heraustreten können. Und ich selbst hätte die Möglichkeit, mir einen Traum zu erfüllen: Ich sollte Teilhaber ihres Antiquitätengeschäfts werden. Es war Henrys ausdrücklicher Wunsch gewesen, dass ich seinen Anteil übernehmen sollte, wenn er gestorben wäre, und Magda hatte dem Arrangement ihren Segen erteilt. Es gab keine direkten Erben, und Magda wollte das Unternehmen nicht allein führen. Außerdem brauchte sie das Geld, und da war es besser, Henrys Anteil an jemanden zu verkaufen, den sie beide gekannt und gemocht hatten, als an einen Fremden.
Selbstverständlich erwähnten wir weder ihre nicht sonderlich gute Ehe noch das Geschäftliche, als wir zur Trauerfeier fuhren. Der Raum – einer der Ausstellungsräume der Auktionsfirma Bukowskis – war halb voll. Magda und ich setzten uns in die erste Reihe. Ich warf einen Blick über die Schulter. Ein paar vereinzelte Freunde aus New York waren nach Stockholm geflogen, um der Feier beizuwohnen, doch insgesamt kannte ich nur wenige.
Ein grauhaariger Mann weckte meine Aufmerksamkeit. Er saß auf einem Platz am Gang und starrte vor sich hin. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, nickte er kurz. Ich erwiderte das Nicken.
Ich kannte ihn nicht, aber offenbar wusste er, wer ich war.
Als Henry starb, hatte ich Magda und ihn seit zwei Jahren gekannt. Doch erst als ich erfahren hatte, dass Henry unheilbar an Krebs erkrankt war, dämmerte mir, wie ihrer beider Leben in Wahrheit aussah. Ich erinnere mich noch gut daran: an jenes Gespräch mit Henry, die kurzen Sätze, die Unmissverständlichkeit.
Er hatte Krebs.
Er würde sterben.
Und er hoffte, dass ich Magda eine Stütze wäre, sobald er nicht mehr da wäre.
Fassungslos hatte ich mit dem Hörer in der Hand dagesessen.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, hatte ich erwidert. »Tut mir sehr leid, dass du so krank bist, Henry.«
»Ich bin wie alle anderen«, hatte er bloß gesagt. »Ich bekomme, was ich verdient habe.«
Ich bekomme, was ich verdient habe.
Irgendwas an seinem Tonfall machte mich hellhörig. Wie viele Menschen glaubten bitte, dass sie es verdient hatten, einen ebenso schrecklichen wie zu frühen Tod zu sterben?
Nicht viele. Aber Henry schon.
»Was redest du für einen Blödsinn«, entgegnete ich, hauptsächlich weil es in der Leitung so still geworden war. »Warum solltest du das hier verdient haben?«
»Weil ich ihr ein Kind verweigert habe«, antwortete Henry. »Das tut man Frauen nicht an, die nie die Hoffnung aufgeben.«
Dann beendete er das Gespräch, indem er mir ein schönes Wochenende wünschte und seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass wir uns bald wiedersehen würden.
Wir schafften es nur noch bei zwei Gelegenheiten, beide Male in New York. Als er letztmals nach Schweden reiste, war er bereits tot. Und da waren wir nun.
Ein Cellist begann, eins der bekannteren Stücke von Bach zu spielen – eines, das alle wiedererkennen, ohne genau zu wissen, wie es heißt. Magdas Schultern sackten nach unten, als die Musik durch den Raum wehte. Sie wirkte müde, aber gefasst, ungefähr so wie ich selbst. Leute wie ich passen nicht in religiöse Zusammenhänge, deshalb war ich froh über Magdas Entscheidung für eine weltliche Trauerfeier. Ich liebe alles, was die Kirche im Lauf der Jahrhunderte verachtet und verdammt hat. Sex ohne den Gedanken an Ehe. Teure Weine. Teure Gewohnheiten überhaupt.
Trägheit.
Völlerei.
Neid.
Nenn mir eine Todsünde, und ich zelebriere sie.
Ich drehte mich erneut nach hinten und versuchte daraufzukommen, wer der Grauhaarige war. Zu meinem Erstaunen war er verschwunden. Sein Platz war leer.
Seltsam.
Der Cellist hörte auf zu spielen. Ein Chor sang Näher, mein Gott, zu dir. Magda war es gelungen, eine Orgel zu beschaffen – so weltlich war sie nun wieder nicht, dass nicht doch ein Kirchenlied und eine Orgel Platz gefunden hätten –, und darauf spielte ein betagter Kantor. Und wie er spielte! Ein unerwartet agiler Senior, der mit solcher Kraft in die Pedale trat, dass man fast den Eindruck hatte, er versuchte, Strom für ein ganzes Stadtviertel zu erzeugen. Bis die Bestatterin mit ihrer Grabrede begann, hatte ich den Grauhaarigen vergessen.
Als wir Bukowskis verließen, lag im Berzeliipark glitzernd und weiß der Schnee. Diskret angelte ich mein Handy hervor. Keine neuen Nachrichten. Nicht von Lucy, nicht von Belle.
Dann hörte ich Magdas Stimme.
»Jetzt sag ich auch mal was!«
Hinter all den breiten Rücken und Wintermänteln konnte ich sie zwar nicht sehen, aber sie klang erregt. Das hörten die anderen auch, woraufhin die Gruppe sich zerstreute und ich Magda mit dem Grauhaarigen sprechen sehen konnte. Was wollte er denn? Als ihr dämmerte, dass alle anderen sie gehört hatten, lächelte sie betreten und machte ein paar diskrete Schritte zur Seite. Der Mann folgte ihr.
Eilig pflügte ich zwischen den verunsicherten anderen Trauergästen hindurch. Niemand sah aus, als hätte er geweint; aber so war das wohl bei solchen Trauerfeiern, auf denen niemand den Toten richtig gut gekannt hatte.
Bis ich bei Magda ankam, war sie aschfahl im Gesicht. Der Mann war verschwunden.
»Wo ist er hin?«, fragte ich. »Und was wollte er?«
»Das war ein sehr verirrter Mensch«, murmelte sie.
Sie sprach leise, war von dem soeben Geschehenen sichtlich mitgenommen.
»Aber du kanntest ihn?«
»Das kann ich nicht behaupten.«
Sie strich sich übers Haar. Sie trug ein Paar traditionell rot-weiß gemusterte Wollhandschuhe, von denen ich wusste, dass Lucy sie gestrickt hatte. Die Handschuhe waren das einzig Farbenfrohe an ihrer Kleidung.
Mit zusammengekniffenen Augen ließ Magda den Blick über die Leute schweifen, die vor Bukowskis standen. All die Fremden, alle diese Schatten, die sich noch nicht entschieden hatten, wohin sie sich nach der Andacht verziehen sollten.
»Hab ich gesagt, dass Lucy grüßen lässt und bedauert, nicht hier sein zu können?«, fragte ich.
»Mindestens fünfmal. Du wirst doch nicht senil?«
Ich lachte leise, hielt aber weiter diskret Ausschau nach dem Grauhaarigen. Er war nirgends mehr zu sehen.
»Ich nehme mal an, dass Lucy vor der Hochzeit alle Hände voll zu tun hat, oder?«, erkundigte sich Magda.
»Erwähn es nicht.«
Magda bedachte mich mit einem eindringlichen Blick.
»Wie fühlt es sich für dich an – vor dem großen Tag? Alles in Ordnung?«
Was zum Teufel sollte ich darauf antworten? Ich, der immer getönt hatte, dass ich nicht heiraten und nicht nur einer Einzigen gehören wollte – auch wenn ich das weiß Gott versucht hatte.
»Da gibt’s nicht viel zu sagen«, antwortete ich. »Es wird schön. Mit etwas Glück ist diese Schneehölle bis dahin vorbei, und Lucy bekommt ihre Frühlingshochzeit.«
Magda lachte heiser.
Ich trat von einem Bein aufs andere. Die Aussicht auf die Hochzeit erwärmte mich nicht; noch waren es einige Wochen bis dahin, noch konnte man so tun, als ginge es um jemand ganz anderen.
»Wer passt denn heute auf Belle auf?«, fragte Magda.
»Sie ist bei ihrer Oma.«
»Also mit anderen Worten bei deiner Mutter? Marianne.«
»Ja, genau. Ich hab immer noch kein vernünftiges Au-pair gefunden, da musste Marianne einspringen.«
Magda schüttelte den Kopf.
»Au-pair?«, sagte sie. »How continental.«
Ich hätte nicht sagen können, warum es so komisch sein sollte, dass ich ein Au-pair haben wollte. Immerhin hatte ich auch eine Putzfrau und einen Gärtner. Jemand, der Belle versorgen würde, wäre doch nicht minder wichtig. Jemand, der bei uns wohnen könnte, ohne Teil der Familie zu sein. Damit sich endlich die ewige Jagd nach Babysittern erledigt hätte, die mich abends und an manchen Nachmittagen würden ablösen können.
»Am liebsten hätte ich ein Au-pair, das Englisch spricht«, sagte ich. »Du darfst dich gern bei deinen amerikanischen Freunden umhören. Fragen, ob sie jemanden empfehlen können.«
Vielleicht war der Zeitpunkt schlecht gewählt, aber schließlich hatte nicht ich Belle zur Sprache gebracht, sondern sie.
Magda zuckte verächtlich mit dem Kopf. Sie fand, man kümmerte sich selbst um seine Kinder, andernfalls sollte man keine haben.
Als hätte ich mich aktiv für Belle entschieden.
»Vielleicht sollten wir losgehen«, schlug ich vor. »Und dann sollten wir aufhören, so verdammt fröhlich auszusehen. Die Leute glauben noch, wir würden Henrys Tod insgeheim feiern.«
Magda wurde ernst.
»Es gab zu seinen Lebzeiten nichts zu feiern. Warum sollten wir das jetzt tun, nur weil er gestorben ist?«
Es war Zeit aufzubrechen. Magda musste in ihr Hotel und ich nach Hause. Ich hielt den Tesla-Autoschlüssel in meiner Tasche umklammert. Lucy hatte das Auto eine »letzte verzweifelte Junggesellenrebellion« genannt. Sie kaufte mir nicht ab, dass ich mich bei der Entscheidung von meiner Sorge um die Umwelt hatte leiten lassen.
Lucy, Lucy, Lucy.
Der Tesla gab ein Klicken von sich, als ich auf den Funkschlüssel drückte. Im selben Moment räusperte sich jemand hinter mir.
Ich drehte mich um und rutschte fast auf einer vereisten Stelle aus. Es war der Grauhaarige. Ich sah mich in alle Richtungen um. Da waren nur noch er und ich.
»Entschuldigen Sie«, sagte er. »Sie sind doch Martin Benner, oder?«
Er trug einen steingrauen Mantel und einen dunklen Wollschal. Und er sprach Englisch mit starkem Akzent. Spontan tippte ich auf ein spanischsprachiges Land.
»Was wollen Sie?«, fragte ich.
Ich machte mir nicht die Mühe zu bestätigen, dass ich Martin Benner war. Es war offenkundig, dass der Mann wusste, wen er vor sich hatte. Er machte einen Schritt in meine Richtung. Ich blieb auf der vereisten Stelle stehen. Besser, ich rührte mich nicht.
»Nur eine Frage«, sagte er. »Wer arrangiert bitte für einen Mann der Kirche eine weltliche Trauerfeier? In einem Land, das niemals seins war? Er ist nicht an Krebs gestorben. Er wurde ermordet. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören – keine der schlimmen Anschuldigungen, vor denen Henry flüchten musste, entsprach der Wahrheit.«
Ich bin nur selten sprachlos, aber diesmal fehlten mir die Worte.
»Wovon zum Teufel reden Sie?«, fragte ich schließlich.
»Nur von der Wahrheit«, erwiderte der Mann.
Dann reichte er mir seine Karte.
»Melden Sie sich, wenn Sie so weit sind.«
Anschließend schlenderte er gemächlich davon.
2
Wenn man längere Zeit als Anwalt gearbeitet hat – und das habe ich –, dann ist einem klar, dass man in diesem Geschäft Gefahr läuft, eine Menge durchgeknallter Personen anzuziehen. Manchmal stehen sie plötzlich auf Partys neben einem und flüstern, sie wüssten, wer sowohl Kennedy als auch Palme erschossen hat. Manchmal wollen sie einem weismachen, dass Katastrophen wie zum Beispiel der Untergang der Estonia nie stattgefunden hätten. Und manchmal möchten sie einem sogar erzählen, warum. Aber alles in allem haben sie nur selten etwas Vernünftiges zu berichten. Ich entschied mich umgehend dafür, dass der Grauhaarige, der mich nach Henrys Beerdigung angesprochen hatte, einer dieser Durchgeknallten gewesen sein musste. Denn mal im Ernst – wer hätte Henry ermorden wollen?
Laut der Karte, die mir der Mann gegeben hatte, hieß er Alejandro Ortega, und abgesehen von seinem Namen, stand da lediglich eine Mailadresse. Ich hatte nicht vor, zu ihm Kontakt aufzunehmen.
Magda blieb nach der Feier noch ein paar Tage in Stockholm. Sie hatte Dinge zu erledigen, und wenn wir uns trafen, hätte es sich verfehlt angefühlt, sie auf Alejandro Ortegas kuriose Behauptungen anzusprechen. Magda und ich sollten schließen Geschäftspartner werden. Unsere Gespräche drehten sich fast ausschließlich um die Übernahme von Henrys Anteil an ihrem gemeinsamen Laden. Der Papierkram wollte kein Ende nehmen. Ich würde in naher Zukunft nach New York reisen müssen, um massenhaft Dokumente zu unterschreiben.
Als es für Magda an der Zeit war, nach Hause zu reisen, brachte ich sie zum Flughafen. Noch immer lag Schnee auf den Hausdächern und offenen Feldern, als wir nach Arlanda fuhren. Wir sprachen über die Zukunft, kommende Ausstellungen und Auktionen, über die Hochzeit und über Belle.
Ich parkte den Tesla so nahe am Eingang wie möglich.
»Ich muss dir etwas gestehen«, sagte Magda, als ich den Motor ausschaltete.
Ich schwöre – für eine Sekunde gefror ich zu Eis. Wäre dies der Augenblick, da meine zukünftige Geschäftspartnerin den Mord an ihrem Mann gestehen würde?
»Ich schäme mich, weil ich die Nase gerümpft habe, als du gesagt hast, du wolltest ein Au-pair«, erklärte sie. »Also hab ich getan wie geheißen, hab ein paar SMS verschickt und mich bei meinen jüngeren Bekannten umgehört. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Eine Freundin hat mir einen jungen Mann empfohlen, der sofort bei dir anfangen könnte. Natürlich nur, wenn du ihn haben willst.«
Es wurde still im Auto.
Ich atmete aus und lachte.
»Mein Gott, hast du mir einen Schrecken eingejagt!«
»Wieso einen Schrecken?«
Ich schüttelte den Kopf und versuchte zu verarbeiten, was sie gerade gesagt hatte. Ein junger Mann, der bei mir …
Ein Mann?
»Ich kann doch wohl kein männliches Au-pair haben!«
»Warum denn nicht?« Sie verdrehte die Augen. »Manchmal bist du wirklich rückschrittlich – denk doch mal nach! Du kannst doch wohl erst recht kein weibliches Au-pair haben – das würde nicht funktionieren. Nicht, wenn du sie auch nur im Geringsten hübsch fändest. Das wäre übrigens mein entscheidendes Argument gegen dieses ganze … Projekt.«
»Entschuldige, wenn ich dir widerspreche, aber einen derart schlechten Charakter hab ich nun wirklich nicht. Ich könnte keine Beziehung zu einer jungen Frau haben, die in meinem Haus wohnt, um auf mein Kind aufzupassen.«
Magda zog eine Augenbraue hoch.
»Nicht?«
Ich kapitulierte.
»Okay, vielleicht könnte ich es«, sagte ich. »Ein junger Mann wäre womöglich besser.«
Magda öffnete die Handtasche auf ihrem Schoß und holte ihr Handy hervor.
»Er heißt Marcel«, sagte sie. »Er ist Franzose und will in Stockholm irgendwas studieren … Hab vergessen, was. Er spricht ausgezeichnet Englisch und Französisch, natürlich, aber auch Schwedisch. Da war irgendwas mit einem schwedischen Verwandten, bei dem er eine Zeit lang gelebt hat oder vielleicht auch … Ist aber auch egal. Wenn du möchtest, bitte ich ihn, sich bei dir zu melden. Er hat die amerikanische Familie, für die er bisher gearbeitet hat, bereits verlassen und sucht derzeit in Stockholm nach einer Unterkunft.«
Ich versuchte, mir vorzustellen, wie der Mensch Marcel aussah. Dreisprachig und bald Student. Möglicherweise mit Verwandtschaftsbeziehungen in Schweden.
»Herzlichen Dank«, sagte ich. »Klingt wie ein Mann mit zahlreichen Talenten. Hoffentlich kommt er mit Belle klar.«
Sie lachte auf und wurde dann ernst.
»Martin, ich kann dir gar nicht genug für all deine Unterstützung danken. Man stelle sich vor – Henry ist nicht mehr da … Ich kann es immer noch nicht fassen.«
Das konnte ich auch nicht.
»Ruf an, wenn etwas ist – egal, was«, sagte ich. »Ich bin für dich da.«
Das Schweigen, das darauf folgte, war die letzte Chance, die sich mir bieten würde. Ich musste sie nach Alejandro Ortega fragen. Alles andere wäre blödsinnig.
»Dieser Mann auf der Trauerfeier«, hob ich an, »der dich so aufgeregt hat … Wer war das?«
Magda erstarrte.
»Ich weiß es nicht.«
»Magda, es war offenkundig, dass du es weißt.«
Ich sprach leise und neutral, sodass es wie eine Feststellung klang und nicht wie der Versuch, einen Streit vom Zaun zu brechen. Wenn ich Teilhaber von Magdas Geschäft werden sollte, dann musste ich alles wissen, was man über ihre Geschäftsbeziehungen wissen konnte. Ich hatte eine Freundin bei der Polizei gebeten, die Datenbanken nach Alejandro Ortega zu durchforsten. Die Freundin hieß Jennifer Dahlén (und manchmal schliefen wir miteinander, aber das ist eine andere Geschichte), und für gewöhnlich reagierte sie schnell auf meine Bitten. Diesmal würde es womöglich noch schneller gehen, weil die Gefahr bestand, dass Alejandro in Wirklichkeit anders hieß, und da gäbe es rein gar nichts über ihn herauszufinden. Außerdem handelte es sich bei ihm höchstwahrscheinlich nicht um einen schwedischen Staatsbürger – oder auch nur um jemanden, der in Schweden lebte –, was es umso schwieriger machen würde.
»Hat er mit dem Geschäft zu tun?«, fragte ich, als Magda nicht antwortete.
»Er hat mit keinem Teil meines Lebens zu tun.«
»Aber Henry kannte ihn?«
»Henry lebt nicht mehr. Es stimmt zwar, dass wir fast fünfundzwanzig Jahre verheiratet waren, aber glaub mir, man kennt einen Menschen nie so gut, wie man denkt. Ich kann dir nicht sagen, ob Henry den Mann kannte oder nicht, ich weiß nur, dass ich ihn nie zuvor gesehen habe, und es ist mir tatsächlich egal, was er hier zu suchen hat oder sich einbildet.«
Das musste reichen. Ich glaubte Magda. Sie wusste nicht, wer der Mann war.
»Was hat er zu dir gesagt?«, fragte ich. »Was wollte er?«
»Er meinte, jemand hätte Henry ermordet«, antwortete Magda. »Aber das stimmt nicht. Insofern können wir davon ausgehen, dass er nicht ganz bei Sinnen war, oder?«
»So ist es«, pflichtete ich ihr bei.
Magda lächelte.
»Du bist ein guter Mann und Mensch«, sagte sie. »Aber achte darauf, immer dich selbst und deine kleine Familie in den Mittelpunkt zu stellen. Und hör auf, so zu tun, als ginge dich die Hochzeit nichts an.«
Das trieb mir die Schamesröte ins Gesicht.
»Wird es dir zu viel?«, fragte Magda.
»Viel zu viel«, erwiderte ich.
Dann öffneten wir gleichzeitig die Autotüren und traten hinaus in die Kälte.
Ich weiß nicht mehr, wann zum ersten Mal die Rede von Hochzeit war. Aber sobald die Verlobung Tatsache war, war es die Hochzeit auch. Es war irgendwann nach Weihnachten, in der Zeit, als Henry schon krank war, aber immer noch lebte.
Die Trauerfeier war mein mentaler Schutzschild gegen die Hochzeit gewesen. Sobald Magda Schiller Stockholm wieder verlassen hatte, fühlte ich mich völlig schutzlos.
»Ich will eine Frühlingsbraut sein«, hatte Lucy gesagt. »Hoffentlich wird es warm im Mai!«
Lucy bekommt in der Regel, was sie will – doch diesmal sah es ganz so aus, als hätte sie eine Niete gezogen. In meinen finstersten Momenten schob ich die ganze Schuld dem eiskalten Höllenwinter zu. Gleichzeitig nahte die Hochzeit mit Riesenschritten, und mit jedem Tag, der verging, dachte ich seltener daran. Am Ende war es mir fast gelungen, mir einzubilden, dass sie gar nicht stattfinden würde.
Hör auf, so zu tun, als ginge dich die Hochzeit nichts an.
Magdas Worte klangen in den folgenden Tagen in mir nach. Jeden Morgen fuhr ich in die Kanzlei, um nicht der Versuchung zu erliegen, von zu Hause zu arbeiten, weil ich mich auf meine Anwaltschaft konzentrieren wollte; ich traf mich mit Klienten, aß mit Bekannten und Kollegen zu Mittag – und ich war mit Belle zusammen. Ich hatte eine Handvoll Babysitter, die ich bei Bedarf beauftragte, und in den ersten Tagen nach der Trauerfeier war ich jeden Abend in einer neuen Bar. Es war eine belastende Zeit für mich, und ich brauchte das, um auf andere Gedanken zu kommen.
Und es funktionierte. Wo immer ich auftauchte, bekam ich zu hören, wie gut alles für mich laufe; es hatte sich anscheinend herumgesprochen, dass ich Henrys Anteil an dem Antiquitätengeschäft übernehmen würde, und die Leute waren verblüfft, wie viel Erfolg ich mit meinem sogenannten Hobby zu haben schien. Aber der kürzeste Weg zum Herzen eines Mannes geht nun mal über sein Ego – und dieser Weg ist kein schmaler Pfad, sondern eine fette deutsche Autobahn. Zig Spuren und ohne Tempolimit. Ich genoss die Aufmerksamkeit, war aber dennoch erschrocken darüber, was in den ganzen sinnlosen Gesprächen, die ich führte, durch Abwesenheit glänzte.
Denn niemand erwähnte Henrys Tod.
Niemand fragte, wie die Trauerfeier gelaufen war.
Am vierten Tag nach Magdas Abreise parkte ich wie gewöhnlich in der Tiefgarage unter dem Haus, in dem sich die Kanzlei befand. Es ist ein altes, aber nobles Haus mitten in Stockholm, in der Nähe des Stadshuset. Zuvor hatte ich Räumlichkeiten in einem anderen Teil von Kungsholmen gehabt, aber das hier fühlte sich besser an. Der Tesla stand in einem Käfig mit Gittertür, für die man einen Schlüssel brauchte. Das war keine übertriebene Vorsicht; ich weiß einfach, dass mein Auto verdammt attraktiv ist.
Im Fahrstuhl fuhr ich nach ganz oben in die Kanzlei: zwei große Räume von insgesamt fast achtzig Quadratmetern. Einen gedachte ich an einen künftigen Partner der Kanzlei zu vermieten, der andere gehörte mir. Dazu eine hübsch eingerichtete Lounge, in deren Mitte zwei Ausziehsofas und ein Schreibtisch für meinen Assistenten Helmer standen. Er begrüßte mich wie immer mit einem breiten Grinsen.
»Hallo, hallo!«
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und fuhr den Computer hoch.
Es gab einiges zu tun, ich würde Klienten besuchen müssen.
Außerdem rief Lucy an.
»Hallo, Baby«, sagte ich.
»Musst du mich immer so nennen?«
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und legte die Füße auf den Schreibtisch. Meine handgenähten Schuhe waren so blank poliert, dass ich mich fast darin spiegelte.
»Ich hab dich doch schon immer Baby genannt.«
»Und wir haben daran gearbeitet, dass du damit aufhörst.«
Ich grinste. »Dann werden wir wohl noch härter daran arbeiten müssen.«
Die Kanzlei hatte lange uns beiden gehört, bis Lucy auf die Idee gekommen war, »mal was Neues probieren« zu müssen, und sich in einem Scheißunternehmen hatte anstellen lassen. Das war wahrscheinlich der Anfang vom Ende gewesen – und der letzte Schritt hin zur Hochzeit.
Ich hörte Lucy in den Hörer atmen.
»Können wir uns heute Abend sehen?«, fragte sie. »Und bei mir zu Hause zu Abend essen? Es ist immerhin schon eine Woche her, seit wir das zuletzt gemacht haben.«
Ich kratzte mich an der Stirn.
»Ich wäre heute Abend gerne zu Hause«, entgegnete ich. »Ich muss meine Reise nach New York vorbereiten. Und seit der Trauerfeier bin ich im Grunde fast jeden Abend weg gewesen. Sowie Belle eingeschlafen war, hat der Babysitter übernommen. Fühlt sich nicht gut an.«
»Verstehe«, sagte Lucy.
Nein, tat sie nicht. Aber das war nicht allein meine Schuld.
Meine Schuld allerdings war, dass ich nach unserem Telefonat nichts mehr auf die Reihe bekam. Die Unruhe rumorte in mir; es wäre nett, nach New York zu kommen – aber nichts würde sich schöner anfühlen, als die Hochzeit hinter mich gebracht zu haben.
Ein paar Stunden später am Nachmittag klopfte Helmer an meine offene Bürotür.
Manchmal ist er übertrieben rücksichtsvoll.
»Ich wollte nur an das Entwicklungsgespräch erinnern«, sagte er.
Ich sah ihn mit großen Augen an.
»Ihres?«, fragte ich erstaunt.
»Das von Belle«, entgegnete er.
»Verdammt.«
Ich schwöre, Batman wäre nicht schneller von der Kanzlei in Belles Schule gewesen. Ich fuhr, als hätte ich eine kreißende Frau auf dem Rücksitz. Und die ganze Zeit dachte ich darüber nach, ob dies wohl auch eine Aufgabe wäre, die ich an ein zukünftiges Au-pair würde delegieren können.
Es ist wohl besser, wenn ich gleich deutlich mache, dass ich mich nie selbst für ein Kind entschieden hätte. Aber meine Schwester und ihr Mann waren ums Leben gekommen, Belle war Waise, und im selben Moment war mir klar, dass es Loyalitäten im Leben gibt, die so selbstverständlich sind, dass wir uns gar nie die Mühe machen, sie zu benennen. Sie treten lediglich in den ganz schweren Augenblicken des Lebens zutage, aber dafür sind sie da – und zwar um jeden Preis. Belle sollte nicht in einem Kinderheim aufwachsen. Das war ein so natürlicher Gedanke, dass er überhaupt nicht mehr wegzudenken war, sobald er erst an die Oberfläche gekommen war.
»Ich nehme sie«, konnte ich mich noch heute sagen hören.
Damals war sie ein knappes Jahr alt gewesen. Inzwischen – sieben Jahre später – konnte ich mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen.
Nicht alle Eltern fahren in einem Tesla zum Entwicklungsgespräch in der Schule, aber nun habe ich ohnehin nur wenige Gemeinsamkeiten mit anderen Eltern. Ich hasse die Elternabende an Belles Schule, ich hasse das Selbstherrliche und das abtörnende Gefühl, dass es in jeder gegebenen Situation ein Richtig und ein Falsch geben soll und der Teufel denjenigen holen möge, der den Unterschied nicht erkennt. Um niemanden zu verwirren, mache ich aus Prinzip alles falsch, so gibt es weniger Diskussionen.
Doch von Belles Klassenlehrerin erhielt ich jede Menge Lob. Belle liege in allen Fächern weit vorn. Sie sei klug und selbstbewusst und warmherzig.
»Sie ist sehr mitfühlend«, sagte die Lehrerin. »Eine gute Teamplayerin. Sie hat Kampfgeist und Führungskompetenz – das ist eine ungewöhnliche Kombination.«
»Ja, ist es.« Ich nahm an, dass diese Eigenschaften von jemand anderem in der Verwandtschaft stammten. Im engsten Familienkreis sind wir alle Individualisten, aber es ist natürlich schön zu hören, dass Belle diesbezüglich anders ist.
Anschließend holte ich sie aus der Betreuung ab. Sie erzählte mir begeistert vom Ausflug, den sie gemacht hatten. Über uns war der Himmel unheilvoll finster, was mich deprimiert und leicht lethargisch machte.
»Wie wär’s, Belle, wenn wir nach Mallorca ziehen würden?«, schlug ich vor.
Das war eher ein Witz, aber allmählich war ich das schwedische Scheißwetter so richtig leid.
»Die Hochzeit ist doch bald«, sagte Belle erstaunt. »Da können wir doch nicht wegziehen.«
Sie gähnte.
Sechzig Sekunden bevor ich das Auto parkte, durfte sie jetzt nicht einschlafen.
»Deine Lehrerin hat erzählt, dass du supertüchtig in der Schule bist. Das war schön zu hören.«
Eigentlich benutze ich das Wort »tüchtig« nicht gern, aber mir war nichts Besseres eingefallen.
Belle antwortete nicht. Der Wagen glitt die Auffahrt hinauf, und ich drückte auf die Fernbedienung für das Garagentor.
»Belle? Nicht einschlafen.«
Ich sah in den Rückspiegel. Belle saß bleich und mit weit aufgerissenen Augen da und starrte durch die Scheibe.
Was zum …
»Belle?«
Sie starrte weiter hinaus.
»Martin, da ist jemand durch unseren Garten gegangen.«
Ich folgte ihrem Blick und sah, was sie längst bemerkt hatte: Vor dem Haus waren Fußabdrücke im Schnee zu erkennen. Allerdings sah man keine Spuren, die vom Haus weggeführt hätten. Es war, als hätte jemand eine Runde ums Haus gedreht, um sich dann in Luft aufzulösen.
3
Oder um sich auf die Treppe zu hocken.
Im selben Augenblick, als ich erwog, den Rückwärtsgang reinzuhauen und wieder vom Grundstück zu rauschen, sah ich, wie sich eine Gestalt aus dem Schatten vor unserer Haustür löste.
»Bleib sitzen«, sagte ich zu Belle und stieß die Autotür auf.
»Nie im Leben«, erwiderte sie und öffnete ihren Sicherheitsgurt.
Die Gestalt kam langsam auf uns zu. Ich konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, aber die Haltung war gerade, und die Schritte wirkten leicht.
Kurz schoss mir durch den Kopf, dass es für die Kindersicherung in den hinteren Türen anscheinend doch gute Gründe gab.
»Martin?«, fragte die Gestalt. »Martin Benner?«
Eine Männerstimme. Kein Zweifel. Außerdem war der Typ jung.
»Ja, das bin ich.«
Noch ehe unser Besucher nah genug gekommen war, dass ich ihn betrachten konnte, dämmerte mir, um wen es sich handelte.
Der Au-pair …
»Ich bin Marcel.« Und dann: »Magda hat gesagt, es wäre okay, wenn ich mal vorbeikäme.«
Magda, verdammt! Meine Adresse einfach rauszugeben … Oder war das ihre Version von »Ich bitte ihn, sich bei dir zu melden«?
Trotzdem kam ich nicht umhin zu lächeln. Marcel hatte etwas Entwaffnendes, sein Tonfall war sanft, fast singend. An seinem Schwedisch war nichts auszusetzen, trotzdem war der französische Akzent deutlich zu hören. Das Gefühl von Wachsamkeit, das ich zuvor verspürt hatte, löste sich in Wohlgefallen auf.
Ein Au-pair.
Mein Au-pair.
Ein Kindermann anstelle einer Kinderfrau.
Ich musterte ihn von oben bis unten. Er trug eine große grüne Mütze auf dem Kopf und ordentliche Schneestiefel an den Füßen. Ungewöhnlich kleine Füße für einen Mann. Eine vergleichsweise helle Stimme.
Er streifte den rechten Handschuh ab und streckte mir die Hand entgegen. Sein Atem bildete weiße Wölkchen in der kalten Luft.
»Marcel«, sagte er und gab mir die Hand.
»Martin«, erwiderte ich. »Schön, Sie kennenzulernen.«
Belle ruckelte wie eine Verrückte am Türgriff. Ihre Stimme hallte aus dem Auto herüber.
»Lass mich raus!«
»Ich wollte Sie nicht erschrecken«, sagte Marcel.
Er schien ehrlich bestürzt zu sein.
»Kein Problem«, sagte ich.
Marcel sah zum Auto.
»Darf ich?«
Er nickte vielsagend zu Belle, die sich die Nase an der Autoscheibe platt drückte – obwohl sie genau weiß, dass ich das nicht leiden kann – und uns mit großen Augen beobachtete.
Die Augen meiner Schwester.
»Bitte«, erwiderte ich.
Marcel öffnete für Belle die Tür. Sie war misstrauischer als ich, das konnte ich ihr ansehen.
»Du musst Belle sein«, sagte Marcel.
Sie nickte ernst.
»Ich bin Marcel. Schön, dich kennenzulernen.«
Sie gaben einander die Hand. Belle angelte ihren Rucksack aus dem Wagen.
»Ein schönes Haus haben Sie«, stellte Marcel fest.
»Danke.«
Wenn es verschneit war, sah das Haus größer aus als in allen anderen Jahreszeiten.
Belle schielte zu mir rüber. Sie wollte wissen, wer dieser Mann war, der sich Marcel nannte, und wenn sie nicht bald eine Erklärung bekäme, würde sie die explizit einfordern – und zwar lautstark. Ich hatte noch keine Zeit gehabt, sie über meine Pläne zu informieren, uns ein Au-pair zuzulegen, aber ich rechnete auch nicht damit, dass das für sie ein Problem wäre. Belle war es gewohnt, dass ich viel arbeitete. Sie war damit vertraut, dass ich andere zu Hilfe rief, um unseren Alltag auf die Reihe zu kriegen.
Belle schulterte ihren grünen Rucksack und stellte sich dicht neben mich. Eigentlich hatte sie einen rosafarbenen gewollt, aber es war mir gelungen, sie davon zu überzeugen, dass ein grüner besser wäre.
»Grün hat einfach mehr Autorität«, hatte ich gesagt.
»Was ist Autorität?«
»Mit das Wichtigste, was es gibt. Etwas, was einen zum Gewinner macht.«
»Aber ich hab doch massenhaft rosa Sachen.«
»Ja, ich weiß – und die sind auch superschön. Die haben auch richtig viel Autorität. Aber der Trick ist zu mischen, Belle. Du wirst doch wohl nicht zur Schule gehen und komplett rosa aussehen wollen wie Barbapapa, oder?«
Das wollte sie nicht, aber sie hatte beunruhigend lange gezögert.
»Kommen Sie doch für einen Moment mit rein«, sagte ich zu Marcel. »Dann können wir uns ein bisschen unterhalten.«
Er nickte und wartete mit Belle, während ich eilig den Wagen in die Garage fuhr. Auf seltsame Art hatte ich Marcel bereits als Teil meines Lebens akzeptiert; so wie er dort an diesem widersinnig winterkalten Apriltag im Schnee stand, wusste ich einfach: Den wollten wir haben.
Belle nahm meine Hand, als ich die Haustür aufschloss.
»Kennst du ihn?«, fragte sie.
Zwei Schlösser, zwei Schlüssel.
»Nein«, sagte ich.
Zwei Alarmanlagen – eine für draußen, eine für drinnen –, zwei Codes.
Marcel hielt sich im Hintergrund.
»Was hat er hier zu suchen?«, flüsterte Belle.
»Ich dachte, er könnte auf dich aufpassen, während ich arbeite«, erklärte ich ihr.
Sie sah mich entsetzt an.
»Soll ich die Tür zumachen, oder geht dann eine Ihrer vierzehn Alarmanlagen los?«, fragte Marcel.
Er zwinkerte Belle verschwörerisch zu und erhielt ein vorsichtiges Lächeln zur Antwort.
»Kommen Sie ins Warme«, sagte ich.
Ich hätte längst etwas in Sachen Au-pair unternehmen müssen, aber das Leben war aufgrund der Hochzeit und angesichts von Henrys Tod ins Hintertreffen geraten. Alles andere hatte dahinter zurückstehen müssen.
Eigentlich gab es nicht viel zu besprechen. Marcel verbrachte ein paar Stunden mit mir und Belle, und ich bat ihn um eine Kopie seines Ausweises und um ein paar Referenzen. Es genügte mir nicht, dass er einen hervorragenden ersten Eindruck machte; ich wollte wissen, was frühere Arbeitgeber von ihm gehalten hatten, außerdem wollte ich zu diesen Arbeitgebern persönlich Kontakt aufnehmen.
Ich zeigte Marcel die Einliegerwohnung im Souterrain. Eigener Eingang, eigene Pantryküche. Und dann versicherte ich ihm, dass er natürlich auch ein eigenes Auto bekäme.
»Großartig«, sagte er, und seine Augen funkelten.
Er wollte an der Tillskärarakademi, der Modehochschule, Design studieren – Mode und Kleidung waren seine große Leidenschaft. Wir hatten nicht sonderlich viel gemeinsam, aber das war im Grunde sogar eine Voraussetzung für unser Arrangement: Denn wenn er so gewesen wäre wie ich, dann wäre er als Au-pair nicht infrage gekommen.
Als Marcel gehen sollte, gesellte Belle sich wieder zu uns. Sie wollte in der offenen Haustür stehen und winken, wenn er ginge – bei zwei Grad minus und eisigem Wind.
»Nichts da«, sagte ich. »Du kannst vom Fenster aus winken.«
Die Fußabdrücke ums Haus waren im Schnee immer noch zu erkennen. Irgendwas störte mich daran. Warum war Marcel dort herumgestrichen und hatte durch die Fenster gespäht? Hatte er sich nur die Zeit vertreiben wollen? Oder hatte Magda zu ihm gesagt, wir wären ganz sicher zu Hause?
»Wohnt Marcel jetzt bald hier?«, fragte Belle.
»Hoffentlich«, erwiderte ich.
Nachdem ich Belle ins Bett gebracht hatte, ließ ich mich mit einer Tasse Kaffee in der Bibliothek nieder. Die Bibliothek ist ein wunderbarer Ort: mit Einbauregalen, die zusammen mit dem Haus um die vorige Jahrhundertwende entstanden sind. Vor allem aber gibt es darin Kunst im Wert von Millionen. Ich bin ein reicher Mann, der aufgehört hat, an Aktien und Fonds zu glauben und seit geraumer Zeit auf nachhaltigere Investitionen wie Kunst und Antiquitäten setzt. Da ist es auch selbstverständlich, dass ich eine Alarmanlage habe.
Ich schrieb eine SMS an Magda und bedankte mich für ihre Hilfe.
Im nächsten Moment klingelte mein Handy. Ich rechnete damit, dass es Magda wäre, doch der Abend hielt eine weitere Überraschung parat.
»Hallöchen!«
Sofort richtete ich mich auf. Es war Jennifer Dahlén, die Polizistin, die ich wegen Alejandro Ortega angerufen hatte. Die Begegnung mit dem Grauhaarigen hatte ich schon ganz vergessen.
»Dieser Mann, nach dem du gefragt hast«, sagte sie, »zu dem hab ich nichts gefunden …«
Jennifer gehörte zu meinen letzten Freunden bei der Polizei. Die anderen hatten mir aktiv den Rücken gekehrt oder schlicht aufgehört, sich zu melden.
»Einen Versuch war es wert«, sagte ich. »Ich danke dir.«
»So gut wie nichts zu danken. Die Namenssuche hat zwar keinen Treffer ergeben«, fuhr Jennifer fort, »aber vielleicht heißt er ja auch anders.«
Es klang, als wäre sie im Auto unterwegs.
»Ich weiß«, murmelte ich. »Ich wollte es zumindest probiert haben.«
Das Gleiche wollte auch Jennifer, wie es schien. »Lust auf ein Treffen irgendwann?«
Ich sah aus dem Fenster. Ich, der ich nie ein Haus hatte kaufen wollen … Und jetzt saß ich in einer dreihundertfünfzig Quadratmeter großen Villa auf Djursholm. Abendnebel hatte sich in den Garten geschlichen. Es waren keine neuen Fußabdrücke zu sehen.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Aber ich komme gern darauf zurück.«
Jennifer lachte leise.
»Du weißt, meine Tür steht dir immer offen.«
»Nicht ungefährlich«, entgegnete ich.
Dann lachten wir beide. Ich wurde als Erster wieder ernst. Das Telefon vibrierte. Marcel hatte mir per E-Mail eine Passkopie sowie Adressdaten zu seinen Referenzen geschickt.
»Sag mal, könntest du vielleicht noch einen Namen für mich checken?«
»Machst du Witze?«
»Marcel Girard. Mein neues Au-pair. Oder das Au-pair von Belle, um genau zu sein.«
Erneut tönte Lachen aus dem Telefon.
Sie willigte ein, und ich schickte ihr die Ausweiskopie.
Im Hintergrund tutete etwas.
»Ich muss auflegen«, sagte Jennifer. »Ich melde mich wegen deines Au-pairs. Aber du – das wird dich mindestens zwei Drinks im Gondolen kosten.«
»Im schicken Gondolen?«, fragte ich. »Ist das jetzt die neue Polizistenkneipe?«
»Nein, aber ein Ort, an dem mein Mann garantiert nicht auftaucht.«
Wir beendeten das Gespräch. Jennifer würde ihre Drinks bekommen, allerdings nicht an diesem Abend.
Im Garten erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Ein Hase hüpfte quer über die Schneedecke auf die Büsche zu und verschwand im Nebel.
Erst in diesem Moment ging mir auf, was mich die ganze Zeit gestört hatte, noch während ich mich von Marcel verabschiedet hatte – und mein Blick erneut an den Fußabdrücken im Schnee hängen geblieben war.
Marcel hatte kleine Füße. Seine Stiefel waren entschieden kleiner gewesen als meine. Die Fußabdrücke der Person, die eine Runde um mein Haus gedreht hatte, waren eindeutig größer.
4
Die Spuren im Schnee waren bereits in der Nacht nach ihrer Entdeckung Geschichte: Es zog ein neuerlicher Schneesturm auf, der sie von meinem Grundstück fegte, allerdings blieben sie mir im Gedächtnis – als Mahnung, dass Einbrecher und Gangster nicht nur in den Märchenbüchern vorkamen, die ich Belle vorlas. Ich redete mit dem Unternehmen, das sich um die Absicherung meines Hauses kümmerte, und man versprach mir, eine zusätzliche Runde pro Nacht einzulegen. Was immer das bringen sollte.
Marcel zog vier Tage nach unserem Treffen bei uns ein. Es war Sonntag. Ich hatte alles getan, um an dem Jungen einen Haken zu finden – irgendeinen schlecht vertuschten Gefängnisaufenthalt, ein dokumentiertes oder bezeugtes ungesundes Interesse an Kindern. Vergebens. Die Familie, für die er in New York gearbeitet hatte, trauerte um ihn wie um einen verlorenen Sohn. Die Frau benutzte Worte wie »entzückend« und »fleißig« und »geduldig«, wenn sie ihn beschrieb, und obwohl ich die Polizeidatenbanken dreier verschiedener Länder – USA, Schweden und Frankreich – auf den Kopf stellen ließ, fand ich nicht mal eine Ordnungswidrigkeit.
Belle liebte Marcel vom Fleck weg. Und ich auch. Man konnte fast sagen, dass er uns mit seiner ruhigen Art und dem gleichzeitig stets gegenwärtigen Charisma im Sturm erobert hatte. Er kochte fantastisches Essen und war ungeheuer sorgfältig. Nach zehn Tagen fühlte es sich an, als würde er bereits seit Urzeiten in unserem Souterrain wohnen. Und in ungefähr derselben Zeit hatte er einen Großteil meiner Schlipse ausgetauscht: Was Mode und Design anging, hatte er Talent, und das musste genutzt werden. Als er hörte, dass ich während meines New-York-Aufenthalts mit Magda zu einem wichtigen Treffen gehen wollte, riss er die Augen auf.
»Du brauchst einen neuen Anzug. Sofort.«
»Was stimmt nicht mit dem Anzug, den ich habe?«
»Nichts – es ist eher so, dass man stärker auftritt, wenn man sich gut angezogen fühlt.«
Dagegen war wohl kaum etwas einzuwenden, auch wenn nun ausgerechnet Magda niemand war, für die ich mich hätte in Schale werfen müssen.
Als meine Reise nach New York nur mehr wenige Tage entfernt war, fühlte es sich für mich und Belle selbstverständlich an, dass Marcel sich um sie kümmerte.
»Und Oma?«, fragte Belle.
»Willst du lieber zur Oma?«, gab ich erstaunt zurück.
Ich persönlich hätte lieber einen Liter Urin getrunken, als von Marianne beaufsichtigt zu werden, aber mir war schon klar, dass ich so etwas besser nicht zu Belle sagte.
»Nein, gar nicht«, erwiderte sie prompt. »Ich möchte lieber bei Marcel bleiben.«
Es war eine kurze Reise, ich wäre nur knapp drei Tage weg. Nichtsdestotrotz gab ich Marcel sämtliche wichtigen Telefonnummern: sowohl die von Marianne als auch die von Lucy, die ihn bereits kennengelernt hatte und vergötterte.
»Warum nennst du sie eigentlich Marianne?«, fragte Marcel.
»Ich hab nie Mama zu ihr gesagt«, antwortete ich. »Immer nur Marianne.«
»Okay«, erwiderte Marcel.
Das war typisch für ihn. Er stellte nichts infrage. Er nahm alles einfach hin.
Einmal hatte Belle gefragt, ob sie ihre Oma auch Marianne nennen müsse. Die Frage hatte ich verneint, weil ich das nicht für notwendig erachtete. Es verwirrte die Leute ohnehin schon, dass mein Kind zwar meine leibliche Mutter »Oma« nannte, mich selbst jedoch Martin.
»Warum nennt sie ihren Papa denn Martin?«, hatte mal eine Nachbarin gefragt, als wir frisch eingezogen waren.
»Weil ihre Mama meine Schwester war«, hatte ich sie angezischt.
Lucy und ich hätten uns danach fast totgelacht – bis ich erfahren musste, dass meine Nachbarin beabsichtigte, mich beim Jugendamt anzuzeigen. Da blieb uns das Lachen im Halse stecken. Allerdings vermochte ich der Nachbarin schnell zu erklären, auf welcher traurigen Wahrheit mein Witz beruhte: Belles Eltern waren gestorben, und ich – Belles Onkel – hatte das Sorgerecht erhalten. Das ist im Übrigen auch die Erklärung für unsere unterschiedliche Hautfarbe. Ich bin dunkelhäutig, wie mein Vater, und Belle ist weiß wie der Vater meiner Schwester. Seither schämt sich die Nachbarin. Und ich mich auch.
Ich flog an einem Freitag nach New York. Bis zur Hochzeit waren es nur noch acht Tage, und im Grunde war es nunmehr Tatsache, dass Lucys Traum von einer sonnigen Frühlingshochzeit nicht in Erfüllung gehen würde. Nach Aussage der Wetterleute aus Radio und Fernsehen ließ die Frühlingssonne noch auf sich warten.
Am Morgen nach meiner Landung traf ich mich mit Magda, um den Papierkram für das Antiquitätengeschäft zu sortieren. Ich hatte Marcels Rat befolgt und mir einen neuen Anzug angeschafft. Statt im Laden trafen Magda und ich uns bei dem Anwalt, den wir damit betraut hatten, die Unterlagen für den Geschäftsübergang sowie die Zahlungsmodalitäten vorzubereiten. Amerikaner lieben Anwälte. Wenn ich als Anwalt in den USA tätig geworden wäre, dann hätte mein Leben völlig anders ausgesehen. Massenhaft Aufträge, massenhaft Geld und schrecklich wenig Zeit, um dieses Geld auch verjuxen zu können. Zum Beispiel arbeitete Magdas und mein Anwalt, obwohl es Samstag war.
»Das hier fühlt sich richtig an, Martin«, stellte Magda fest, als alles erledigt war, und nahm mich in den Arm.
»Für mich auch«, erwiderte ich.
»Wir treffen uns doch heute Abend auf einen Drink, um zu feiern, oder?«, fragte sie. »Im Laden?«
»Ja, machen wir. Aber erst muss ich noch kurz im Hotel vorbei.«
Magda zog die Augenbrauen hoch.
»Du wohnst wie immer im Plaza?«
»Na klar.«
»Dieser Luxusschuppen …«
»Es ist praktisch«, erwiderte ich, weil ich die Kosten nicht überbetonen, aber auch nicht gleichgültig erscheinen wollte.
Im selben Moment klingelte mein Handy.
»Entschuldige bitte, ich muss nur kurz nachsehen, wer dran ist.«
Es war Lucy.
Ich überlegte kurz, nicht ranzugehen. Ich musste noch diverse Dinge erledigen, ehe ich mit Magda anstoßen würde, und gerade Lucy hatte immer irgendein Anliegen, wenn sie anrief.
Trotzdem ging ich ran.
»Tut mir leid, wenn ich störe«, sagte sie, »aber ich wollte fragen, ob du mir vielleicht einen Gefallen tun könntest.«
»Kann ich in einer Minute zurückrufen?«
Ich sah verstohlen zu Magda.
»Ich schick dir einfach eine SMS«, erwiderte Lucy. »Dann weißt du Bescheid – wenn du willst und Zeit hast …«
»Worum geht es denn?«, hakte ich nach – und zwar unnötig formell, aber ich wollte ihr signalisieren, dass ich nicht allein war.
»Um ein Geschenk«, sagte Lucy.
»Für mich?«, frohlockte ich.
»Für meinen zukünftigen Ehemann.«
Ich legte auf.
»War das Lucy?«, wollte Magda wissen.
Offenkundig war sie nicht so leicht hinters Licht zu führen.
»Yes.«
Magda schüttelte den Kopf.
»Diese Hochzeit …«, murmelte sie.
Mein Handy piepste – SMS von Lucy. Ich überflog eilig, was sie geschrieben hatte.
»Hab bei einer Online-Auktion ein Schachspiel gekauft. Muss 301 Park Ave., New York, abgeholt werden. Ich maile dir die Vollmacht und den Zahlungsbeleg. Tausend Dank! PS: Du kommst doch wohl vor der Hochzeit noch vorbei und schaust dir heimlich mein Brautkleid an, oder?«
Mein Gott, sie gab sich aber auch nicht zufrieden, ehe sie mein Herz gebrochen und fein gemahlen hatte.
Ich konzentrierte mich wieder auf das Wesentliche. Ein Schachspiel. Das klang ja wahnsinnig inspirierend. Außerdem handelte es sich um eine seltsame Adresse – soweit ich wusste, gab es dort nirgends Auktionatoren. Ich runzelte die Stirn. Irgendwas stimmte nicht mit der Adresse, die Lucy mir geschickt hatte.
»Wir zwei sehen uns dann später … Ich muss noch etwas für Lucy erledigen«, teilte ich Magda mit.
»Was denn?«
»Sie meint, ich soll das Brautkleid inspizieren …«
»Inspizieren?«
»Ich bin Best Man«, erklärte ich. »Da macht man so was. Man schaut sich heimlich das Brautkleid an.«
Magda sah mich eingehend an.
»Gib bloß Acht, wenn es um die Liebe geht«, sagte sie. »Noch hast du sie in Reichweite.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich bin kein Mann zum Heiraten«, entgegnete ich. »So ist es nun mal.«
Ehe Magda mit weiteren Einwänden kommen konnte, bestellte ich mir schnell ein Taxi.
5
Als Lucy mich gebeten hatte, ihr Best Man zu sein, hatte ich sofort Ja gesagt. Viele haben mich gefragt, ob es mich nicht störe, dass ich Best Man und nicht Bräutigam wäre, aber es stört mich tatsächlich nicht. Lucy war oder vielmehr ist ohne Zweifel die Liebe meines Lebens, aber das hat ihr nicht genügt, und das verstehe ich.
»Das Beste an dir ist, dass du so echt bist«, hatte Lucy an jenem Abend zu mir gesagt, nachdem sie mir eröffnet hatte, dass sie heiraten wollte. »Du hast mir nie etwas versprochen, was du nicht halten konntest. Du bist genauso warmherzig und genauso rastlos, wie du immer behauptest.«
Dann hatte sie mir über die Wange gestreichelt, und wir haben beide geweint.
Lächerlich.
Absolut unpassend für die modernen Zeiten, in denen wir leben.
Aber jemand musste sich schließlich der Gegenwart verweigern, und ich war gern bereit, diese Person zu sein.
Allerdings hatte ich nicht allzu viel Lust, als Bote zu fungieren, der ein Geschenk für Lucys Zukünftigen abholte.
Der griesgrämige Taxifahrer schaffte es kaum, guten Tag zu sagen.
»301 Park Avenue, bitte«, sagte ich.
Dann kämpfte ich mit dem Sicherheitsgurt.
»Was haben Sie denn da verloren?«, wollte der Fahrer wissen.
»Muss was abholen«, erwiderte ich.
Der Taxifahrer sah mich im Rückspiegel an.
»Wie heißt der Laden, zu dem Sie wollen?«
»Wenn ich das wüsste. Ich hab nur die Adresse.«
»Das erklärt einiges.« Der Taxifahrer fuhr von der Fifth Avenue ab.
Die ganze Fahrt über herrschte Schweigen. Das Taxi überquerte eine Kreuzung nach der anderen – man muss die rechten Winkel in New York einfach lieben! – und bog schließlich in die 50th Street ein. Es war warm und schön, und wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich zu Fuß gegangen. Als der Taxifahrer die Park Avenue überquert hatte, fuhr er rechts ran.
»Da wären wir«, sagte er. »Der Eingang zum Hotel ist um die Ecke, aber da kann ich leider nicht halten.«
Ich starrte das verrammelte Gebäude an.
»Äh …«
»Das ist die 301 Park Avenue«, erklärte er.
An der Adresse, die ich von Lucy erhalten hatte, befand sich eins der bekanntesten Hotels der Welt. Zugleich auch das geschlossenste.
Das Waldorf Astoria.
Was zum Henker …
Ich bezahlte die Taxifahrt und stieg aus. Hier musste ein Missverständnis vorliegen – und zwar eins, für das ich keine Zeit hatte. Das Waldorf Astoria war lange mein Lieblingshotel in New York gewesen. Es war in seiner Gänze einfach magisch. Sämtliche Berühmtheiten, die im zwanzigsten Jahrhundert New York besucht hatten, waren in dem Hotel abgestiegen. Wirklich alle. Inzwischen hatte es geschlossen, weil die Zeit es nicht nur eingeholt, sondern weit hinter sich gelassen hatte. Es sollte komplett renoviert werden und für mehrere Jahre geschlossen bleiben.
Verärgert rief ich Lucy an. Sie ging sofort ran.
»Tut mir leid!«
Siehe da, sie hatte mir also die falsche Adresse gegeben.
»Baby, sag mir einfach die richtige Adresse, dann fahr ich stattdessen dorthin.«
»Wie, die richtige Adresse?«
Sie klang ehrlich verwundert.
»Lucy, du schickst mich los, um ein Schachspiel zu holen, und als ich ankomme, befindet sich an der Adresse nur ein geschlossenes Hotel. Das Waldorf Astoria, um genau zu sein.«
»Das ist seltsam«, sagte Lucy. »Das ist die einzige Adresse, die ich habe … Ich dachte, du würdest anrufen, weil du festgestellt hättest, dass es schon abgeholt worden ist?«
»Also, jedenfalls nicht hier.«
»Doch, doch«, sagte Lucy, »Steve hat zumindest nicht erwähnt, dass er woanders hätte hinfahren müssen.«
»Steve?«
»Unser Best Man«, erklärte Lucy.
Meine Verwirrung hätte nicht größer sein können.
»Okay«, sagte ich, »lass es mich kurz zusammenfassen: Du hast für deinen Zukünftigen ein Schachspiel gekauft. Das Schachspiel hast du bei einer Auktion erstanden, und es sollte hier in New York abgeholt werden. Du hast mich gebeten, zum Waldorf Astoria zu fahren, weil das Schachspiel sich hier hätte befinden sollen – und du hast Steve ein und denselben Auftrag erteilt. Korrekt?«
»Korrekt«, erwiderte Lucy. »Steve hat nicht gleich reagiert, deshalb hab ich dich angerufen. Dann hat er doch von sich hören lassen, hat das Schachspiel abgeholt, und du kannst ganz entspannt zurück nach Schweden fliegen.«
Ich konnte ihr anhören, dass sie lächelte. Das Lächeln mancher Menschen ist so.
»Ich dachte, ich wäre Best Man?«, hakte ich nach.
»Martin, du bist mein Best Man. Außerdem ist Steve der beste Freund meines Verlobten.«
Dass sie ihren Zukünftigen aber auch immer nur ausnahmsweise beim Namen nannte! Dass sie ihn ihren Verlobten oder was auch immer nannte, um das Gespräch nicht darauf zu lenken, was er eigentlich war: mein amerikanischer Herzchirurg Michael Grossman. Der Mann, der mir das Leben gerettet hatte, nachdem ich bei einem ziemlich turbulenten Besuch in Texas einen Herzinfarkt erlitten hatte. Hatte im amerikanischen Gesundheitswesen vielleicht sonst noch jemand mit der Liebe seines Lebens bezahlt?
Fahrzeuge dröhnten an mir vorbei, als die Ampel auf Grün sprang. Die Park Avenue ist zwar nicht die meistbefahrene Straße in Manhattan, aber das soll nichts heißen. In den USA wird schlichtweg alles viel zu schnell zu viel – so ist es einfach. Und sie hupen hier die ganze Zeit. Sehr unschwedisch und irritierend.
»Ich melde mich, wenn ich nach Hause komme«, sagte ich zu Lucy. »Ich kann jetzt nicht länger reden.«
»Du weißt, was du mir versprochen hast«, sagte sie.
»Yes. Ich komme vorbei und bewundere dein Kleid.«
Jetzt lächelte sie wieder hörbar.
»Danke«, sagte sie.
Wir legten auf. Auf dem Bürgersteig lief eine große, hübsche Frau an mir vorbei, die auf warmherzige Weise ansprechend wirkte. So was mochte ich.
Was ich nicht mochte, waren lose Fäden. Natürlich war das Waldorf Astoria ein charmanter Ort, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es verriegelt und verrammelt war.
Ich beschloss, eine Runde um das Hotel zu drehen. In den Fenstern hingen riesige Plakate – fast genauso groß wie die Schilder, auf denen zu lesen stand, dass das Hotel geschlossen sei und eine »exciting renovation« erfahre. Nun war »exciting« womöglich nicht gerade ein Wort, das ich sonst mit Renovierungsarbeiten in Verbindung brachte.
Ich spähte in eins der Fenster und versuchte, an den Schildern vorbeizusehen.
Alles finster.
Im nächsten Fenster war es das Gleiche. In dem daneben auch. Ich umrundete die südwestliche Ecke des Hotels und lief die 49th Street entlang. Kurz gesagt, war es verdammt noch mal völlig unmöglich, dass Steve – was für ein lächerlicher Name übrigens! – hier gewesen war und ein Schachspiel abgeholt hatte. Sollte ich die Adresse falsch verstanden haben? Ich sah schnell nach. Nein.
Ich schob das Telefon in die Jackentasche. Als Belle gesehen hatte, wie ich das Jackett anprobierte, hatte sie gesagt, dass ich damit aussähe wie Sherlock Holmes, was ich mal positiv aufgefasst habe. Ich kam zu einem Garagentor. Hier besagte ein Schild, dass Waren für das Hotel angeliefert würden. Privates Parken sei nicht gestattet.
Die Zufahrt stand offen. Es klang, als würde drinnen ein Fahrzeug im Leerlauf stehen, allerdings konnte ich es nicht sehen. Dann verstummte der Motor, und es war nur noch der völlig ausreichende Straßenverkehrslärm zu hören.
Ich blieb in der Nähe des Tors stehen. Eilig suchte ich mit dem Blick die Fassade und den Eingang zur Garage ab. Keine sichtbaren Kameras. Aber Stimmen. Viele. Als hätte das Hotel seine Angestellten zwar teils nach Hause geschickt, ein paar aber in der Garage zurückbehalten.
Rasche Schritte in meine Richtung. Intuitiv wich ich zurück. Kurz darauf stand ein Mann im Tor, sicher zwei Meter lang und mit imponierend breiten Schultern.
»Was wollen Sie?«, fragte er. »Das Hotel ist geschlossen.«
Seine gesamte Erscheinung wirkte auf mich kompromisslos. Als er gefragt hatte, was ich hier wolle, hatte er mir auch durch die Blume zu verstehen gegeben: Wenn ich nicht binnen drei Sekunden verschwunden wäre, würde mir und sämtlichen Nachkommen etwas Schreckliches zustoßen.
»Nichts«, antwortete ich. »Tut mir leid, hab mich geirrt …«
Dass ich aber auch nicht die Klappe halten konnte. Der Hinweis, ich hätte mich geirrt, war völlig unnötig gewesen. Denn natürlich kam die Folgefrage: »Wohin wollten Sie denn?«
Hierher. Genau dahin, wo ich jetzt bin.
Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste den Idioten geben.
»Doch, na ja … Aber es war irgendwie doch hier«, stammelte ich. »Ich sollte hier ein Paket abholen, das nach Schweden soll, aber …«
Er runzelte die Stirn.
»Nach Schweden? Zum Royal?«
Zum Royal?
Ich verstand die Frage nicht und tat, was Belle getan hätte: Ich zuckte mit den Schultern.
Er sah mir die Verwirrung an und kam einen Schritt näher.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Ich sehe ja, dass hier geschlossen ist. Ich muss mich vertan haben.«
Und dann machte ich auf dem Absatz kehrt und ging.
Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Eher, als wäre ich jemand, der zu erfolgreich war, um zu akzeptieren, dass es in New York Orte gab, an denen er nicht willkommen war.
Und es funktionierte.
An der Park Avenue blieb ich an der roten Ampel stehen, drehte mich dann aber erneut um und betrachtete das große Hotel. Sämtliche Fenster gähnten mich schwarz und leer an.
Dieser Steve, mein konkurrierender Best Man, durfte mir gern erklären, wie es ihm gelungen war, Lucys Paket hier abzuholen. Ich selbst jedenfalls war froh, lebend dort weggekommen zu sein.
6
Um kurz vor acht Uhr abends stand ich vor Magdas und Henrys Antiquitätengeschäft – vor Magdas und meinem Antiquitätengeschäft. Der Laden war geöffnet, allerdings waren keine Kunden mehr da.
Ich drückte die Klinke nach unten, und als ich die Tür leicht anstieß, glitt sie lautlos auf. Während Stockholm immer noch im Klammergriff des Winterfrühlings steckte, schien New York von einer Art launischem Altweiberherbst heimgesucht worden zu sein. Ich wischte mir den Regen aus dem Gesicht und stellte meinen Schirm in einen Ständer. Der Laden war verhältnismäßig klein und die Schaufenster sparsam dekoriert, doch beides war offensichtlich gut überwacht. Überall Kameras, dazu ein Einbruchsalarm, der die Räume binnen Sekunden in Dantes Inferno verwandeln konnte.