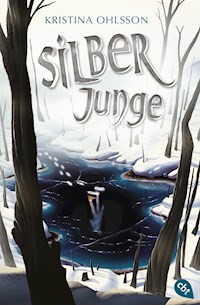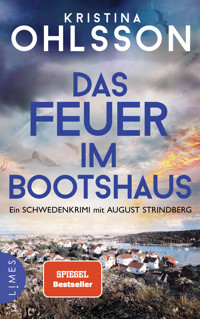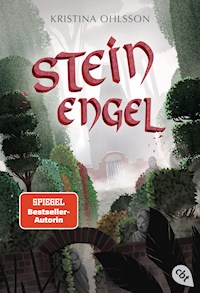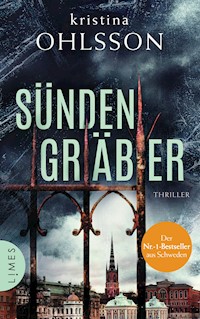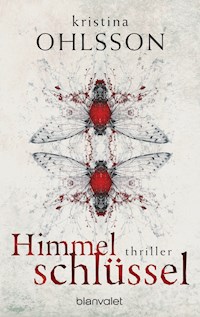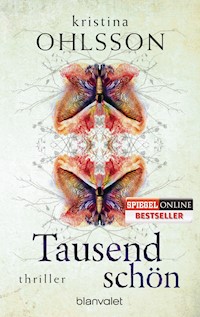
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fredrika Bergman / Stockholm Requiem
- Sprache: Deutsch
Komplex, intelligent und überraschend! Der zweite Fall für die schwedische Ermittlerin Fredrika Bergman.
Ein junges Mädchen wird am Mittsommerabend überfallen und vergewaltigt. Fünfzehn Jahre später stirbt ein Mann bei einem Unfall mit Fahrerflucht, doch niemand scheint ihn zu vermissen. Zeitgleich begehen ein Pfarrer und seine Frau Selbstmord. Oder hat es nur den Anschein?
Das Team um Alex Recht und Fredrika Bergman beginnt zu ermitteln. Nicht nur der augenscheinliche Doppelselbstmord des Ehepaars wirft bald Fragen auf. Die Zeit läuft den Ermittlern davon, doch diejenigen, die ihnen die entscheidenden Hinweise geben könnten, hüllen sich in Schweigen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Kristina Ohlsson
Tausendschön
Thriller
Deutsch von Susanne Dahmann
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
»Tusenskönor« bei Piratförlaget, Stockholm.
1. Auflage
Copyright © 2010 der Originalausgabe by Kristina Ohlsson
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Limes Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Getty Images/Stanislav Pobytov
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-08040-2
www.limes-verlag.de
Am Anfang
Sicherer kann niemand sein
Die Wiese – ihr Grün und die Blumen – hatte immer schon ihr gehört. Es war nicht allzu schwer gewesen, sich zu einigen; sie hatte sich einfach nur einverstanden erklären müssen, dass ihre Schwester die Dachkammer im Sommerhaus bekam. Sie fand es unbegreiflich, wie die Schwester sich auf einen solchen Tausch hatte einlassen können – eine langweilige Dachkammer gegen eine Wiese –, aber sie hatte nichts gesagt, sonst wäre die Schwester womöglich auf die Idee gekommen, mehr zu fordern.
Die Wiese lag dicht und verwildert jenseits der Grundstücksgrenze. Als sie klein war, hatten ihr einige Pflanzen bis zum Kinn gereicht. Jetzt, da sie älter war, reichten sie ihr nur noch bis zur Taille. Mit leichten Bewegungen und suchendem Blick schritt sie durchs Gras und spürte die Blüten und Blätter an ihren nackten Beinen. Die Blumen mussten schweigend gepflückt werden, sonst würde nichts daraus. Sieben Arten mussten es sein, und sie sollten am Mittsommerabend gepflückt und dann unters Kopfkissen gelegt werden. Dann würde sie ihn sehen, den Mann, den sie heiraten würde.
Das hatte sie zumindest als kleines Mädchen geglaubt, als sie zum allerersten Mal an Mittsommer Blumen gepflückt hatte. Die Schwester hatte sie aufgezogen. »Du willst doch nur Viktor«, hatte sie gesagt und gelacht.
Offensichtlich war ihre Schwester schon damals dumm und naiv gewesen. Natürlich war es überhaupt nicht um Viktor gegangen, sondern um einen ganz anderen. Aber das behielt sie lieber für sich.
Seit jenem ersten Mal wiederholte sie die Prozedur jedes Jahr wieder. Natürlich war sie inzwischen zu groß, um den alten Aberglauben für bare Münze zu nehmen. Trotzdem hielt sie daran fest. Außerdem gab es, wie sie nüchtern feststellen musste, nicht gerade viele Möglichkeiten, sich hier anderweitig zu beschäftigen. Jahr für Jahr bestanden ihre Eltern darauf, Mittsommer auf dem Land zu feiern, und jedes Mal wurde es quälender für sie. Diesmal war sie sogar zum Fest ihrer Freundin Anna eingeladen, deren Eltern ein großes Mittsommerfest feierten, zu dem auch die Freunde ihrer Kinder kommen durften.
Aber ihr Vater erlaubte es nicht.
»Wir feiern, wie wir es immer getan haben«, erklärte er. »Zusammen. Und das gilt, solange du bei uns zu Hause wohnst.«
Sie war verzweifelt. Begriff er denn nicht, wie ungerecht das war? Es würde noch Jahre dauern, bis sie überhaupt darüber nachdenken konnte, von zu Hause auszuziehen. Und das illoyale Verhalten der Schwester machte es auch nicht gerade leichter. Die wurde ohnehin niemals zu irgendwelchen Partys eingeladen und vermisste in der Gesellschaft der Eltern auf dem Lande rein gar nichts. Sie schien sogar die komischen Gäste zu schätzen, die nach Einbruch der Dämmerung aus dem Keller gekrochen kamen und sich zu ihnen setzten, sobald Mama die Jalousien herunterließ, damit niemand hereinschauen konnte.
Sie verabscheute sie. Im Gegensatz zum Rest der Familie brachte sie keine Sympathie für sie auf, und sie taten ihr auch nicht leid. Zerlumpte Menschen, die stanken und keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernahmen. Die nichts weiter taten, als sich in einem Keller im Hinterland herumzudrücken. Die sich mit so lächerlich wenig zufriedengaben.
Sie selbst war nie zufrieden. Niemals.
»Du sollst deinen Nächsten lieben«, pflegte ihr Vater zu sagen.
»Man soll dankbar sein für das, was man hat«, sagte ihre Mutter.
Da hörte sie schon lange nicht mehr hin.
Sie entdeckte ihn, als sie gerade die vierte Blume gepflückt hatte. Er musste irgendeinen Laut von sich gegeben haben, sonst hätte sie seine Gegenwart niemals bemerkt. Sie blickte von der Wiese und den Blumen auf und wurde von der Sonne geblendet. Im Gegenlicht war er nur eine dunkle Silhouette, unmöglich zu erkennen oder vom Alter her einzuordnen.
Sie hielt die Hand über die Augen und sah zu ihm hinüber. Doch, sie kannte ihn. Ein paar Abende zuvor hatte sie ihn vom Küchenfenster aus gesehen, als Papa mit den letzten Gästen spät nach Hause gekommen war. Er war größer als die anderen. Nicht älter, aber größer. Kräftiger. Hatte ein markantes Kinn. Er sah aus wie ein amerikanischer Soldat in irgendeinem Film.
Sie standen sich reglos gegenüber und sahen einander an.
»Du darfst nicht hier draußen sein«, sagte sie schließlich und richtete sich gerade auf.
Sie wusste, dass es sinnlos war. Niemand von denen im Keller hatte jemals Schwedisch gesprochen.
Als er sich nicht rührte und auch nichts sagte, seufzte sie und wandte sich wieder den Blumen zu.
Glockenblume.
Margerite.
Er bewegte sich. Sie sah zu ihm zurück und entdeckte, dass er näher gekommen war.
Sie und ihre Familie waren einmal im Ausland gewesen. Ein einziges Mal hatten sie eine normale Urlaubsreise unternommen und hatten auf den Kanaren in der Sonne gelegen und gebadet. Die Straßen dort waren voll herrenloser Hunde gewesen, die hinter den Touristen herliefen. Ihr Vater war sehr geschickt darin gewesen, sie zu verjagen.
»Such!«, hatte er gerufen und einen Stein in die andere Richtung geworfen.
Es hatte immer geklappt. Die Hunde hatten von ihnen abgelassen und waren hinter dem Stein hergesaust.
Der Typ auf der Wiese erinnerte sie an die streunenden Hunde. In seinem Blick lag etwas Unberechenbares, das nicht zu deuten war. Vielleicht auch etwas Böses.
Plötzlich war sie unsicher, was sie als Nächstes tun sollte. Einen Stein konnte sie schlecht werfen. Ein Blick zum Sommerhaus hinüber bestätigte nur, was sie ohnehin wusste: Ihre Eltern und die Schwester waren in die Stadt gefahren, um Fisch für das Mittsommeressen zu kaufen. Noch so eine dämliche alte Tradition, an der ihre Eltern festhielten, um das Bild von einer normalen Familie aufrechtzuerhalten. Wie immer hatte sie abgelehnt mitzufahren, sie wollte lieber in aller Ruhe– und schweigend– ihre Blumen pflücken.
»Was willst du?«, fragte sie verärgert.
Verärgert und mit wachsender Furcht. Sie wusste, wie Gefahr roch; ihr Instinkt hatte sie selten getrügt. Und gerade sagten ihr all ihre Sinne, dass sie die Kontrolle über die Situation behalten musste.
Die Blumen pikten, als sie ihre Hand fester um die Stängel schloss. Nur eine Blume fehlte noch. Das Tausendschön. Kultiviertes Unkraut, wie ihr Vater es nannte.
Der Mann kam schweigend auf sie zu. Dann blieb er stehen, nur noch einen knappen Meter entfernt. Langsam breitete sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus, und im selben Moment wusste sie, wofür er gekommen war.
Die Beine waren schneller als ihre Gedanken. Ihre Nerven funkten Gefahr, und im selben Augenblick fing sie an zu rennen. Die Grundstücksgrenze war weniger als hundert Meter entfernt. Mehrmals rief sie um Hilfe. Doch die Schreie versickerten in der Stille der Wiese. Die trockene Erde dämpfte die Laute ihrer Schritte ebenso wie den dumpfen Schlag, als er sie nach nur zwanzig Metern zu Boden warf, so als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass sie ohnehin nicht entkommen würde, und sie nur hatte laufen lassen, weil es ihn erregte, sie zu jagen.
Sie kämpfte wie ein Tier, als er sie auf den Rücken drehte und derart gezielt und behände an ihren Kleider riss und zerrte, dass ihr in diesem Moment klar war: Das hier musste etwas sein, das er schon einmal getan hatte.
Und als dann alles vorüber war, als sie weinend in dem Krater lag, den ihre Körper in das Grün geschlagen hatten, wusste sie: Darüber würde sie niemals hinwegkommen. In ihrer geballten Faust, die Fingerknöchel von ihrem erfolglosen Kampf blutig gescheuert, hielt sie noch immer den Mittsommerstrauß. Sie ließ ihn fallen, als hätte sie sich daran verbrannt. Die Blumen waren nicht mehr wichtig. Sie wusste, wessen Gesicht sie in ihren Träumen sehen würde.
Als das Auto der Eltern auf das Grundstück fuhr, lag sie immer noch auf der Wiese, unfähig, sich zu erheben. Die Wolken am Himmel sahen aus, als würden sie Fangen spielen. Um sie herum schien alles seinen unveränderten Weg zu gehen, während ihre eigene Welt soeben auf ewig in Scherben geschlagen worden war. Sie blieb auf der Wiese liegen, bis man sie vermisste und sie suchen ging. Und als man sie endlich fand, war sie bereits eine andere geworden.
Gegenwart
»Jedes Tierlein hat sein Essen.
Jedes Blümlein trinkt von Dir.
Hast auch meiner nicht vergessen,
lieber Gott, ich danke Dir.«
Freitag, 22. Februar 2008
Stockholm
Nicht ahnend, dass er bald sterben würde, hielt er mit großem Engagement den Vortrag, der sein letzter werden sollte. Der Freitag war lang gewesen, und doch waren die Stunden schnell verflogen. Die Zuhörer waren aufmerksam, und es wurde Jakob Ahlbin warm ums Herz, wenn sich so viele andere für das Thema interessierten.
Ein paar Tage später, als er sich eingestehen musste, dass alles vergebens war, dachte er noch darüber nach, ob ausgerechnet dieser letzte Vortrag vielleicht ein Fehler gewesen war. War er während der Fragestunde vielleicht zu offen gewesen, hatte er zu erkennen gegeben, dass er geheimes Wissen besaß? Doch eigentlich glaubte er das nicht. Noch im Moment seines Todes war er überzeugt davon, dass die Katastrophe unmöglich hatte verhindert werden können. Als er den Lauf der Jagdpistole an seiner Schläfe spürte, war ohnehin alles zu spät. Und doch empfand er eine große Trauer darüber, dass sein Leben auf diese Weise endete. Wo er doch immer noch so unendlich viel zu geben gehabt hätte.
Jakob Ahlbin hatte im Laufe der Jahre mehr Vorträge gehalten, als er zählen konnte, und er wusste, dass er die Gabe, ein guter Redner zu sein, exzellent genutzt hatte. Der Aufbau seiner Vorträge war oft der gleiche gewesen und die Fragen, die folgten, ebenso; nur das Publikum hatte sich geändert. Manchmal waren die Leute hinbeordert worden, manchmal suchten sie ihn spontan auf. Jakob schätzte beides, er fühlte sich in jedem Fall hinter dem Rednerpult wohl.
Meist begann er damit, dass er Bilder von den Booten zeigte. Zugegeben, ein simpler Trick, dessen man sich jedoch, wie er wohl wusste, nur schwer erwehren konnte. Ein Dutzend Menschen in einem viel zu kleinen Boot, das Tag um Tag, Woche um Woche auf dem Meer dahintreibt, während die Passagiere immer erschöpfter und verzweifelter werden. Und am Horizont die Fata Morgana Europas, wie ein Traum oder eine Fantasie, die für diese Leute doch niemals Wirklichkeit werden sollte.
»Wir glauben, dieses Phänomen wäre neu«, pflegte er einleitend zu sagen. »Wir glauben, es gehörte zu einem anderen Teil der Welt, während uns so etwas nie passiert ist und nie passieren wird.«
Dann wechselte diskret das Bild hinter ihm, und eine Europakarte erschien.
»Aber da greift unser Gedächtnis zu kurz«, seufzte er. »Wir erinnern uns lieber nicht daran, dass es nur ein paar wenige Jahrzehnte her ist, dass Europa in Flammen stand und die Menschen in Panik von einem Land ins nächste flüchteten. Und ebenso vergessen wir, dass vor einem knappen Jahrhundert mehr als eine Million Schweden sich entschieden, ihr Land zu verlassen, um in Amerika neu anzufangen.«
Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar, hielt einen Moment inne und kontrollierte, ob er die volle Aufmerksamkeit des Publikums besaß. Das Bild hinter ihm wechselte erneut, und nun waren da Max von Sydow und Liv Ullmann aus der Verfilmung von Vilhelm Mobergs Auswanderersaga zu sehen.
»Eine Million Menschen«, wiederholte er mit lauter Stimme. »Glauben Sie ja nicht, dass Karl Oskar und Kristina hier die Reise nach Amerika auch nur einen Augenblick lang als etwas anderes betrachteten als eine Strafe. Glauben Sie ja nicht, dass sie nicht in Schweden geblieben wären, wenn sie nur gekonnt hätten. Überlegen Sie, was es mit sich bringen würde, wenn Sie selbst aufbrechen und Ihr altes Leben hinter sich lassen müssten, um ein neues auf einem anderen Kontinent zu beginnen– ohne einen Cent in der Tasche und nur mit den Habseligkeiten versehen, die in eine erbärmliche, verdammte Reisetasche passen.«
Der Fluch war bewusst eingesetzt. Ein fluchender Pfarrer hatte immer etwas Unerhörtes.
Er wusste nur zu gut, wo er mit Widerstand rechnen konnte: manchmal schon in dem Moment, da er das Bild von Karl Oskar und Kristina, den Auswanderern, zeigte; manchmal erst später. An diesem Nachmittag geschah es, nachdem er zum ersten Mal geflucht hatte. Ein junger Kerl aus einer der vorderen Reihen fühlte sich offensichtlich provoziert, und seine Hand schoss hoch, als Jakob eben weiterreden wollte. »Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche«, gellte der junge Mann, »aber dieser Vergleich hinkt doch, zum Teufel!«
Jakob wusste, was jetzt kommen würde, doch um der Wirkung willen runzelte er die Stirn.
»Karl Oskar und Kristina und all die anderen Schweden, die nach Amerika gegangen sind, haben dort schließlich geschuftet wie die Tiere. Sie haben dieses verdammte Land überhaupt erst aufgebaut. Sie haben die Sprache gelernt und sich der Kultur angepasst. Sie haben sich Arbeit gesucht und sich selbst versorgt. Die Menschen, die heutzutage nach Schweden kommen, machen nichts in der Art! Sie wohnen in ihren Ghettos und scheißen darauf, Schwedisch zu lernen, leben von der Sozialhilfe und denken nicht daran zu arbeiten.«
Im Saal wurde es still. Wie ein unguter Geist schwebte Sorge über den Zuschauern: die Sorge, dass es zu einem Eklat kommen könnte, aber auch die Sorge, selbst als jemand entlarvt zu werden, der die Ansichten des jungen Mannes teilte. Gedämpftes Murmeln breitete sich aus, und Jakob wartete ab. Er hatte lange versucht, den Politikern, so sie ihm überhaupt noch zuhören wollten, zu erklären, dass man diese Art von Denken und die Frustration, der der Junge soeben Luft gemacht hatte, nicht totschweigen dürfe.
Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust. Er schob das Kinn vor und wartete auf die Antwort des Pfarrers. Und Jakob ließ ihn warten. Er nahm einen Gesichtsausdruck an, der vermuten ließ, dass das, was da gerade gesagt worden war, ihm völlig neu wäre. Er sah zu dem Bild hinter sich und wandte sich dann wieder den Zuschauern zu.
»Glauben Sie wirklich, dass diese Menschen sich das so vorgestellt haben, als sie hierherkamen? Zum Beispiel diejenigen, die bis zu fünfzehntausend Dollar gezahlt haben, um aus einem in Flammen stehenden Irak nach Schweden zu kommen? Haben die von einem Leben in verkommenen, alten Städtebauprojekten aus den Sechziger- und Siebzigerjahren in isolierten Vororten geträumt? Wo sie zusammen mit zehn anderen Erwachsenen tagaus, tagein in einer Dreizimmerwohnung hocken würden, ohne Beschäftigung und ohne ihre Familien? Allein? Fünfzehntausend Dollar kostet es nämlich für eine Person hierherzukommen.« Er hielt einen langen, geraden Finger in die Luft. »Glauben Sie wirklich, dass diese Menschen sich auch nur in ihren kühnsten Träumen vorgestellt haben, dass sie von uns zu solchen Außenseitern gemacht würden? Dass jemand, der ausgebildeter Arzt ist, im besten Fall noch einen Job als Taxifahrer angeboten bekommt und jemand, der einen niedrigeren Ausbildungsgrad hat, noch nicht einmal das?«
Ohne vorwurfsvoll auszusehen, konzentrierte Jakob seinen Blick auf den jungen Mann.
»Ich glaube, dass die Menschen genauso denken wie Karl Oskar und Kristina. Ich glaube, sie erwarten, dass es so sein wird, wie vor hundert Jahren nach Amerika zu kommen: dass die Möglichkeiten für diejenigen, die bereit sind, sich abzurackern, unendlich sind und dass harte Arbeit sich bezahlt macht.«
Eine junge Frau fing Jakobs Blick auf. Ihre Augen glänzten, und in der Hand hielt sie ein Papiertaschentuch umklammert.
»Ich weiß«, fuhr er langsam fort, »dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die sich bewusst dafür entscheiden, in einer Wohnung in einem Vorort zu sitzen und vor sich hinzustarren, solange sie das Gefühl haben, dass es noch Alternativen gibt. Zumindest habe ich das im Rahmen meiner Arbeit festgestellt«, fügte er hinzu.
Und genau an dieser Stelle ging die Veränderung vonstatten. So wie immer. Das Publikum saß schweigend da und hörte mit wachsendem Interesse zu. Die Bilder wechselten, während sein Bericht von den Einwanderern, die in den letzten Jahrzehnten nach Schweden gekommen waren, Gestalt annahm. Schmerzlich scharfe Fotografien zeigten Männer und Frauen, die in einen Lastwagen gepfercht waren, der durch die Türkei und dann weiter nach Europa fuhr.
»Für fünfzehntausend Dollar erhält ein Iraker heute Pass, Reise und Geschichte. Die Netzwerke der Schlepper erstrecken sich über ganz Europa, und sie haben Verzweigungen in sämtliche Konfliktherde, wo Menschen gezwungen sind, sich auf die Flucht zu begeben.«
»Was soll das heißen, Geschichte?«, fragte eine der Frauen aus dem Publikum.
»Eine Asylgeschichte«, erklärte Jakob. »Die Schlepper erklären dem Flüchtling, was er oder sie sagen muss, um in Schweden eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen.«
»Aber fünfzehntausend Dollar«, fragte ein Mann zögernd, »das ist so unglaublich viel Geld– ist das denn wirklich so teuer?«
»Natürlich nicht«, antwortete Jakob geduldig. »Die Leute, die hinter diesen Netzwerken stehen, verdienen unglaubliche Summen. Es ist ein hart umkämpfter Markt und entsetzlich ungerecht. Gleichzeitig ist trotz der Brutalität verständlich, dass es diesen Markt gibt. Europa ist für Menschen in Not verschlossen. Der einzige Weg hinein führt durch die Illegalität, und er ist von Kriminellen kontrolliert.«
Mehrere Hände winkten, und Jakob beantwortete eine Frage nach der anderen. Am Ende war nur noch die Hand einer jungen Frau erhoben. Das Mädchen mit dem Papiertaschentuch. Ein viel zu langer roter Pony hing ihm wie eine Gardine über die Augen und ließ es fast anonym wirken. Eine Person, die man im Nachhinein nicht würde beschreiben können.
»Gibt es denn niemanden, der sich dieser Sache aus reiner Solidarität annimmt?«, fragte sie. Diese Frage war neu und bei keinem von Jakobs Vorträgen je zuvor gestellt worden. »Es gibt doch massenhaft Organisationen in Schweden und in ganz Europa, die sich mit Flüchtlingen beschäftigen? Ist denn darunter keine, die ihnen hilft, nach Schweden zu kommen?«, fuhr sie fort. »Und zwar auf eine humanere Art als über Menschenschmuggler?«
Die Frage setzte sich fest. Schlug Wurzeln. Jakob zögerte lange, ehe er antwortete. Er wusste nicht recht, wie viel er sagen durfte.
»Menschen dabei zu helfen, illegal nach Europa zu kommen, ist eine kriminelle Handlung. Ganz gleich was wir davon halten, so ist es nun einmal. Und das bedeutet auch, dass es strafbar wäre, sich einer solchen Unternehmung anzunehmen. Das schreckt selbst den nobelsten Wohltäter ab.« Er zögerte wieder. »Aber ich habe gehört, dass diese Haltung im Wandel begriffen ist und dass es inzwischen Menschen gibt, die ausreichend Mitgefühl haben, um Flüchtlingen die Möglichkeit geben zu wollen, für entschieden kleinere Summen nach Europa zu kommen. Doch das weiß ich, wie gesagt, nur vom Hörensagen, es ist nichts, was ich sicher sagen könnte.«
Er machte eine Pause und spürte, wie sein Puls ein wenig schneller ging, während er gleichzeitig ein Stoßgebet aussandte, dass das auch stimmen möge.
Dann schloss er den Vortrag so ab, wie er es immer tat.
»Wie gesagt, ich glaube, dass wir uns davor hüten müssen zu glauben, dass es massenhaft Menschen auf der Welt gibt, die sich wünschen, ohne Arbeit und festen Wohnsitz in irgendeinem Vorort in Schweden zu leben. Hingegen sollten wir über Folgendes gründlich nachdenken: Was tut ein Vater nicht alles, um die Zukunft seiner Kinder zu sichern? Zu welchen Taten ist ein Mensch, der alles verloren hat, bereit, um eines besseren Lebens willen?«
Während Jakob Ahlbin seinen letzten Vortrag beendete und den Applaus des Publikums entgegennahm, landete auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda eine Boeing 737, die nur wenige Stunden zuvor Istanbul verlassen hatte. Der Kapitän, der das Flugzeug zur schwedischen Hauptstadt gelenkt hatte, verkündete, dass die Außentemperatur drei Grad minus betrage und man im Laufe des Abends mit Schnee zu rechnen habe. Er wünschte den Passagieren, die er bei nächster Gelegenheit gern wieder begrüßen wollte, einen guten Tag, und dann bat eine Stewardess die Reisenden, sitzen zu bleiben, bis die Anschnallzeichen erlöschen würden.
Ali lauschte konzentriert, doch er verstand weder das Englische noch die andere Sprache, von der er annahm, dass es Schwedisch war. Der Schweiß lief ihm über den Rücken und ließ das Hemd, das er sich unmittelbar vor seiner Abreise gekauft hatte, auf der Haut kleben. Er versuchte, sich nicht zurückzulehnen, wollte aber auch nicht die Blicke auf sich ziehen, indem er verkrampft und vorgebeugt dasaß, so wie er es bereits auf der Reise von Bagdad nach Istanbul getan hatte. Ein paarmal hatten die Stewardessen ihn sogar gefragt, ob es ihm gut gehe, ob er etwas zu trinken oder zu essen benötige. Er hatte nur stumm den Kopf geschüttelt, sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Oberlippe gewischt und die Augen geschlossen. Und sich gewünscht, dass er bald da sei, dass alles vorüber sei und er sich sicher fühlen könne.
Unruhe bemächtigte sich seines Körpers. Er umklammerte die Armlehnen mit beiden Händen und biss die Zähne aufeinander. Zum sicher hundertsten Mal sah er sich im Flugzeug um und versuchte herauszubekommen, wer wohl seine Begleitung war. Wer war die geheime Person, die angeblich zwischen den anderen Passagieren saß, nur um darauf zu achten, dass er sich richtig verhielt und die Anweisungen befolgte? Ein von seinem Befreier ausgesandter Schatten. Um seiner selbst willen. Wegen der anderen. Damit keine Probleme für die anderen entstanden, die ebenso wie er die großzügige Möglichkeit erhalten sollten, nach Schweden einzureisen.
Der gefälschte Pass steckte in der Brusttasche seines Hemdes. Er hatte ihn erst in seinem Handgepäck gehabt, ihn dann aber herausnehmen müssen, als die Stewardess kam und ihn darauf hinwies, dass er an einem Notausgang saß. Dort durfte man kein Gepäck unter den Vordersitz legen, sondern musste es in den Fächern über dem Kopf verstauen. Ali war in Panik geraten und hatte sich geweigert, den Pass in der Gepäckablage zu verstauen. Mit zitternden Händen hatte er schließlich den Reißverschluss der Tasche geöffnet und versucht, den Pass zu finden, der ganz nach unten gerutscht war. Hatte den harten Umschlag gepackt, ihn in die Hemdtasche geschoben und dann der wartenden Stewardess die Tasche gereicht.
Die Anweisungen für die Ankunft in Schweden waren sonnenklar gewesen. Unter keinen Umständen durfte er schon am Flughafen Asyl beantragen. Außerdem durfte er weder im Flugzeug noch sonst wie vor dem Aussteigen seine Papiere hergeben. Der Pass enthielt ein Visum, das besagte, dass er Geschäftsreisender aus einem der Golfstaaten sei und berechtigt, ins Land einzureisen. Dass er kein Englisch sprach, sollte dabei kein Problem darstellen.
Das Flugzeug rollte von der Landebahn und glitt erstaunlich sanft über den harten Asphalt, in den sich der Frost festgebissen hatte. Nun näherte es sich Gate 37, wo die Passagiere aussteigen sollten.
»Was passiert, wenn es nicht klappt?«, hatte Ali seine Kontaktperson in Damaskus gefragt.
»Mach dir nicht so viele Gedanken«, hatte die Kontaktperson mit einem schmalen Lächeln geantwortet.
»Ich muss das wissen«, sagte Ali. »Was passiert, wenn ich irgendetwas falsch mache? Ich habe schon mit anderen geredet, die an denselben Ort wollen. Das geht normalerweise nicht so.«
Das Gesicht seines Gegenübers hatte sich verfinstert. »Du solltest dankbar sein, Ali…«
»Das bin ich auch«, beeilte er sich zu sagen. »Ich frage mich nur…«
»Frag dich mal nicht so viel«, unterbrach ihn die Kontaktperson scharf. »Und du darfst unter keinen Umständen mit irgendjemandem über dies hier reden. Niemals! Du konzentrierst dich nur auf eine einzige Sache, und das ist, auf die Art, die wir beschlossen haben, nach Schweden zu kommen und dann den Auftrag auszuführen, den wir dir dort erteilen werden. Damit du wieder mit deiner Familie zusammenkommen kannst. Das willst du doch, oder?«
»Mehr als alles andere.«
»Gut. Dann mach dir weniger Gedanken, und streng dich mehr an. Ansonsten läufst du Gefahr, unglücklicher zu werden denn je.«
»Ich kann nicht noch unglücklicher werden, als ich bereits bin«, hatte Ali mit gesenktem Kopf geflüstert.
»Doch, das kannst du«, hatte die Person mit einer Stimme geantwortet, die so kalt klang, dass Ali die Luft angehalten hatte. »Stell dir vor, du würdest deine ganze Familie verlieren, Ali. Oder sie würden dich verlieren. Einsamkeit ist das einzige wahre Unglück. Vergiss das nie, um deiner Familie willen.«
Ali schloss die Augen. Nein, das würde er nicht vergessen. Er erkannte eine Drohung, wenn sie ausgesprochen wurde.
Als er knapp zehn Minuten später die Passkontrolle hinter sich gelassen hatte, musste er erneut daran denken. Von nun an gab es keinen anderen Weg mehr als den Weg fort von jenem Leben, das– da war er sich sicher– Vergangenheit war.
Mittwoch, 27. Februar 2008
Stockholm
Die selbst gebackenen Zimtröllchen, die in der vormittäglichen Kaffeepause serviert wurden, sahen ziemlich merkwürdig aus. Peder Rydh nahm sich zwei auf einmal und stieß seinem neuen Kollegen Joar Sahlin grinsend den Ellenbogen in die Seite. Joar sah verständnislos drein und begnügte sich mit einem Exemplar.
»Pimmel«, erklärte Peder mit einem einzigen Wort und hielt eines der Röllchen in die Höhe.
»Bitte?«, fragte der Kollege und sah ihm direkt in die Augen.
Peder stopfte sich das halbe Teilchen in den Mund und antwortete, noch ehe er fertig gekaut hatte: »Schi schehen ausch wie schlappe Schwänsche.«
Dann ließ er sich neben der Polizeidienstanwärterin nieder, die einige Wochen zuvor auf demselben Stockwerk ihren Dienst angetreten hatte.
Herbst und Winter waren für Peder hart gewesen. Nachdem er den ersten Geburtstag seiner Söhne damit begangen hatte, ihre Mutter zu verlassen, war eigentlich so gut wie alles den Bach hinuntergegangen. Bei der Arbeit nicht, aber privat. Pia Nordh, die Frau, die vorher so gern seine Geliebte gewesen wäre, hatte ihm, angeblich weil sie einen anderen kennengelernt hatte, den Laufpass gegeben.
»Das ist eine ernste Sache, Peder«, hatte sie ihm erklärt. »Ich will nichts versauen, was sich so dermaßen gut anfühlt.«
Peder hatte das Gesicht verzogen und sich gefragt, wie seriös eine solche Sache bei Pia Nordh überhaupt sein konnte, hatte diese Meinung aber klugerweise nicht laut geäußert. Zumindest noch nicht.
Richtig frustrierend aber war doch, dass es sich, nachdem er von Pia einen Korb gekriegt hatte, so schwierig gestaltet hatte, ein neues Objekt der Begierde zu finden. Bis jetzt. Die Polizeidienstanwärterin war zwar sicher nicht älter als fünfundzwanzig, doch wirkte sie irgendwie reif. Vor allem war sie so frisch im Laden, dass sie noch nicht all die Geschichten gehört hatte, die über Peder kursierten. Zum Beispiel dass er seine Frau verlassen hatte. Dass er sie, während sie noch zusammenlebten, betrogen hatte. Dass die Jungen, die doch noch so klein waren, doppelt von ihrem Vater im Stich gelassen worden waren, weil ihm mitten in seiner ohnehin schon verkürzten Erziehungszeit klar geworden war, dass er es nicht ertrug, mit den Kindern allein daheim zu sitzen. Daraufhin hatte er sie wieder zu ihrer Mutter verfrachtet, die– nachdem sie ein Jahr lang unter einer schweren postnatalen Depression gelitten hatte– gerade wieder angefangen hatte, in Teilzeit zu arbeiten.
Peder setzte sich so nah neben die Anwärterin wie nur möglich, ohne dass es bemerkt würde, wobei ihm sofort klar war, dass es deutlich zu nah war. Doch sie rückte nicht ab, was Peder als gutes Zeichen wertete.
»Die sind gut«, sagte sie stattdessen, legte den Kopf schief und sah auf die Zimtröllchen hinab.
Sie hatte kurze Haare mit störrischen Locken, die in alle Richtungen abstanden. Wenn ihr Gesicht nicht so hübsch gewesen wäre, hätte sie für einen Troll durchgehen können.
Peder beschloss, alles zu geben, und setzte sein frechstes Grinsen auf. »Sehen aus wie Pimmel, findest du nicht?«, fragte er und zwinkerte ihr zu.
Die Anwärterin bedachte ihn mit einem langen Blick, erhob sich und ging. Die Kollegen auf dem Sofa gegenüber grinsten höhnisch.
»Das schaffst auch nur du, Peder, einen so guten Start zu versauen«, sagte einer von ihnen und schüttelte den Kopf.
Statt zu antworten, stopfte Peder sich mit erröteten Wangen den Rest des Zimtröllchens in den Mund.
Im selben Moment steckte Kriminalkommissar Alex Recht den Kopf ins Zimmer. »Peder und Joar, in zehn Minuten Besprechung in der Löwengrube.«
Peder sah sich unauffällig um und konstatierte befriedigt, dass die Ordnung wiederhergestellt war. Zwar war er erklärtermaßen der erbärmlichste Anbaggerer der ganzen Etage, doch er war auch der Einzige, dem es gelungen war, im Alter von nur zweiunddreißig Jahren zum Kriminalinspektor befördert zu werden, und definitiv der Einzige von ihnen, der einen permanenten Sitz in der Arbeitsgruppe des legendären Alex Recht einnahm.
Demonstrativ langsam erhob er sich vom Sofa, griff nach seiner Kaffeetasse und stellte sie in die Spüle, obwohl die Spülmaschine offen stand und ein feuerrotes Schild mit der Aufschrift »Deine Mama arbeitet nicht hier« ihn daran erinnerte, wohin die Tasse eigentlich gehörte.
In einer früheren Zeit, die so weit entfernt schien wie ein früheres Leben, hatte Fredrika Bergman Erleichterung und Freude empfunden, wenn der Abend und die Müdigkeit kamen und sie sich endlich schlafen legen konnte. Doch das war lange her. Inzwischen verspürte sie, sobald es auf zehn Uhr zuging und das Schlafbedürfnis sich bemerkbar machte, nichts anderes als Angst. Wie ein Guerillakrieger stemmte sie sich dem Feind entgegen– bereit, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Für gewöhnlich errang sie irgendwann den Sieg, aber ihr Körper und ihre Seele waren derart überspannt, dass sie bis weit in die frühen Morgenstunden wach lag. Die Müdigkeit tat fast physisch weh, und das Kind trat unruhig um sich und schien seine Mutter zwingen zu wollen, zur Ruhe zu kommen. Doch das gelang ihm natürlich fast nie.
Ein Arzt, den sie über die Schwangerschaftsberatung vermittelt bekommen hatte, meinte, sie damit beruhigen zu können, dass sie nicht die einzige Schwangere sei, die von schrecklichen Albträumen heimgesucht wurde. »Das hat mit den Hormonen zu tun«, hatte er erklärt, »und es geht oft mit einer Symphysenlockerung im Beckenbereich und starken Schmerzen einher.«
Dann hatte er gesagt, dass er sie krankschreiben könne, doch da war Fredrika aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Sie war sicher, dass es ihr Untergang wäre, wenn sie nicht mehr arbeiten dürfte. Denn dann würden die Albträume wohl kaum weniger werden.
Eine Woche später hatte sie wieder bei dem Arzt gesessen und mit gesenktem Blick erklärt, dass sie eine Krankschreibung um fünfundzwanzig Prozent akzeptieren würde. Die bekam sie auch ohne weitere Diskussionen.
Fredrika bewegte sich langsam durch den kurzen Teil des Flures, an dem das Team von Alex saß. Ihr Bauch stand geradeaus vor, als hätte sich ein Basketball unter ihren Pullover verirrt. Ihre Brüste waren fast doppelt so groß wie früher.
»Wie die schönen Hügel in Südfrankreich, auf denen so guter Wein angebaut wird«, hatte Spencer Lagergren, der Vater des Kindes, vor einigen Abenden zu ihr gesagt, als sie sich getroffen hatten.
Als wären Symphysenlockerung und Albträume nicht genug, so war auch Spencer Lagergren ein Problem für sich. Fredrikas Eltern, die noch nie zuvor von dem Geliebten der Tochter gehört hatten, obwohl die beiden schon seit über zehn Jahren ein Paar waren, waren gelinde gesagt bestürzt gewesen, als sie ihnen passend zum ersten Advent eröffnet hatte, dass sie schwanger war. Und dass der Vater des Kindes ein verheirateter Professor an der Universität Uppsala war.
»Aber Fredrika!«, hatte ihre Mutter gerufen. »Wie alt ist dieser Mann denn?«
»Er ist fünfundzwanzig Jahre älter als ich, und er übernimmt die volle Verantwortung«, erwiderte Fredrika und glaubte beinahe selbst, was sie da sagte.
»Ah ja«, erwiderte ihr Vater müde, »und was bedeutet das im einundzwanzigsten Jahrhundert?«
Gute Frage, dachte Fredrika und fühlte sich mit einem Mal ebenso erschöpft, wie die Stimme des Vaters klang.
Kurz gesagt bedeutete es nicht mehr und nicht weniger, als dass Spencer selbstverständlich vorhatte, die Vaterschaft anzuerkennen und Unterhalt zu zahlen. Und das Kind so oft wie möglich zu sehen, ohne jedoch seine Ehefrau zu verlassen, die inzwischen ebenfalls in das Geheimnis eingeweiht war, wenn es denn je eines gewesen war.
»Was hat sie gesagt, als du es ihr erzählt hast?«, hatte Fredrika vorsichtig gefragt.
»Sie hat gesagt, es würde sicher nett sein, Kinder im Haus zu haben«, antwortete Spencer.
»Hat sie das wirklich gesagt?«, antwortete Fredrika, die unmöglich erkennen konnte, ob er scherzte oder nicht.
Spencer warf ihr einen nüchternen Blick zu. »Was glaubst du wohl?«
Dann war er gegangen, und sie hatten seither nicht mehr über das Thema gesprochen.
Im Büro weckte ihre Schwangerschaft indes mehr Interesse, als sie es sich gewünscht hätte, und da niemand sich bereitfand, sie direkt zu fragen, gab es natürlich viel Gerede. Wer war denn nun der Vater zum Kind der Single-Karrierefrau Fredrika Bergman? Fredrika, die einzige Zivilangestellte im ganzen Laden, die es, seit sie da war, geschafft hatte, fast jeden männlichen Kollegen zu verärgern, indem sie ihm entweder zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt oder seine Kompetenz infrage gestellt hatte.
Erstaunlich, stellte Fredrika fest, als sie vor Alex’ Tür stehen blieb. War sie doch von Anfang skeptisch gewesen, ob sie überhaupt weiter bei der Polizei arbeiten sollte. Und dann hatte sie am Ende doch eine Art Frieden mit der Arbeit geschlossen und war geblieben, nachdem ihre Probezeit ausgelaufen war.
Dabei war ich doch die ganze Zeit auf dem Weg woandershin, dachte sie und ließ ihre Hand kurz auf dem Bauch ruhen. Ich hätte von Anfang an nicht hierherkommen sollen und bin trotzdem geblieben.
Sie klopfte fest an die Tür von Alex Recht, der in der letzten Zeit, wie sie bemerkt hatte, nicht mehr so gut hörte.
»Herein«, murmelte der Kommissar auf der anderen Seite der Tür.
Als er sie erblickte, hellte sich seine Miene auf. Das war in letzter Zeit oft der Fall, viel öfter als bei den meisten anderen im Büro.
Fredrika erwiderte sein Lächeln, bis sie merkte, dass sein Gesichtsausdruck sich veränderte und er wieder besorgt aussah.
»Schläfst du irgendwann auch mal?«
»Ja, ja, es geht schon«, antwortete sie ausweichend.
Alex nickte, mehr für sich selbst.
»Ich habe hier einen ganz einfachen Fall, der…«, begann er, doch dann unterbrach er sich und formulierte den Satz neu. »Wir sind gebeten worden, uns einen Fall von Fahrerflucht anzusehen. Ein Ausländer wurde auf dem Frescativägen überfahren. Man hat ihn noch nicht identifizieren können. Wir sollen seine Fingerabdrücke durchs System schicken und sehen, ob wir etwas finden.«
»Und ansonsten abwarten, bis ihn jemand als vermisst meldet?«
»Ja, und sozusagen noch mal all das durcharbeiten, was bislang schon getan wurde. Er hatte ein paar persönliche Dinge bei sich. Bitte doch darum, dir die mal ansehen zu dürfen. Lies noch mal den Bericht, und prüfe, ob an der Sache wirklich irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ansonsten leg es zu den Akten.«
Ein Gedanke flog an ihr vorüber, war aber so schnell, dass Fredrika ihn nicht packen konnte. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, ihn zurückzurufen.
»Ja, das war’s«, sagte Alex schleppend und betrachtete ihr verkniffenes Gesicht. »Wir haben gleich ein Treffen in der Löwengrube wegen eines anderen Falles.«
»Dann sehen wir uns da«, sagte Fredrika und erhob sich.
Sie war schon draußen im Flur, als ihr einfiel, dass sie die Akte drinnen bei Alex vergessen hatte.
In der Löwengrube, wie der Besprechungsraum der Ermittlergruppe genannt wurde, waren die Gardinen zugezogen, und die Luft erinnerte an eine überhitzte Sauna. Alex riss die Stoffstücke zur Seite, die die Fenster verhängten, und musste feststellen, dass vom finsteren Himmel leichte Schneeflocken rieselten. Die Wetterfröschin im Fernsehen hatte am selben Morgen erst versprochen, das miese Wetter würde sich bis zum Abend auflösen, doch Alex hatte das ohnehin nicht geglaubt. Es war zum Verrücktwerden: Seit Neujahr war das Wetter völlig unbeständig, und Tage mit Schnee und Minusgraden wechselten sich mit Regen und Wind ab.
»Scheißwetter«, verkündete Peder, als er den Besprechungsraum betrat.
»Ja, furchtbar«, bekräftigte Alex kurz. »Kommt Joar auch?«
Peder nickte nur, und in dem Moment betrat Joar den Raum. Gleich hinter ihm kamen Ellen Lind, die Assistentin der Ermittlergruppe, und Fredrika.
Der neu installierte Projektor unter der Decke gab ein leises Hintergrundbrummen von sich, und Alex konzentrierte sich darauf, den Computer zum Laufen zu bringen. Die Gruppe wartete geduldig. Jeder von ihnen wäre besser geeignet gewesen, sich um die Technik zu kümmern, als der Chef, doch darauf hinzuweisen, wäre keine gute Idee gewesen.
»Ich habe ein paar Neuigkeiten«, sagte Alex schließlich und schob die Tastatur zur Seite. »Wie ihr sicher schon bemerkt habt, hat diese Gruppenkonstellation nicht so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war. Unser Ermittlerteam ist gegründet worden, um sich besonders schwerer Verbrechen anzunehmen, vor allem Fällen von Vermissten und besonders brutaler Gewaltverbrechen. Als Fredrika in Teilzeit gegangen ist, haben wir als Verstärkung Joar bekommen, wofür wir sehr dankbar sind.«
Joar begegnete Alex’ Blick, ohne etwas zu sagen. Der junge Mann hatte etwas Reserviertes und Zurückhaltendes, das Alex erstaunlich fand. Der Gegensatz zu dem geschickten, aber oft ungehobelten Peder konnte gar nicht größer sein. Zunächst hatte er das als positiv betrachtet, doch jetzt, nach nur wenigen Wochen, hegte er Zweifel. Es war offenkundig, dass Joar Peders Art zu reden ebenso anstrengend wie verletzend fand, während Peder von der Gelassenheit und Geschmeidigkeit seines neuen Kollegen frustriert zu sein schien. Wahrscheinlich würde Joar besser zu Fredrika Bergman passen, doch die war nun mal von einer Schwangerschaft gezeichnet, die ihr die Kräfte raubte. Die Krankschreibungen wegen Schmerzen und wegen mit schweren Albträumen verbundenen Schlafstörungen wanderten nur so über Alex’ Schreibtisch, und die wenigen Male, in denen Fredrika es überhaupt schaffte, ins Büro zu kommen, erschreckte sie ihre Kollegen mit ihrer kraftlosen und bleichen Erscheinung zu Tode.
»Es hat sich gezeigt, und das ist eigentlich kaum verwunderlich, dass wir, wenn es wirklich einmal darauf ankommt, zu wenige sind und Verstärkung benötigen. Stattdessen aber werden wir ständig an die Mordkommission ausgeliehen. Das hat die Frage aufgeworfen, ob wir wirklich eine dauerhafte Einrichtung sein müssen oder ob es nicht doch besser wäre, uns stattdessen auf die Kripo Stockholm oder die Reichskriminalpolizei aufzuteilen.«
Peder war am deutlichsten bestürzt. »Aber, aber…«
Alex hob eine Hand. »Es gibt noch keinen offiziellen Beschluss, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es diese Überlegungen gibt.«
Der Projektor hörte auf zu brummen, und es wurde still.
Alex blätterte in den Papieren, die er vor sich hatte.
»Wie dem auch sei, wir haben jedenfalls einen, nein, eigentlich zwei Fälle reinbekommen, bei denen unsere Kollegen aus Norrmalm Hilfe brauchen. Gestern Abend wurde ein Ehepaar um die sechzig, Jakob und Marja Ahlbin, in seiner Wohnung tot aufgefunden. Vielleicht habt ihr ja heute Morgen davon in der Zeitung gelesen. Ein befreundetes Ehepaar war bei ihnen zum Essen eingeladen, aber als auf ihr Klingeln hin niemand öffnete, betraten die Bekannten mit dem Ersatzschlüssel die Wohnung und fanden die Eheleute tot im Schlafzimmer. Nach dem ersten Polizeibericht, der in großen Teilen auf einen Abschiedsbrief des toten Ehemannes basiert, soll er zunächst seine Ehefrau und dann sich selbst erschossen haben.«
Endlich zeigte sich der Computer zur Zusammenarbeit bereit, und auf der weißen Leinwand hinter Alex blitzten Bilder vom Tatort auf. Ellen und Joar zuckten bei dem Anblick des erschossenen Paares zusammen, während Peder beinahe begeistert wirkte.
Er hat sich verändert, dachte Alex. Früher war er nicht so.
»In dem Abschiedsbrief steht, der Mann habe zwei Tage zuvor erfahren, dass ihre älteste Tochter, Karolina, an einer Überdosis Heroin gestorben sei und dass er deshalb keinen Sinn mehr im Leben sehe. Der Mann selbst ist wohl sein ganzes Erwachsenenleben lang immer wieder wegen schwerer Depressionen in Behandlung gewesen. Erst im Januar vorigen Jahres hatte er eine ECT-Behandlung erhalten, außerdem nahm er Psychopharmaka. Er war also chronisch depressiv.«
»Was ist ETC?«, fragte Peder.
»ECT«, berichtigte Alex, »Electroconvulsive therapy. Wird bei besonders schweren Fällen von Depression angewandt. So eine Art Kickstart fürs Gehirn.«
»Elektroschocks?«, rief Peder. »Ist das nicht verboten?«
»Wie Alex schon sagte, hat sich das bei der Behandlung schwerkranker Patienten in eingeschränkter Form bewährt«, schaltete sich Joar mit sachlicher Stimme ein. »Der Patient ist während der Behandlung unter Narkose. Die allermeisten fühlen sich danach besser.«
Peder starrte Joar an, sagte aber nichts. Stattdessen wandte er sich an Alex. »Warum ist dieser Fall bei uns gelandet? Er ist doch schon gelöst.«
»Das weiß man nicht«, antwortete Alex. »Die Leute, die das Paar gefunden haben, wollen nämlich überhaupt nicht glauben, dass der Mann erst seine Ehefrau und dann sich selbst erschossen haben soll. Die Tatwaffe, eine Jagdpistole vom Kaliber .22, haben die beiden von früher her identifizieren können, da die Männer eine Zeit lang gemeinsam zur Jagd gegangen sind. Doch sie haben den Polizisten gegenüber mit Nachdruck versichert, es sei undenkbar, dass der Mann so krank vor Trauer gewesen sein könnte, dass er eine solche Tat begeht.«
»Was ist denn nach Meinung der Freunde geschehen?«, meldete Fredrika sich zu Wort.
»Ihrer Meinung nach müssen die beiden ermordet worden sein«, antwortete Alex und sah sie an. »Beide waren offenbar bei der Schwedischen Kirche angestellt, er als Pfarrer und sie als Kantorin. Jakob Ahlbin ist in den letzten Jahren recht häufig öffentlich in Einwanderungsdebatten aufgetreten. Wie auch immer behaupten ihre Bekannten, dass der Glaube der Eheleute so stark gewesen sei, dass der ihnen in einem solchen Fall als Trost gedient hätte. Sie halten es für völlig unvorstellbar, dass Jakob Ahlbin, ohne darüber zu sprechen, die Nachricht vom Tod der Tochter entgegengenommen und sich dann umgebracht hätte.«
»Das heißt, die Ehefrau wusste nichts davon?«, fragte Joar.
»So geht es aus dem Abschiedsbrief hervor. Und das finden die Freunde noch unwahrscheinlicher: dass der Mann seiner Frau nicht erzählt haben soll, dass die Tochter tot ist.«
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Peder, der immer noch nicht überzeugt war, dass dies wirklich ein Fall für die Gruppe war.
»Wir werden die beiden Freunde noch einmal verhören«, entschied Alex. »Und dann müssen wir versuchen, die jüngste Tochter zu finden, Johanna, die wahrscheinlich noch gar nicht weiß, dass ihre Schwester und die Eltern tot sind. Dieser Teil könnte schwierig werden, denn man hat die Frau noch nicht aufspüren können. Hoffentlich bringen die Zeitungen keine Fotos und Namen von den Toten, ehe wir sie informiert haben.« Er sah zunächst Joar und dann Peder an. »Ich möchte, dass ihr den Tatort begeht und dann noch einmal das befreundete Ehepaar befragt. Prüft nach, ob es sonst noch Gründe gibt, mit der Sache hier weiterzumachen. Wenn es sein muss, teilt euch auf, und befragt noch mehr Leute. Besucht weitere Bekannte aus den Kirchenkreisen.«
Für einen Moment schien es, als sei hiermit die Besprechung beendet, bis Peder fragte: »Hattest du nicht gesagt, du hättest zwei Fälle? Was ist mit dem anderen?«
Alex runzelte die Stirn. »Das andere ist eine Sache, die ich schon Fredrika übertragen habe«, erklärte er. »Eine Routinesache, ein bislang unbekannter Mann, der heute Morgen überfahren wurde. Wahrscheinlich ist er im Dunkeln auf die Straße gelaufen und von jemandem angefahren worden, der nicht gewagt hat anzuhalten und sich der Polizei anzuzeigen. Vergesst nicht, was ich gesagt habe«, wechselte er abrupt das Thema. »Seht zu, dass ihr so schnell wie möglich diese Tochter findet. Niemand sollte aus der Abendpresse erfahren müssen, dass seine Eltern gestorben sind.«
Bangkok
Die Sonne war soeben im Begriff, hinter den Hochhäusern zu verschwinden. Es war ein unbeschreiblich schwüler Tag mit Temperaturen weit über dem Durchschnitt gewesen, und sie hatte sich schon seit den frühen Morgenstunden klebrig gefühlt. Die Sitzungen in verschiedenen Räumen ohne Klimaanlage hatten einander abgelöst, und ein Bild– oder vielleicht eher ein misstrauischer Gedanke– hatte sich herauskristallisiert. Sie konnte noch nicht recht entscheiden, was es war. Die Nacharbeit zu Hause würde sicherlich alle Fragezeichen auslöschen.
Die Heimreise nach Schweden stand, wenn man in Tagen rechnete, kurz bevor. Viel zu kurz. Der ursprüngliche Plan war gewesen, die weite Reise mit ein paar Tagen Strandurlaub in Cha-am abzuschließen, doch Umstände, die nicht in ihrer Hand lagen, hatten dieses Vorhaben unmöglich gemacht. Sie erkannte, dass es wohl am praktischsten war, in Bangkok zu bleiben, bis sie nach Hause fahren konnte. Außerdem hatte die letzte Mail ihres Vaters ihr Sorgen bereitet: »Du musst vorsichtig sein. Verlängere deine Reise nicht, und sei bei den Nachforschungen diskret. Papa.«
Nachdem sie die letzte Sitzung für diesen Tag abgeschlossen hatte, bat sie darum, ein Telefon ausleihen zu dürfen. »Ich muss meinen Rückflug bestätigen«, erklärte sie dem Mann, den sie eben befragt hatte, und holte die Plastikmappe mit der Buchung hervor.
Es klingelte ein paarmal, bis sie jemanden von der Fluggesellschaft in der Leitung hatte.
»Ich möchte gern meinen Rückflug am Freitag bestätigen«, erklärte sie und spielte mit einer kleinen Buddhastatue, die auf dem Schreibtisch vor ihr stand.
»Buchungsnummer?«
Sie gab ihre Buchungsdaten an und wartete, während der Mann sie in die Warteschleife stellte. Pausenmusik dudelte ihr ins Ohr, und sie sah aus dem Fenster. Da draußen kochte Bangkok und machte sich für Abend und Nacht bereit. Ein unbegrenztes Angebot an Diskotheken und Nachtclubs, Bars und Restaurants. Nie verstummender Lärm und ein ewiger Strom von Menschen auf dem Weg in unterschiedliche Richtungen. Schmutz und Staub, mit den erstaunlichsten Düften und Sinneseindrücken vermischt. Unmengen von Verkäufern und ab und zu Elefanten mitten in der Stadt, obwohl das verboten war. Und zwischen all den Gebäuden schnitt der Fluss die Stadt mitten entzwei.
Ich muss einfach noch mal herkommen, stellte sie fest. Richtig als Tourist und nicht zum Arbeiten.
Die Pausenmusik verstummte, und der Mann von der Fluggesellschaft war wieder am Apparat. »I’m sorry, Miss, aber wir können Ihre Buchung nicht finden. Würden Sie die Buchungsnummer bitte wiederholen?«
Sie seufzte und gab die Nummer erneut durch. Der Mann, der ihr den Raum zur Verfügung gestellt hatte, war offensichtlich ebenso ungeduldig. Ein diskretes Klopfen an der Tür bedeutete ihr, dass er den Raum alsbald benötigte.
»Bin gleich so weit!«, rief sie.
Das Klopfen hörte auf, und sie hörte wieder die Pausenmusik. Diesmal musste sie lange warten und war schon tief in ihre Fantasien über zukünftige Thailandurlaube versunken, als der Mann sich zurück in die Leitung schaltete.
»Es tut mir wirklich leid, Miss, aber wir können Ihre Buchung nicht finden.«
»Ich habe die Buchungsbestätigung in der Hand«, antwortete sie verärgert und sah auf den Ausdruck. »Ich soll mit Thai Airways am Freitag von Bangkok nach Stockholm fliegen. Dafür habe ich 4 567 schwedische Kronen bezahlt. Das Geld ist am zehnten Januar dieses Jahres abgebucht worden.«
Sie konnte hören, wie der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung tippte. Diesmal machte er sich nicht die Mühe mit der Pausenmusik.
»Darf ich fragen, wie Sie nach Thailand gereist sind, Miss?«, fragte er. »War das auch mit uns?«
Sie zögerte, erinnerte sich an die ersten Abschnitte ihrer Reise und wollte davon nichts preisgeben.
»Nein«, antwortete sie. »Nein, ich bin nicht mit Ihnen hierhergekommen. Und ich bin auch nicht aus Stockholm nach Thailand gereist.«
In ihrem Bewusstsein schienen die Namen von verschiedenen Städten auf und versanken wieder im Dunkel. Athen, Istanbul, Amman, Damaskus. Dies waren keine Informationen, die sie weitergeben wollte.
Es folgten einige Minuten der Stille, während der Mann draußen wieder an die Bürotür klopfte. »Sind Sie so weit?«
»Nur ein Problem mit meinem Flugticket«, rief sie. »Ich bin gleich fertig.«
Dann war der Mann von der Fluggesellschaft wieder dran. »Ich habe jetzt noch einmal alles nachgeprüft und mit meinem Gruppenleiter gesprochen«, sagte er mit Bestimmtheit. »Für Sie liegt keine Buchung bei unserer Fluggesellschaft vor.«
Sie holte tief Luft und machte sich bereit zu protestieren, doch er kam ihr zuvor.
»Es tut mir leid, Miss. Wenn Sie eine neue Buchung durchführen möchten, so helfen wir Ihnen natürlich gern. Ich fürchte, für Freitag wird das nicht mehr gehen, aber wir können Sie am Sonntag nach Hause fliegen. Da bekommen Sie einen einfachen Flug für 1255 Dollar.«
»Das ist doch lächerlich!«, rief sie empört. »Ich will kein neues Ticket, ich will mit dem Ticket fliegen, das ich bereits gekauft habe. Ich will, dass Sie…«
»Wir haben alles getan, was wir können, Miss. Ich kann Ihnen nur raten, in Ihren Mails noch einmal zu kontrollieren, dass Sie das Ticket wirklich bei uns und nicht woanders gekauft haben. Es ist schon vorgekommen, dass Betrüger falsche Tickets verkaufen, aber das ist äußerst selten. Wie gesagt, kontrollieren Sie das noch einmal, und melden Sie sich dann. Ich werde so lange auf Ihren Namen einen Rückflug reservieren, okay?«
»In Ordnung«, antwortete sie mit schwacher Stimme.
Doch es war nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht.
ENDE DER LESEPROBE