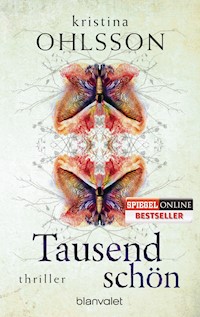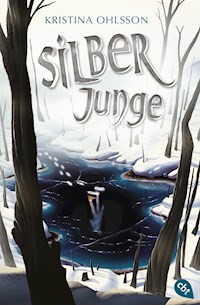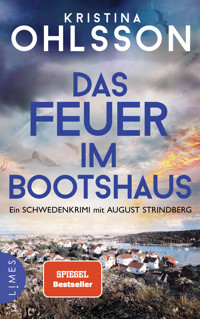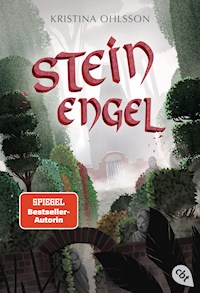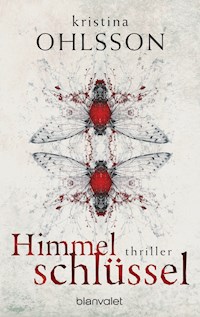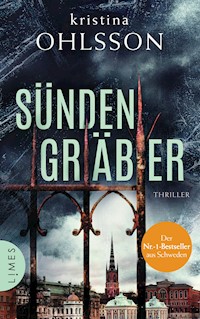
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fredrika Bergman / Stockholm Requiem
- Sprache: Deutsch
Das große Finale für Fredrika Bergman: »Unfassbar spannend.« Expressen
Ein Mann wird in seinem Sessel erschossen aufgefunden – mit dem Ehering seiner Tochter am Finger. Ein Bestatter sucht verzweifelt nach seinem verschwundenen Bruder. Eine Frau kämpft darum, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten, während ihr Mann von Tag zu Tag gefährlicher wird ... Fredrika Bergman und Alex Recht erkennen einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen. Sie begeben sich auf eine Spurensuche, die in die Vergangenheit führt – zu Sünden, die längst begraben schienen, und doch tödlicher denn je sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Ein Mann wird in seinem Sessel erschossen aufgefunden – mit dem Ehering seiner Tochter am Finger. Ein Bestatter sucht verzweifelt nach seinem verschwundenen Bruder. Eine Frau kämpft darum, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten, während ihr Mann von Tag zu Tag gefährlicher wird ... Fredrika Bergman und Alex Recht erkennen einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen. Sie begeben sich auf eine Spurensuche, die in die Vergangenheit führt – zu Sünden, die längst begraben schienen und doch tödlicher denn je sind.
Autorin
Kristina Ohlsson, Jahrgang 1979, arbeitete im schwedischen Außen- und Verteidigungsministerium als Expertin für EU-Außenpolitik und Nahostfragen, bei der nationalen schwedischen Polizeibehörde in Stockholm und als Terrorismusexpertin bei der OSZE in Wien. Mit ihrem Debütroman »Aschenputtel« gelang ihr der internationale Durchbruch und der Auftakt zu einer hoch gelobten Thrillerreihe um die Ermittler Fredrika Bergman und Alex Recht, die mit »Sündengräber« spektakulär ausklingt. Neben der Veröffentlichung zahlreicher Jugendbücher schuf Kristina Ohlsson außerdem einen neuen Ermittler: Anwalt Martin Benner, der in »Schwesterherz« und »Bruderlüge« einen aufsehenerregenden Fall zu lösen hat.
Kristina Ohlsson
Sündengräber
Thriller
Deutsch von Susanne Dahmann
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Syndafloder« bei Piratförlaget, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © Kristina Ohlsson 2017
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Limes Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Leena Flegler
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Roy Bishop/Arcangel Images
BL · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22318-2V003
www.limes-verlag.de
Für Annika, eine der Allerbesten
Dies ist eine erfundene Geschichte.
Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Ereignissen sind dem Zufall geschuldet.
Drei verirrte Männer
April 2016
Der erste Mann: Das Testament
ALL DIESE ENTSCHEIDUNGEN. Während seiner letzten Lebensmonate sollte er diesen Gedanken am häufigsten haben. All die Fragen, die eine Antwort erforderten, all die Antworten, die wiederum Entscheidungen gleichkamen. Wie er leben wollte; wie er sterben wollte. Welche Geheimnisse er noch jemandem mitteilen wollte und wie viele er mit ins Grab nehmen würde.
Sie verdiente es, Bescheid zu wissen. Davon war er fest überzeugt. Weniger sicher war er sich, ob sie wirklich wissen müsste, was er all die Jahre vor ihr geheim gehalten hatte, während er noch am Leben gewesen war. Immerhin war er immer der Ansicht gewesen, ihrer Beziehung gehe es am besten, wenn er weiterhin schwieg. Ihre Zeit war so knapp bemessen, und er hatte noch so viel zu tun … oder um eine abgegriffene Formulierung zu gebrauchen: Nun war die Zeit gekommen, alte Sünden zu sühnen.
Also setzte er sich an einem regnerischen Vormittag im April an seinen Schreibtisch und verfasste den wichtigsten Brief seines Lebens. Jedes Wort musste mit größter Sorgfalt gewählt werden, jeder Satz sollte aufs Äußerste feinpoliert sein. Als er fertig war, las er den Text wieder und immer wieder; öfter, als er hinterher zu zählen vermocht hätte. Irgendwann war er zufrieden. Oder vielmehr resigniert. Besser würde es nicht mehr werden. Und er würde niemals erleben, wie sie reagierte, sobald sie erführe, was er getan hatte. Erschöpft stand er auf. Er musste zu Mittag essen, sich ausruhen, einen Spaziergang machen. Er musste raus. Doch mit einem Mal überkamen ihn Reue und Unruhe.
Er setzte sich.
Noch mal von vorn, dachte er. Ich muss diesen Brief noch mal lesen.
Also tat er es.
Geliebte,
nun ist eine Weile vergangen, seit wir den schlimmsten aller Bescheide erhalten haben. Mein Todestag steht fest, wir kennen beide das Datum. Es ist unbegreiflich – ich kann es nicht fassen –, dass ich hier sitze und schreibe und gleichzeitig weiß, dass meine Zeit bemessen ist. Das war sie im Grunde immer, auch wenn wir Menschen oft nachlässig glauben, dass der Tod nur für andere gilt und nicht für uns selbst. Als gäbe es eine dritte Alternative irgendwo zwischen dem ewigen Leben und der ewigen Ruhe. Als könnte man, ganz wie man wollte, durch das Tor schreiten, das die Lebenden von den Toten trennt. Glaub mir, so ist es nicht.
Vielleicht verdiene ich es nicht besser. Vielleicht ist es sogar gerecht, dass ich früher abberufen werde, als wir beide es uns gewünscht haben. Deshalb schreibe ich diesen Brief – weil ich eine solche Angst habe, dass ich den Tod verdienen könnte, der vor mir liegt.
Du sollst endlich erfahren, dass ich vor etlichen Jahren etwas erbärmlich Dummes getan habe. Weißt Du noch, als unsere Tochter gerade zur Welt gekommen war und ich immer noch mit den Verletzungen zu kämpfen hatte, die ich mir bei dem Autounfall zugezogen hatte? Natürlich erinnerst Du Dich, das war eine schlimme Zeit. Und sicher erinnerst Du Dich auch noch an die Tabletten, die ich genommen habe, und daran, wie wir darüber gelacht haben, dass sie stark genug seien, um ein Pferd in Tiefschlaf zu versetzen. Gott weiß, dass ich die Tabletten gebraucht habe, um den Alltag durchzustehen, um meine Kräfte und meinen Körper zurückzugewinnen. Aber es war, wie Du gesagt hast – Kopf und Blick wurden einfach nicht klar, ehe die Schmerzen endlich nachließen und ich mich vom Morphium freigemacht hatte.
Ein einziges Mal war ich unaufmerksam. Ein einziges Mal. Doch das genügte, um das Leben eines Menschen zu zerstören. Es war ein Dienstag. Folgendes ist passiert:
Ich setzte mich ins Auto, um nach Uppsala zu fahren und meinen Chef anlässlich eines Geschäftsessens zu treffen, das später am Abend stattfinden sollte. Obwohl ich krankgeschrieben war, obwohl ich Probleme hatte, mich zu bewegen. Und obwohl meine Sinne durch die vielen Tabletten benebelt waren. Ich hätte mit der Bahn fahren müssen. Aber das tat ich nicht.
Und ich überfuhr einen anderen Menschen.
Ja, du hast richtig gelesen. Es ist schrecklich und verdammt noch mal unmöglich, es ungeschehen zu machen. Das Geräusch, als sie auf die Motorhaube krachte, als ihr Kopf gegen die Windschutzscheibe knallte … und dann der vollkommen bizarre Anblick, wie sie keine drei Sekunden später leblos auf der Straße hinter dem Auto lag. Ich weiß noch, wie ich in den Rückspiegel starrte und nicht begreifen konnte, wie sie dort hingekommen war.
Alles andere hingegen begriff ich nur allzu gut.
Entweder würde ich anhalten und die Verantwortung dafür übernehmen müssen, was ich getan hatte, und da wäre mein Leben zu Ende. Da würde ich vielleicht sogar Dich und unser Kind verlieren. Oder ich würde weiterfahren und so tun, als wäre nichts geschehen. Ich sah mich um, entdeckte keine Menschenseele, keinen Zeugen. Da war bloß Stille. Also wählte ich Letzteres: Ich ließ sie dort auf der Straße liegen. Dachte, eine solche Entscheidung trifft man nur ein Mal und ohne jedes Recht auf Reue. Ich weiß nicht mehr, welche Gedanken mir durch den Kopf gingen, als das Auto wieder anrollte; wahrscheinlich nicht viele. Doch Schuld und Scham saßen mir im Nacken, und es ist seither kein Tag vergangen, an dem ich nicht mit der Erinnerung daran gerungen hätte.
Natürlich haben die Zeitungen darüber berichtet, und insgeheim habe ich verfolgt, wie es der Frau ergangen ist, die ich überfahren hatte. Zu meinem großen Erstaunen überlebte sie nämlich. Mehr oder weniger. Es war allerdings nicht mehr viel von jenem Menschen übrig, der sie einmal gewesen war. Leider tun wir das – retten Menschen um jeden Preis.
Jetzt bist Du wahrscheinlich zutiefst schockiert. Gewiss wirfst Du mir Feigheit vor, fragst Dich, was zum Teufel ich mir dabei gedacht habe.
Ich habe an mich gedacht. So muss die kurze Antwort wohl lauten. Und an Dich und unsere Tochter und später auch an unseren Sohn. Und so blieb es bis vor einigen Monaten. Du weißt schon – bis alles anders wurde. Bis alles zerbrach und ich etwas über meinen Tod erfuhr, was ich nicht hatte ahnen können. Da beschloss ich, dass es an der Zeit war, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was damals falsch gelaufen war. Sühne zu tun für mein Verbrechen.
Das habe ich getan. Ich habe versucht, die Folgen des Unglücks geradezurücken. Zumindest soweit das möglich ist. Ich fürchte, dass es in diesem Zuge unvermeidlich war, Spuren zu hinterlassen. Deshalb schreibe ich Dir diesen Brief, denn ich glaube, es besteht die Gefahr, dass die Polizei sich den Unfall, den ich verursacht habe, wieder vornehmen und mich ausfindig machen könnte. Mich finden und feststellen könnte, dass ich tot bin. Und natürlich sollst Du nicht auf diese Weise erfahren, was ich getan habe. Du sollst es von mir erfahren.
Ich habe eine junge Frau überfahren und sie auf der Straße zurückgelassen, ohne ihr zu helfen. Es haben schon mehr Menschen Ähnliches getan, haben sich wie Schweine verhalten und sich davongestohlen, ohne für ihre Taten Verantwortung zu übernehmen. Ich will nicht, dass Du mich so in Erinnerung behältst – als einen, der sich davongestohlen hat. Deshalb will ich Dir sagen, dass ich anders bin als andere. Ich versuche, Verantwortung zu übernehmen, obwohl so viele Jahre vergangen sind … oder wie ein Schriftsteller einmal gesagt hat: Ich mache alles wieder gut.
Ich fürchte allerdings, dass ich es nicht schaffen werde.
Ich liebe Dich über alles.
Der zweite Mann: Das Haus
ZUR SELBEN ZEIT, da der Mann, der wusste, wann er sterben würde, sein Bekenntnis unterschrieb, stand ein anderer Mann vor einem Haus, das nach Geheimnis aussah. Die Luft war kalt und klar und kratzte in der Kehle, wenn er einatmete. Im April war das Wetter unbeständig.
Das hier würde gut werden. Sehr gut sogar. Dieses Haus war von so diskreten Leuten errichtet worden, dass kaum jemand überhaupt von seiner Existenz wusste. Fast niemand. Es war gerade richtig für den Mann, der sich jetzt an die Frau wandte, die neben ihm stand.
»Dürfte ich es auch von innen sehen?«
»Selbstverständlich«, antwortete sie.
Der Mann blickte sich um. Das Gelände um das Haus sah gepflegt aus; das Grundstück grenzte an einen kleineren Acker. Dahinter nur Wald, so weit das Auge reichte.
Perfekt, dachte er.
Die Frau schloss die Haustür auf und ließ ihn eintreten.
»Das Haus ist fünf Jahre alt – und absolut baurechtskonform. Aber es sollte so wenig wie nur möglich über den Bau bekannt werden. Das Haus ist weder an die Wasser- noch die Abwasserleitungen der Gemeinde angeschlossen. Wir haben einen eigenen Brunnen gebohrt und benutzen Chemietoiletten, die wir selbst leeren. Zudem haben wir eine unabhängige Stromversorgung durch ein Dieselaggregat, das den hauseigenen Generator antreibt.«
»Verstehe«, sagte der Mann, obwohl er in Wahrheit kein Wort verstand.
Dass es solche Orte überhaupt geben konnte, machte ihn wirklich sprachlos.
Außerdem kam er sich ziemlich naiv vor. Fühlte sich das so an, wenn einem die Zeit entglitt? Oder war es ganz einfach so, dass dieses Haus Ausdruck einer immer kälter werdenden Gesellschaft war? Er kannte die Bauherren hinter dem Projekt, er wusste, was deren Geschichte war.
Als er das Haus betrat, strich er mit der Hand über die Eingangstür. Sie war dicker als eine gewöhnliche Tür und sah aus, als wöge sie eine Tonne.
Die Frau wirkte hochzufrieden.
»Sowohl Fenster als auch Türen sind schusssicher«, erklärte sie. »Das Glas ist eigens bei einem deutschen Lieferanten bestellt worden und hat eine Festigkeit, die Hammerschlägen und anderen Arten von Gewalteinwirkung mühelos standhält.«
»Klingt wie die Fenster im Oval Office«, scherzte der Mann.
Seine Begleiterin lachte. »Wir haben tatsächlich an das Weiße Haus gedacht, als wir diesen Bunker entworfen haben. Und ich finde, es ist uns sogar einigermaßen gut gelungen.«
Der Mann zog eine Augenbraue hoch. »Den Bunker?«
»Nur damit niemand vergisst, dass dies kein gewöhnliches Haus ist.«
Wortlos ging er von Zimmer zu Zimmer. Sein Puls beschleunigte sich; nicht mal in seinen wildesten Fantasien hätte er sich vorstellen können, dass es eine so einfache Lösung für sein Problem gäbe. Das Haus war schlichtweg perfekt.
»Für wie lange kann ich es mieten?« Seine Stimme klang heiser.
»Es steht jetzt mindestens für ein halbes Jahr leer. Was meinen Sie, genügt das?«
Er zögerte kurz. »Ich weiß nicht … Sie müssen wissen … Ich benötige das Haus nicht sofort, sondern erst später im Frühjahr. Wenn meine Tochter aus dem Ausland zurückkommt.«
Die Frau legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich hab gehört, was Ihnen zugestoßen ist. Schreckliche Geschichte.«
Die Sonne schien durchs Fenster. Man konnte sogar mit bloßem Auge erkennen, wie das dicke Glas das Licht filterte.
»Ja«, sagte der Mann, der das Haus anmieten würde. »Schreckliche Geschichte. Weniger für mich als für meine Tochter und ihre Familie. Es wäre fantastisch, wenn sie endlich einen sicheren Zufluchtsort finden könnten. Ich meine, sie können sich ja nicht auf ewig im Ausland verstecken.«
Die Frau richtete sich gerade auf.
»Eine Zuflucht ist das hier garantiert«, sagte sie. »Hier findet sie niemand. Wenn sich ihre Situation also nicht verändert, bis sie wieder nach Hause kommen …«
»Das wird wohl kaum der Fall sein.«
»… dann sind sie hier willkommen.«
Der Mann, der das Haus anmieten würde, leistete sich ein Lächeln.
»Ausgezeichnet«, sagte er. »Ausgezeichnet.«
Der dritte Mann: Die Leere
UND DANN GAB es noch den dritten Mann. Der weder das Bedürfnis verspürte, seine Sünden zu bekennen noch eine Zuflucht für jemanden zu suchen, der ihm nahestand. Der Mann, der so viel verloren hatte, dass er nicht mal mehr er selbst war.
Er saß in seinem Arbeitszimmer, starrte die Wand an und zuckte nicht mal mit der Wimper, als sein Chef an der Tür vorbeikam und stehen blieb.
»Hier sitzt du. Ich dachte, du hättest frei.«
Es war nicht zu überhören, dass ihm nicht gefiel, was er vor sich sah. Und »freihaben« war in diesem Zusammenhang auch nicht die passende Formulierung.
»Es gab ein paar Dinge, die ich noch erledigen musste.«
Sein Chef stand immer noch an der Tür.
»Weißt du, ich merke doch, dass es dir nicht gut geht«, sagte er nach einer Weile.
Seine Stimme war sanft, sein Wohlwollen groß.
»Schon in Ordnung. Ich kann einfach nicht die ganze Zeit über zu Hause herumsitzen.«
Sein Chef räusperte sich verlegen. »Du brauchst eine Pause. Im Moment funktionierst du hier nicht.«
»Wie bitte?«
Der Chef sah bedrückt aus. Mehr als bedrückt.
»So geht das nicht mehr – dass du bei allem und jedem sofort in die Luft gehst«, fuhr er leise fort. »Deine gesamte Einstellung, diese Unausgeglichenheit … Das geht so nicht mehr. Deshalb haben wir ja auch diese Sache mit der Krankschreibung vereinbart.«
Es wurde still.
Jetzt stand es also ausgesprochen im Raum. Worauf er schon so lange gewartet hatte. Er war nicht mehr willkommen, er durfte nicht länger bleiben.
»Hau ab«, sagte er. »Hau bloß ab. Ich will diese verdammte Krankschreibung nicht.«
Sein Chef wich einen Schritt zurück.
»Ich möchte, dass du jetzt sofort gehst«, sagte er. »Ich habe dir mehr Chancen gegeben, als du verdient gehabt hättest.«
Dann wandte der Chef sich zögerlichen Schrittes ab.
Endlich würde er in Ruhe gelassen. Kein Mensch würde sich noch in seine Nähe wagen, in die Nähe eines trauernden Mannes – und erst recht nicht in die eines Mannes, der gekränkt war. Keiner seiner Freunde, keiner seiner Kollegen. Denn sie hätten gar nicht gewusst, was sie zu ihm hätten sagen sollen. Er machte ihnen deswegen keinen Vorwurf, es fiel ihm ja selbst schwer, Worte dafür zu finden, was er gerade durchmachte. Wie schwer musste das also erst jemand anders fallen?
Die Stunden krochen langsam dahin. Er blieb sitzen. Starrte die Wand an. So sah es aus, wenn er dachte. Der Chef hatte ihn gebeten, von hier zu verschwinden, aber keine Uhrzeit genannt. In seinem Kopf nahm eine Idee Gestalt an, die er erst in aller Ruhe weiterentwickeln wollte. Er hatte in vielem geschlampt, doch das hier würde gut werden müssen. Nicht nur um seinetwillen, sondern auch für so viele andere. Für all diejenigen, die für sich selbst keine Gerechtigkeit wiederherstellen konnten, all diejenigen, die alleingelassen worden waren.
Die Zeit war zu etwas geworden, wovon er zu viel und gleichzeitig zu wenig hatte. Heute hatte er eindeutig zu viel davon. Doch irgendwann würde der Abend kommen, und er müsste nach Hause gehen. Nach Hause zu alledem, was für gewöhnlich Leben genannt wurde, nach Hause zu allem, was sich einfach nur leer anfühlte, trostlos.
So etwas kann man nicht wiedergutmachen, dachte er. Aber zumindest kann ich es besser machen.
Mit diesem Gedanken stand er auf und verließ sein Arbeitszimmer.
Vernehmung des ZeugenALEX RECHT,
06.09.2016
Anwesend: Vernehmungsleiter 1 (V1), Vernehmungsleiter 2 (V2), Kriminalkommissar Alex Recht (Recht)
V1: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben herzukommen. Wie wir gehört haben, gehen Sie morgen auf die Beerdigung?
Recht: Ja, das stimmt.
V2: Das muss schwer für Sie sein.
Recht: Ehrlich gesagt ist es verdammt beschissen.
V2: Vermissen Sie sie?
(Schweigen)
V1: Wir wissen, dass Sie und Fredrika … Also, wenn Sie jetzt nicht über sie sprechen wollen, dann müssen wir versuchen, es irgendwie zu umschiffen. Uns ist klar, dass Sie unter Druck stehen, trotz allem müssen wir dieses Gespräch führen. Eine Person aus Ihrem engsten Kollegenkreis wird eines Verbrechens beschuldigt, und wir müssen uns mit jemandem unterhalten, der von Anfang an mit der Sache betraut war.
Recht: Reden Sie mit jemand anderem. Ich war nämlich nicht von Anfang an mit dabei. Keiner von uns war das.
V2: Wie meinen Sie das?
Recht: Ich meine, dass wir anfangs gar nicht mitbekommen haben, worum es in Wahrheit bei dieser Geschichte ging. Ich meine, es hätte die Sache wesentlich leichter gemacht, wenn wir gewisse zugrunde liegende Umstände direkt begriffen hätten … zum Beispiel, wie viele Opfer es noch werden würden – und in welcher Reihenfolge diese Menschen ums Leben kommen sollten.
(Schweigen)
V1: Okay, aber dann lassen Sie uns doch damit anfangen. Wer war das erste Mordopfer?
(Schweigen)
Recht: Ein Mann wie wir anderen.
V2: Wie bitte?
Recht: Ich sagte, ein Mann wie wir anderen. Ein Mann, der nicht mehr war als ein Mensch.
Samstag
MITTEN IM SOMMER, der zum längsten Sommer überhaupt werden sollte, wurde der erste schreckliche Mord begangen. Es begann an einem Samstag, einem merkwürdigen Wochenendtag, der wie jeder andere Tag ganz einfach hätte vorübergehen können, am Ende aber ein Tag werden würde, der das Leben einer ganzen Reihe Menschen von Grund auf veränderte.
Einer dieser Menschen war Henry Lindgren. Doch noch hatte er davon keine Ahnung.
Es war Viertel vor neun am Abend, als Henry die Wohnung verließ, um sich eine Zeitschrift zu kaufen. So eine mit Kreuzworträtseln drin. Im Fernsehen kam nichts Vernünftiges, außerdem konnte er besser schlafen, wenn er zuvor ein Kreuzworträtsel gelöst hatte und dann erst die Nachttischlampe ausschaltete. Wenn er gewusst hätte, was ihm bei seinem kurzen Abendausflug widerfahren würde, hätte er liebend gern auf die Zeitschrift verzichtet.
Es regnete und war zudem ein wenig kühl. Also zog Henry seine Herbstjacke an, die seit fast einem Jahr an der Garderobe gehangen hatte (der Winter war mild gewesen, das Frühjahr kalt und der Sommer anfänglich kühl), und nahm außerdem noch einen Regenschirm zur Hand. Er wollte zum Tabakgeschäft an der Ecke gehen, bis dorthin wäre es nicht allzu weit durch dieses Unwetter. Was für ein Glück.
Der Wind riss an seinem Schirm, als er hinaus auf die Straße trat, und im Nu hatte er nasse Hosenbeine. Als er die Tür des Tabakgeschäfts aufschob, klingelte darüber ein Glöckchen.
»Elender Sommer, den wir da haben«, sagte der Ladenbesitzer, ein Mann namens Amir.
»Könnte schlimmer sein«, erwiderte Henry, dem es gefiel, wenn der Sommer sowohl mit Sonne als auch mit Regen aufwartete.
Er bezahlte seine Zeitschrift und ging wieder.
Der Schatten kam aus dem Nichts. Nicht sonderlich groß, nicht lang, aber doch ganz deutlich in seinem Weg. Henry blieb stehen und versuchte zu erkennen, wer ihn da nicht durchlassen wollte.
»Ich bräuchte Hilfe mit meinem Hund«, sagte der Mann.
Henry sah sich um. Da war kein Hund in der Nähe. »Aha …«
Der Mann kam einen Schritt näher auf ihn zu.
»Mein Hund«, wiederholte er. »Dem geht es nicht gut. Könnten Sie mir helfen, ihn die Rolltreppe hochzutragen?«
Bereits hier hätten die Alarmglocken in Henrys Kopf losschrillen müssen, aber das taten sie nicht. Er dachte noch, womöglich stand der Mann unter Drogen und halluzinierte – sowohl was den Hund als auch die Rolltreppe anging.
»Tut mir leid, aber ich fürchte, ich kann nichts für Sie tun«, sagte er und versuchte, an dem Mann vorbeizugehen.
Das durfte er auch. Er eilte auf seinen Hauseingang zu und tippte den vierstelligen Türcode ein. Dann schüttelte er seinen Regenschirm aus und klappte ihn zusammen. Zu spät bemerkte er, dass der Mann ihm ins Haus gefolgt war. Die Tür schlug hinter ihnen beiden zu.
Teufel auch, das hier fühlte sich nicht gut an. Henry Lindgren ermahnte sich zur Ruhe. Das Wichtigste war doch immer, nicht in Panik zu geraten. Das hatte er schon öfter gelesen, als er zählen konnte. Man durfte einfach nur nicht panisch werden, wenn man sich irgendwelchen unberechenbaren Leuten gegenübersah.
Er traute sich nicht, auf den Fahrstuhl zu warten, und nahm stattdessen die Treppe. Henry wohnte im obersten Stock. Die Knie begannen schon im zweiten Stock zu protestieren. Der Mann schien unten geblieben zu sein, zumindest konnte Henry keine Schritte hinter sich hören. Als er das dritte Stockwerk erreicht hatte, atmete er schwer. Das Treppensteigen und das Lauschen strengten ihn an. Er zwang sich weiterzugehen und vergewisserte sich zugleich, dass der Mann noch immer nicht hinter ihm herkam. Damit war er derart beschäftigt, dass er nicht mal bemerkte, wie sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte und nach oben fuhr.
Als er seine Wohnungstür erreicht hatte, hätte er heulen können. Eilig schloss er die Tür auf und wollte sie gerade aufschieben, als im selben Moment der Fahrstuhl auf seiner Etage anhielt. Dann geschah alles so unglaublich schnell, dass man einem älteren Menschen wie Henry wohl nachsehen muss, dass er es nicht schaffte, angemessen zu reagieren. Es war, als flöge der Mann regelrecht in Henrys Wohnung. Mit einem Knall zog er die Tür zu und schloss ab. Und Henry stand mit seinem tropfenden Regenschirm still in seiner Diele.
Im nächsten Moment sagte der Mann etwas, was alles verändern und möglicherweise auch erklären sollte: »Der Hund ist egal. Aber ich habe eine Tochter, auf die Sie aufpassen müssen. Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen, müssen Sie wissen – ich habe sie in einem Zug zurückgelassen. Sie hat geschlafen, als ich gegangen bin – nur für ein paar Minuten, aber das reichte. Jetzt sitzt das Mädchen allein im Zug, und ich stehe auf dem Bahnsteig. Könnten Sie auf sie aufpassen?«
Henry schüttelte langsam den Kopf und spürte, wie sein Sichtfeld immer kleiner wurde.
Der Schock lähmte ihn, hatte ihm die Sprache verschlagen. Er brachte kein Wort heraus. Er wollte im Grunde lediglich wissen, warum dieser Mann hier aufgetaucht war und ihn ausgerechnet an sein größtes Versagen erinnern zu wollen schien.
Könnten Sie auf sie aufpassen?
Ich dachte es. Ich dachte, ich könnte es.
»Was wollen Sie?«, flüsterte Henry.
Seine Stimme klang heiser und angespannt. Henry hatte Angst.
Er war außer sich vor Angst.
Der Mann antwortete nicht. Stattdessen schlug er Henry so hart über den Hals, dass ihm schwarz vor Augen wurde und die Beine unter ihm wegsackten. Noch auf dem Boden liegend, unfähig zu sprechen oder auch nur Spucke hinunterzuschlucken, bekam Henry nur mehr vage mit, was um ihn herum passierte. Wirre Gedanken rollten über ihn hinweg – so viele, dass er sie unmöglich einzeln zu fassen bekommen konnte. Sie bildeten einen warmen Strom aus Energie, der durch seinen Körper wallte, während er gleichzeitig spürte, wie der Mann ihn ihm Nacken packte und den Kopf nach vorn drückte. Einige wenige Gedanken blitzten noch auf – sich losmachen, auf sich aufmerksam machen. Erstaunlicherweise dachte er nicht für eine Sekunde: Warum ich? Nein, die Frage hatte sein Mörder längst für ihn beantwortet, und dafür empfand Henry Dankbarkeit. Was er hingegen nicht verstand, war das Bedürfnis des Mannes, Vergeltung zu üben. Kein Tag war vergangen, an dem Henry seine Untätigkeit und deren Konsequenzen nicht verflucht hätte.
Henry Lindgren war letztlich nicht mehr als ein Mensch. Aber das genügte offenbar nicht.
DAS FEUER IM Kachelofen brannte zu heftig. Malin sah das sehr wohl, unternahm aber nichts dagegen. Zumindest fürs Erste nicht. Sie war erschöpft, übersensibel, ihre Nerven lagen blank, während ihr Vermögen, mit dieser Krise umzugehen, zusehends schwand. Panik zerstörte den Körper auf so viele Arten. Am schlimmsten war das Gehirn betroffen – die Fähigkeit, klar zu denken. Und es ging immer weiter, stellte Malin fest, die Panik hörte nie auf, sie war mittlerweile alltäglich geworden.
Sie saß in der Wärme und sah zu, wie die Flammen ihr entgegenschlugen. Gelbrote Monster, die über die weißen Außenkacheln leckten, nur um sich dann schnell wieder ins Innere zurückzuziehen. Erst als sie die Stimme ihres Sohnes hinter sich hörte, reagierte sie.
»Mama, es brennt ja! So richtig!«
Malin stürzte auf den Ofen zu und schlug die Klappe zu. Bald wäre das Feuer erstickt. Genau wie alles andere.
Der Sohn klammerte sich mit beiden Armen um ihre Hüften.
»Mama, mir ist laaangweilig.«
Malin schleifte ihren Sohn hinter sich her durchs Zimmer. Eigentlich war er zu groß für so etwas, aber dieses Spielchen hatte er schon als kleines Kind geliebt. An ihrem Bein zu hängen, während sie irgendwohin ging.
»Hast du Hedvig schon gefragt, was sie vorhat?«, wollte sie wissen. »Vielleicht würde sie gern etwas Lustiges machen.«
Sie wusste nicht, wie spät es war, womöglich müssten die Kinder auch schon bald ins Bett. Aber dies alles – selbst eine geregelte Schlafenszeit – war inzwischen unendlich schwer aufrechtzuerhalten. Regeln, an denen sie jahrelang konsequent festgehalten hatten, gerieten hier in Vergessenheit. Oder besser gesagt: Sie wurden aufgehoben. Vieles aus ihrem alten Leben spielte im neuen ganz einfach keine Rolle mehr.
Nicht, während sie ununterbrochen in Angst lebten.
Der Sohn ließ los und sank zu Boden.
»Hedvig will nicht spielen«, sagte er mit einem verzweifelten Unterton. »Hedvig will lesen.«
Wenn nur die Bücher nie ausgingen! Denn dann wüsste Malin nicht, was ihre Tochter sonst tun würde. Nur mittels der Bücher hatte Hedvig ihr Gleichgewicht bewahrt. Ohne sie würde ein Wrack aus ihr werden. Genau wie aus ihrer Mutter.
»Ich wollte was backen«, sagte sie zu ihrem Sohn. »Magst du mir helfen?«
Eigentlich wollte sie seine Hilfe nicht. Sie wollte einfach nur allein sein, eine Stunde, eine Viertelstunde oder eine Minute. Aber das ging nicht. Eins der Kinder war immer in ihrer Nähe, um sie herum, hing an ihr dran. Rund um die Uhr.
Die Miene ihres Sohnes hellte sich auf. Er wollte nur zu gern backen.
»Zimtschnecken«, sagte er.
»Heute nicht, Max«, sagte Malin, »heute backen wir Teekuchen.«
Wann hatten sie eigentlich zuletzt Zimtschnecken gebacken? Vorige Woche? Oder vorvorige? Sie wusste es nicht mehr, aber es war wohl rund um die letzte Lebensmittellieferung gewesen. Die Tage flossen ineinander, sie konnte werktags nicht mehr vom Wochenende unterscheiden. Zu Anfang hatte sie es versucht, aber es war ihr zusehends schwergefallen. Der Vater der Kinder weigerte sich, ihr zu helfen. Es sah fast so aus, als fragte er sich, was sie da eigentlich machte, warum sie sich überhaupt noch Mühe gab. Dabei hatte sie es ihm wieder und immer wieder erklärt – und doch sah sie, wie er immer weiter von ihr und den Kindern wegtrieb.
Routinen.
Brauchten sie die nicht am allerdringendsten?
Routinen.
Das A und O in der Krisenbewältigung jener Art.
War das so schwer zu begreifen?
Sie liefen in die Küche. Malin holte Hefe, Milch und Butter aus dem Kühlschrank, während der Sohn mit dem Mehlpaket kämpfte.
»Sei vorsichtig, wenn es so voll ist«, ermahnte ihn Malin.
»Weiß ich«, gab er zurück.
Malin ließ die Butter schmelzen und goss Milch dazu, wärmte alles handwarm auf. Max krümelte die Hefe in die Teigschüssel.
»Darf ich gießen?«, fragte er.
Malin nickte, und der Sohn ließ die Milch über die Hefe perlen. Malin griff zum Handquirl, die Hefe löste sich in der Flüssigkeit auf und färbte sie beige.
»Jetzt noch ein bisschen Salz«, sagte sie.
Max lief und holte das Salzfass. Malin hob den Blick von der Teigschüssel und sah aus dem Küchenfenster. Es regnete mittlerweile so heftig, dass es draußen nach Nebel aussah. Trotzdem konnte sie – leider – erkennen, dass die Bäume immer noch grün und die Beerensträucher vor dem Fenster voller Beeren waren. Der Rasen wirkte leicht ungepflegt. Der Zaun stand schief. Unwillkürlich verspürte sie Trauer, und sie musste tief Luft holen und schluchzte, als sie ausatmete.
»Was ist denn, Mama?«
Das blasse Gesicht ihres Sohnes sah angespannt und ängstlich aus. Manchmal fragte sie sich, wie viel er wohl begriff, wie sehr er selbst litt.
»Nichts«, sagte sie. »Ich bin nur ein bisschen müde.«
Der Sohn folgte ihrem Blick und sah, was auch sie gesehen hatte. Den Garten, den vernachlässigten Acker. Die Obstbäume. Die Stille. Die Einsamkeit. Und in einiger Entfernung den Wald, der sie unsichtbar machte.
»Ich will raus«, flüsterte er.
»Ich weiß, mein Lieber«, sagte Malin. »Das möchte ich auch.«
Montag
DIE ERDE UM Malcolm Benkes große Villa war vom vielen Regen komplett aufgeweicht. Das Gras gab unter den beschuhten Füßen nach, die kreuz und quer über das Grundstück liefen. Am Zaun hatten sich bereits Gaffer versammelt, die sich streckten, um etwas erkennen zu können, was das plötzliche Interesse der Polizei an der Villa erklärte.
»Ist etwas passiert? Ist er tot?«, fragte ein jüngerer Typ mit einem Skateboard unter dem Arm.
Kriminalkommissar Torbjörn Ross musterte ihn schweigend und überlegte, was er darauf wohl antworten sollte. Er hatte ewig kein Skateboard mehr gesehen. Gab es wirklich immer noch Leute, die so etwas benutzten?
»Sorg dafür, dass die sich fernhalten«, sagte er zu einem Kollegen und deutete auf ihre ungebetenen Zuschauer.
Mit schweren Schritten marschierte er auf das Haus zu. Die letzten Jahre hatten an Torbjörn Ross gezehrt. Er hatte sogar erwogen, frühzeitig in Rente zu gehen. Das Problem war nur, dass sich zu viele seiner Kollegen darüber gefreut hätten – diejenigen nämlich, die es gar nicht erwarten konnten, ihn loszuwerden. Die ihn für unzurechnungsfähig hielten. Ross schüttelte den Kopf. Es gab doch immer Leute, die einen ganz gewöhnlichen Ordnungssinn und Durchhaltevermögen mit Geisteskrankheit verwechselten.
»Torbjörn!«
Die Stimme erreichte ihn, als er gerade auf der Schwelle zu Benkes Haus stand. Er musste sich nicht einmal umdrehen, um zu wissen, wer nach ihm rief. Margareta Berlin.
»Was machen Sie hier?«, fragte sie.
»Das könnte ich Sie genauso gut fragen«, entgegnete er.
Berlin seufzte. »Den Fall übernimmt Recht.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das Ihre Anwesenheit hier erklärt«, entgegnete Torbjörn Ross ruhig.
»Ich wollte mal wieder Tatortluft schnuppern«, konterte Berlin.
Jetzt war es an Ross zu seufzen. Dass ausgerechnet Berlin eine dieser Chefinnen sein musste, die dem Fußvolk beweisen wollte, dass sie eine aus der Truppe war, dass auch die Chefin mal Dreck unter den Nägeln haben konnte … Zum Teufel mit dieser Pseudohaltung. Ross stand nicht auf Fake. Und Wahrhaftigkeit war so selten, dass er gelernt hatte, schon aus Prinzip nicht mehr damit zu rechnen.
»Ich dachte, Rechts Team gibt es nicht mehr«, brummte er. »Und ich dachte, solche Sonderlösungen sind nicht länger erwünscht in unserer neuen Organisation.«
Die letzten drei Wörter spie er regelrecht aus. Unsere neue Organisation. Von allen zutiefst verabscheut. Die größte Umstrukturierungsaktion bei der schwedischen Polizei seit Menschengedenken. Und so miserabel umgesetzt, dass sie in der Truppe keinerlei Rückhalt hatte. Zumindest nach Ross’ Ansicht.
»Alex’ Team erweist sich seit geraumer Zeit als Erfolgskonzept«, gab Berlin zurück, die nun offenbar Recht nicht länger Recht, sondern Alex nennen wollte. »Deshalb bleibt es erhalten.«
Ross schüttelte den Kopf. Er würde keine Öre auf dieses sogenannte Erfolgskonzept setzen. Wie war das gleich wieder gewesen, als Recht die Ermittlungen im Mordfall eines jungen Mädchens geleitet hatte, das tot aufgefunden worden war, nachdem es zuvor über Jahre verschwunden gewesen war? Den Fall hätte er ohne Ross niemals gelöst. Wenn einer es verdiente, in der neuen Organisation gefördert zu werden, dann war er es, nicht Recht.
»Mal im Ernst«, sagte Berlin und nahm Ross beim Arm. »Fahren Sie zurück ins Haus. Ich weiß nicht, wie es hierzu kommen konnte, und es tut mir natürlich leid, dass Sie jetzt unnötigerweise hier rausgefahren sind.«
Er sah ihr direkt in die Augen und musste sich zusammenreißen, um nicht zu lächeln, als er sah, was man aus ihrem Blick herauslesen konnte. Seine Chefin hatte Angst vor ihm. Wenn er sich jetzt weigerte zu gehen, dann würde ihr nichts mehr einfallen.
Ross fixierte einen Punkt hinter Berlin und dachte kurz nach. Seine Chefin hatte keine Ahnung, warum er nach Nacka gefahren war. So richtig viel bekam sie nicht mit. Und das durfte auch gern so bleiben.
»Torbjörn?«, hakte Berlin nach.
»Ich hau ja schon ab«, sagte er.
Sie war sichtlich erleichtert. Sie hatte ganz offenbar nicht den Hauch einer Ahnung, dass er sie bestrafte, indem er jetzt ging. Er und niemand anders kannte die Wahrheit hinter jenem Verbrechen, das Recht jetzt würde aufklären müssen. Das geschah ihnen recht. Diesmal würden sie ohne seine Unterstützung zurechtkommen müssen. Zumindest bis sie so schlau wären, von selbst zu ihm zu kommen und ihn um Rat anzubetteln.
Torbjörn Ross kehrte zu seinem Auto zurück. Er hatte sich nicht mal die Zeit genommen, einen Dienstwagen zu holen, sondern war mit seinem privaten Saab gefahren. Als er den Zündschlüssel herumdrehte, schielte er hinüber zu seiner Chefin.
Über Berlin hing der Himmel voller dunkler Wolken.
EIN WENIGER ROUTINIERTER Autofahrer wäre bei der Begegnung mit dem Saab wahrscheinlich von der Fahrbahn abgekommen. Der braun lackierte Wagen kam wie eine Kanonenkugel über die Straße geschossen, weit jenseits der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und viel zu nah an der Mittellinie.
Als Kriminalkommissar Alex Recht und der Saab einander in der Kurve begegneten, hätte Alex um Haaresbreite dem Impuls nachgegeben auszuweichen – und wäre im Graben gelandet.
»Verdammter Idiot«, murmelte er.
Doch er hatte jetzt keine Zeit, um dem Verkehrssünder hinterherzujagen. Berlin hatte angespannt geklungen, als sie angerufen hatte.
»Ich will, dass Sie und Fredrika sich des Falles annehmen«, hatte sie gesagt und dann hinzugefügt: »Und – Alex: Augenblicklich!«
Selbstverständlich. Alex war niemand, der Nein sagte. Allerdings nicht aus Loyalität gegenüber seiner Chefin, sondern weil er zu seinem Dienstauftrag stand. Das sollte sie sich besser mal klarmachen, verdammt. Berlin kam einer Kernschmelze vom Typ Tschernobyl gleich – eine schlimme Frau. Das hatte er damals schon gedacht, als sie nach Lenas Tod und hinter seinem Rücken seine Kompetenzen infrage gestellt hatte. Als Personalchefin hatte sie sich Mal ums Mal Übergriffigkeiten und Anmaßungen erlaubt und nur mehr als der Elefant im Porzellanladen gegolten.
Deshalb war das Erstaunen auch groß gewesen, als sie sich vor ungefähr einem Jahr um eine operative Führungsposition beworben und diese dann auch noch bekommen hatte. Alex war davon ausgegangen, dass sie am Ende sei und in der Organisation nicht höher aufsteigen werde.
Wie naiv von ihm.
Doch all das musste zurückstehen, sobald die Pflicht rief. Keine Stunde nach Berlins Anruf war er vor Ort.
Vor ihm tauchte die große Villa auf. Teure Autos in der Auffahrt. Er lief auf das Haus zu, zog sich im Gehen die erforderliche Schutzkleidung über und trat ein.
Der Tote, ein Mann namens Malcolm Benke, saß in einem gepolsterten Ledersessel und starrte mit leerem Blick in ein Kaminfeuer, das schon vor Stunden erloschen war. Er war am Morgen von der Putzfrau tot aufgefunden worden, die immer montags ins Haus kam. Die Frau war bereits befragt worden, doch Alex glaubte nicht, dass sie für die Ermittlung sonderlich interessant wäre.
Um ihn herum waren die Spurentechniker bereits bei ihrer stillen Arbeit. Das komplette Zuhause des Mannes – eine riesige Villa, wunderschön am Meer gelegen – war voller Menschen, die Benke nie kennengelernt hatte und die nur aus einem einzigen Grund hier waren: nämlich um das Verbrechen aufzuklären, dem er zum Opfer gefallen war.
Alex ging vor dem Verstorbenen in die Hocke und betrachtete die Blutflecken auf dessen Hemd. Malcolm Benke war in die Brust geschossen worden. Die Kugel war durch den Körper hindurchgeschlagen, dann durch die Sessellehne, ehe sie schließlich in der Wand stecken geblieben war.
Wer, dachte Alex, wer wird denn bitte in seinem gemütlichen Sessel vor einem Feuer sitzend erschossen?
Nirgends rundherum konnte er Hinweise auf einen vorausgegangenen Streit erkennen. Hätte es die gegeben, hätte man leicht den Schluss ziehen können, dass Opfer und Täter einander gekannt hatten. Benke und sein Mörder. Vielleicht war Benke von ihm überrascht worden, hatte ihn nicht einmal kommen hören. Es war dieses Zögern zwischen den verschiedenen Möglichkeiten, das man lieben musste, um als Polizist arbeiten zu können. Man durfte keine vorschnellen Schlüsse ziehen, und es durfte einen nicht frustrieren, was man zunächst alles nicht wusste.
»Die Kugel hat da ein anständiges Loch gerissen«, stellte Rechtsmedizinerin Renata Rashid fest, die neben dem Toten stand.
Sie zeigte es ihm, indem sie vorsichtig an dem Hemd zupfte, sodass die Wunde sichtbar wurde.
Alex verzog das Gesicht.
»Auch eine üble Art zu sterben«, sagte er.
Obwohl er das eigentlich gar nicht so meinte. Im Gegenteil – er hatte nur wenige Einwände gegen die Art, wie dieser Mann ums Leben gekommen war. Ein Schuss in Nacken oder Brust war im Grunde ein Traum verglichen mit der Art und Weise, wie viele andere ihr Leben beenden mussten. Allerdings widerstrebte Alex der Ort, an dem der Mann hatte sterben müssen. Er fand es immer besonders übel, wenn Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer eines Verbrechens wurden – an dem Ort, an dem sie sich mit Fug und Recht sicher fühlen sollten.
»Soweit ich sehen kann, hat er keine weiteren äußerlichen Verletzungen«, sagte Renata. »Aber das können wir natürlich erst bei der Obduktion verifizieren.«
Alex betrachtete das Gesicht des Mannes. Es wirkte so friedlich. Oder vielleicht resigniert? Alex hatte schon Gesichter gesehen, die im Augenblick des Todes in Entsetzen erstarrt waren. Das war kein schöner Anblick.
Malcolm Benke trug Hemd, Hose und Hausschuhe. Über der Rückenlehne des Sessels hing sein Jackett. Laut Einwohnermelderegister war er zweiundsiebzig Jahre alt gewesen und hatte allein gelebt. Er und seine Frau hatten sich zehn Jahre zuvor getrennt. Sie hatten zwei gemeinsame Kinder gehabt, von denen nur mehr eins lebte. Die Tochter war mit dreißig gestorben, ein halbes Jahr vor der Trennung der Eltern. Eine erste oberflächliche Suche im Netz hatte ergeben, dass Malcolm Benke erfolgreicher Bauunternehmer und an mehreren viel beachteten Bauprojekten in Stockholm beteiligt gewesen war.
Ein junger Kollege gesellte sich zu ihm. Alex Recht war es ein wenig peinlich, dass er sich nicht an den Namen erinnerte. Er gehörte nicht zu Alex’ Team, sondern war lediglich als Verstärkung geschickt worden. Man spürte den Eifer, der in ihm pulsierte, das Adrenalin, das kochte.
Vor langer Zeit war ich auch mal wie du, dachte Alex. Da dachte ich auch, es sei spannend, wenn Menschen sterben.
»Was meinen Sie?«, fragte der Jüngere.
»Nichts«, sagte Alex.
»Vielleicht ein unzufriedener Kunde?«
Alex starrte den Kollegen an. »Mischt man so die Bauleute auf, die man engagiert? Indem man sie erschießt?«
Der Junge wurde rot.
»Man wird doch wohl ein bisschen herumspinnen dürfen«, murmelte er. Dann nickte er zu dem Toten. »War der vom anderen Ufer?«
Alex war fassungslos. Vom anderen Ufer? Sollte er sich jetzt allen Ernstes die Mühe machen, den Jungen darauf hinzuweisen, dass man sich so nicht ausdrückte? Sollte er sich wirklich die Mühe machen, den Dienstälteren raushängen zu lassen und in der Truppe eine gewisse Anständigkeit einzufordern? Wer wusste schon, was aus dem Kollegen als Nächstes herausplatzen würde – vielleicht eine rassistische Äußerung, bei der Renata Rashid an die Decke gehen würde? Sie, die mit einem Iraner verheiratet war, wusste genau, wie es sich anfühlte, als anders wahrgenommen zu werden.
Alex unterdrückte einen Seufzer. Es gab Tage, da glaubte er nicht mehr an die Macht der Rüge oder daran, die Welt verändern zu können. Und heute war wohl ein solcher Tag.
»Wie kommen Sie darauf, dass er homosexuell gewesen sein könnte?«, fragte er und hoffte insgeheim, dass seine Wortwahl und sein Tonfall den Kollegen dazu inspirierten, sich selbst ein wenig zusammenzureißen.
»Die Hände«, erwiderte der Junge.
»Die Hände?«
»Die Ringe. Ungewöhnlich viel Schmuck für jemanden, der hetero ist. Und das da ist doch ein Damenring, oder?«
Alex runzelte die Stirn. Er zählte drei Ringe: einen normalen Siegelring, einen Freimaurerring und dann denjenigen, den sein Kollege als Damenring bezeichnet hatte. Er steckte an Benkes linkem kleinem Finger. Ein Goldring, in den ein Stein eingelassen war – womöglich ein Diamant. Widerwillig musste er sich eingestehen, dass der Ring tatsächlich eher so aussah, als sei er für eine Frau entworfen worden. Was allerdings nicht bedeutete, dass nicht auch ein Mann ihn gern tragen wollte.
Aber doch nicht dieser Mann, dachte Alex finster.
Malcolm Benke und sein Haus hatten etwas zutiefst Maskulines. Und selbst für den kleinen Finger des Hausherrn war der Ring zu klein.
»Können wir uns den mal genauer ansehen?«, wandte sich Alex an Renata und zeigte auf den Diamantring.
Das war leicht zu bewerkstelligen.
Alex hielt sich den Ring vors Gesicht und betrachtete ihn im Licht des Kronleuchters. Die verdammten Latexhandschuhe, die er tragen musste, juckten.
»Da steht was drin«, stellte der Kollege fest, der jetzt so nah neben Alex stand, dass er fast auf dessen Schulter lag.
Wir auf ewig. Beata und Richard.
»Beata«, murmelte Alex.
»Hieß seine Tochter nicht Beata?«, fragte der Kollege.
»Doch …«
Er ließ den Ring in einen Asservatenbeutel fallen und drückte ihn dem Kollegen in die Hand.
Wenn dies hier der Ehering von Malcolm Benkes Tochter war, warum trug er ihn dann an seinem kleinen Finger?
ES WAR DER mieseste Sommer, den sie je erlebt hatte. Das war Fredrika Bergmans feste Überzeugung. Sie hatte in ihrer Erinnerung lange nach einem gekramt, den man als noch schlechter hätte bezeichnen können. Aber – nichts. Sie konnte sich an Sommer erinnern, die bei ihr Angst heraufbeschworen hatten – wer konnte das nicht? –, aber an keinen, der diesem auch nur annähernd ähnlich gewesen wäre.
Ich mag nicht mehr.
Dass diese Phrase aber auch nur legitim war, wenn ein Kind sie äußerte und nicht ein Erwachsener. Manchmal, wenn Fredrika sich erlaubte loszulassen, am liebsten des Nachts, wenn sich der Schlaf nicht einfinden wollte, dann dachte sie daran, wie einfach alles in der Kindheit gewesen war. Da hatte es keine Überzeugung gegeben, die stärker gewesen wäre als: Alles ist möglich.
Wie sehr sie dieses Gefühl und diese Illusion vermisste.
Inzwischen war sie über vierzig und wusste nur allzu gut, wie oft man sich wünschte, dass etwas nicht eintreten möge. Niemals.
Es war Spencers Idee gewesen, früh Urlaub zu machen. Das hatte er bereits im Januar vorgeschlagen, lange bevor sie ihre Urlaubstage hatten eintragen müssen – und lange bevor ihr Leben in Stücke zerbrochen war. Am Ende hatte er seinen Willen bekommen. Sie waren nach Italien gefahren, hatten sich ein Haus in der Toskana gemietet. Den Rest ihres Sommerurlaubs – das bisschen, was noch übrig war – hatten sie zwischen Stahl und Beton in der Stadt verbracht. Als es für Fredrika und Spencer an der Zeit gewesen war, wieder arbeiten zu gehen, waren die Kinder bei den Großeltern in deren Sommerhaus geblieben. Das beruhigte Fredrika – sowohl wieder arbeiten gehen zu können als auch, dass die Kinder eine Art Sommer erlebten, den sie sich verdient hatten.
»Warum wollt ihr denn arbeiten, wo jetzt alles so ist, wie es ist?«, hatte Fredrikas Mutter gefragt. »Warum nehmt ihr euch denn nicht frei und seid ein bisschen zusammen?«
Wo jetzt alles so ist, wie es ist.
So konnte man natürlich auch einen Alltag beschreiben, der fast alle Lebensfreude erstickt hatte.
»Spencer will nicht«, hatte Fredrika erwidert.
Sie hätte sich deutlicher ausdrücken können. Sie hätte sagen können, dass Spencer einfach nicht den kompletten Sommer lang Urlaub hatte machen wollen.
»Warum denn auch, zum Teufel?«, hatte er sie angeblafft, als sie es angesprochen hatte. »Damit wir alle Zeit der Welt haben, um hier zu sitzen und einander totzustarren? Vergiss es!«
Als Reaktion auf seinen Zorn hatte sie erst lachen, dann weinen müssen. Allerdings erst nachdem sie die Wohnung verlassen hatte, um allein einkaufen zu gehen.
Alex Recht rief sie an, als sie gerade auf dem Weg zur Probe im Auto saß. Das Geigenspiel, das früher mal ihr Lebensunterhalt hätte werden sollen, war für sie seit Langem wieder wichtiger denn je. Die Musik war ihr Raum zum Atmen und ihr Zufluchtsort.
»Ja? Fredrika.«
»Alex hier. Wie schnell kannst du nach Nacka kommen?«
Fredrika seufzte. »Vielleicht morgen früh?«
»Vielleicht auch in einer Stunde?«
»Alex, ich habe frei.«
Spencer hatte den Kampf um die Urlaubsplanung nicht auf ganzer Linie gewonnen. Fredrika hatte selbst im Juli noch einzelne freie Tage in den Kalender geschmuggelt. Tage, an denen sie nicht zur Arbeit ging, sondern sich Zeit zum Nachdenken und für die Proben verschafft hatte. Und – wie an ebendiesem Tag – sogar Zeit für ein Treffen, das nicht länger aufgeschoben werden konnte.
»Heute hast du vielleicht frei«, sagte Alex, »aber morgen und in den kommenden Tagen wirst du einen Mord aufklären müssen.«
Fredrika antwortete nicht.
»Ich brauche dich«, sagte ihr Chef.
Und das war alles, was nötig war, damit sie wendete und nach Nacka fuhr. Ihr privates Treffen würde sie trotzdem noch schaffen, bis dahin wären es noch mehrere Stunden. Die Probe würde indes warten müssen. Alex hatte im Auftrag eines Toten angerufen – und einen solchen Auftrag durfte man nicht ausschlagen.
Das Haus wirkte wie ein modernes Geisterhaus. In einem Zeichentrickfilm für Kinder wäre es mit Spinnennetzen, Schmutz und der einen oder anderen zerbrochenen Fensterscheibe dekoriert gewesen. In Wahrheit war es sauber. Aber eben seelenlos. Fredrika schlug die Fahrertür zu und steuerte die Haustür an, die sperrangelweit offen stand. Ein Kollege bedachte sie mit Schutzkleidung und Ermahnungen, ehe sie ins Haus gelassen wurde, das nun nicht länger die private Heimstatt eines Menschen war, sondern ein Tatort, an dem jede Spur des Täters gesichert und irreführende Fährten vonseiten der Polizei und des Rettungspersonals ausgeschlossen werden mussten.
Fredrika zog sich Plastiküberzieher über die Schuhe und wunderte sich noch, wie leicht es ihr fiel, von Urlaubs- auf Arbeitsmodus umzuschalten. Welch wunderbare Verwandlung – sämtliche schlimmen Gedanken waren von einem Moment auf den anderen in die Flucht geschlagen, sobald sie in ihre berufliche Rolle schlüpfte.
Sie fand Alex in dem Zimmer, in dem der Tote in sich zusammengesackt in seinem Sessel saß. Ein großes Wohnzimmer mit einer auf einen Fernseher ausgerichteten Sitzgruppe. Doch Malcolm Benke hatte nicht ferngesehen, als er gestorben war. Er hatte ins Feuer im offenen Kamin geschaut. Zumindest sah es so aus.
»Kennen wir den Mann?«, wollte Fredrika von Alex wissen.
Was sie meinte, aber nicht aussprechen wollte, war die Frage, ob er kriminell und deshalb polizeibekannt gewesen war. Sie betrachtete das silbergraue Haar des Toten, das freundliche Gesicht. Es schien fast, als wollte er ihr ein Willkommen entgegenflüstern.
»Nein«, antwortete Alex, »bisher nicht.«
Das musste nichts heißen, so viel war ihnen beiden klar. Benke mochte durchaus kriminell gewesen sein, ohne dass die Polizei davon wusste; vielleicht war er einfach nur nie aufgeflogen. Das war bei haarsträubend vielen Verbrechern der Fall.
Fredrika sah sich um. Benkes Einrichtung suggerierte Macht und Stilbewusstsein. Alles im Haus erweckte den Eindruck, teuer und sorgfältig ausgewählt worden zu sein, fast wie in einem exklusiven Hotel. Benkes Haus war kein Heim im Sinne eines gemütlichen Rückzugsraums, sondern lediglich ein Ort, an dem er sich öfter aufgehalten hatte als an anderen.
»Ich drehe mal eine Runde«, sagte Fredrika.
Alex antwortete nicht. Stattdessen wechselte er ein paar Worte mit einem der Spurentechniker.
Schweigend schlenderte Fredrika durchs Haus. Die Küche gehörte zu den schönsten, die sie je gesehen hatte. Handverlesene französische Kacheln und geschmackvoll hochglänzende Schranktüren – perfekt für jemanden, der gern kochte. Aber war Benke ein Mann gewesen, der sich in die Küche gestellt und ein Bœuf Bourguignon gezaubert hatte? Das wollte Fredrika nicht glauben.
Auf einem Schneidebrett lagen ein Brotlaib und ein Messer.
»Hat er dort drüben gesessen und gegessen, als er starb?«, fragte Fredrika einen Techniker, der gerade Benkes Hausmüll unter der Spüle untersuchte.
Der Techniker sah auf.
»Auf dem Tisch neben dem Sessel steht ein leerer Teller«, sagte er zögerlich. »Kann sein, dass er sich ein Butterbrot aus der Küche mitgenommen und es vor dem Kamin gegessen hat.«
Was Benke wohl zum Abendessen gewählt hätte, wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass es seine letzte Mahlzeit sein würde? Wahrscheinlich nicht ausgerechnet Butterbrot.
Sie ging weiter in die Diele, kam an etwas vorbei, was wie ein Büro aussah. Allerdings lag dort kein einziges Blatt Papier auf dem Schreibtisch, und ihr schoss etwas Ähnliches durch den Kopf wie schon in der Küche: Hatte er je hier gearbeitet? Sie trat ein, sah sich die gut sortierten Bücherregale an (so gut sortiert, dass man sich nur schwer vorstellen konnte, dass überhaupt jemals ein Buch dort herausgezogen worden war). Dann kehrte sie dem Arbeitszimmer den Rücken und lief ins obere Stockwerk, wo sie noch mehr klaren Funktionen zugeordnete Zimmer vorfand, von denen sie sich ebenso wenig vorstellen konnte, dass Benke sie wirklich genutzt hatte: zwei Schlafzimmer, bei denen es sich wahrscheinlich um Gästezimmer handelte. Ein weiteres Fernsehzimmer, das mit zwei Chesterfield-Sofas möbliert war. Fredrika ließ sich auf einem nieder. Es war knochenhart – kein vernünftiger Mensch würde hierauf je bequem sitzen. Am Ende stieß sie auf ein riesiges Schlafzimmer, das Benke bewohnt haben musste. Das Bett war gemacht. Auf der Tagesdecke lag ein Schlips, auf dem Nachttisch die Zeitung vom Vortag.
Fredrika öffnete die Schränke, spähte zwischen Hemden, Hosen und Anzüge. Ihr war selbst nicht klar, wonach sie suchte oder was sie glaubte, dort finden zu können.
Sie lief zurück nach unten zu Alex. Er telefonierte gerade mit seiner Freundin Diana.
»Ich weiß nicht, wann ich heute nach Hause komme«, sagte er. »Ich rufe dich später noch mal an. Kuss!«
Kuss.
War das nicht zu privat? Oder war Fredrika überempfindlich geworden? Sie war nie der Typ gewesen, der von sich selbst viel Privates preisgab oder sich für das Privatleben anderer Menschen interessierte. Doch im Lauf des Frühjahrs war sie noch schweigsamer geworden, als sie es zuvor schon gewesen war. Sie fragte nicht einmal mehr, wie es bei Alex zu Hause lief, ob alles gut war … hauptsächlich, um keine Gegenfrage gestellt zu bekommen.
Wie geht es dir und Spencer?
Tja, weißt du, ziemlich schlecht.
Fredrika blinzelte. Dann wandte sie sich Benkes Wandschmuck zu, einer Reihe großer Gemälde, die sicher eher gekauft worden waren, um Eindruck zu schinden, denn weil Benke die Künstler geschätzt hätte. Private Bilder oder Fotos waren nirgends zu sehen. Warum die Fassade? Wer wollte in seinen eigenen vier Wänden alles Persönliche geheim halten?
Sie trat an den Kaminsims. Drei gerahmte Fotografien schienen das Einzige zu sein, das hier privaten Charakter hatte. Auf allen dreien waren Kinder zu sehen. Schätzungsweise waren die Bilder in den Achtzigerjahren entstanden.
»Wie viele Kinder hatte er gleich wieder?«, fragte sie Alex, der inzwischen das Handy weggepackt hatte.
»Zwei.«
Fredrikas Blick fiel auf den Servierwagen vor der Wand neben Benkes Sessel. Sie runzelte die Stirn. Obenauf neben einem Obstkorb lag ein weiteres Foto, ein Polaroid. Sie betrachtete es eine Weile, fragte sich, warum es auf dem Servierwagen lag und wer wohl die abgebildeten Personen waren. Drei Männer – einer davon Benke selbst – schauten ernst in die Kamera, ein vierter sah weg. In welchem Zusammenhang oder wo genau das Bild geschossen worden war, war nicht zu erkennen. Allerdings trug keiner der Anwesenden sonderlich schicke Kleidung: Benke hatte Chinos an und die Ärmel seines blauen Hemdes hochgekrempelt.
Dann mit einem Mal schlug ihr Herz schneller. Der vierte Mann – der aussah, als wollte er sich von der Kamera wegdrehen – stand halb im Schatten, sodass sie es erst nicht gesehen hatte. Inzwischen war sie sich sicher.
Sie kannte ihn.
Sie hielt Alex das Foto hin.
»Siehst du, wer das ist?«, fragte sie und tippte auf den Mann.
»Nein … Sieht aus, als hätte das Bild schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Benke ist darauf noch deutlich jünger.«
Fredrika drehte das Foto um. Keine Namen, keine Jahreszahl.
Sie legte es auf den Servierwagen zurück. Die Techniker würden es mit ins Haus nehmen und eine Kopie davon machen.
»Die Brutalität«, sagte Alex und riss sie aus ihren Gedanken.
»Wie bitte?«
»Ich meine nur, dass mir irgendetwas an diesem Mord verdammt brutal vorkommt«, erklärte Alex und fügte dann fast beschämt hinzu: »Ich meine, brutaler als … tja. Als sonst.«
»Kommt darauf an, womit man es vergleicht«, gab Fredrika zu bedenken.
»Natürlich«, pflichtete Alex ihr bei und verzog das Gesicht. »Das meine ich ja. Es ist nicht das Brutalste, was wir je gesehen hätten … aber es ist … ungewöhnlich. Guck dir das Eintrittsloch an. Das hier war ein Mörder, der sich seiner Sache ganz sicher sein wollte.«
Die Erinnerung an Ermittlungen, die sie an den Rand des Wahnsinns gebracht hatten, trieben zurück an die Oberfläche.
Brutal, hatte Alex gesagt.
Und das war es, natürlich.
Vielleicht bin ich abgestumpft, dachte Fredrika. Zumindest reagiere ich gerade kein bisschen so wie er.
Wieder sah sie zu dem Bild auf dem Servierwagen.
Es musste für Benke eine Bedeutung gehabt haben. Oder für seinen Mörder.
Fredrika wollte wissen, in welcher Hinsicht. Vor allem aber wollte sie wissen, wer der vierte Mann war, der nicht in die Kamera hatte sehen wollen.
WAR ER DENN allen Ernstes der Einzige, der den Verdacht hatte, da könnte etwas nicht stimmen? Es fiel Noah Johansson schwer, sich damit zufriedenzugeben. Er musste nicht mal mehr in seinem Kalender nachsehen, wann immer ihn jemand fragte. Er wusste aus dem Kopf, wie viele Wochen und Tage Dan jetzt schon verschwunden war. Und Noah hatte nicht die geringste Ahnung, wie er ihn wieder zurückholen sollte.
Vor allem diese Erkenntnis war schier unerträglich. In Noah machte sich langsam, aber sicher die Befürchtung breit, dass ihm die Zeit davonlaufen könnte. Wenn er Dan nicht schnell fände, wäre es unter Garantie zu spät.
Dieser Gedanke war neu – und tat maßlos weh: dass die Zeit einfach weiter verstrich, egal wie sehr er sich bemühte und kämpfte. Und dass er bald keine mehr hätte.
Noah hatte allmählich das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Er fühlte sich so allein. Die Polizei wollte nichts mehr von ihm wissen, und seine Freunde verstanden seine Seelenqualen einfach nicht. Dass die Sorge ein derart großes Loch in einen Bekanntenkreis reißen konnte, schockierte ihn bei allem, was in den vergangenen Wochen geschehen war, wohl am allermeisten.
Roine, sein ältester Freund und einer der wenigen, die ihm noch geblieben waren, hatte es erst letzte Woche gesagt, als sie sich in einer Bar getroffen hatten.
»Ich versuche wirklich, dich zu verstehen«, hatte er gesagt. »Aber … es macht mir Angst. All das, was du da beschreibst … In Wahrheit willst du dich doch einfach nicht damit abfinden, dass dein Bruder nach Australien gezogen ist. Hör auf damit, hör auf, dann wirst du wieder der Alte.«
Australien.
Immer dieses verdammte Australien.
Noah hatte eine Entscheidung treffen müssen. Entweder verlor er auch noch Roine, oder aber er ließ dessen harte Worte unkommentiert. Am Ende entschied er sich dafür, den Freund zu behalten. Noch einsamer – das würde Noah nicht aushalten. Er würde es nicht überleben, Roine auch noch zu verlieren. Trotzdem fühlte es sich momentan so an, als wäre genau das passiert, denn Roine hatte sich seit jenem Abend nicht mehr bei ihm gemeldet.
Zu Anfang hatte Noah noch gedacht, mit seinem Bruder sei alles in Ordnung. Dan und seine Familie hatten jahrelang davon gesprochen, nach Australien zu gehen. Es hätte weniger eine echte Auswanderung sein sollen denn eine Art Familienabenteuer: ein, zwei Schulhalbjahre im Ausland.
Erst war Thailand im Gespräch gewesen (zu viel Sonne und Strand), dann London (zu teuer). Dann Australien. Nach dem Jahreswechsel war es dann konkret geworden. Sowohl Dan als auch seine Frau hatten dort spannende Jobs aufgetan. Die Vorstellungsgespräche hatten sie übers Internet machen können, die Schulanmeldungen der Kinder waren per Post verschickt worden – und irgendwann war das komplette Paket fertig geschnürt gewesen.
»Zwei Wochen vor Ende des Schuljahres geht es los«, hatte Dan erzählt. »Ich habe gleich Ende Mai ein paar Besprechungen dort, bei denen ich dabei sein soll, und es gibt keinen Grund, warum wir nicht gleich alle zusammen fahren sollten. Dann haben wir noch ein paar Wochen frei, bevor Job und Schule ernsthaft losgehen.«
Noah würde jederzeit freiheraus zugeben, dass ihm das Australienprojekt von Anfang an nicht behagt hatte. Er hatte es irgendwie unseriös gefunden, und leider hatte er dies nicht nur ein Mal laut gesagt. Am Ende waren die Brüder darüber in einen heftigen Streit geraten. Als Noah dann unversehens die Möglichkeit bekommen hatte, in der Woche vor Dans Umzug an einer Fachkonferenz auf Mallorca teilzunehmen, sorgte er dafür, dass er mitfahren durfte, und verlängerte obendrein seinen Aufenthalt, legte seinen Jahresurlaub diesmal früher, sodass er auch garantiert weg wäre … und als er wieder nach Hause kam, fühlte sich alles leer an. Dan war weg, das Haus war verwaist. In Noahs Briefkasten lag bloß ein Umschlag mit einem knappen Gruß und dem Hausschlüssel seines Bruders.
»Kümmerst du dich um das Haus, so wie wir es ausgemacht haben? Danke.«
Noah war stinkwütend gewesen. Sie hatten überhaupt nicht ausgemacht, dass er sich um Dans Haus kümmern sollte – das konnte doch wohl jemand anders machen! Außerdem besaß Noah bereits einen Schlüssel. Es vergingen ein, zwei Wochen, in denen Noah nichts mehr von seinem Bruder hörte. Irgendwann wurde das Schweigen unangenehm. So konnte es doch nicht weitergehen. Also nahm Noah seinen Schlüssel und fuhr zum Haus seines Bruders. Wollte mal nachsehen, was es dort zu tun gäbe, ehe er Dan mailen würde, um zu hören, wie es ihnen ging.
In Dans Haus hatte er zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmte. Es sah nicht so aus, wie man es von jemandem erwartete, der die Absicht gehabt hatte, ein Jahr lang nicht wiederzukommen. Im Trockner lag Wäsche. In der Spülmaschine Geschirr. Und dann die Schränke. Massenhaft Klamotten. Hatten sie vorgehabt, sich in Australien alles neu anzuschaffen? Oder was war der Plan gewesen?
Noah schickte seinem Bruder, noch während er bei ihm zu Hause war, per Smartphone eine E-Mail. Die Antwort kam erst geschlagene zwei Tage später. Dan klang kurz angebunden, machte nicht viele Worte. Noah solle aufhören zu stänkern und nach Fehlern zu suchen. Sie hätten ihren Umzug verdammt noch mal so organisiert, wie sie wollten. Verdammt noch mal so, wie sie wollten. Das waren die alles entscheidenden Worte gewesen. Noch nie hatte Dan gegenüber Noah geflucht. Das Fluchen, der Schlüssel im Briefkasten – allesamt eindeutige Signale, dass da etwas nicht stimmte. Und zwar ganz und gar nicht.
Deshalb hatte Noah schließlich die Polizei alarmiert.
Doch dort hatte man ihn nicht ernst genommen. Nicht mal als er in Tränen ausgebrochen war und vom Fahrrad des Bruders erzählt hatte, das am selben Nachmittag, als ihm gedämmert hatte, dass da etwas faul war, in der Auffahrt gelehnt hatte. Es sah vielleicht aus wie ein x-beliebiges altes Fahrrad, aber sein Bruder hatte es von ihrem Großvater geerbt und hätte es niemals unverschlossen dort draußen stehen lassen.
Die Polizei kam nach einer kurzen Stippvisite zu dem Schluss, dass Noah sich alles nur einbildete. Sie behaupteten, sie hätten Kontakt mit Dan aufgenommen, und der habe ihnen bestätigt, er sei aus freien Stücken verzogen. Für die Polizei war die Sache damit erledigt.
Doch nicht für Noah.
Er nahm Kontakt zur schwedischen Botschaft in Canberra auf. Dort versprach man ihm zu prüfen, ob Dan und seine Familie wie geplant in Australien angekommen waren, wollte aber nicht zu viel versprechen. Es sei nicht sicher, ob man ihm werde helfen können, aber man werde ihn dennoch binnen einer Woche zurückrufen. Es sei immerhin Urlaubszeit und die Botschaft derzeit nur sporadisch besetzt.
Noah hatte auf eigene Faust weitergesucht – ohne jeden Erfolg. Die Fluglinie berief sich auf den Datenschutz, dort wollte ihm niemand bestätigen, dass Dan überhaupt abgeflogen war. Noah bat erneut die Polizei um Hilfe, doch die verweigerte ihm jede Unterstützung. Es sei nur unter ganz speziellen Bedingungen überhaupt möglich, an Passagierlisten zu kommen, ob Noah das denn nicht einsehen könne? Wenn die Polizei keine deutlicheren Hinweise darauf bekomme, dass irgendetwas nicht stimme, dann werde sie keinen Finger rühren, um ihm zu helfen.
Noah schluckte. Sein nächster Kunde war schon auf dem Weg, da musste Noah sich konzentrieren. Es handelte sich um jemanden mit besonderen Wünschen, und insgeheim hätte Noah den Termin lieber abgesagt, hatte es dann aber doch nicht geschafft. War dies der Inbegriff von »zu viel zu tun« – dass man es nicht mal mehr schaffte, den eigenen Kalender aufzuräumen?
Als der Kunde eintrat, klingelte die Glocke über der Tür.
Mit mühsam erkämpfter Ruhe trat Noah ihm entgegen.