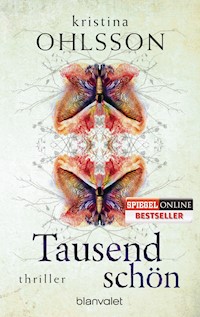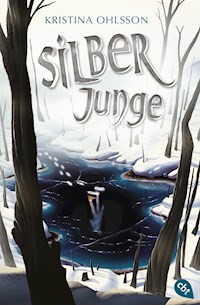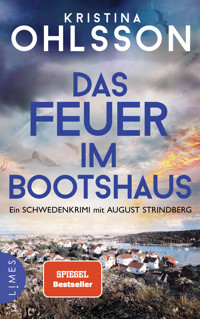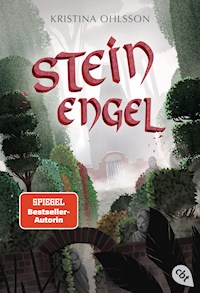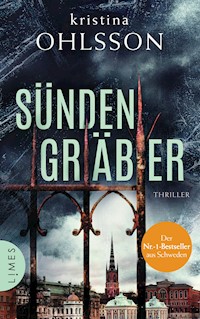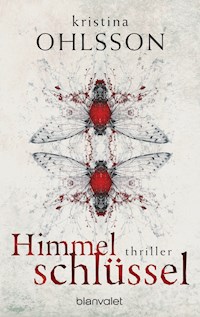9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Martin Benner
- Sprache: Deutsch
Der Sensationserfolg – insgesamt 55 Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und unter den Top 5 der bestverkauften Paperbacks 2017!
Staatsanwalt Martin Benner will Bobby Tell eigentlich schnellstmöglich wieder loswerden: Dieser ungepflegte, nach Zigaretten stinkende Kerl wirkt erst mal wenig vertrauenswürdig. Sein Anliegen ist nicht weniger prekär: Tells Schwester Sara – eine geständige fünffache Mörderin, die sich noch vor der Verfahrenseröffnung das Leben nahm – soll unschuldig gewesen sein, und Benner soll nun posthum einen Freispruch erwirken. Vor Gericht hätte die Beweislage damals nicht mal ausgereicht, um Sara zu verurteilen, doch unbegreiflicherweise legte sie ein umfassendes Geständnis ab und konnte sogar die Verstecke der Tatwaffen präzise benennen. Benners Neugier ist geweckt, und er nimmt das Mandat an …
Alle Bücher der Serie:
Schwesterherz. Martin Benner 1
Bruderlüge. Martin Benner 2
Blutsfreund. Martin Benner 3
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kristina Ohlsson
Schwesterherz
Thriller
Deutsch von Susanne Dahmann
Von Kristina Ohlsson bereits erschienen:
Aus der Serie mit Fredrika Bergman und Alex Recht: Aschenputtel Tausendschön Sterntaler Himmelschlüssel Papierjunge Sündengräber
Aus der Serie mit Martin Benner: Schwesterherz Bruderlüge Blutsfreunde
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Lotus Blues« bei Piratförlaget, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2014 der Originalausgabe by Kristina Ohlsson
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
by Limes Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Leena Flegler
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: Ilona Wellmann/Arcangel Images
BL · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-17231-2V004
www.limes-verlag.de
Teil I
»Es geht um meine Schwester«
ABSCHRIFTDESINTERVIEWSMITMARTINBENNER (MB)
DURCHFREDRIKOHLANDER (FO), freier Journalist
Ort des Treffens: Zimmer 714 im Grand Hôtel, Stockholm
MB:
Also, diese Geschichte, die ich erzählen will, da kann ich jetzt schon sagen: Sie werden mir nicht glauben. Okay? Aber wissen Sie was? Das ist mir scheißegal. Ich muss einfach erzählen, was mir passiert ist. Von Anfang bis Ende. Ich muss zu Ende reden dürfen.
FO:
Okay, ich höre Ihnen zu. Dafür hab ich schließlich auch bezahlt. Ich bin kein Polizist und kein Richter. Ich halt einfach die Klappe und hör zu.
MB:
Das will ich hoffen. Es ist wichtig, dass Sie mir zuhören, und vor allem, dass Sie darüber schreiben. Damit meine Geschichte festgehalten wird. Ansonsten ist dieses Gespräch keinen müden Cent wert. Ist das klar?
FO:
Vollkommen. Deshalb bin ich hier. Um Ihre Version zu hören.
MB:
Das ist nicht meine Version, die Sie zu hören kriegen.
FO:
Wie das?
MB:
Sie haben gerade gesagt, Sie wären hier, um meine Version des Ganzen zu hören. Das heißt doch, dass es mehrere Versionen gibt. Meine und die von jemand anderem. Aber das ist nicht der Fall.
FO:
Okay.
MB:
Ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Dass ich entweder unterbelichtet oder komplett durchgeknallt bin. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht so ist.
FO:
Vielleicht können wir jetzt einfach ganz am Anfang beginnen, anstatt darüber zu diskutieren, was ich glaube und was nicht. Sie behaupten also, Sie wären einem Komplott zum Opfer gefallen und es würden Ihnen Verbrechen angehängt, die Sie gar nicht begangen haben.
MB:
Nicht so eilig.
FO:
So eilig?
MB:
Sie haben doch gerade gesagt, wir sollten ganz am Anfang beginnen. Aber das ist nicht der Anfang. Ganz am Anfang dieser Geschichte saß nämlich nicht ich auf der Anklagebank.
FO:
Entschuldigen Sie, da haben Sie natürlich recht. Aber erzählen Sie doch einfach selbst. Damit dieses Gespräch so verläuft, wie Sie es sich vorstellen.
MB:
Sie müssen schon entschuldigen, dass ich mit den Details so kleinlich bin, aber was immer Sie darüber schreiben, sobald wir dieses Gespräch beendet haben, wird das Wichtigste sein, was Sie in Ihrem Leben je schreiben werden.
FO:
Das bezweifle ich nicht.
(Schweigen)
MB:
Eins müssen Sie noch wissen, bevor wir hier ernsthaft loslegen.
FO:
Ja?
MB:
Sie haben noch nie eine so klischeehafte Geschichte gehört.
FO:
Wirklich?
MB:
Definitiv. Sie enthält alle notwendigen Zutaten. Unaufgeklärte Morde. Einen übermächtigen Drogenboss. Einen erfolgreichen sexsüchtigen Anwalt. Und – Trommelwirbel! – ein süßes Kleinkind. Mit anderen Worten: Großes Kino. Wenn da nicht dieses eine Detail wäre.
FO:
Nämlich?
MB:
Es ist nun mal kein Spielfilm. Das alles ist tatsächlich passiert. Hier und jetzt. Direkt vor der Nase diverser Durchschnittsidioten, die absolut nichts gemerkt haben. Und nichts – nicht das Geringste – war so, wie es zunächst den Anschein hatte.
1
BOBBYBRACHTEDASSCHLECHTEWETTERmit. Regen ist in Stockholm im Grunde nichts Ungewöhnliches, aber bevor Bobby in mein Leben trat, hatte die Sonne geschienen, daran erinnere ich mich noch genau.
Wie auch immer. Es regnete also. Ich hatte nicht sonderlich viel zu tun, und das war mir auch ganz recht. Es war Sommer, und bald würde ich den Laden für die Ferien schließen. Lucy und ich wollten nach Nizza fliegen, baden und in der Sonne liegen, Drinks schlürfen und einander mit Sonnencreme einschmieren. Belle sollte bei ihren Großeltern bleiben. In dieser Situation hat man echt keinen Bock darauf, dass es an der Tür klingelt. Aber genau das passierte. Helmer, Lucys und mein Assistent, ließ den Besucher rein und führte ihn zu meinem Zimmer. Er blieb auf der Schwelle stehen.
Ich erkenne ein Problem, sobald ich es vor Augen habe. Und in dem Augenblick, als ich Bobby zum ersten Mal vor Augen hatte, witterte ich auf der Stelle Unrat. Das hatte nichts mit seiner Kleidung zu tun oder damit, dass er stank wie eine alte Zigarettenfabrik. Nein, sein Blick hatte ihn verraten. Augen wie zwei antike Pistolenkugeln. Kohlrabenschwarz.
»Was gibt’s?«, fragte ich, ohne mir die Mühe zu machen, die Füße vom Schreibtisch zu nehmen. »Ich mache gerade zu.«
»Nicht, bevor Sie mit mir geredet haben«, erwiderte der Mann und trat ins Zimmer.
Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Ich hab mich nicht Herein sagen hören«, knurrte ich.
»Seltsam«, entgegnete der Mann, »ich schon.«
Ich nahm die Füße vom Tisch und setzte mich ordentlich hin.
Der Mann streckte mir die Hand über den Schreibtisch hinweg entgegen.
»Bobby T.«, sagte er.
Ich lachte ihm direkt ins Gesicht. Es war kein freundliches Lachen.
»Bobby T.?«, fragte ich und gab ihm die Hand. »Sehr interessant.«
Verdammt lächerlich, hätte ich eigentlich sagen wollen. Ich meine, wer zum Henker nennt sich hier in Stockholm Bobby T.? Es klang wie der miese Name eines miesen Gangsters aus einem miesen amerikanischen Film.
»Als ich klein war, gab es in meiner Klasse zwei Bobbys«, erklärte der Mann. »Also wurden wir Bobby L. und Bobby T. genannt.«
»Ach so«, erwiderte ich. »Zwei Bobbys also? Das ist ungewöhnlich.«
Wahrscheinlich nicht nur ungewöhnlich, sondern einzigartig. Ich riss mich zusammen, um nicht noch mehr zu lachen.
Schweigend stand Bobby vor meinem Schreibtisch. Ich musterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle.
»So war es jedenfalls«, sagte er. »Aber wenn Sie nicht Bobby T. sagen wollen, dann müssen Sie das nicht. Bobby reicht vollkommen.«
Meine Gedanken wanderten erneut zum amerikanischen Filmbusiness. Dort wär Bobby ein großer Schwarzer gewesen, die Mutter hätte Lockenwickler in den Haaren gehabt, und sein Vater wäre Bankräuber gewesen. Bobby T. selbst wäre wahrscheinlich der Älteste in einer Schar von vierzehn Geschwistern, der Bräute anbaggerte, indem er ihnen erzählte, wie er seine kleinen Geschwister zur Schule brachte, während die Mutter zu Hause saß und soff. Dass Frauen aber auch immer auf einen solchen Mist reinfallen müssen. Männer, die ihnen leidtun.
Aber zurück zum echten Bobby. Er war hellhäutig, mager und sah ziemlich mitgenommen aus. Seine Haare waren so fettig, dass sie sich lockten, und die Haut glänzte. Was wollte dieser Kerl von mir?
»Jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie zur Sache kommen«, sagte ich. Mein Besucher fing allmählich an zu nerven. »Wissen Sie, das war nicht gelogen, als ich gesagt hab, ich würd für heute dichtmachen. Ich hab heute Abend ein verdammt heißes Date und will vorher noch duschen und mich umziehen. Das verstehen Sie doch sicher, oder?«
Ich glaube, er verstand es ganz und gar nicht. Lucy und ich machen uns manchmal einen Spaß daraus zu schätzen, wann die Leute zum letzten Mal Sex hatten. Bobby sah aus wie jemand, der schon seit Jahren nicht mehr zum Zug gekommen war. Mich beschlichen sogar Zweifel, ob er sich jemals einen runterholte. Lucy kann so was viel besser als ich erkennen. Sie behauptet, man könnte es am unteren Teil der Handfläche eines Mannes erkennen, ob er oft onaniert.
»Ich bin nicht meinetwegen hier«, sagte Bobby.
»Ach nein«, seufzte ich. Um wen geht es dann? Um Papi? Mami? Oder um Ihren Kumpel, der die Alte, die er vorige Woche beklaut hat, eigentlich gar nicht niederschlagen wollte?
Sagte ich allerdings nicht.
Ich hab gelernt, die Schnauze zu halten, wenn es nötig ist.
»Es geht um meine Schwester«, sagte Bobby.
Er wand sich ein wenig, und zum ersten Mal, seit er eingetreten war, wurde sein Blick beinahe sanft. Ich faltete die Hände auf dem Schreibtisch und legte einen Gesichtsausdruck auf, von dem ich hoffte, dass er Geduld ausstrahlte.
»Ich gebe Ihnen zehn Minuten, Bobby T.«, erklärte ich.
Nur damit er nicht glaubte, er hätte alle Zeit der Welt.
Bobby nickte mehrmals. Dann ließ er sich unaufgefordert auf einem meiner Besucherstühle nieder.
»Ich erkläre es Ihnen«, sagte er, als hätte ich unbändiges Interesse für seine Geschichte versprüht. »Ich möchte, dass Sie ihr helfen. Also, meiner Schwester. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass sie freigesprochen wird.«
Wie oft hat man so etwas als Strafverteidiger schon gehört? Die Leute bringen sich selbst in die unmöglichsten Situationen und wollen dann, dass man sie wieder raushaut. Aber so funktioniert das nicht. Meine Rolle als Anwalt ist es nicht, den Menschen zu helfen, in den Himmel statt in die Hölle zu kommen. Meine Job ist es, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die am Ende das große Urteil fällen, anständige Arbeit machen. Und das tun sie meistens.
»Wollen Sie damit sagen, sie wird eines Verbrechens angeklagt?«, hakte ich nach.
»Nicht eines Verbrechens. Mehrerer.«
»Okay. Sie ist angeklagt, mehrere Verbrechen begangen zu haben. Hat sie dann nicht schon einen Verteidiger?«
»Sie hatte einen. Aber der hat seinen Job nicht gemacht.«
Ich strich mir übers Kinn.
»Und jetzt will sie einen neuen Anwalt?«
Bobby schüttelte den Kopf.
»Nicht sie«, stellte er richtig. »Sondern ich.«
»Entschuldigung, aber jetzt hab ich wohl den Faden verloren. Sie selbst wollen einen Anwalt? Oder meinen Sie nur, Ihre Schwester könnte einen neuen gebrauchen?«
»Letzteres.«
»Und wie kommen Sie darauf, wenn Ihre Schwester doch anderer Meinung zu sein scheint?«, fragte ich. »Man hüte sich davor, den Leuten zu predigen, was sie tun sollen. Die meisten können ganz gut für sich selbst sorgen.«
Bobby schluckte, und sein Blick wurde wieder so hart wie zu Anfang.
»Meine Schwester nicht«, sagte er. »Die konnte noch nie für sich selbst sorgen. Dafür war immer ich zuständig.«
Also war er der verantwortungsbewusste Bruder. Wie schön. Davon gab es viel zu wenige auf der Welt. Oder auch nicht.
»Jetzt hören Sie mir mal gut zu«, sagte ich. »Solange Ihre Schwester nicht unmündig ist, haben Sie überhaupt keine Befugnis, sich einzumischen und ihre Verteidigung über den Haufen zu werfen. Damit erweisen Sie ihr nur einen Bärendienst. Es ist wirklich besser, wenn sie darüber selbst entscheidet.«
Bobby beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf meinem Schreibtisch auf. Ich ertrug seinen Atem nicht und lehnte mich zurück.
»Sie haben wohl nicht zugehört«, entgegnete er. »Ich hab gesagt, dass meine Schwester noch nie für sich selbst sorgen konnte. Konnte. Das ist Vergangenheit.«
Unsicher, was als Nächstes kommen würde, wartete ich erst einmal ab.
»Sie ist tot«, fuhr Bobby T. fort. »Sie ist vor einem halben Jahr gestorben.«
Es geschieht selten oder nie, dass ich erstaunt bin. Doch diesmal war ich es, denn Bobby T. wirkte weder besoffen noch high.
»Ihre Schwester ist tot?«, echote ich leicht verzögert.
Bobby T. nickte, merklich froh darüber, dass ich es schlussendlich begriffen hatte.
»Dann müssen Sie mir aber mal erklären, warum Sie hier sind«, verlangte ich. »Tote brauchen keinen Anwalt mehr.«
»Meine Schwester schon«, sagte Bobby mit zittriger Stimme. »Irgendein Teufel hat ihr Leben zerstört – mit falschen Anschuldigungen –, und ich will, dass Sie mir helfen, das zu beweisen.«
Jetzt musste ich den Kopf schütteln.
Und wählte meine Worte mit Bedacht.
»Bobby, da müssen Sie sich wirklich an die Polizei wenden. Ich bin Anwalt. Mit Ermittlungen beschäftige ich mich nicht. Ich …«
Bobby schlug mit der Faust auf den Schreibtisch, und ich zuckte unwillkürlich zusammen.
»Es ist mir scheißegal, was Sie glauben, womit Sie sich beschäftigen«, brüllte er. »Jetzt hören Sie mir mal zu! Ich weiß, dass Sie meiner Schwester helfen wollen. Deshalb bin ich hier. Weil ich gehört hab, wie Sie es gesagt haben. Im Radio.«
Ich war fassungslos.
»Sie haben mich im Radio sagen hören, dass ich Ihrer Schwester helfen will?«
»Exakt so haben Sie es gesagt. Es sei der Traum eines jeden Anwalts, jemanden wie sie zu verteidigen.«
Langsam dämmerte mir, wovon er sprach. Und wer seine Schwester war.
»Sie sind der Bruder von Sara Texas«, stellte ich fest.
»Tell! Sie hieß Tell!«
Seine aufgebrachte Stimme ließ mich erneut zurückweichen. Dann änderte er seinen Tonfall.
»Sie haben gesagt, dass Sie ihr helfen würden«, sagte er wieder. »Sie haben es im Radio gesagt. Also müssen Sie das auch so gemeint haben.«
Grundgütiger!
»Das war ein Interview über aktuelle Verbrechen«, erklärte ich und bemühte mich jetzt wirklich, freundlich zu klingen. »Ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt, das war dumm von mir. Der Fall Ihrer Schwester war in der Tat ungewöhnlich, und deshalb hab ich auch gesagt, dass es der Traum eines jeden Juristen gewesen wäre, sie zu verteidigen.«
Ich konnte kaum glauben, was hier vor sich ging.
Vor mir saß der Bruder einer Frau, die nicht weniger als fünf Morde gestanden hatte, ehe sie während eines überwachten Freigangs abgehauen war und sich am Tag, bevor die Gerichtsverhandlung eröffnet werden sollte, das Leben genommen hatte.
»Ich weiß, was Sie gesagt haben«, beharrte Bobby. »Ich habe mir das Interview wieder und wieder angehört. Man kann es sich im Internet runterladen. Und dann hab ich Sie gegoogelt. Sie sind gut.«
Dass man mit Schmeicheleien so weit kommt.
Ich sei gut, hatte er behauptet.
Und ich fand natürlich, dass er recht damit hatte.
Aber so gut, dass ich Tote wieder zum Leben erwecken konnte, war ich natürlich nicht.
»Ich fürchte, Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen«, sagte ich. »Ihre Schwester war wegen schwerer Verbrechen angeklagt – und sie hat gestanden, Bobby. Sie hat dem Ermittlungsleiter und dem Staatsanwalt direkt ins Gesicht gesehen und zugegeben, dass sie diejenige war, die all diese Menschen umgebracht hat. Erst hat sie während ihrer Zeit als Kindermädchen in Texas zwei Menschen ermordet. Dann drei weitere hier in Stockholm. Die Beweislage war erdrückend, und sie ist es immer noch. Es gibt nichts, was Sie jetzt noch für sie tun könnten.«
Er saß lange schweigend da und sah mich an, ehe er wieder das Wort ergriff.
»Sie hat gelogen. Sie hat sie nicht ermordet. Und ich habe Beweise dafür.«
Ich machte eine resignierte Geste. Dann fiel mir etwas ein, was ich von Anfang an hätte sagen sollen: »Wenn es so ist, dass Sie im Besitz von Informationen sind, die belegen, dass Ihre Schwester unschuldig war, dann müssen Sie zur Polizei gehen. Und zwar umgehend. Denn das bedeutet, dass jemand anderes der Mörder ist, und dieser Person muss das Handwerk gelegt werden.«
Wenn ich wütend oder erhitzt bin, weiten sich meine Nasenlöcher. Wie bei einem Pferd. Das war mit das Erste, was Lucy zu mir sagte, als wir uns kennenlernten, und hätte sie mich jetzt gesehen, wäre sie in Gelächter ausgebrochen.
»Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe, Bobby? Sie müssen zur Polizei gehen.«
Der verdammte Regen hämmerte derart frenetisch an die Fensterscheibe hinter mir, dass ich schon befürchtete, das Glas würde gleich nachgeben.
Auch Bobby sah erhitzt aus.
»Da war ich schon. Die haben nicht auf mich gehört. Nicht als Sara noch lebte und hinterher genauso wenig.«
»Dann müssen Sie noch mal hingehen.«
»Die scheren sich nicht um mich.«
»Das wirkt vielleicht so, aber glauben Sie mir: Die hören zu. Wenn die sich dann hinterher dafür entscheiden, alles, was Sie gesagt haben, nicht weiter zu berücksichtigen, dann nur, weil sie es als unerheblich ansehen. Dann müssen Sie das akzeptieren.«
Bobby sprang so abrupt auf, dass der Stuhl umfiel. Sein zuvor blasses Gesicht war jetzt knallrot.
»Ich kann nicht akzeptieren, was sie Sara angetan haben! Niemals!«
Auch ich stand auf.
»Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Sie noch tun können«, sagte ich. »Denn ich kann Ihnen nicht helfen.«
Einen Moment lang glaubte ich, er würde mir gleich in die Fresse hauen, doch dann schien es, als könnte er den schlimmsten Zorn zurückhalten. Stattdessen knöpfte er seine Jacke auf und holte ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Innentasche.
»Hier«, sagte er und reichte es mir.
Skeptisch nahm ich den Zettel entgegen und faltete ihn auf.
»Und?«, fragte ich, als ich gelesen hatte, was darauf stand.
»Beweis«, sagte Bobby. »Dafür, dass sie unschuldig war.«
Ich las den Zettel noch einmal.
Irgendwie sah es aus wie eine Bus- oder Zugfahrkarte. Der Text war auf Englisch.
Houston to San Antonio
5.30 PM
Friday 8 October 2007
Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Für so einen Scheiß hatte ich keine Zeit.
»Eine Busfahrkarte, die jemand gekauft hat, um am Freitag, den 8. Oktober 2007, um halb sechs Uhr abends von Houston nach San Antonio zu fahren. Und das soll der Beweis für die Unschuld Ihrer Schwester sein?«
»Das ist keine Bus-, sondern eine Zugfahrkarte«, verbesserte mich Bobby wütend, als wäre da ein himmelweiter Unterschied. »Sie haben keine Ahnung vom Fall meiner Schwester, das merke ich schon. Am Freitag, den 8. Oktober 2007, wurde der erste Mord verübt, der Sara in die Schuhe geschoben wurde. Das Opfer starb um acht Uhr abends in einer Stadt in Texas namens Galveston. Aber meine Schwester kann gar nicht die Mörderin gewesen sein, denn zu der Zeit befand sie sich in einem Zug in Richtung San Antonio. Sie halten ihren Fahrschein in der Hand.«
Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Eine Fahrkarte bewies rein gar nichts. Sie konnte genauso gut einfach nicht in den Zug gestiegen sein. Wenn die Fahrkarte überhaupt ihr gehört hatte.
»Woher haben Sie die?«, fragte ich und wedelte mit dem Zettel.
»Von Saras Freundin Jenny. Die war ebenfalls Kindermädchen, in derselben Stadt wie Sara. Sie ist mit dieser Fahrkarte zur Polizei in Texas gegangen, aber die wollten sie nicht haben. Das Ganze endete damit, dass sie das Ticket per Kurier an mich geschickt hat. Und ich ging dann damit zu dieser Null von einem Anwalt meiner Schwester.«
Was gab es da noch zu sagen?
Es stimmte, dass ich die Details aus dem Fall Sara Tell nicht kannte. Aber in groben Zügen hatte ich mir vieles angelesen. Die Beweise gegen sie waren wasserdicht gewesen. Der Staatsanwalt hatte jede Menge Material vorliegen. Die Fahrkarte bewies nicht das Geringste.
Allerdings war mir klar, dass Bobby mein Büro nicht ohne Weiteres wieder verlassen würde, wenn ich ihm nicht irgendetwas mitgäbe. Hoffnung. Was alle, die über die Schwelle zu meinem Büro schreiten, haben wollen.
Also tat ich, was ich immer tue, wenn es keinen anderen Ausweg gibt.
Ich log.
»Okay, Bobby«, sagte ich, »wir machen es so. Sie lassen die Fahrkarte und Ihre Telefonnummer hier, und ich verspreche, mir die Sache einmal anzusehen. Ich ruf Sie Ende der Woche an, sagen wir mal, am Sonntag, und dann teile ich Ihnen mit, ob wir weiter an dem Fall Ihrer Schwester arbeiten können. Und wenn ich entscheide, dass ich das nicht tun will, dann müssen Sie das akzeptieren. Einverstanden?«
Ich streckte ihm die Hand entgegen.
Er zögerte ein bisschen, doch dann ergriff er sie.
Seine Hand war kühl und trocken.
»Einverstanden.«
Er schrieb seine Telefonnummer auf einen Zettel, und dann verschwand er endlich aus meinem Büro. Ich selbst blieb mit einem alten Zugfahrschein in der Hand sitzen. Verdammt, es konnte überhaupt nicht sein, dass Sara Texas unschuldig gewesen war. Und wenn sie es gewesen wäre, dann spielte es doch keine Rolle mehr. Sie war sowohl tot als auch begraben.
Ich zog die oberste Schreibtischschublade auf und ließ die Fahrtkarte hineingleiten.
In einer Stunde würde ich Lucy treffen, und sie würde garantiert nicht mit mir schlafen wollen, wenn ich nicht erst geduscht hätte. Besser, ich fuhr schleunigst nach Hause.
Im selben Moment hörte ich, wie sich die Tür zu meinem Büro erneut öffnete, und dann stand Bobby wieder vor meinem Schreibtisch.
»Zwei Dinge noch«, sagte er. »Zum einen: Sara hatte wie gesagt einen Anwalt. Aber der hat seinen Job nicht gemacht. Wenn Sie sich den Fall vornehmen, dann werden Sie schon sehen. Dass er sie im Stich gelassen hat.«
»Und warum, glauben Sie, hat er das gemacht?«
»Er wusste gewisse Dinge, aber er hat niemandem etwas gesagt. Er kannte diese Fahrkarte, die ich Ihnen gegeben habe. Und, wie gesagt, noch andere Sachen.«
Ich hasse Leute, die in Rätseln sprechen. Ich hasse Spielchen. Die einzige Person, mit der ich spiele, ist Belle. Sie ist vier Jahre alt und glaubt noch an den Weihnachtsmann.
»Was, glauben Sie, hat er gewusst?«
»Reden Sie mit ihm. Dann verstehen Sie, was ich meine. Mehr sag ich nicht.«
Seine Rhetorik ging mir zusehends auf die Nerven, aber ich hatte keine Lust, die Diskussion noch weiter zu führen.
»Und zweitens? Sie haben gesagt, Sie hätten noch zwei Dinge hinzuzufügen.«
Bobby schluckte.
»Mein Neffe Mio. Er ist am selben Tag verschwunden, als meine Schwester sich umgebracht hat. Ich will, dass Sie ihn finden.«
Sara Texas war alleinerziehende Mutter eines kleinen Jungen gewesen. Die Polizei hatte gemutmaßt, dass Sara ihn ermordet und dann seine Leiche irgendwo verscharrt hätte.
Soweit ich informiert war, hatten entsprechende Nachforschungen nie auch nur einen einzigen Hinweis darauf zutage gefördert, wo das Kind abgeblieben war.
»Da muss ich eine deutliche Grenze ziehen«, sagte ich. »Das hier ist ein Anwaltsbüro, kein ehrenamtlicher Verein, der sich um Vermisste kümmert. Sorry. Ich hab Ihnen versprochen, mir den Fall Ihrer Schwester anzusehen, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen herauszufinden, was mit ihrem Sohn geschehen ist.«
»Das hängt zusammen«, sagte Bobby. »Das werden Sie schon sehen. Alles Teile ein und derselben Geschichte.«
Dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging. Und diesmal kam er nicht zurück.
2
»ICHHABNICHTVOR, HEUTEAbend mit dir zu schlafen, nur dass du’s weißt.«
Warum sagen Frauen so etwas? Wir hatten uns gerade erst hingesetzt und den ersten Drink bestellt, als Lucy auch schon wieder das Gefühl hatte, unseren Abend ruinieren zu müssen.
»Du, Sex war wirklich das Letzte, woran ich gedacht hab, als ich hierherkam«, sagte ich.
»Martin, also echt!«
»Was denn? Ist doch wahr.«
Unsere Drinks kamen, und ich nippte vorsichtig an dem bitteren Getränk. GT, zeitlos, Klassiker.
Natürlich kaufte Lucy mir die billige Lüge nicht ab. Dafür kennt sie mich zu gut. Sie kennt die Männer, weiß, dass wir in einer Tour an Sex denken. Das ist biologisch, daran kann man nichts ändern.
»Wenn du nicht an Sex gedacht hast, woran dachtest du dann?«
»An Sara Texas.«
Lucy prustete los und hätte fast ihren Drink verschüttet. Sie trinkt immer erst einen Cosmopolitan und dann Wein.
»Der war gut!«
Ich merkte, wie sie sich entspannte und ihr Lächeln wärmer wurde. Vielleicht würde ja doch noch was draus werden. Auf jeden Fall würde ich Bobby ordentlich danken müssen, wenn ich mich das nächste Mal mit ihm unterhielt.
Allein der Gedanke, Bobby noch einmal treffen zu müssen, verfinsterte prompt meine Laune. Gierig nahm ich ein paar Schlucke von meinem GT und spürte plötzlich Lucys Hand auf meiner Schulter.
»Ist irgendwas passiert?«
»Nachdem du weg warst, haben wir Besuch bekommen«, erklärte ich.
Ich erzählte ihr von Bobby, und Lucy hörte mit großen Augen zu.
»Das ist doch komplett verrückt«, sagte sie, als ich fertig war. »Sara Texas hatte einen Bruder, der glaubt, sie wäre unschuldig gewesen?«
»So ist es ja wohl in den meisten Fällen«, gab ich zu bedenken, »dass Kriminelle Angehörige haben, die ums Verrecken glauben wollen, dass sie nichts Böses getan hätten, aber …«
Lucy sah mich abwartend an.
»Ja?«
»Verdammt, Lucy, der Typ hatte irgendetwas Seltsames an sich. Mal abgesehen davon, dass er Sara Texas’ Bruder war. Er war so forsch … so überzeugt …«
»Davon, dass Sara unschuldig gewesen wäre?«
»Ja, einerseits, aber auch davon, dass ich mich ihres Falles annehmen würde.«
Lucy runzelte die Stirn.
»Aber Sara Texas ist doch tot, oder?«
»Natürlich ist sie das. Und das schon seit Monaten.«
In den Zeitungen waren meterlange Spalten über sie erschienen. Von ihrer Kindheit im Stockholmer Vorort Bandhagen und von ihrem Alkoholikervater, der sie an seine Saufkumpane verhökert hatte. Ihre Lehrer waren vorgetreten und hatten von Saras trauriger Kindheit berichtet. Hatten dabei auch ordentlich geweint und bereut, nicht viel früher das Jugendamt alarmiert zu haben.
»Ich kann mich kaum noch an die Geschichte erinnern«, meinte Lucy. »Wie war das noch, wie ist sie in Texas gelandet?«
»Sie war Au-pair.«
»Gott, wer stellt denn so jemanden als Au-pair ein?«
»Was soll das denn heißen, so jemanden? Auf dem Papier kann jeder gut aussehen. Die Frage ist wohl eher, wie Leute jemanden für die Betreuung ihrer Kinder anstellen können, der selbst gerade erst von zu Hause ausgezogen ist. Wir wollen Menschen dieses Alters ja wohl kaum dazu ermuntern, Eltern zu werden.«
Lucy nahm noch einen Schluck von ihrem Drink.
»Das muss eine riesige Erleichterung für sie gewesen sein, von ihrer grässlichen Familie wegzukommen …«
»Ganz sicher«, stimmte ich ihr zu. Diesen Gedanken hatte ich auch schon gehabt. »Schade nur, dass sie ihre neu gewonnene Freiheit nicht kreativer zu nutzen wusste, als eine Handvoll Menschen umzubringen.«
Lucy grinste.
»Du bist echt so geil, Martin …«
»Du auch, Baby. Deshalb kannst du ja auch nicht ohne mich leben.«
Ich legte ihr den Arm um den Rücken. Sie ließ mich gewähren.
Wir waren mal ein Paar gewesen. Ich glaube kaum, dass ich je aufgeblasener war als damals. Ich, Martin Benner, hatte es geschafft, die heißeste Juristenbraut in ganz Stockholm, vielleicht sogar ganz Schwedens zu erobern. Lucia »Lucy« Miller. Größer ging es nicht.
Größer nicht, aber dauerhaft eben auch nicht. Natürlich war es meine Schuld, dass es nicht hielt. Wie üblich verfiel ich in Panik und fing an, mit anderen zu schlafen. Ein kleiner Teil von mir glaubt immer noch, dass ich nichts dafür kann. Es hat doch jeder seine Unarten. Manche rülpsen, wenn sie gegessen haben, und andere können eben nicht monogam sein.
»Wo ist Belle heute Abend?«, fragte Lucy.
»Kindermädchen«, erwiderte ich kurz angebunden.
»Apropos, die Erziehung von Kindern jemand anderem anvertrauen.«
»Jemand anderem, der nicht selber noch ein Kind ist. Signe ist fünfundfünfzig. Perfektes Alter für ein Kindermädchen.«
»Quatsch. Du hast nur deshalb so ein altes Kindermädchen eingestellt, weil du wusstest, dass du so nicht in Versuchung kommen würdest, mit ihr zu schlafen.«
Ich kippte den restlichen Drink in mich hinein und tat so, als hätte ich nicht hingehört.
»Bitte noch einen«, sagte ich zum Barkeeper.
»Und du findest immer noch nicht, dass Belle mit nach Nizza kommen sollte?«, fragte Lucy.
»Belle sollte definitiv nicht mit nach Nizza kommen. Sie sollte bei ihren Großeltern bleiben. Das wird wunderbar.«
Die meisten, die mir begegnen, glauben nicht, dass ich ein Kind habe. Das hab ich auch nicht, zumindest kein leibliches und schon gar kein geplantes. Belle ist die Tochter meiner Schwester. Meine Schwester und ihr Mann sind vor knapp drei Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Damals war Belle neun Monate alt. Niemand, ich selbst eingeschlossen, hätte je gedacht, dass Belle einmal bei mir wohnen würde. Jeder war der Ansicht, dass sie zu ihrer Tante väterlicherseits und deren Familie kommen sollte. Doch diese Tante, dieses Aas, meinte glatt, sie könnte sich nicht auch noch um die Tochter ihres Bruders kümmern. Sie hatte bereits zwei Kinder und behauptete, es wäre den anderen gegenüber ungerecht, wenn sie noch ein Kind in die Familie aufnähme. Ihr Mann war außerdem der Meinung, dass sie weder Zeit noch Geld hätten, um ein weiteres Baby großzuziehen. Ein Waisenkind passte einfach nicht in ihr schönes Idyll. Das Haus zu eng, das Auto zu klein.
Lucy formulierte es damals ganz richtig: Zu klein war einzig und allein der Platz in ihren Herzen.
Also sollte Belle zu einer Pflegefamilie kommen. Und zwar ausgerechnet in Skövde.
Ich weiß noch, wie mein Blutdruck stieg, als ich das hörte. Keine Ahnung, wie ich zum Jugendamt gekommen bin, aber plötzlich saß ich da.
»Aber wir haben doch schon alles besprochen«, sagte die Tusse vom Jugendamt. »Belles Tante will sie nicht bei sich aufnehmen. Und Sie auch nicht. Was Ihre Mutter angeht, Belles Großmutter – die ist zu alt. Dasselbe gilt für die Großeltern väterlicherseits. Also muss die Sorge für Belle jemand anderem anvertraut werden.«
Sie lächelte mich aufmunternd an.
»Die Familie hat jede Menge Erfahrung als Pflegeeltern. Sie wohnen auf einem wunderschönen Hof mit vielen Tieren. Das wird eine gute Umgebung für Belle, um den Verlust zu verarbeiten.«
Ich sah es deutlich vor mir, wie Belle bei irgendwelchen Bauerntölpeln in der Pampa landete, wo man ihr beibringen würde, Kühe von Hand zu melken. Verdammt, war das alles beschissen gelaufen.
»Ich hab’s mir anders überlegt«, hörte ich mich selbst sagen. »Ich will, dass sie zu mir kommt.«
Am selben Abend habe ich geweint, und zwar zum ersten Mal seit vielen Jahren. Nicht mal auf der Beerdigung meiner Schwester hatte ich geweint. Als ich fertig geweint hatte, stiefelte ich in mein Arbeitszimmer und schleppte dort sämtliche Möbel raus. Dann strich ich die Wände gelb und ließ sogar den Fußboden neu abschleifen. Ein paar Tage später zog Belle ein. Bis dahin hatte ich mein ganzes Leben lang nicht eine einzige Windel gewechselt und noch nie ein Fläschchen warm gemacht. Und noch nie das Gewicht eines so kleinen Menschen auf meinem Arm gespürt.
Es passiert immer noch, dass ich Albträume bekomme, die davon handeln, wie viel Belle zu Anfang geschrien hat. Wenn Lucy und meine Mutter nicht gewesen wären, hätte ich das erste Jahr nicht überstanden. Im Nachhinein finde ich allerdings, dass es das alles wert war. Es ist schön, ab und zu mal etwas richtig zu machen.
Lucy bestellte sich ein Glas Wein.
»Das wird schön, mal rauszukommen«, sagte sie.
»Finde ich auch«, erwiderte ich.
Ich zog sie näher an mich und atmete den Duft ihres Haares ein. Es war schon okay, wenn sie nicht mit mir schlafen wollte. Wenn sie es nur nicht mit jemand anderem tat.
»Was machst du denn jetzt?«, fragte Lucy.
»Was meinst du?«
»Mit Sara Texas und ihrem Bruder.«
»Was ich mache? Natürlich nichts. Ich meine, was gibt es da noch zu machen? Die Frau ist tot. Sie hat gestanden, Lucy. That’s it. Es ist vorbei, da gibt es nichts mehr zu bedenken.«
»Und diese Fahrkarte?«
»Was soll damit sein? Es ist nur eine Zugfahrkarte. Die beweist gar nichts. Außerdem ist es nicht meine Aufgabe, solche Details zu ermitteln. Das muss schon die Polizei machen.«
Lucy schwieg. Sie wusste natürlich, dass ich recht hatte. Was mich allerdings erstaunte, war, dass sie es nicht mal infrage stellte.
»Woran denkst du?«, fragte ich.
»Nichts. Ich spinne nur ein bisschen rum. Klar, dass sie schuldig war. Und wenn sie es nicht war, dann ist es eben genauso, wie du sagst. Dann ist es Aufgabe der Polizei, sich darum zu kümmern.«
Sie nahm einen Schluck Wein.
Im selben Moment entdeckte ich am anderen Ende des Lokals eine Frau. Hübsch und offensichtlich von ihrer Gesellschaft gelangweilt. Sie hielt ihr Weinglas mit beiden Händen. Kein Ring. Die würde ich in weniger als einer halben Stunde abschleppen können.
Lucy folgte meinem Blick.
»Du bist wirklich unmöglich, Martin.«
»Jetzt hör schon auf. Ich guck doch nur ein bisschen.«
Ich küsste sie auf die Wange.
»Das macht doch wohl nichts, oder?«
Lucy sah sauer aus.
»Trink aus«, sagte sie.
»Willst du nach Hause?«
»Ja, und du kommst mit. Ich hab’s mir anders überlegt. Ich will heute Abend doch mit dir schlafen.«
3
MERKTEUCHEINS: DERÄLTESTETrick aus der Mottenkiste funktioniert immer noch am besten. Es genügte schon, dass ich nach einer anderen Frau schielte, um Lucy dazu zu bringen, mit mir schlafen zu wollen. Als ich eine Stunde später nackt neben ihr auf dem Boden ihrer Wohnung lag, wunderte ich mich, wie leicht es doch jedes Mal wieder war, seinen Willen durchzusetzen. Sie hatte den Abend damit begonnen, Nein zu sagen, und dann hatte sie Ja gesagt.
Same old story.
Mein Handy klingelte.
»Martin, du musst sofort kommen, der Keller steht unter Wasser!«
Wie immer.
Meine Mutter ruft ausschließlich an, um zu fragen, ob sie auf Belle aufpassen darf, oder weil sie will, dass ich ihr mit irgendwas helfe. Auf die Hilferufe hab ich inzwischen eine Standardantwort: »Du weißt, dass ich dir sofort helfen würde, wenn ich könnte, Marianne. Aber ich schaff es einfach nicht. Eine Mandantin braucht mich, ich kann sie jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Ruf jemand anderen an, ich kümmer mich dann um die Rechnung.«
Die Behauptung, Geld mache nicht glücklich, ist völliger Quatsch. Mit Geld kann man sich Zeit kaufen, und mit der Zeit kauft man sich die Freiheit. Und wer frei ist, ist auch glücklich.
Übrigens hab ich meine Mutter nie Mama genannt. Sie heißt Marianne, und es gibt keinen Grund, sie anders zu nennen.
Nachdem ich aufgelegt hatte, sah ich, wie Lucy mich ansah.
»Das war aber nicht gerade nett.«
»Es ist schon spät. Ich muss nach Hause und das Kindermädchen ablösen.«
Ich stand vom Boden auf und streckte mich.
»Du weißt, dass ich mit dir nach Hause kommen könnte«, sagte Lucy. »Bei dir übernachten und dann Belle morgen in die Kindertagesstätte bringen.«
Ich zog Unterhose und Hose an.
»Baby, das ist keine gute Idee.«
Wir wussten beide, warum. Belle durfte uns nicht zu oft zusammen sehen, ich wollte nicht, dass sie glaubte, wir wären ein richtiges Paar.
»Ein andermal, okay?«
Lucy ging ins Badezimmer und machte die Tür hinter sich zu. Ich hörte, wie sie das Wasser im Waschbecken laufen ließ, damit ich nicht hörte, dass sie pinkelte. Echt lächerlich.
Und noch lächerlicher war, dass ich immer noch an Sara Texas dachte. Und an Bobby.
Fünf Morde hatte sie gestanden. Dieser Fall war keine blöde Dokusoap gewesen. Es hatte Beweise gegeben. Sara hatte exakte Uhrzeiten und Daten liefern können. Sie hatte das Versteck der Mordwaffen präzise benennen können, sofern es Waffen gegeben hatte. Und in den anderen Fällen hatte sie Details geliefert, über die niemand außer dem Mörder hätte Bescheid wissen können.
Trotzdem verspürte ich den Zweifel wie ein schwaches Jucken im ganzen Körper.
Diese verdammte Fahrkarte. Ob die irgendwas beweisen konnte? Sie war nicht mal personifiziert – der Name desjenigen, der mit ihr unterwegs gewesen war, stand jedenfalls nicht drauf.
Bobby hatte behauptet, sie von Jenny, der Freundin seiner Schwester, bekommen zu haben. Bobby. Ein rechter Scheißname war das. Ein Problemname. Zumindest in Schweden. Bobby und Sara. Ich erinnerte mich wieder an die Bilder, die ich in der Zeitung gesehen hatte. Sie war ihrem Bruder kein bisschen ähnlich gewesen, was natürlich keine Rolle spielte. Ich selbst hatte meiner Schwester auch nicht sonderlich ähnlich gesehen, wir hatten schließlich nicht denselben Vater. Meiner war schwarz und stammte aus den USA. Aus Texas übrigens. Mein Schwesterchen war genauso weiß gewesen wie meine Mutter. Ihr Vater stammte aus Sälen, und zwar so richtig. Ich hatte lange gedacht, dort würden überhaupt keine Menschen leben.
Bei dem Gedanken daran, wie unterschiedlich meine Schwester und ich ausgesehen hatten, musste ich grinsen. Als ich die kleine Belle zum ersten Mal in die Tagesstätte brachte, war den Erzieherinnen schier die Kinnlade runtergeklappt. Ich hab’s deutlich gesehen, obwohl sie natürlich kein Wort sagten. Wie konnte ein ellenlanger Schwarzer so ein kleines, helles Kind bekommen haben?
Sara Texas. Natürlich hieß sie nicht Texas, sondern Tell, wie ihr Bruder schon gesagt hatte. Texas hatten die Zeitungen sie genannt, weil sie dort ihre ersten Opfer erlegt hatte. Wie ein Jäger.
Ich seufzte. Ich wusste, dass ich nicht würde widerstehen können. Ich würde mich hinsetzen und alle Artikel über Sara Texas lesen, die ich finden könnte, und wenn ich dafür die ganze Nacht aufbleiben würde. Im Morgengrauen dann würde ich mir die Augen reiben und am Schreibtisch einschlafen. Erst wenn Belle aufwachte, würde die Magie verfliegen. Ich würde sie mürrisch und unrasiert zur Tagesstätte bringen und auf den Sonntag warten, an dem ich Bobby anrufen und ihm sagen könnte, was Sache wäre. Dass der Fall seiner Schwester interessant wäre, aber nichts für mich.
Weil sie tot war.
Und weil ich kein Privatdetektiv bin.
Weil Sommer war und ich bald Urlaub haben würde.
Einen einzigen Satz hatte Bobby gesagt, den ich nicht so leicht abschütteln konnte. Dass Saras Anwalt seinen Job nicht richtig gemacht hätte. Dass er »Dinge gewusst« hätte.
Lucy kam aus dem Badezimmer. Nackt und schön. Völlig unbegreiflich, dass sie mal echt meine gewesen war.
»Weißt du noch, wer Sara Texas damals verteidigt hat?«, fragte ich.
Lucy lachte und schnappte sich ihre Unterhose vom Boden.
»Das lässt dich nicht los, wusst ich’s doch.«
»Komm, hör auf. Ich bin nur neugierig.«
»Schon klar. Tor Gustavsson war das.«
Ich gab einen Pfiff von mir. Der olle Gustavsson, das hatte ich ja ganz vergessen.
»Ist der nicht kürzlich in Rente gegangen?«, fragte ich.
»Im Dezember vorigen Jahres, kurz nach Saras Tod«, erwiderte Lucy. »Du hast seine Verabschiedung verpasst, weil du an dem Wochenende mit Belle in Kopenhagen warst.«
Ich musste lächeln, als Lucy mich an die Kopenhagenreise erinnerte. Ein rundum geglücktes Wochenende. Nur Belle und ich. Wir waren am zweiten Advent rübergeflogen und hatten uns in einem Hotel am Wasser einquartiert. Wahrscheinlich hatte ich dort erstmals begriffen, wie Kinder sich im Lauf der Zeit verändern. Dass sie wachsen, Schritt für Schritt. Aus irgendeinem dummen Grund war ich erstaunt, dass Belle so ordentlich aß, als wir im Restaurant saßen. Sie konnte sagen, was sie mochte und was sie nicht mochte. Ich trank Wein, sie Limonade. Als wir zum Hotel zurückspazierten, lief sie allein. Kein Buggy, kein Tragen. Nicht, dass es sonderlich weit gewesen wäre, aber es erfüllte mich doch mit Stolz. Und mit großer Trauer. Weil meine Schwester gestorben war, als Belle noch so klein war. Und weil derjenige, der mittlerweile für Belle sorgte, also ich, nicht mal gewusst hatte, dass sie längst allein essen konnte.
Danach hatte ich mir geschworen, mich mehr mit ihrem Leben zu beschäftigen. Das Versprechen habe ich gehalten.
Die Erinnerung wärmte erst, um dann prompt ein wenig abzukühlen, und ich blinzelte ein paarmal.
»Es war eine todlangweilige Veranstaltung«, sagte Lucy. »Gustavsson hielt die längste Rede aller Zeiten und hörte gar nicht mehr auf mit all den großen Dingen, die er während seiner Laufbahn zustande gebracht hat.«
»Hat er Sara Texas erwähnt?«
»Nein, und das war komisch. Ich glaube nämlich nicht, dass er je einen größeren Fall hatte als ihren. Wahrscheinlich hat er ihn als gescheitert betrachtet. Immerhin ist sie jetzt tot.«
Das stimmte. Ich wusste noch, wie erstaunt ich war, als Gustavsson in den Zeitungen zitiert wurde. Warum hatte Sara sich einen der besten Anwälte der Stadt als Verteidiger genommen, wenn sie doch schon entschieden hatte, alles zu gestehen und sich dann noch vor der Gerichtsverhandlung das Leben zu nehmen?
»Soll ich dir ein Taxi rufen?«, fragte Lucy.
Ich schob das Hemd in die Hose.
Blickte aus dem Fenster und sah den Regen. Sollte das jetzt so bleiben? Regnerisch und nass?
»Gerne«, antwortete ich.
Kurz darauf saß ich im Taxi. Ich rief meine Mutter an und fragte, wie es mit der Überschwemmung lief. Die Handwerker waren auf dem Weg.
4
DASKINDERMÄDCHEN– ODERDIEKinderfrau, je nachdem, wie man Signes hohes Alter betrachten wollte – saß in der Küche und trank Kaffee, als ich nach Hause kam.
»War’s ruhig?«, fragte ich.
Sie lächelte.
»Absolut. Gar kein Problem.«
Signe tut all das, was ich als alleinerziehender und vollzeitbeschäftigter Vater nicht schaffe: Ich bringe Belle zur Tagesstätte, und sie holt sie von dort ab. Sie kauft ein und kocht. Wenn Belle eingeschult wird, soll sie ihr auch bei den Hausaufgaben helfen. Putzen und bügeln muss sie nicht, das macht die Putzfrau.
Wie gesagt, mit Geld kauft man sich Zeit und schafft sich eine gewisse Freiheit. Und diese Freiheit macht den Menschen glücklich.
Nachdem das Kindermädchen gegangen war, warf ich einen Blick in Belles Zimmer. Sie lag auf dem Rücken und schlief mit offenem Mund. Die rosafarbene Decke war zu groß für sie, die Kleine verschwand darunter fast komplett. Leise schlich ich hinein und zog die Decke ein Stückchen runter. Viel besser. Ich beugte mich zu ihr hinab und küsste sie leicht auf die Wange.
Dann kehrte ich in die Küche zurück und nahm die Whiskeyflasche heraus. Mein Großvater mütterlicherseits hatte mir das Whiskeytrinken beigebracht. Immer Single Malt, niemals kalt. Eis gab es nur beim Blended.
Der Holzfußboden knarrte unter meinen Füßen, als ich ins Lesezimmer rüberging und die Tür hinter mir zumachte. Es gibt keinen besseren Wachhund als einen alten Fußboden. Nachdem Belle gerade ein Jahr bei mir gelebt hatte, hatte ich die Nachbarwohnung ebenfalls gekauft und einen Durchbruch machen lassen. Wir brauchten schließlich Platz, das kleine Mädchen und ich.
Ich fuhr den Computer hoch und nahm einen Schluck Whiskey.
Sara Texas.
Ich würde ein paar Sachen nachschauen und mich dann schlafen legen. Wenn Bobby einen Privatermittler suchte, dann müsste er sich nach jemand anderem umsehen.
Meine Gedanken wanderten wieder zu Tor Gustavsson. Der Anwalt, der seinen Job nicht gemacht hatte. Der »Dinge gewusst hatte«.
Da fang ich an, dachte ich. Morgen klingel ich den ollen Gustavsson an. Und dann ruf ich Bobby an und sag ihm, dass ich aus der Nummer raus bin.
Der Ventilator im Computer surrte leise.
Meine Finger flogen über die Tastatur.
Sara Texas Tell.
Welche Geheimnisse hatte sie mit ins Grab genommen?
Sechsundzwanzig Jahre. So alt war Sara Tell gewesen, als sie den Mord an fünf Menschen gestanden hatte. Drei Frauen und zwei Männer. Kriminologen bezeichneten sie als einzigartig. Von dem Tag an, da sie gefasst worden und im Gefängnis gelandet war, war eine ausufernde Diskussion darüber entbrannt, inwieweit sie als Serienmörderin gelten konnte oder nicht. Ich hatte das nicht verstanden. Natürlich war sie eine Serienmörderin gewesen. Wäre sie nicht eine ansprechende junge Frau gewesen, hätte es diese Diskussion nie gegeben.
Wir Menschen neigen nicht dazu, an das zu glauben, was aus dem Rahmen des Erwarteten fällt. Sara Tell war nicht hübsch, aber sie war süß gewesen. Ihre Gesichtszüge waren so fein ausgemeißelt, dass sie an das Gesicht einer Puppe erinnerten. Sie war größer als die durchschnittliche Frau, fast eins achtzig. Wäre sie kleiner gewesen, hätte der Fall noch seltsamer gewirkt. Dann hätte man nämlich gar nicht mehr begreifen können, wie sie die Taten hatte begehen können.
Eine Erklärung zu den Morden hatte sie nie abgegeben, zumindest konnte ich das den Zeitungen nicht entnehmen. Inzwischen war es nach Mitternacht, und die Luft im Zimmer wurde allmählich stickig. Der Whiskey sah trübe aus, und mein Rücken war steif.
Ich musste wieder an das Radiointerview denken, in dem Bobby mich gehört hatte. Der Interviewer, ein sensationslüsterner Reporter, hatte wissen wollen, wie ich Saras Chancen einschätzte, freigesprochen zu werden. Es kommt vor, dass ich solche Anfragen bekomme, die die unterschiedlichsten Fälle betreffen, und das hängt damit zusammen, dass ich eine ziemlich kurze Zeit in meinem Leben Polizist gewesen bin. Noch dazu in den USA. Was Sara Texas betrifft, sagte ich damals, ihre Chancen, freigesprochen zu werden, seien quasi nicht existent, doch habe meiner Meinung nach jeder Mensch – ganz gleich, was er sich hat einfallen lassen – bei Gericht ein Recht auf einen Verteidiger. Auf die Frage, ob ich persönlich mir vorstellen könne, Sara zu verteidigen, hatte ich geantwortet – genau wie Bobby es wiedergegeben hatte –, Sara sei ein Traumfall, und ich hätte ihr gern geholfen.
Nur wie?, fragte ich mich jetzt, da ich vor dem Rechner saß und einen Artikel nach dem anderen über die ekelhaften Verbrechen las, die sie begangen hatte. Sara Texas wirkte auf mich darin nicht wie eine Frau in Not. Ganz im Gegenteil. Sie schien durchaus imstande gewesen zu sein, für sich selbst zu sorgen. Auf den Bildern aus dem Gericht war sie verbissen, hielt sich gerade und wirkte tatsächlich ziemlich attraktiv. Aus irgendeinem Grund irritierte mich die Tatsache, dass sie eine Brille trug. Ein Serienmörder mit süßem Gesicht, Brille und Jackett. Das passte einfach nicht zusammen. Und das lag nicht daran, dass ich irgendwelche Vorurteile hege, wer in dieser Welt Verbrechen begeht. Sara Texas war ein Paradoxon, und genau deshalb war sie interessant. Ebendeshalb hätte ich sie gern kennengelernt.
Fast ohne es selbst zu merken, streckte ich mich nach Stift und Papier. Eilig kritzelte ich ein paar grundlegende Fakten nieder. Ihren ersten Mord hatte sie im Alter von einundzwanzig Jahren begangen. Da hatte sie eine junge Frau in Galveston, Texas, erstochen. Im Jahr darauf hatte sie einen Mann in Houston ermordet. Danach war sie wieder nach Schweden gezogen. Als sie ihren dritten Mord beging, war sie gerade erst Mutter geworden. Den vierten und den fünften Mord hatte sie begangen, noch ehe der Junge drei Jahre alt gewesen war.
Die Polizei in Texas brauchte fast fünf Jahre, um herauszufinden, dass sie es gewesen war, die die Frau in Galveston und den Mann in Houston ermordet hatte. Ein Zufall hatte die Ermittlung ins Rollen gebracht und dazu geführt, dass man sich an die schwedischen Behörden wandte und beantragte, dass Sara Texas in die USA ausgeliefert würde. Das hatten die Schweden natürlich abgelehnt. Wir liefern keine Menschen an Länder aus, in denen ihnen die Todesstrafe droht. Allerdings können wir selbst Verbrechen vor Gericht bringen, auch wenn sie im Ausland stattgefunden haben. Und genau das, erklärte der Staatsanwalt, werde er tun.
Erst da dämmerte es ihnen wohl, dass Sara noch drei weitere Menschen umgebracht hatte. Diese Verbrechen hatten bis dato unaufgeklärt bei der Polizei gelegen, und dabei wäre es wahrscheinlich auch geblieben, hätte nicht Sara selbst die Hinweise darauf geliefert.
Warum in aller Welt macht man so was?
Gestand drei Morde, nach denen niemand gefragt hatte? Das ging über meinen Verstand.
Wenn man mal davon absah, dass es unseriös war, Zeitungsartikel als Quelle zu verwenden, meinte ich da noch ein paar weitere Dinge zu erkennen, die schwer zu begreifen waren.
Nirgends Fingerabdrücke.
Keine DNA-Spuren in Form von Blut, Speichel oder Haaren.
Keine vergessenen Gegenstände.
Keine Zeugen.
Und doch hatte sie sämtliche Opfer zu Lebzeiten gekannt oder getroffen. Ein solches Detail musste in diesem Zusammenhang natürlich als kompromittierend angesehen werden. Nachdem es sich gleich um fünf Opfer gehandelt hatte, die obendrein auf zwei verschiedenen Kontinenten ermordet worden waren, konnte man von dieser Tatsache kaum absehen. Dann wiederum waren es keine engen Freunde von Sara gewesen. Eins der Opfer hatte in einem Hotel gearbeitet, wo sie mal übernachtet hatte. Das zweite war ein Taxifahrer gewesen, der sie mal gefahren hatte. Beziehungen, die alles andere als eng gewesen waren.
Zusammenfassend konnte wohl nur ein einziger Schluss gezogen werden: Vor einem schwedischen Gericht wäre sie in allen fünf Fällen davongekommen, wenn sie nicht gestanden und selbst angeführt hätte.
Ich schüttelte nachdenklich den Kopf.
Warum macht man so was? Weil man ein schlechtes Gewissen hat? Weil man das Bedürfnis verspürt, alles zu erzählen?
Andererseits hatte Sara nie Reue gezeigt. Sie hatte niemals jemanden um Vergebung gebeten oder ihre Verbrechen erklärt. Weiß der Teufel, was sie da angetrieben hatte.
Mittlerweile war ich wirklich müde. Meine Augen brannten. Ich schaltete die Schreibtischlampe aus und legte mich ins Bett.
Irgendetwas am Fall Sara Texas war rätselhaft.
Etwas, von dem ich nicht wusste, wie ich Zugang dazu finden sollte.
Das störte mich.
Und zwar gewaltig.
5
WIEDERREGNETEES. WASSERTROPFENSOgroß wie Heidelbeeren fielen vom Himmel und ruinierten sowohl meine Frisur als auch mein Jackett.
Lucy lächelte, als ich zur Tür reinkam.
»Schick siehst du aus«, sagte sie.
Sie gab mir einen flüchtigen Kuss.
»Danke für gestern übrigens.«
»Gleichfalls«, erwiderte ich. »Wie immer sehr nett.«
Lucy und ich hatten unser Anwaltsbüro vor fast zehn Jahren gegründet. Damals waren wir beide frisch auf dem Arbeitsmarkt und gleichermaßen ehrgeizig gewesen. Ich weiß noch, dass ich in ihr damals eine Seelenverwandte erkannte. Sie war in allem, was sie sich vornahm, so irre hungrig – und das ist sie heute immer noch. Wir sprachen damals schon früh davon, wie erfolgreich wir einmal sein und wie viele Angestellte wir haben wollten. Letztere hatte es nie gegeben. Wir hatten uns selbst genügt und wollten niemanden mehr reinlassen, mal abgesehen von unserem Assistenten Helmer.
Ein Freund hat mich einmal gefragt, wie ich es aushalte, so eng mit einer Frau zusammenzuarbeiten, in die ich so verliebt gewesen sei. Die Frage hab ich nie verstanden. In Lucys Nähe zu sein war niemals ein Problem und ist es auch heute nicht. Aber ich würde kaputtgehen, wenn sie ihre Sachen packte und mich stehen ließe.
»Du siehst müde aus, warst du noch lange auf?«
»Nein, nein«, erwiderte ich und unterdrückte ein Gähnen.
»Von wegen. Mit Ringen unter den Augen wie ein Panda. Gib zu, du hast dich hingelegt und Sara-Texas-Artikel gelesen.«
»Ganz und gar nicht«, gab ich trocken zurück. »Ich hab gesessen. Verdammt interessant übrigens, was es da zu lesen gibt.«
»Das kann ich mir denken«, sagte Lucy. »Süße Signorina, dieses Mädel.«
Ich ging in mein Büro und hatte kaum die Tür hinter mir zugemacht, als sie wieder aufging. Helmer, unser Assistent, betrat den Raum.
»Irgendein Handwerker hat angerufen. Er wollte fragen, an welche Adresse er die Rechnung wegen irgendeines Lecks im Keller schicken solle. Ich hab ihm gesagt, dass wir keinen Keller haben, und ihn gebeten, seine Fake-Rechnungen an jemand anderen zu schicken.«
»Dann rufen Sie ihn jetzt bitte an und entschuldigen Sie sich dafür«, sagte ich. »Wir haben einen Keller, und zwar einen, der gestern unter Wasser stand.«
Helmer starrte mich verständnislos an. Für meinen Geschmack macht er das ein bisschen oft. Aber Lucy mag ihn.
»Jetzt versteh ich nicht …«
»Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Seien Sie so gut und rufen Sie ihn noch mal an. Die Rechnung geht an die Kanzlei.«
Helmer machte die Tür hinter sich zu.
Ich brauchte weniger als fünf Minuten, um die Privatnummer von Rechtsanwalt Tor Gustavsson herauszufinden. Der Kerl war eine lebende Legende. Ein bisschen unverdient vielleicht, aber trotzdem. Irgendwann hatte er mal einen sehr erfolgreichen Fabrikbesitzer verteidigt, der wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt worden war. Wie es Gustavsson gelungen war, für den Mann einen Freispruch zu erwirken, war ein Mysterium, aber im Handumdrehen hatten sämtliche Instanzen ihn freigesprochen. Danach wollten alle nur noch mit Gustavsson arbeiten.
Inzwischen war er Pensionär. Sara Texas war sein letzter großer Fall gewesen. Ich hoffte, dass er nicht sauer wäre, wenn ich anriefe. Saure alte Männer waren so ziemlich das Schlimmste.
Es klingelte ein ums andere Mal. Niemand ging ran. Ich wollte schon auflegen, als plötzlich eine helle Stimme rief: »Hallo?«
Ich räusperte mich, eine Unart, die sich bemerkbar macht, sobald ich überrascht werde.
»Martin Benner«, sagte ich, »vom Anwaltsbüro Benner & Miller. Ich würde gern Tor Gustavsson sprechen.«
Einen Moment lang war es still.
»Es tut mir schrecklich leid«, sagte die Stimme nach einer Weile, »aber Tor kann derzeit keine Telefonate entgegennehmen.«
Ich sprach mit einer Frau. Wenn ich leibhaftig vor ihr gestanden hätte, hätte ich Gustavsson in null Komma nichts an die Strippe bekommen.
»Ich bedaure sehr, das zu hören«, erwiderte ich, »denn ich rufe in einer sehr wichtigen Angelegenheit an.«
»Sind Sie Journalist?«
Die Frage überraschte mich.
»Was? Nein, wirklich nicht. Ich bin Anwalt, das hab ich doch bereits gesagt. Entschuldigen Sie, aber darf ich fragen, mit wem ich spreche?«
»Gunilla Gustavsson, ich bin Tors Schwiegertochter. Worum geht es denn?«
Ich zögerte. Irgendetwas sagte mir, dass der Name Sara Texas kein Türöffner sein würde.
»Um einen älteren Fall«, erklärte ich. »Mit dem Herr Gustavsson vor einer ganzen Weile … zu tun hatte.«
Am anderen Ende der Leitung war ein Seufzer zu hören.
»Geht es um Sara Texas?«
Fuck.
»Ja«, musste ich eingestehen.
»Der Fall hat meinen Schwiegervater beinahe umgebracht, und es wäre mir am liebsten, wenn Sie mit ihm nicht darüber reden würden.«
»Vielleicht kann ich ja noch mal anrufen, wenn es ihm besser geht?«
»Das glaube ich nicht. Sie müssen wissen, Tor hatte vor einer Weile einen heftigen Schlaganfall. Und vorige Woche einen Herzinfarkt. Und als würde das noch nicht genügen, hat er zwei Tage später eine Lungenentzündung bekommen. Er muss buchstäblich all seine Energie darauf verwenden, wieder gesund zu werden, sonst wissen wir nicht, ob er es schafft.«
Ihre Stimme klang klar und gefasst, trotzdem konnte ich einen deutlich besorgten Unterton vernehmen. Kein Wunder, wenn man bedachte, was sie gerade erzählt hatte.
»Selbstverständlich«, sagte ich. »Dann grüßen Sie ihn bitte herzlich. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht.«
Ich war Tor Gustavsson nur einige wenige Male begegnet, aber vielleicht würde er sich dennoch an mich erinnern.
»Danke«, erwiderte die Schwiegertochter. »Ich richte ihm aus, dass Sie angerufen haben. Außerdem können Sie es ja auch mal bei Eivor probieren.«
»Eivor?«
»Bei seiner Assistentin. Sie müsste eigentlich sämtliche Fragen zu Sara Texas beantworten können.«
Meine Neugier war geweckt.
»Und wo finde ich Eivor?«
»Sie ist zeitgleich mit meinem Schwiegervater pensioniert worden und wohnt in einer kleinen Wohnung in Gamla Stan.«
Tors Schwiegertochter diktierte mir eine Telefonnummer.
»Sagen Sie ihr, dass Sie die Nummer von mir haben«, fuhr die Schwiegertochter fort. »Eivor gehört fast zur Familie, sie war meinem Schwiegervater sehr ergeben.«
Das konnte ich mir vorstellen. Es ist doch immer das Gleiche. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau mit sanftem Lächeln, um ihn darauf hinzuweisen, dass seine Hosen Hochwasser haben. In Tor Gustavssons Fall hieß diese Frau Eivor. In meinem Fall hatte sie noch keinen Namen. Jedenfalls hieß sie nicht Lucy.
Ehe ich Eivor anrief, klingelte ich kurz bei Belles Tagesstätte an.
Sie war traurig gewesen, als ich sie heute Morgen dort abgeliefert hatte, und ich wollte wissen, ob alles in Ordnung war.
»Es geht ihr gut«, sagte die Erzieherin, die ans Telefon ging. »Aber vergessen Sie bitte nicht, dass sie morgen Proviant dabeihaben muss. Wir machen einen Ausflug.«
Ausflug und Proviant, solche kleinen Dinge können einen schon an den Rand des Wahnsinns bringen. Kaum hatte ich mit der Tagesstätte telefoniert, rief ich das Kindermädchen an.
»Belle soll morgen Mittagessen mit in die Schule bringen.«
»Sie meinen Proviant? In die Tagesstätte, nicht in die Schule?«
»Genau. Könnten Sie heute Nachmittag was Einfaches zusammenstellen?«
»Martin, es geht da nur um ein paar Butterbrote und etwas zu trinken.«
»Sie meinen, das sollte ich selbst hinkriegen?«
Das Kindermädchen schwieg.
»Kaufen Sie ihr was zu trinken, dann kümmer ich mich um die Butterbrote«, erwiderte ich.
Dann beendete ich das Gespräch und konzentrierte mich wieder auf wichtigere Dinge als irgendwelche dämlichen Stullen.
Eivor. Tor Gustavssons ehemalige Assistentin. Ob sie mir helfen könnte?
Sie konnte. Und – noch wichtiger – sie wollte es auch. Wir trafen uns in ihrer Wohnung. Eine kleine, aber fast schon märchenhafte Behausung wie aus einer Zeitschrift. Sie musste ihre ganze Seele reingelegt haben, um diese mickrigen Quadratmeter, die zu bewohnen sie beschlossen hatte, zu veredeln.
Sie führte mich in die Küche und drückte mich auf einen Stuhl an einem dreieckigen Tisch. Hier würde nun offensichtlich Kaffee getrunken werden.
»Ich nehm an, dass Sie jede Menge zu tun haben, ich werd auch nicht lang bleiben«, sagte ich.
Und meinte damit natürlich, dass ich selbst verdammt viel zu tun hatte, was wichtiger war, als mit einem wildfremden Menschen Kaffee zu trinken. Doch derlei verblümte Botschaften schien Eivor nicht zu verstehen.
»Sie können bleiben, solange Sie wollen«, flötete sie. »Ich habe alle Zeit der Welt.«
Gott hat mir nicht viele Talente mitgegeben, aber er hat mir das einzigartige Vermögen geschenkt, Frauen jeden Alters und jeder Kultur zu bezirzen. Und Eivor war keine harte Nuss. Ich setzte mich brav an den Tisch und hörte aufmerksam zu, während Eivor mit zitternder Stimme berichtete, wie schlimm es Tor Gustavsson ergangen und wie schrecklich alles gewesen sei.
»Sie hätten ihn arbeiten sehen sollen«, sagte sie. »Ich schwöre – im Gericht stand die Zeit still, wenn er seine Schlussplädoyers hielt.«
Fast hätte ich angefangen zu lachen, aber ich schaffte es gerade so, es wie ein Husten klingen zu lassen.
»Ich hab nur Gutes von Tor gehört«, bestätigte ich. »Der Mann war ein Ritter des Rechts.«
»Er ist noch nicht tot«, warf Eivor ein.
»Tor ist ein Ritter des Rechts.«
Ganz offenkundig hatten sie eine Affäre gehabt. Vielleicht über Jahrzehnte. Mit großer Wärme schilderte Eivor all die Jahre, in denen sie seine Assistentin gewesen war. Mit behutsamen Manövern gelang es mir, die Geschichte ein wenig voranzutreiben, sodass wir am Ende vor Tors letztem großen Fall standen: Sara Texas.
»Sie hat gestanden«, gab Eivor zu bedenken. »Tor hat alles versucht, um sie umzustimmen, das weiß ich genau. Aber sie hat sich geweigert. Recht sollte Recht bleiben.«
»Hat Tor je daran gezweifelt, dass sie die Wahrheit sagte?«
»Nein, und warum sollte er auch? Die Beweislast war erdrückend. Die Aussagen des Mädchens waren bestätigt worden. Was hätte er denn tun sollen? Er gab ihr die Unterstützung, die sie brauchte, sorgte dafür, dass es ihr im Gefängnis nicht unnötig schwer erging. Und … dann passierte, was eben passierte.«
»Sie nahm sich das Leben.«
Eivor nickte bedächtig.
»Genau das. Tor war unendlich traurig, als er es erfuhr. Aber es war nicht seine Schuld, das hab ich ihm mehrfach zu verstehen gegeben.«
In der Ecke tickte eine alte Bauernuhr. Der Regen prasselte an die Fensterscheiben, und ich fragte mich, was ich hier eigentlich machte. Trank Kaffee bei einer redseligen alten Dame. Was hatte ich eigentlich geglaubt, ihr entlocken zu können? Eine revolutionäre Wahrheit, die sie und Gustavsson über Monate verschwiegen hatten?
Ich jagte Gespenster.
Weil ein Idiot namens Bobby T. in mein Büro gestiefelt war und jede Menge Chaos angerichtet hatte.
»Wissen Sie, ob Tor Kontakt zu Sara Tells Bruder hatte?«
Eivor zuckte zusammen.
»Sie meinen Bobby? O ja. Der war stinkwütend auf Tor, müssen Sie wissen. Schrie und fluchte, wann immer er in die Kanzlei kam.«
»Warum denn das?«
»Weil er der Auffassung war, seine Schwester wäre unschuldig.«
»Hatte er für diese Auffassung denn irgendwelche Beweise?«
»Ich weiß noch, dass er einmal da war und mit einer Fahrkarte herumwedelte. Aber Tor wollte von alldem nichts hören. Und Sara ebenso wenig. Sie hat Tor regelrecht untersagt, mit ihrem Bruder zu sprechen, und danach hörte Bobby auf, in die Kanzlei zu kommen.«
Das war ja mal interessant. Sara hatte also ihren Bruder auf Abstand gehalten, sowie er versucht hatte, ihr zu helfen.
»Warum glauben Sie, dass es Sara so wichtig war, wegen Mordes verurteilt zu werden?«, wollte ich wissen.
»Weil sie Frieden wollte«, erwiderte Eivor und bekam feuchte Augen.
Sie befingerte ihre Kaffeetasse.
»Das wollen wir doch alle«, fügte sie hinzu. »Frieden.«
Frieden. Das war wahrscheinlich das Lächerlichste, was ich je gehört hatte.
Mit einem Mal wirkte die Küche kalt und abweisend. Der Kaffee schmeckte nach Pferdepisse, und ich wollte in meine Kanzlei zurück. Vielleicht würde sich ja irgendwann noch mal ein Grund ergeben, Eivor erneut aufzusuchen, aber diesmal hatte mich der Besuch nicht wirklich weitergebracht.
»Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben«, sagte ich und stellte die Tasse in die winzig kleine Spüle.
»Ich habe zu danken«, erwiderte Eivor. »Wie nett, dass Sie vorbeigekommen sind.«
Als wär ich ihretwegen da gewesen.
Sie begleitete mich hinaus in die Diele und sah mir zu, wie ich in meine Schuhe schlüpfte. Wir sollten hierzulande endlich damit aufhören, unsere Mitmenschen zu nötigen, auf Strümpfen rumzulaufen. Das ist erniedrigend.
»Übrigens hätte ich noch ein paar Sachen auf dem Dachboden, die Sie sich vielleicht gerne ansehen möchten«, sagte sie.
Ich sah mit fragendem Blick auf.
»Also, Sachen aus dem Fall Sara Texas«, legte sie nach. »Nicht mehr als ein Karton. Wollen Sie es sich mal ansehen?«
Ich zögerte. Stand ich hier allen Ernstes da und zog in Erwägung, noch mehr Zeit auf diesen toten Fisch von einem Fall zu verschwenden?
Aber verdammt, wenn ich doch schon mal angefangen hatte, in diesem Elend rumzustochern, dann konnte ich es genauso gut zu Ende bringen.
»Ich schau gern mal rein«, sagte ich.
Wie zur Antwort darauf hörten wir im selben Moment ein Gewittergrollen über uns.
»Ich lauf nur schnell auf den Dachboden und hol die Sachen«, rief Eivor und warf sich eine Jacke über. »Sie können gern hier warten.«
Ich nutzte die Gelegenheit, während sie weg war, um ein paar E-Mails zu beantworten. Irgendwie fühlte es sich trist an, allein in ihrer Wohnung zu sein.