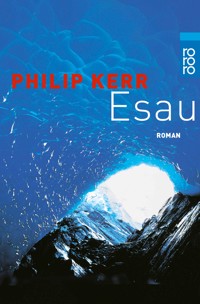9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bernie Gunther ermittelt
- Sprache: Deutsch
September 1941. Die Lebensmittelrationierung, die Angriffe der englischen Luftwaffe, die nächtliche Ausgangssperre – all das macht das tägliche Leben in der deutschen Reichshauptstadt Berlin alles andere als angenehm. In der vom Krieg geschüttelten Stadt treiben zudem Mörder und tschechische Terroristen ihr Unwesen. Aber für Bernie Gunther ist die Arbeit im Morddezernat der Kripo am Alexanderplatz nach den Schrecken der Ostfront beinahe Erholung. Leider muss er alles stehen- und liegenlassen – auch seine hübsche Kneipenbekanntschaft –, als sein alter Chef Reinhard Heydrich, inzwischen stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, ihn nach Prag beordert. Dort soll er ein Wochenende in dessen Landhaus verbringen. Neben Heydrich geben sich dort zahlreiche andere unangenehme Persönlichkeiten aus SA und SS ein Stelldichein. Doch dann wird eine Leiche in einem von innen abgeschlossenen Zimmer gefunden, und Bernie muss den Täter finden. Und er muss es schnell tun, denn Heydrich kann einen ungelösten Mordfall nicht auf sich sitzenlassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Philip Kerr
Böhmisches Blut
Roman
Aus dem Englischen von Juliane Pahnke
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
September 1941. Die Lebensmittelrationierung, die Angriffe der englischen Luftwaffe, die nächtliche Ausgangssperre – all das macht das tägliche Leben in der deutschen Reichshauptstadt Berlin alles andere als angenehm. In der vom Krieg geschüttelten Stadt treiben zudem Mörder und tschechische Terroristen ihr Unwesen. Aber für Bernie Gunther ist die Arbeit im Morddezernat der Kripo am Alexanderplatz nach den Schrecken der Ostfront beinahe Erholung.
Leider muss er alles stehen- und liegenlassen – auch seine hübsche Kneipenbekanntschaft –, als sein alter Chef Reinhard Heydrich, inzwischen stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, ihn nach Prag beordert. Dort soll er ein Wochenende in dessen Landhaus verbringen. Neben Heydrich geben sich dort zahlreiche andere unangenehme Persönlichkeiten aus SA und SS ein Stelldichein.
Doch dann wird eine Leiche in einem von innen abgeschlossenen Zimmer gefunden, und Bernie muss den Täter finden. Und er muss es schnell tun, denn Heydrich kann einen ungelösten Mordfall nicht auf sich sitzenlassen …
Über Philip Kerr
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Diese Reihe führte Kerr mit den 2007, 2008 und 2010 erschienenen Romanen «Das Janus-Projekt», «Das letzte Experiment», «Die Adlon-Verschwörung» und «Mission Walhalla» fort. Für «Die Adlon-Verschwörung» gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award.
Seit 2004 schreibt er als P.B. Kerr an der Fantasy-Kinderbuch-Serie «Die Kinder des Dschinn» und eroberte damit auch das jugendliche Publikum.
Kerr lebt mit seiner Frau, der Schriftstellerin Jane Thynne, und seinen drei Kindern in London.
Inhaltsübersicht
Einmal mehr für Jane
Prolog
Montag bis Dienstag, 8./9. Juni 1942
Es war ein angenehm warmer Tag, als ich zusammen mit SS-Obergruppenführer Reinhard Tristan Eugen Heydrich, dem Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, auf dem Rückweg von Prag im Anhalter Bahnhof von Berlin eintraf. Wir trugen beide unsere SD-Uniform, aber anders als der General war ich ein Mann voller Elan. Ich hatte eine Melodie in meinem Kopf und ein Lächeln im Herzen. Ich freute mich, wieder in meiner Geburtsstadt zu sein. Ich freute mich auf einen ruhigen Abend mit einer guten Flasche Mackenstedter und ein paar Zigaretten, die ich aus Heydrichs persönlichem Vorrat in seinem Büro in der Prager Burg entwendet hatte. Doch ich machte mir keine Sorgen, dass er diesen dreisten Raub bemerkte. Ich machte mir eigentlich überhaupt keine Sorgen mehr. Ich war mehr, als Heydrich von sich behaupten konnte. Ich war am Leben.
Die Berliner Zeitungen berichteten, der arme Reichsprotektor sei von einer Gruppe Terroristen ermordet worden, die aus England kommend über Böhmen mit dem Fallschirm abgesprungen waren. Es war ein bisschen komplizierter gewesen, aber es stand mir nicht frei, das laut auszusprechen. Noch nicht. Noch lange nicht. Vielleicht auch nie.
Es ist schwierig zu sagen, was mit Heydrichs Seele passiert ist, wenn er überhaupt eine besessen hatte. Ich vermute, Dante Alighieri könnte mir die ungefähre Richtung zeigen, wenn ich mich irgendwann bemüßigt fühlen sollte, mich auf die Suche nach Heydrichs Seele in der Unterwelt zu begeben. Andererseits habe ich eine ziemlich genaue Ahnung davon, was mit seinem Leichnam passierte.
Jeder erfreut sich an einer schönen Beerdigung, und die Nazis waren da bestimmt keine Ausnahme. Sie schenkten Heydrich die beste Abschiedsfeier, auf die ein psychopathischer, mörderischer Krimineller hoffen durfte. Die ganze Veranstaltung nahm so gewaltige Ausmaße an, dass man hätte glauben können, hier werde ein Satrap des Persischen Reichs zu Grabe getragen, nachdem er in einer großen Schlacht gesiegt hatte. Und es sah so aus, als beruhte das Ritual tatsächlich auf einer so alten, martialischen Tradition. Es fehlten nur ein paar hundert Sklaven, die ihm zu Ehren geopfert wurden. Allerdings stellte sich später heraus, dass man auch daran gedacht hatte – ich erfuhr, dass das kleine, tschechische Dorf Lidice vollständig ausgerottet worden war.
Vom Anhalter Bahnhof wurde Heydrich in den Konferenzsaal im Hauptquartier der Gestapo gebracht, wo sechs Ehrengarden in ihren schwarzen Uniformen seine Aufbahrung überwachten. Für viele Berliner war dies die Gelegenheit, auf Zehenspitzen am Prinz-Albrecht-Palais vorbeizuschleichen und leise «Dingdong, die Hex ist tot!» zu singen. Das stand auf einer Stufe mit ähnlich waghalsigen Manövern, wie etwa einer Kletterpartie auf die Spitze des alten Radioturms in Charlottenburg oder einer Fahrt über die steile Kurve auf der Avus. Schön, wenn man sagen kann, dass man es mal gemacht hat.
Im Radio pries der Führer an diesem Abend den toten Heydrich. Er beschrieb ihn als «den Mann mit dem eisernen Herzen», was wohl als Kompliment gemeint war. Andererseits war es auch gut möglich, dass unser böser Zauberer von Oz hier nur den Blechmann mit dem Feigen Löwen verwechselt hat.
Am nächsten Tag trug ich wieder Zivil und fühlte mich völlig menschlich, als ich mich zu den Tausenden anderen Berlinern gesellte, die sich vor der Neuen Reichskanzlei versammelten. Ich versuchte, angemessen finster zu wirken, als das ganze Ameisenvolk aus Hitlers Schergen aus der Mosaikhalle strömte und der glänzenden Lafette folgten, die Heydrichs von einer Fahne verhüllten Sarg erst in östlicher Richtung auf der Vossstraße und dann auf der Wilhelmstraße Richtung Norden brachte. Dort fand der General seine letzte Ruhestätte auf dem Invalidenfriedhof und wurde neben einigen echten, deutschen Helden wie von Scharnhorst, Ernst Udet und Manfred von Richthofen bestattet.
An Heydrichs Tapferkeit durfte kein Zweifel bestehen. Immerhin war er voller Ungestüm in der Luftwaffe aktiv gewesen, als die meisten hohen Tiere lieber in der Wolfsschanze und ihren mit Pelz verbrämten Bunkern blieben. Das war schon Beweis genug für seine Tapferkeit. Ich vermute, Hegel hätte Heydrichs Heldentum als den Inbegriff von Mut in diesen despotischen Zeiten beschrieben. Aber meiner Ansicht nach mussten Helden mit den Göttern zusammenarbeiten und nicht mit den dunklen und chaotischen Mächten der Titanen. Besonders in Deutschland. Deshalb tat es mir nicht im Geringsten leid, ihn tot zu sehen. Wegen Heydrich war ich Offizier des Sicherheitsdienstes geworden. Und in das angelaufene Silber meines Abzeichens an der Mütze, das ein verabscheuungswürdiges Zeichen für meine lange Bekanntschaft mit Heydrich war, hatten sich Hass, Angst und, nach meiner Rückkehr aus Minsk, auch Schuld eingebrannt.
Das lag nun neun Monate zurück. Meist versuchte ich, nicht daran zu denken. Doch wie ein anderer deutscher Verrückter einst bemerkt hatte, ist es schwer, in den Abgrund zu blicken, ohne dass der Abgrund zurückblickt.
Kapitel 1
September 1941
Der Gedanke an Selbstmord ist für mich sehr beruhigend. Manchmal ist er das Einzige, was mir durch eine schlaflose Nacht hilft.
In solch einer Nacht – und davon gab es viele – zerlegte ich meist meine Baby Browning und fettete sorgfältig die metallenen Teile der Pistole. Ich hatte zu oft erlebt, was Fehlschläge anrichten konnten, und wusste, wie wichtig eine gut gepflegte Waffe war. Zu viele Selbstmorde gingen daneben, weil eine Kugel in einem zu spitzen Winkel in den Schädel eines Mannes eindrang. Ich entlud sogar die kleine Stiege des Magazins, in der die Kugeln ruhten, und polierte jede einzelne. Dann reihte ich sie wie kleine, tapfere Messingsoldaten vor mir auf und suchte die sauberste und strahlendste aus, die über allen anderen thronen durfte. Ich wollte mir nur mit der besten ein Loch in die Wand meiner Gefängniszelle sprengen, zu der mein Schädel geworden war. Nur sie durfte einen Tunnel in die grauen Windungen aus Verzweiflung graben, zu denen mein Verstand geworden war.
Das alles erklärte vielleicht, warum so viele Selbstmorde bei der Polizei fälschlicherweise als Unfall registriert werden. «Er hat doch nur seine Waffe gereinigt, und dann ging ein Schuss los», sagte die trauernde Witwe.
Natürlich löst sich gern mal ein Schuss, und manchmal tötet die Waffe auch denjenigen, der sie in der Hand hält. Aber zuerst muss man den kalten Lauf gegen seinen Kopf drücken – am besten gegen den Hinterkopf – und den verfluchten Abzug drücken.
Ein paarmal habe ich sogar einige gefaltete Handtücher unter das Kopfkissen auf meinem Bett gelegt und mich mit dem festen Entschluss hingelegt, es jetzt endlich hinter mich zu bringen. Es fließt ziemlich viel Blut aus einem Kopf, selbst wenn das Loch nur ganz klein ist. Ich lag dann da und starrte auf den Abschiedsbrief, den ich auf meinem besten Papier verfasst hatte. Das Papier hatte ich in Paris gekauft. Der Brief lehnte auf dem Kaminsims und war an niemand Bestimmtes adressiert.
Niemand Bestimmtes und ich hatten im Spätsommer 1941 eine ziemlich enge Beziehung.
Nach einer Weile schlief ich dann manchmal ein. Aber die Träume, die ich dann hatte, waren allesamt nicht jugendfrei. Vermutlich waren sie sogar für Conrad Veidt oder Max Schreck unpassend. Einmal wachte ich aus einem so schrecklichen, lebhaften und packenden Traum auf, dass ich tatsächlich meine Pistole abfeuerte. Ich saß kerzengerade im Bett und schoss. Die Uhr in meinem Schlafzimmer – die Wiener Wanduhr aus Walnussholz, die meiner Mutter gehört hatte – war danach nie mehr dieselbe.
In anderen Nächten lag ich da und wartete, bis das graue Licht unter den Kanten der staubigen Vorhänge an Kraft gewann und mich die absolute Leere des neuen Tages begrüßte.
Tapferkeit zählte nichts mehr. Aber ich war auch gar nicht tapfer. Die ständige Befragung meines zerrissenen Ichs schuf kein Bedauern, sondern nur noch mehr Selbsthass. Für alle Außenstehenden war ich immer noch derselbe Mann, der ich schon immer gewesen war: Bernie Gunther, Kriminalkommissar vom Alex. Und doch war ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Ein Blender. Ein Knäuel aus Gefühlen mit gefletschten Zähnen und einem Kloß im Hals und einer schrecklich leeren Höhle tief in meinem Bauch.
Aber nach meiner Rückkehr aus der Ukraine war ich nicht der Einzige, der sich anders fühlte. Auch Berlin war anders. Wir befanden uns fast zweitausend Kilometer von der Front entfernt, doch der Krieg lag trotzdem in der Luft. Das hatte nichts mit der britischen Luftwaffe zu tun, die trotz Hermann Görings leeren Versprechungen, dass niemals eine englische Bombe auf die deutsche Hauptstadt fallen werde, es irgendwie schaffte, unregelmäßig, aber dennoch zerstörerisch am nächtlichen Himmel aufzutauchen. Im Sommer 1941 suchten die Briten uns allerdings noch selten auf. Nein, es war Russland, das jetzt jeden Aspekt unseres Lebens beeinflusste. Nicht nur, was in die Läden kam, sondern auch die Aktivitäten in der spärlich bemessenen Freizeit – eine Zeitlang war es sogar verboten, zu tanzen – wurden vom Russen bestimmt. Selbst, wie man in der Stadt von einem Ort zum anderen kam.
«Die Juden sind unser Unglück», verkündeten die Zeitungen der Nazis. Aber niemand glaubte wirklich an das, was Curt Treitschke im Herbst 1941 verkündete. Und schon gar nicht, da die selbstverursachte Katastrophe in Russland ihren Lauf nahm, die um einiges verheerender war. Die Kampagne im Osten lief schon jetzt völlig aus dem Ruder. Und wegen Russland und der überhandnehmenden Bedürfnisse unserer Armee fühlte sich Berlin zunehmend wie die Hauptstadt einer Bananenrepublik an, der die Bananen ausgegangen waren. Wie auch so ziemlich alles andere, was man sich vorstellen konnte.
Es gab nur noch wenig Bier, und manchmal gar keins mehr. Gaststätten und Bars blieben zuerst einen Tag die Woche geschlossen, dann zwei. Manchmal machten sie gleich ganz zu, und nach einiger Zeit gab es nur noch vier Bars in der Stadt, in denen man überhaupt noch ein Glas Bier bekam. Nicht, dass es nach Bier schmeckte, wenn man es schaffte, welches zu bekommen. Die saure, braune und brackige Flüssigkeit, die wir verbittert in den Gläsern vor uns hüteten, erinnerte mich eher an die mit Wasser gefüllten Granattrichter und die ruhigen Tümpel im Niemandsland, in denen wir uns manchmal dankenswerterweise verstecken durften. Für einen Berliner war dieses «Bier» ein echtes Unglück. An härtere Sachen kam man erst recht nicht, und das bedeutete, dass es schlicht unmöglich war, sich zu betrinken und seinem eigenen Ich zu entkommen. Und deshalb blieb mir spät in der Nacht nichts anderes übrig, als meine Pistole zu reinigen.
Die Fleischration war ebenso enttäuschend für eine Bevölkerung, für die Wurst in allen Darreichungsformen ein Ausdruck ihrer Lebensart war. Angeblich standen jedem 500 Gramm Fleisch pro Woche zu. Aber selbst wenn Fleisch zu bekommen war, erhielt man für einen 100-Gramm-Coupon höchstens 50 Gramm.
Nach einer schlechten Ernte gab es bald keine Kartoffeln mehr. Auch die Pferde, die die Milchwagen zogen, verschwanden von der Straße. Nicht, dass man sie noch brauchte, denn in den großen Milchkannen war keine Milch mehr. Es gab nur noch Milchpulver und Eipulver. Beides schmeckte wie der Mörtelstaub, der durch das Bombardement der britischen Luftwaffe von unseren Zimmerdecken rieselte. Brot schmeckte nach Sägemehl, und viele schworen, es sei auch daraus gebacken. Mit einer Kleiderkarte bekam man gerade einmal des Kaisers neue Kleider und mehr nicht. Man konnte sich kein neues Paar Schuhe kaufen, und es war fast unmöglich, einen Schuster zu finden, der einem die alten reparierte. Wie alle anderen Handwerker waren auch Berlins Schuster in der Armee.
Ersatz oder Waren zweiter Wahl gab’s überall. Bindfaden riss, wenn man versuchte, ihn festzuziehen. Neue Knöpfe zerbröselten unter den Fingern, wenn man versuchte, sie anzunähen. Zahnpasta bestand aus Kalk und Wasser mit Pfefferminzgeschmack, und in den langen Schlangen, in denen man für Seife anstand, schäumten die Leute selbst mehr als dieses krümelige, keksgroße Stück, mit dem sie sich angeblich sauber halten konnten – und das für einen ganzen Monat reichen sollte. Selbst diejenigen unter uns, die nicht in der Partei waren, fingen allmählich an, unangenehm zu riechen.
Weil alle Handwerker in der Armee waren, gab es auch niemanden, der die Tram oder die Busse instand hielt, und deshalb wurden ganze Strecken – wie die Linie 1, die Unter den Linden entlangführte – einfach eingestellt. Die Hälfte von Berlins Zügen wurden in den Osten geschickt, wo sie die russische Kampagne mit dem Fleisch, den Kartoffeln, dem Bier, der Seife und der Zahnpasta, die man daheim nicht bekam, unterstützten.
Und es waren nicht nur die Maschinen, die vernachlässigt wurden. Wohin man auch schaute, blätterte die Farbe von den Wänden und dem Gebälk. Türklinken hielt man unvermutet in der Hand. Die Rohrleitungen und das Heizungssystem brachen zusammen. Die Baugerüste an den von Bomben zerstörten Häusern blieben lange stehen, weil es keine Dachdecker mehr gab, die wenigstens notdürftige Reparaturen ausführten. Kugeln hingegen arbeiteten weiterhin perfekt, wie sie es stets getan hatten. Die deutsche Munition war schon immer gut gewesen. Ich hatte mich selbst davon überzeugt, dass Munition und die Waffen, mit denen sie abgefeuert wurde, weiterhin in einwandfreiem Zustand waren. Aber alles andere ging kaputt oder war zweite Wahl, wurde ersetzt oder geschlossen, war nicht verfügbar oder knapp. Die Laune war – wie die Rationen – alles andere als gut. Der böse dreinblickende, schwarze Bär auf dem Wappen unserer stolzen Stadt sah langsam eher wie der typische Berliner aus, der andere Passagiere in der S-Bahn finster anstarrte, einen gleichgültigen Fleischer anfauchte, weil er ihm nur die Hälfte der Ration Speck gab, die ihm laut Lebensmittelkarte zustand, oder der einem Nachbarn im Wohnhaus mit einem Parteibonzen drohte, der ihm schon sagen würde, wo es langging.
Die ungeduldigsten Zeitgenossen fand man wohl in der immer längeren Schlange, in der die Leute für Tabak anstanden. Die Ration war auf vierzig Zigaretten im Monat begrenzt, aber wenn man wirklich so verstiegen war, eine der Zigaretten zu rauchen, war es nicht schwer, zu verstehen, warum Hitler nicht rauchte. Sie schmeckten nach verbranntem Toast. Manchmal rauchten die Leute Tee, wenn sie welchen bekommen konnten, aber sie hätten das Zeug lieber mit kochendem Wasser übergossen und getrunken.
Rings um das Polizeihauptquartier am Alexanderplatz traf uns der Benzinmangel fast genauso sehr wie die fehlenden Zigaretten und der knappe Alkohol. Ausgerechnet dort befand sich zufällig auch das Zentrum des Berliner Schwarzmarkts, den man als einzigen Ort in der ganzen Stadt als blühend bezeichnen konnte, obwohl sehr strenge Strafen drohten, wenn man erwischt wurde.
Wir nahmen derweil Busse und Züge zu den Tatorten, und wenn die nicht fuhren, gingen wir eben zu Fuß. Oft waren wir deshalb während der Verdunklung unterwegs, was nicht ungefährlich war. Beinahe ein Drittel aller Unfalltoten starben in jener Zeit in Berlin wegen der Verdunklung. Nicht, dass einer meiner Kollegen daran interessiert war, einen Tatort in Augenschein zu nehmen. Sie interessierten sich nur dafür, wo es Wurst, Bier und Zigaretten für sie gab. Manchmal witzelten wir, dass es immer weniger Verbrechen gab: Keiner klaute Geld, und das aus dem einfachen Grund, weil es in den Läden nichts für Geld zu kaufen gab. Wie die meisten Witze in Berlin im Herbst 1941 war dieser vor allem lustig, da er so sehr der Wahrheit entsprach.
Natürlich gab es trotzdem noch ziemlich viele Diebstähle: Lebensmittelkarten, Wäsche, Sprit, Möbel – die Menschen benutzten sie als Feuerholz –, Vorhänge (um daraus Kleidung zu nähen), Kaninchen und Meerschweinchen, die die Leute auf ihren Balkonen hielten, damit sie wenigstens etwas frisches Fleisch bekamen. Die Berliner stahlen einfach alles. Und während der Verdunklung gab es auch Verbrechen voller Gewalt. Die Verdunklung war bestens geeignet, wenn man als Vergewaltiger nach Opfern suchte.
Eine Zeitlang arbeitete ich wieder im Morddezernat. Die Berliner brachten einander weiterhin um. Es gab allerdings mehr als einmal den Moment, dass ich es ziemlich lächerlich fand, meine Arbeit wichtig zu nehmen, wenn ich bedachte, was zur selben Zeit im Osten passierte. Es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht an den Anblick der alten jüdischen Männer und Frauen erinnerte, die zu den Hinrichtungsgruben getrieben wurden, wo betrunkene, lachende SS-Erschießungskommandos sie ins Jenseits beförderten. Trotzdem versuchte ich weiterhin, mich wie ein anständiger Ermittler zu benehmen, obwohl es sich oft so anfühlte, als versuche ich, das Feuer in einem Aschenbecher zu löschen, während am anderen Ende der Straße ganze Häuser in Flammen standen.
Bei meiner Arbeit im Morddezernat erkannte ich im September 1941, dass es nun wohl neue Motive gab, jemanden zu ermorden. Diese waren in den Strafgesetzbüchern noch nicht erfasst und angemessen dokumentiert. Es handelte sich um Motive, die in der bizarren, neuen Wirklichkeit des Berliner Lebens begründet lagen. Der Kleinbauer in Weißensee zum Beispiel, der von dem scharfen, selbstgebrannten Wodka verrückt wurde und die Postbotin mit einer Axt erschlug. Ein Metzger in Wilmersdorf, der mit seinem eigenen Messer vom örtlichen Luftschutzhelfer erstochen wurde, weil sie um eine gekürzte Speckration stritten. Die junge Krankenschwester aus dem Rudolf-Virchow-Krankenhaus, die wegen der akuten Wohnraumnot in der Stadt eine 65-jährige alte Jungfer in Plötzensee vergiftete, damit sie das Zimmer ihres Opfers bekam. Ein SS-Unterfeldwebel, der auf Heimaturlaub aus Riga gekommen und so sehr an die Massenmorde in Lettland gewohnt war, dass er kurzerhand seine Eltern erschoss, weil ihm kein Grund einfiel, warum er sie nicht erschießen sollte. Aber die meisten Soldaten, die von der Ostfront nach Hause kamen und Lust hatten, jemanden umzubringen, brachten sich selbst um.
Ich hätte das vermutlich auch getan, wenn ich mir nicht absolut sicher gewesen wäre, dass mich sowieso niemand vermissen würde. Außerdem hinderte mich das Bewusstsein, dass viele andere – vor allem Juden – immer und immer weitermachten, obwohl ihre Lage noch viel schlechter war. Ja. Im Spätsommer 1941 waren es die Juden und das, was mit ihnen passierte, was mich letztlich davon überzeugte, mich nicht umzubringen.
Natürlich wurden auch noch die altmodischen Berliner Morde begangen – jene also, die den Zeitungen Auflage bescherten. Ehemänner brachten weiterhin ihre Ehefrauen um. Und gelegentlich brachten Ehefrauen ihre Ehemänner um. Aus meiner Sicht hatten diese Ehemänner – zumeist brutale Kerle, die mit ihren Fäusten und ihrer Kritik nicht hinterm Berg hielten – es meist auch verdient. Ich habe nie eine Frau geschlagen, es sei denn, wir hatten vorher darüber gesprochen. Prostituierte bekamen weiterhin die Kehle aufgeschlitzt oder wurden zu Tode geprügelt wie früher. Und nicht nur Prostituierte. In dem Sommer, der auf meine Rückkehr aus der Ukraine folgte, bekannte sich ein Serienmörder namens Paul Ogorzow schuldig, acht Frauen vergewaltigt und ermordet zu haben. Außerdem gab er bei mindestens acht weiteren Frauen versuchten Mord zu. Die Boulevardpresse taufte ihn den S-Bahn-Mörder, weil die meisten seiner Angriffe in den Zügen oder nahe den Haltestellen der S-Bahn verübt wurden.
Darum musste ich auch wieder an Paul Ogorzow denken, als ich in der zweiten Septemberwoche 1941 spätabends hinzugerufen wurde, um einen Leichnam in Augenschein zu nehmen, den man nahe der S-Bahn-Linie zwischen Jannowitzbrücke und Schlesischer gefunden hatte. Wegen der Verdunkelung wusste man noch nicht, ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelte. Das war durchaus verständlich, schließlich war der Körper von einem Zug erfasst worden, wobei der Kopf vom Rumpf getrennt wurde. Ein plötzlicher Tod ist selten eine saubere Sache. Wenn das so wäre, bräuchte man ja keine Ermittler. Aber dieser Tod war so ziemlich das Unsauberste, was ich seit dem Großen Krieg erlebt hatte. Damals hatte eine Mine oder eine Haubitze einen Mann innerhalb eines Augenblicks zu einem fleischigen Haufen aus Kleidung und Knochen verwandelt. Vielleicht konnte ich deshalb diesen Leichnam so unbeteiligt betrachten. Ich hoffte es jedenfalls. Die Alternative – dass nämlich meine jüngste Erfahrung im tödlichen Ghetto von Minsk mich für jedes menschliche Leiden unempfindlich gemacht hatte – war zu schrecklich, um sie nur zu denken.
Die anderen beiden Ermittler hießen Wilhelm Wurth und Gottfried Lehnhoff. Wurth war ein Wachtmeister und ein hohes Tier bei der Polizeisportbewegung. Lehnhoff war ein Kommissar, der nach seiner Pensionierung wieder zum Alex zurückgekehrt war.
Wurth war in der Fechtmannschaft, und letzten Winter hatte er an Heydrichs Skiwettbewerb für die deutsche Polizei teilgenommen und eine Medaille gewonnen. Wurth wäre auch in der Wehrmacht, wenn er nicht ein, zwei Jahre zu alt dafür gewesen wäre. Aber er war nützlich bei einer Mordermittlung, bei der das Opfer so offensichtlich den Tanz auf einer Klinge verloren hatte. Er war ein dünner, ruhiger Mann mit Ohren wie Klingelzüge und einer Oberlippe, die so voll wie sein Walrossschnurrbart war. Er hatte das geeignete Gesicht, um bei der modernen Berliner Polizei zu arbeiten, denn er war nicht annähernd so dumm, wie er aussah. Er trug einen schlichten, grauen Doppelreiher und hatte einen dicken Spazierstock dabei. Dabei kaute er ständig auf dem Mundstück seiner Kirschholzpfeife herum, die zwar leer war, aber trotzdem nach Tabak roch.
Lehnhoff hatte einen Hals und einen Kopf wie eine Birne, aber er war nicht mehr grün hinter den Ohren. Wie viele andere Bullen bezog er bereits Pension, aber da die meisten jungen Kollegen nun in den Polizeieinheiten an der Ostfront dienten, war er wieder zu uns gekommen, um es sich in einer Ecke vom Alex gemütlich einzurichten. Das kleine Parteiabzeichen, das er am Revers seines billigen Anzugs trug, hatte es ihm erleichtert, so wenig richtige Polizeiarbeit wie möglich zu erledigen.
Wir marschierten also südlich die Dircksenstraße entlang zur Jannowitzbrücke und dann an der S-Bahn-Linie entlang, mit dem Fluss zur Rechten. Der Mond schien, und die meiste Zeit brauchten wir unsere Taschenlampen nicht, aber wir fühlten uns sicherer damit. Die Schienen machten am Gaswerk und der alten Fabrik der Julius-Pintsch-AG vorbei einen Schwenk. Es gab keinen Zaun, und es hätte leicht passieren können, dass man einen falschen Schritt machte und stürzte.
Jenseits des Gaswerks kamen wir an einer Gruppe uniformierter Polizisten und Bahnarbeiter vorbei. Weiter hinten konnte ich gerade noch die Umrisse eines Zugs im Schlesischen Bahnhof ausmachen.
«Ich bin Kommissar Gunther vom Alex», sagte ich. Es schien sinnlos, ihnen bei der Dunkelheit meine Marke zu zeigen. «Das sind Kommissar Lehnhoff und Wachtmeister Wurth. Wer hat uns gerufen?»
«Das war ich.» Einer der Polizisten trat mir entgegen und salutierte. «Wachtmeister Stumm.»
«Nicht verwandt, will ich hoffen», sagte Lehnhoff.
Es hatte einen Johannes Stumm gegeben, der vom dicken Hermann gezwungen wurde, die politische Polizei zu verlassen, weil er kein Nazi war.
«Nein.» Wachtmeister Stumm lächelte geduldig.
«Sagen Sie mir eins, Wachtmeister», bat ich. «Warum denken Sie, es könne sich hier um einen Mord handeln und nicht um einen Selbstmord oder einen Unfall?»
«Na ja, es ist heutzutage bestimmt sehr beliebt, einfach vor den Zug zu springen, um sich umzubringen», sagte Wachtmeister Stumm. «Besonders bei Frauen. Ich würde eher eine Waffe benutzen, wenn ich mich umbringen wollte. Frauen sind allerdings mit Waffen nicht so vertraut wie Männer. Bei diesem Opfer jedoch sind alle Taschen nach außen gedreht. Das ist nicht unbedingt das Letzte, was man so macht, ehe man sich umbringt. Und ein Zug macht so etwas gewöhnlich auch nicht, ehe er einen überrollt. Das lässt es nicht unbedingt wie einen Unfall aussehen, oder?»
«Vielleicht hat ihn jemand vor Ihnen gefunden», wandte ich ein. «Und hat ihn einfach ausgeraubt.»
«Ein Polizist zum Beispiel», bot Wurth an.
Wachtmeister Stumm ignorierte diese Bemerkung.
«Unwahrscheinlich. Ich bin ziemlich sicher, dass ich der Erste am Tatort war. Der Zugführer sah jemanden auf den Gleisen, als er nach dem S-Bahnhof Jannowitz beschleunigte. Er trat auf die Bremse, doch als der Zug zum Stehen kam, war es schon zu spät.»
«Also gut. Werfen wir doch mal einen Blick auf ihn.»
«Kein schöner Anblick, Herr Kommissar. Nicht mal im Dunkeln.»
«Glauben Sie mir, ich hab schon Schlimmeres gesehen.»
«Ich nehme Sie beim Wort.»
Der uniformierte Wachtmeister führte uns an den Gleisen entlang und blieb kurz stehen, um seine Taschenlampe einzuschalten und eine abgetrennte Hand anzuleuchten, die auf dem Boden lag. Ich schaute sie mir ungefähr eine Minute lang an, ehe wir weitergingen. In einiger Entfernung wartete ein weiterer Polizeibeamter neben einem Haufen zerrissener Kleidungsstücke und zerfetzter Überreste, die irgendwann einmal ein Mensch gewesen waren. Für einen Moment glaubte ich, mich selbst dort liegen zu sehen.
«Richten Sie das Licht auf ihn, während wir ihn uns ansehen.»
Der Leichnam sah aus, als sei er von einem prähistorischen Monster zerkaut und wieder ausgespuckt worden. Die gewellten Beine waren kaum mehr mit dem plattgedrückten Rumpf verbunden. Der Mann trug den blauen Overall eines Arbeiters mit fäustlingsgroßen Taschen, die tatsächlich nach außen gedreht waren, wie der Wachtmeister es beschrieben hatte. Ebenso die Taschen von dem öligen Fetzen, der von seiner Flanelljacke übriggeblieben war. Wo sich früher der Kopf befand, gab es jetzt nur eine zerfetzte, glänzende Harpunenspitze aus Knochen und Sehnen. In der Luft hing der intensive Gestank nach Scheiße und Eingeweiden, die unter dem enormen Druck der Lokomotivräder ausgequetscht worden waren.
«Ich kann mir nichts vorstellen, das Sie schon mal gesehen haben und das schlimmer aussah als dieser arme Kerl», sagte Wachtmeister Stumm.
«Ich auch nicht», bemerkte Wurth und wandte sich angeekelt ab.
«Ich wage mal die Prognose, dass wir alle noch manch Interessantes sehen werden, ehe dieser Krieg vorbei ist», sagte ich. «Hat schon jemand nach dem Kopf gesucht?»
«Ich hab ein paar Jungs ausgeschickt, die das Gelände danach absuchen», sagte der Wachtmeister. «Einer auf den Gleisen und der andere weiter unten, nur für den Fall, dass er aufs Gelände des Gaswerks oder der Fabrik gefallen ist.»
«Ich denke, Sie haben vermutlich recht», sagte ich. «Es sieht tatsächlich wie ein Mord aus. Abgesehen von den umgedrehten Taschen ist da noch die Hand.»
«Die Hand?» Das kam von Lehnhoff. «Was soll damit sein?»
Ich führte die Männer an den Gleisen zurück zu der Stelle, damit sie noch einmal einen Blick darauf werfen konnten. Ich hob sie auf und drehte sie wie ein historisches Artefakt in den Händen. Oder wie ein Andenken an den Propheten Daniel.
«Diese Schnitte an den Fingern sehen so aus, als habe er sich verteidigt», sagte ich. «Als ob er in das Messer desjenigen gegriffen hat, der auf ihn einstechen wollte.»
«Ich weiß nicht, wie Sie das behaupten können, nachdem er von einem Zug überrollt wurde», sagte Lehnhoff.
«Weil diese Schnitte viel zu dünn sind, um von dem Zug zu stammen. Und sehen Sie nur, wo sie sind. Sie führen über die Innenseite der Finger und die Handfläche zwischen Daumen und Zeigefinger. Das ist eine Verteidigungsverletzung, wie sie im Buche steht, Gottfried.»
«Also gut», erwiderte Lehnhoff fast grimmig. «Ich vermute, Sie sind der Experte. Für Mord.»
«Vielleicht. In letzter Zeit hatte ich aber einige Konkurrenz. Drüben im Osten sind ziemlich viele Polizisten, vor allem junge, die sehr viel mehr über Mord wissen als ich.»
«Das wage ich zu bezweifeln», sagte Lehnhoff.
«Glauben Sie’s mir einfach. Es gibt eine ganz neue Generation Polizeiexperten.» Ich schwieg, damit sich meine Bemerkung in ihren Köpfen setzen konnte, ehe ich sehr vorsichtig hinzufügte: «Ich finde das manchmal sehr beruhigend. Dass es so viele gute Männer gibt, die meinen Platz einnehmen. Ähm, Wachtmeister Stumm?»
«Ja.» Aber ich vermochte die Zweifel in der Stimme des Wachtmeisters deutlich zu hören.
«Begleiten Sie uns ein Stück», sagte ich warm zu ihm. In einem Land, in dem Gereiztheit und Übellaunigkeit an der Tagesordnung waren – Hitler und Goebbels waren schließlich ständig wegen irgendetwas schlechter Laune –, wirkte die Gelassenheit des Wachtmeisters herzerfrischend. «Wir gehen zurück zur Brücke. Ein weiteres Augenpaar könnte nützlich sein.»
«Ja, Herr Kommissar.»
«Wonach suchen wir denn?» In Lehnhoffs Stimme schwang ein erschöpftes Seufzen mit, als könne er keinen Grund dafür erkennen, diesen Fall noch weiter zu untersuchen.
«Nach einem Elefanten.»
«Was?»
«Irgendetwas. Einen Beweis. Sie werden es schon wissen, wenn Sie es sehen», sagte ich.
Zurück auf den Schienen, fanden wir einige Blutspuren auf einer Eisenbahnschwelle und dann noch ein paar weitere auf der Kante der Plattform vor der widerhallenden Glaskuppe der Station Jannowitzbrücke.
Unterhalb unseres Wegs schrie jemand, der sein Boot leise unter einem der vielen roten Ziegelbögen der Brücke herlenkte, uns zu, wir sollten gefälligst unsere Taschenlampen ausmachen. Das war für Lehnhoff das Stichwort, sich wichtig zu machen. Fast konnte man meinen, er habe darauf gewartet, zu irgendwem grob werden zu können. Egal, zu wem.
«Hier ist die Polizei!», rief er zu dem Boot hinab. Lehnhoff war halt auch ein wütender Deutscher. «Und wir untersuchen hier unten einen Mord. Also kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, oder ich komme runter und durchsuche Ihr Boot, einfach so!»
«Es geht jeden von uns was an, wenn die Bomber der Tommys Ihre Lichter sehen!», rief die Stimme zurück. Nicht unvernünftig.
Wurth zog zweifelnd die Nase kraus. «Ich glaube, das ist nicht allzu wahrscheinlich. Denken Sie nicht auch, Herr Kommissar? Es ist eine Weile her, seit die britische Luftwaffe so weit nach Osten gekommen ist.»
«Vermutlich kriegen sie auch nicht genug Treibstoff», sagte ich.
Mit meiner Taschenlampe beleuchtete ich den Grund vor uns und folgte einer Blutspur am Bahnsteig entlang zu ihrem Ursprung.
«Wenn man bedenkt, wie viel Blut hier überall ist, wurde er vermutlich dort erstochen. Dann stolperte er ein Stück über den Bahnsteig, ehe er auf die Gleise fiel. Da rappelte er sich wieder hoch. Ging noch etwas weiter und wurde dann von dem Zug Richtung Friedrichshagen erfasst.»
«Es war der Spätzug», sagte Wachtmeister Stumm. «Der Ein-Uhr-Zug.»
«So ein Glück, dass er den nicht verpasst hat», bemerkte Lehnhoff.
Ich ignorierte ihn und schaute auf die Uhr. Es war drei. «Nun, damit wissen wir also den ungefähren Todeszeitpunkt.»
Ich lief über die Gleise vor dem Bahnsteig und fand nach einiger Zeit auf dem Boden ein gräulich grünes, etwa reisepassgroßes Büchlein. Es war ein Arbeitsbuch für Ausländer und ähnelte meinem eigenen, nur mit dem Unterschied, dass es speziell für Ausländer war. Innen fand ich alle Informationen über den Toten, die ich brauchte: seinen Namen, seine Herkunft, die Adresse, ein Foto und den Arbeitgeber.
«Ist das ein Arbeitsbuch für Ausländer?», fragte Lehnhoff und schaute mir über die Schulter, während ich die Daten des Opfers im Licht meiner Taschenlampe studierte.
Ich nickte. Der tote Mann hieß Geert Vranken. Er war 39, geboren in Dordrecht in den Niederlanden. Ein freiwilliger Bahnarbeiter, der in einem Wohnheim in Wuhlheide untergebracht war. Das Gesicht auf dem Foto wirkte erschöpft. Er hatte ein zerklüftetes Kinn, das unrasiert wirkte. Die Augenbrauen waren kurz und die Haare an einer Seite ausgedünnt. Er schien dieselbe dicke Flanelljacke zu tragen, die wir an dem Leichnam gefunden hatten, und darunter ein Hemd ohne Kragen. Während wir die nackten Daten von Geert Vrankens kurzem Leben studierten, kam ein anderer Polizist die Stufen zur S-Bahn-Station hoch. Er hielt etwas in der Hand, das in der Dunkelheit wie eine kleine, runde Tasche aussah.
«Ich habe den Kopf gefunden», berichtete der Polizist. «Er lag auf dem Dach der Pintsch-Fabrik.» Er hielt den Kopf am Ohr fest, was angesichts der fehlenden Haare die beste Methode war, ihn zu tragen. «Ich habe ihn lieber nicht da unten liegen gelassen.»
«Nein, es war richtig, ihn mitzubringen, Junge», sagte Wachtmeister Stumm. Er ergriff den Kopf am anderen Ohr und legte ihn behutsam auf den Bahnsteig, sodass er zu uns aufblickte.
«Kein Anblick, den man jeden Tag sieht», sagte Wurth und schaute fort.
«Da müssen Sie nur mal nach Plötzensee gehen», bemerkte ich. «Habe gehört, im Moment ist das Fallbeil dort sehr beschäftigt.»
«Das ist er, eindeutig», stellte Lehnhoff fest. «Der Mann aus dem Arbeitsbuch. Denken Sie nicht auch?»
«Ich stimme Ihnen zu», sagte ich. «Und ich vermute, jemand hat versucht, ihn auszurauben. Oder welchen Grund hatte er sonst, seine Taschen zu durchsuchen?»
«Sie halten also weiter an der Theorie fest, dass es sich um einen Mord handelt und nicht um einen Unfall?», fragte Lehnhoff.
«Ja, das tue ich. Aus genau diesem Grund.»
Wachtmeister Stumm machte seinem Unmut Luft und rieb sich das stoppelige Kinn, was in der Dunkelheit fast genauso laut klang. «Pech für ihn. Aber der Mörder hatte auch Pech.»
«Was meinen Sie damit?», fragte ich.
«Na ja, wenn er ein Fremdarbeiter war, kann ich mir kaum vorstellen, dass er mehr als ein paar Fussel in den Taschen hatte. Ist doch verdammt enttäuschend, einen Mann umzubringen, weil man ihn ausrauben will, und dann findet man nichts, das sich zu klauen lohnt. Ich meine, diese Unglücksraben werden kaum gut bezahlt, oder?»
«Er hatte einen Job», wandte Lehnhoff ein. «Es ist sicher besser, hier in Deutschland Arbeit zu haben, als daheim in Holland keine zu haben.»
«Und wessen Schuld ist das?», fragte Wachtmeister Stumm.
«Ich glaube, mir gefällt nicht, was Sie da andeuten, Wachtmeister», sagte Lehnhoff.
«Lassen Sie’s, Lehnhoff», sagte ich. «Dies ist kaum der richtige Zeitpunkt oder Ort, um eine politische Grundsatzdiskussion zu führen. Schließlich ist ein Mann gestorben.»
Lehnhoff grunzte und stieß mit der Schuhspitze gegen den Kopf. Das allein reichte, dass ich ihn am liebsten auf der Stelle vom Bahnsteig verjagt hätte.
«Also, wenn jemand ihn umgebracht hat, wie Sie behaupten, Herr Kommissar, wird es vermutlich ein anderer Fremdarbeiter gewesen sein. Sie werden schon sehen, dass ich recht habe. In diesen Wohnheimen für ausländische Arbeiter kämpft jeder gegen jeden. Sie sind wie wildgewordene Hunde.»
«Mit dem Wort ‹wildgeworden› wäre ich vorsichtig», sagte ich. «Schließlich wissen auch Hunde, wie wichtig es ist, hin und wieder eine anständige Mahlzeit zu bekommen. Und wenn Sie mich fragen, würde ich lieber 50 Gramm Hund wählen als 100 Gramm Nichts.»
«Ich nicht», erwiderte Lehnhoff. «Für mich sind Meerschweinchen die Grenze. Ich werde niemals einen Hund essen.»
«Das sagt sich so leicht», sagte Wachtmeister Stumm. «Aber versuchen Sie mal, den Unterschied zu erkennen. Vielleicht haben Sie noch nicht davon gehört, aber die Polizisten drüben am Bahnhof Zoo gehen inzwischen sogar nachts im Zoo auf Streife. Und das nur, weil inzwischen Wilddiebe einbrechen und die Tiere klauen. Sie haben ihnen wohl erst vor kurzem den Tapir gestohlen.»
«Was ist ein Tapir?», fragte Wurth.
«Es sieht ein bisschen wie Schwein aus», sagte ich. «Daher vermute ich, dass ein skrupelloser Metzger es jetzt als solches verkauft.»
«Dem wünsch ich viel Glück», sagte Wachtmeister Stumm.
«Das meinen Sie doch nicht ernst», sagte Lehnhoff.
«Ein Mann braucht mehr als eine aufwühlende Rede von Mahatma Propagandi, um seinen Magen zu füllen», bemerkte ich.
«Amen», fügte Wachtmeister Stumm hinzu.
«Sie würden also wegschauen, wenn Sie wüssten, welche Sorte Fleisch da liegt?»
«Darüber weiß ich nichts», sagte ich vorsichtig. Ich war auf der Hut. Ich mochte vielleicht selbstmordgefährdet sein, aber nicht dumm: Lehnhoff war genau der Typ, der einen Kollegen bei der Gestapo anschwärzte, weil er englische Schuhe trug. Und ich hatte keine Lust, eine Woche in einer Zelle zu verbringen und auf die beruhigende Wirkung meiner warmen, nächtlichen Pistole zu verzichten. «Aber wir sind hier in Berlin, Gottfried. Wir sind gut darin, wegzuschauen.»
Ich zeigte auf den abgetrennten Kopf, der zwischen uns lag.
«Sie werden schon sehen, dass ich recht habe.»
Kapitel 2
Natürlich lag ich in vielen Fällen nicht immer richtig. Aber bei den Nazis lag ich selten falsch.
Geert Vranken war ein freiwilliger Arbeiter und auf der Suche nach einer besseren Arbeit als der, die ihm in Holland gegeben wurde, nach Berlin gekommen. Berlins Bahngesellschaft war froh, einen erfahrenen Gleisarbeiter zu bekommen, denn sie steckte gerade in einer hausgemachten Krise, weil sie Ersatz für das eigene Wartungspersonal brauchten. Berlins Polizei hingegen war nicht besonders daran interessiert, diesen Mordfall aufzuklären. Aber es konnte kein Zweifel daran bestehen, dass der Holländer ermordet worden war. Als sein Leichnam schließlich oberflächlich von dem unwilligen uralten Arzt untersucht wurde, der aus dem Ruhestand zurückgekehrt war, um für die Berliner Polizei als forensischer Pathologe zu arbeiten, fand dieser sechs Stichwunden auf dem, was vom Torso des Toten übriggeblieben war.
Kommissar Wilhelm Lüdtke, derzeit Leiter der Berliner Kriminalpolizei, war kein schlechter Ermittler. Er hatte erfolgreich die Ermittlungen um die S-Bahn-Morde geleitet, die schließlich zur Ergreifung und Hinrichtung von Paul Ogorzow führten. Aber wie er mir in seinem mit neuem Teppich ausgelegten Büro im obersten Stockwerk am Alex erklärte, gab es ein wichtiges neues Gesetz, das gerade aus der Wilhelmstraße weitergeleitet worden war. Und Lüdtkes Chef Wilhelm Frick, der Reichsminister des Innern, hatte ihm befohlen, der Umsetzung dieses Gesetzes oberste Priorität einzuräumen. Alle anderen Ermittlungen mussten vorerst zurückstehen. Dem promovierten Juristen Lüdtke war es fast peinlich, mir zu erklären, worum es bei diesem Gesetz ging.
«Ab dem 19. September», sagte er, «sind alle Juden im Deutschen Reich und im Protektorat Böhmen und Mähren verpflichtet, einen gelben Stern mit dem Wort ‹Jude› an ihre Kleidung geheftet zu tragen.»
«Sie meinen, wie im Mittelalter?»
«Ja, wie im Mittelalter.»
«Na ja, das wird’s leichter machen, sie zu erkennen. Großartige Idee. In letzter Zeit fand ich es doch ziemlich schwierig, zu unterscheiden, wer Jude ist und wer nicht. Inzwischen sehen sie etwas dünner und hungriger aus als wir anderen. Aber das war’s auch schon. Ehrlich gesagt habe ich noch keinen gesehen, der diesen dummen Karikaturen im Stürmer ähnelt.» Ich nickte mit gespielter Begeisterung. «Ja, das wird sie bestimmt von uns abheben, das ist gut.»
Lüdtke fühlte sich sichtlich unwohl in seiner Haut. Er zupfte an seinen gestärkten Manschetten und dem Hemdkragen. Er war ein großer Mann mit dichten, dunklen Haaren, die er sorgfältig aus der breiten, gebräunten Stirn gekämmt hatte. Er trug einen marineblauen Anzug und eine Krawatte mit einem Knoten, der so klein war wie das Parteiabzeichen am Revers seines Jacketts. Vermutlich fühlte sich die Krawatte auch so beengend an, wie sie aussah, wenn er die Wahrheit sagen musste. Ein passender, marineblauer Bowler lag auf dem Tisch seines Partners, als verstecke er darunter etwas. Vielleicht ja sein Mittagessen. Oder einfach nur sein Gewissen. Ich fragte mich, wie der Hut wohl aussah, wenn man einen gelben Stern unter das Hutband schob. Wie der Helm eines der Keystone Kops, die vor 25 Jahren große Kinoerfolge gefeiert hatten, dachte ich. Irgendwie ein idiotischer Gedanke.
«Mir gefällt das ebenso wenig wie Ihnen», sagte Lüdtke und kratzte nervös seine Handrücken. Ich wusste, für eine Zigarette wäre er gestorben. So ging es uns beiden. Ohne Zigaretten fühlte sich der Alex wie ein Aschenbecher in einem Salon für Nichtraucher an.
«Mir würde es noch viel weniger gefallen, wenn ich Jude wäre», sagte ich.
«Ja, aber wissen Sie, was es fast unverzeihlich macht?» Er öffnete eine Streichholzschachtel und biss auf ein Streichholz. «Im Moment gibt es einen akuten Stoffmangel.»
«Gelben Stoff.»
Lüdtke nickte.
«Das hätte ich mir denken können. Darf ich auch eins haben?»
«Bedienen Sie sich.» Er warf die Streichhölzer über den Schreibtisch und beobachtete mich. Ich fischte eins aus der Schachtel und steckte es in den Mundwinkel. «Habe mir sagen lassen, sie sind gut für den Hals.»
«Sind Sie um Ihre Gesundheit besorgt, Wilhelm?»
«Ist das nicht jeder? Darum tun wir doch, was man uns aufträgt. Falls wir uns mal zu viel Aufmerksamkeit von der Gestapo einfangen.»
«Sie meinen so, wie es den Juden bestimmt passiert, wenn sie den gelben Stern tragen?»
«Ganz genau.»
«Oh, natürlich. Auch wenn ich selbstverständlich einsehe, wie wichtig die Umsetzung dieses Gesetzes ist, bleibt immer noch der Fall des toten Holländers. Falls Sie es vergessen haben, auf ihn wurde sechsmal eingestochen.»
Lüdtke zuckte mit den Schultern. «Wenn er Deutscher wäre, würden die Dinge anders liegen, Bernie. Aber der Ogorzow-Fall war eine sehr teure Ermittlung für unsere Abteilung. Wir haben unser Budget weit überzogen. Sie haben ja keine Ahnung, wie viel Geld es gekostet hat, diesen Mistkerl zu kriegen! Verdeckt ermittelnde Polizeioffiziere, die Hälfte der Bahnarbeiter in dieser Stadt befragen, eine verstärkte Polizeipräsenz an den Bahnhöfen – die Überstunden, die wir bezahlen mussten, waren enorm. Es war wirklich eine sehr schwere Zeit für die Kripo. Ganz zu schweigen von dem Druck, den das Propagandaministerium auf uns ausgeübt hat. Es ist schwer, jemanden festzunehmen, wenn nicht mal den Zeitungen erlaubt ist, über den Fall zu schreiben.»
«Geert Vranken war ein Bahnarbeiter», sagte ich.
«Und Sie glauben wirklich, das Ministerium ist besonders glücklich, wenn sie dort erfahren, dass wieder ein Mörder sein Unwesen in den S-Bahnen treibt?»
«Dieser Mörder ist anders. Soweit ich es bisher beurteilen kann, hat sich niemand an dem Mann vergangen. Und wenn man mal außer Acht lässt, dass ihn ein Zug überrollt hat, hat auch niemand versucht, ihn zu verstümmeln.»
«Mord bleibt Mord. Und ich weiß genau, was sie sagen werden. Dass es im Moment genug schlechte Nachrichten gibt. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, Bernie, die Moral in dieser Stadt ist schon jetzt tiefer gesunken als ein Dachsarsch. Außerdem brauchen wir die Fremdarbeiter. Das werden sie mir sagen. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass die Deutschen glauben, es gebe ein Problem mit unseren Gastarbeitern. Das war beim Ogorzow-Fall schon schlimm genug. Jeder in Berlin war doch überzeugt, dass ein Deutscher unmöglich all diese Frauen hätte ermorden können. Viele ausländische Arbeiter wurden von wütenden Berlinern belästigt und verprügelt, weil diese glaubten, einer von ihnen müsse einfach der Schuldige sein. Sie wollen doch nicht, dass sich so etwas wiederholt, oder? Himmel, es gibt im Moment genug Probleme in den Zügen und in der U-Bahn. Ich brauche jeden Morgen fast eine Stunde, um zur Arbeit zu kommen.»
«Ich frage mich, warum wir überhaupt noch herkommen, wenn doch das Ministerium für Propaganda entscheidet, was wir tun dürfen und wo wir nicht ermitteln dürfen. Sollen wir jetzt wirklich die Leute suchen, die jüdisch aussehen, und überprüfen, ob sie den richtigen Schmuck tragen? Das ist doch lächerlich.»
«Ich fürchte, genau so ist es. Vielleicht können wir mehr Leute für eine Ermittlung freistellen, wenn es noch weitere erstochene Opfer gibt. Aber für den Moment muss ich Sie leider mit dem Holländer allein lassen.»
«Also gut, Wilhelm. Wenn Sie es so wollen …» Ich biss hart auf mein Streichholz. «Aber allmählich beginne ich zu verstehen, warum Sie jeden Tag an die zwanzig Streichhölzer kauen. Ich vermute, es ist leichter, nicht zu schreien, wenn man auf etwas herumkaut.»
Ich stand auf und schaute zu dem Bild hoch, das an der Wand hing. Der Führer starrte triumphierend auf mich herab. Aber zur Abwechslung sagte er mal nichts. Wenn jemand einen gelben Stern brauchte, dann er. Und zwar direkt über sein Herz genäht, falls er überhaupt eins hatte. Das wäre ein veritables Ziel für ein Erschießungskommando.
Die Straßenkarte von Berlin, die in Lüdtkes Büro an der Wand hing, verriet mir nichts. Als Bernhard Weiß, einer von Lüdtkes Vorgängern, bei der Berliner Kripo zuständig gewesen war, hatte er auf der Karte immer mit kleinen Fähnchen markiert, wo in der Stadt Verbrechen begangen wurden. Jetzt war die Karte leer. Es schien keine nennenswerten Verbrechen mehr zu geben. Noch ein großer Sieg für den Nationalsozialismus.
«Ach, übrigens … Sollte nicht jemand der Familie Vranken in Holland mitteilen, dass der Haupternährer einen Zug mit dem Gesicht hat aufhalten wollen?»
«Ich werde mit dem Reichsarbeitsdienst sprechen», sagte Lüdtke. «Sie können das denen überlassen.»
Ich seufzte und rollte erschöpft den Kopf hin und her. Er fühlte sich auf meinen Schultern schwer und wattig an. Wie ein alter Medizinball.
«Dann bin ich ja beruhigt.»
«Sie sehen aber nicht so aus», sagte er. «Was ist denn im Moment mit Ihnen los, Bernie? Sie wirken echt ziemlich fertig, wissen Sie das? Wenn Sie durch diese Tür kommen, fühlt es sich an, als würde ein eiskalter Regenguss runtergehen. Sie machen auf mich den Eindruck, als hätten Sie schon aufgegeben.»
«Vielleicht habe ich das ja auch.»
«Bloß nicht. Ich befehle Ihnen, sich zusammenzureißen.»
Ich zuckte mit den Schultern. «Wissen Sie, was, Wilhelm? Wenn ich wüsste, wie man schwimmt, würde ich zuerst den Amboss losbinden, der meine Beine nach unten zieht.»
Kapitel 3
Preußen war schon immer ein spannender Landstrich gewesen – besonders, wenn man Jude war. Schon vor den Nazis wurde Juden von ihren Nachbarn eine besondere Behandlung zuteil. 1881 und 1900 brannte man die Synagogen in Neustettin und Konitz – sowie vermutlich noch in einigen anderen preußischen Städten – nieder. Dann wurden 1923, als die Hungerunruhen ausbrachen und ich als junger Polizist auf Streife ging, viele jüdische Läden im Scheunenviertel – das zu Berlins härtesten Gegenden zählt – für eine Sonderbehandlung auserkoren, weil man die Juden verdächtigte, die Preise zu treiben oder Lebensmittel zu horten – oder beides. Es war im Grunde egal, denn Juden waren Juden, und man durfte ihnen nicht trauen.
Die meisten Synagogen der Stadt waren natürlich im November 1938 zerstört worden. Am oberen Ende der Fasanenstraße, wo ich eine kleine Wohnung besaß, standen noch die Reste einer riesigen Synagoge. Hier sah es aus, als habe Titus, der spätere römische Kaiser, gerade erst der Stadt Jerusalem eine Lektion erteilt. Irgendwie kam es mir vor, als habe sich seit 70 nach Christus nicht viel verändert. Bestimmt nicht in Berlin. Und es konnte eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir anfingen, die Juden auf der Straße zu kreuzigen.
Ich ging nie an dieser Ruine vorbei, ohne mich insgeheim ein wenig zu schämen. Aber es dauerte eine ganze Weile, ehe ich bemerkte, dass auch in meinem Haus Juden wohnten. Ziemlich lange war ich mir ihrer Gegenwart in meiner Nähe schlicht nicht bewusst. Doch mittlerweile waren diese Juden leicht zu erkennen, wenn man Augen im Kopf hatte. Im Gegensatz zu dem, was ich zuvor zu Kommissar Lüdtke gesagt hatte, brauchte man keinen gelben Stern oder einen Bauchzirkel, um die Länge der Nase von jemandem zu messen, um zu wissen, dass er Jude war. Ihnen war jede Annehmlichkeit verwehrt, und nach neun Uhr hatten sie Ausgangssperre. Jegliche «Luxusgüter» wie Obst, Tabak oder Alkohol blieben ihnen verwehrt, und man erlaubte ihnen nur während einer Stunde am Ende des Tages einzukaufen. Dann waren die Läden für gewöhnlich schon leergekauft. Die Juden führten ein ziemlich erbärmliches Leben, und das ließ sich an ihren Gesichtern ablesen. Jedes Mal, wenn ich einen sah, musste ich an den «Ewigen Juden» denken. Nur dass die Ratte hier eine Kripo-Marke in ihrer Manteltasche hatte, auf der mein Name und meine Dienstnummer stand. Ich bewunderte ihre Widerstandsfähigkeit. Und das taten auch viele andere Berliner und sogar einige Nazis.
Um im Herbst 1941 als Jude in Berlin zu überleben, musste man eine mutige und starke Persönlichkeit sein. Selbst dann war es schwer, zu überleben. Dennoch war es hart, die beiden Friedmann-Schwestern zu sehen, die in der Wohnung unter meiner wohnten. Eine von ihnen, Raisa, war verheiratet und hatte einen Sohn, Efim. Aber sowohl ihr Sohn als auch ihr Ehemann Mikhail waren 1938 festgenommen worden und noch immer im Gefängnis. Die Tochter Sara war 1934 nach Frankreich geflohen. Seitdem hatten sie nichts mehr von ihr gehört. Diese beiden Schwestern – die ältere hieß Tsilia – wussten, dass ich Polizist war. Deshalb waren sie vor mir auf der Hut. Es kam selten mehr als ein Nicken oder ein «Guten Morgen». Kontakt zwischen Ariern und Juden war ohnehin streng verboten, und weil der Blockwart bestimmt bei der Gestapo Meldung gemacht hätte, hielt ich es für angebracht, mich um ihretwillen von ihnen fernzuhalten.
Nach Minsk hätte ich nicht so entsetzt über den gelben Stern sein dürfen. Aber ich war entsetzt. Vielleicht empfand ich dieses Gesetz umso schlimmer, weil ich wusste, was die Juden, die nach Osten deportiert wurden, erwartete. Aber nach meinem Gespräch mit dem Polizeipräsidenten beschloss ich, etwas zu tun. Es dauerte allerdings ein, zwei Tage, ehe mir einfiel, was ich tun konnte.
Meine Frau war inzwischen seit zwanzig Jahren tot, aber in meinem Schrank hingen immer noch ein paar ihrer Kleider. Manchmal, wenn ich es schaffte, die strenge Rationierung zu umgehen, und den einen oder anderen Schnaps trank, erfasste mich großes Mitleid mit mir und vor allem mit ihr. Dann holte ich eins ihrer alten Kleider aus dem Schrank und drückte den Stoff gegen Nase und Mund, um ihre Erinnerung tief einzuatmen. Für eine lange Zeit war dies mein einziges Privatleben. Als sie noch lebte, besaßen wir Seife, weshalb meine Erinnerungen angenehm waren. Heutzutage roch nichts mehr so gut, und wenn man klug war, stieg man nur mit einer mit Nelken gespickten Orange in die S-Bahn, wie es die Päpste im Mittelalter getan hatten, wenn sie sich unter das einfache Volk mischten.
Zuerst überlegte ich, den beiden Friedmann-Schwestern das gelbe Kleid zu geben, damit sie sich daraus gelbe Sterne machen konnten. Doch irgendwie gefiel mir der Gedanke nicht. Ich hatte das Gefühl, dann mitschuldig an diesem entsetzlichen Polizeibefehl zu sein. Besonders, da ich ja Polizist war. Als ich mit dem gelben Kleid über den Arm schon halb die Treppe hinunter war, kehrte ich um, ging in meine Wohnung zurück und ergriff alle Kleider, die sich noch im Schrank befanden. Aber selbst nachdem ich diesen beiden harmlosen Frauen die letzten Kleider meiner Frau ausgehändigt hatte, fühlte es sich ungenügend an, und ich beschloss im Stillen, noch mehr zu tun.
Das war nicht besonders heroisch. Meine Geschichte war kaum die eines Helden, wie Winckelmann oder Hölderlin sie beschrieben hätten. Aber so ging die ganze Sache los: Wenn ich nicht beschlossen hätte, den Friedmann-Schwestern zu helfen, wäre ich nie Arianne Tauber begegnet. Und was dann passierte, wäre nie passiert.
In meiner Wohnung rauchte ich meine letzte Zigarette und fragte mich, ob ich meine Nase am Alex einfach mal in ein paar Polizeiberichte stecken sollte. Nur um zu sehen, ob Mikhail und Efim Friedmann noch am Leben waren. Das war das eine, was ich tun konnte. Aber jeden, der ein rotes J auf seiner Lebensmittelkarte stehen hatte, würde dieses Wissen kaum satt machen. Zwei so dünne Frauen wie die Friedmann-Schwestern brauchten etwas mehr Substanz als ein paar Informationen über ihre Lieben.
Nach einer Weile wusste ich, was zu tun war. Ich holte einen Brotbeutel der Wehrmacht aus meinem Schrank. In dem Brotbeutel befand sich ein Kilo Kaffeebohnen, die ich in Paris entwendet hatte und eigentlich gegen Zigaretten hatte eintauschen wollen. Ich verließ meine Wohnung und fuhr mit der Tram Richtung Osten bis Potsdamer Platz.
Es war ein warmer Abend und noch nicht ganz dunkel. Pärchen schlenderten Arm in Arm durch den Tiergarten, und es war schwer vorstellbar, dass 2000 Kilometer weiter östlich die Wehrmacht Kiew einkesselte und langsam die Schlinge um Leningrad enger zog. Ich ging Richtung Pariser Platz. Ich war auf dem Weg zum Hotel Adlon, um dort den Oberkellner aufzusuchen. Ich wollte den Kaffee gegen etwas Essbares eintauschen, das ich den beiden Schwestern geben konnte.
In jenem Jahr war Willy Thümmel der Oberkellner im Adlon – ein dicker Sudetendeutscher, der immer sehr beschäftigt wirkte und so leichtfüßig durch sein Reich tänzelte, dass man sich fragte, wie er überhaupt so dick hatte werden können. Mit den rosigen Wangen, dem ungezwungenen Lächeln und seiner makellosen Kleidung erinnerte er mich immer an Hermann Göring. Zweifellos genossen beide Männer das Essen, wenngleich ich beim Reichsmarschall immer den Eindruck hatte, er hätte auch mich, ohne zu zögern, gefressen, wenn er richtig hungrig war. Willy mochte sein Essen. Doch Menschen mochte er noch lieber.
Es waren keine Gäste im Restaurant, und Willy überprüfte gerade ein letztes Mal die Verdunkelungsvorhänge, als ich meine Nase durch die Tür steckte. Wie jeder gute Oberkellner bemerkte er mich sofort und kam zu mir herübergeschwebt.
«Bernie! Du siehst besorgt aus. Geht’s dir gut?»
«Was nutzt es, wenn ich mich beklage, Willy?»
«Keine Ahnung. Das Rädchen im Getriebe, das am lautesten knirscht, wird in Deutschland heutzutage am besten geölt. Was bringt dich her?»
«Können wir irgendwo ungestört reden?»
Er führte mich eine schmale Treppe hinunter in ein Büro, schloss die Tür und schenkte uns zwei Gläschen Sherry ein. Ich wusste, dass er sich selten länger vom Restaurant entfernte, als ein Mann brauchte, um das Klo aufzusuchen. Darum kam ich sofort zur Sache.
«Als ich in Paris war, habe ich dort ein wenig Kaffee befreit», sagte ich. «Richtigen Kaffee, nicht den Muckefuck, den wir hier in Deutschland kriegen. Bohnen. Afrikanische Kaffebohnen. Ein ganzes Kilo.» Ich stellte den Brotbeutel auf Willys Schreibtisch und ließ ihn den Inhalt überprüfen.
Einen Augenblick lang schloss er nur die Augen und inhalierte das Aroma. Dann stöhnte er auf. Solch ein Stöhnen hörte man selten außerhalb eines Schlafzimmers.
«Du hast dir diesen Sherry redlich verdient. Ich habe schon ganz vergessen, wie richtiger Kaffee riecht.»
Ich kippte den Alkohol runter. Er prallte gegen meine Mandeln und brannte im Rachen.
«Ein ganzes Kilo, sagst du? Das bringt auf dem Schwarzmarkt hundert Mark, zumindest war es so, als ich das letzte Mal versucht habe, welchen zu bekommen. Und da es im Moment nirgends Kaffee gibt, ist er jetzt vermutlich mehr wert. Kein Wunder, dass wir in Frankreich einmarschiert sind. Für solch einen Kaffee würde ich bis Leningrad kriechen.»
«Da gibt es inzwischen auch keinen mehr.» Ich ließ mir nachschenken. Der Sherry war nicht der beste. Aber nichts war heutzutage noch das Beste – nicht mal im Adlon. «Ich habe gedacht, du könntest den vielleicht für ein paar spezielle Gäste brauchen.»
«Ja, könnte ich.» Er runzelte die Stirn. «Aber du möchtest dafür doch kein Geld, oder? Für etwas so Wertvolles kannst du kein Geld wollen, Bernie. Selbst der Teufel muss heutzutage Dreck mit Milchpulver trinken.»
Er steckte noch mal die Nase in den Beutel und schüttelte ungläubig den Kopf. «Also, was willst du? Das Adlon steht dir zur Verfügung.»
«Ich möchte gar nichts Besonderes. Nur etwas zu essen.»
«Du enttäuschst mich. In unserer Küche gibt es nichts, das auch nur annähernd so viel wert ist wie dieser Kaffee. Und lass dich nicht von der Speisekarte blenden.» Er nahm eine vom Schreibtisch und gab sie mir. «Es stehen zwei Fleischgerichte auf der Karte, obwohl die Küche eigentlich nur eins hat. Aber wir setzen zwei auf die Karte, um den Schein zu wahren. Was soll ich machen? Wir haben schließlich einen Ruf zu verlieren.»
«Und falls jemand nach dem Gericht fragt, das es nicht gibt?», fragte ich.
«Das passiert nicht.» Willy schüttelte den Kopf. «Sobald der erste Gast durch die Tür kommt, streichen wir das zweite Gericht. Das ist Hitlers Entscheidung. Was bedeutet, dass wir im Grunde keine Wahl haben.»
Er zögerte. «Du willst für diesen Kaffee Essen? Was denn genau?»
«Konserven.»
«Aha.»
«Die Qualität ist nicht so wichtig, solange es genießbar ist. Fleischkonserven, Obstkonserven, Milchkonserven und Gemüsekonserven. Alles, was du findest, und so viel, dass es für eine Weile reicht.»
«Du weißt aber, dass der Besitz von Nahrungskonserven streng verboten ist? So lautet das Gesetz. Alle Nahrungskonserven sind für die Front. Wenn man dich auf offener Straße damit erwischt, hast du ein echtes Problem. So viel wertvolles Metall … Sie werden glauben, dass du es an die Briten verkaufst.»
«Das weiß ich. Aber ich brauche Nahrungsmittel, die eine Weile halten, und ich weiß nicht, wo ich sonst welche bekomme.»
«Du machst auf mich nicht den Eindruck, als könntest du nicht einfach in die Geschäfte gehen, Bernie.»
«Die Sachen sind ja auch nicht für mich, Willy.»
«Das habe ich mir gedacht. Und es geht mich auch nichts an. Aber eins sage ich dir, Kommissar: Für solchen Kaffee bin ich bereit, ein Verbrechen gegen den Staat zu begehen, solange du niemandem etwas davon erzählst. Und jetzt komm mit. Ich glaube, wir haben noch ein paar Konserven von vorm Krieg.»
Wir gingen in den Lagerraum des Hotels. Der war ungefähr so groß wie das Gefängnis unter dem Alex, aber hier war’s für Nase und Ohren angenehmer. Die Tür war mit mehr Vorhängeschlössern gesichert als die Reichsbank. Willy füllte meinen Brotbeutel mit so vielen Konserven, wie hineinpassten.
«Wenn sie aufgebraucht sind, komm vorbei und hol dir ruhig mehr, wenn du dann noch auf freiem Fuß bist. Und wenn nicht, vergiss bitte, dass du mir je begegnet bist.»
«Danke, Willy.»
«Jetzt muss ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten, Bernie. Es könnte auch für dich von Vorteil sein. Hier im Hotel gibt es einen amerikanischen Journalisten, einer von mehreren. Sein Name ist Paul Dickson, und er arbeitet für das Mutual Broadcasting System. Er würde liebend gern die Front besuchen, aber so etwas ist offensichtlich verboten. Hier ist ja inzwischen alles verboten. Wir wissen nur dann, ob etwas erlaubt ist, wenn wir es tun und nicht ins Gefängnis gesteckt werden, nicht wahr?
Nun weiß ich, dass du erst kürzlich von der Front zurückgekehrt bist. Bestimmt ist dir aufgefallen, dass ich nicht gefragt habe, wie es da ist. Im Osten. Wenn ich nur einen Kompass sehe, wird mir schlecht. Ich frage nicht nach, weil ich es nicht wissen will. Die Welt jenseits dieses Hauses interessiert mich nicht. Die Gäste im Hotel sind meine Welt, und mehr brauche ich nicht zu wissen. Ihre Zufriedenheit und ihr Glück ist alles, was mich kümmert.
Um Mr. Dicksons Glück und Zufriedenheit willen frage ich dich, ob du dich mit ihm treffen könntest. Aber nicht hier im Hotel. Es ist alles andere als sicher, im Adlon zu reden. Es gibt oben einige Suiten, die von den Leuten vom Außenpolitischen Amt übernommen wurden. Und diese Leute werden von deutschen Soldaten mit Stahlhelmen überwacht. Kannst du dir das vorstellen? Soldaten im Adlon. Das ist unerträglich. Es ist wie damals 1919, nur dass keiner Barrikaden errichtet.
Die meisten Amerikaner sind übrigens auch hier im Hotel. Was im Klartext bedeutet, dass die Gestapo an der Bar sitzt. Vermutlich hören sie uns sogar heimlich ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Aber es ist gut möglich, und das bereitet mir zusätzlichen Kummer.»
«Dieser Dickson … Ist er im Moment im Hotel?»
Willy dachte einen Moment lang nach. «Ich glaube, schon.»
«Verrate ihm nicht meinen Namen. Sag ihm nur, er findet mich neben der Goethestatue im Tiergarten, wenn er Lust auf ein paar Lebensweisheiten und Wahrheiten hat.»
«Die Statue kenne ich. Direkt an der Hermann-Göring-Straße.»
«Ich warte dort fünfzehn Minuten auf ihn. Und wenn er kommt, soll er allein kommen. Nur er, ich und Goethe. Ich will keine Zeugen, wenn ich mit ihm rede. Es gibt zu viele Amis, die für die Gestapo arbeiten. Und was Goethe angeht, bin ich mir auch nicht so sicher.»
Ich warf mir den Brotbeutel über die Schulter und marschierte aus dem Adlon auf den Pariser Platz. Es war schon fast dunkel. Einen Vorteil hatte die Verdunkelung: Man sah die Hakenkreuzflaggen nicht. Aber der klotzige Rohbau des von Speer entworfenen Reichsluftfahrtministeriums erhob sich in der Ferne vor dem violetten Nachthimmel und dominierte die Gegend südwestlich vom Brandenburger Tor. Es ging das Gerücht, Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer setze russische Kriegsgefangene als Arbeitskräfte ein, um ein Gebäude zu errichten, das außer Hitler niemand haben wollte. Es gab außerdem das Gerücht, dass unterhalb des Baus ein neues Tunnelnetz die Regierungsgebäude an der Wilhelmstraße mit einer geheimen Bunkeranlage verband, die sich unter der Hermann-Göring-Straße bis zum Tiergarten erstreckte. Es war nie gut, wenn man den Gerüchten in Berlin zu viel Glauben schenkte. Aus dem einfachen Grund, dass sie meistens stimmten.
Ich stand neben Goethe und wartete. Nach einiger Zeit hörte ich eine Messerschmitt 109, die ziemlich niedrig Richtung Flugplatz Tempelhof flog. Und dann eine zweite. Für jemanden, der in Russland gewesen war, war das ein beunruhigendes Geräusch. Wie ein riesiger, freundlicher Löwe, der in einer leeren Höhle gähnte. Das Geräusch unterschied sich von dem, das die deutlich langsamere Whitley der Briten machte. Die Armstrong Whitworth Whitley pflügte manchmal wie ein tödlicher, zerstörerischer Traktor durch den Berliner Nachthimmel.
«Guten Abend», sagte der Mann, der schließlich auf mich zukam. «Ich bin Paul Dickson. Der Amerikaner aus dem Adlon.»