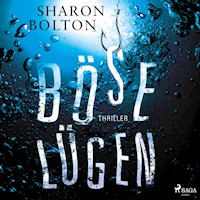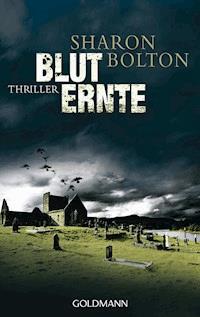2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer kleinen Gemeinschaft wie der auf den Falklands gehen keine Kinder verloren. Und wenn doch, so kann es sich nur um einen tragischen Unfall handeln, schließlich sind die rauen Küsten der Inselgruppe nicht ungefährlich. Doch als zum dritten Mal ein kleiner Junge verschwindet, glaubt kaum noch jemand an einen Zufall. Die Bewohner müssen befürchten, dass einer von ihnen ein Mörder ist. Auch Catrin Quinn, die nach dem Tod ihrer beiden Söhne ein zurückgezogenes Leben führt, wird in die Suche hineingezogen. Mit jeder Stunde steigen Misstrauen und Hysterie, bis eine regelrechte Hexenjagd beginnt. In ihrem Zentrum stehen Catrin selbst; Rachel, ihre beste Freundin aus Kindertagen; und Catrins ehemaliger Liebhaber Callum. Alle drei hüten Geheimnisse, die sie bis in ihre Träume verfolgen. Und sie vertrauen niemandem – nicht einmal sich selbst. Schließlich wären sie zu allem fähig …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
In einer kleinen Gemeinschaft wie der auf den Falklands gehen keine Kinder verloren. Und wenn doch, so kann es sich nur um einen tragischen Unfall handeln, schließlich sind die rauen Küsten der Inselgruppe nicht ungefährlich. Doch als zum dritten Mal ein kleiner Junge verschwindet, glaubt kaum noch jemand an einen Zufall. Die Bewohner müssen befürchten, dass einer von ihnen ein Mörder ist. Auch Catrin Quinn, die nach dem Tod ihrer beiden Söhne ein zurückgezogenes Leben führt, wird in die Suche hineingezogen. Mit jeder Stunde steigen Misstrauen und Hysterie, bis eine regelrechte Hexenjagd beginnt. In ihrem Zentrum stehen Catrin selbst, Rachel, ihre beste Freundin aus Kindertagen, und Catrins ehemaliger Liebhaber Callum. Alle drei hüten Geheimnisse, die sie bis in ihre Träume verfolgen. Und sie vertrauen niemandem – nicht einmal sich selbst. Schließlich wären sie zu allem fähig …
Autorin
Sharon Bolton wurde im englischen Lancashire geboren, hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaft studiert. »Todesopfer«, ihr erster Roman, wurde von Lesern und Presse begeistert gefeiert und machte die Autorin über Nacht zum neuen Star unter den britischen Spannungsautorinnen. Ihrem ersten Triumph folgten mittlerweile sieben weitere Thriller – darunter vier mit der grandiosen Ermittlerin Lacey Flint –, in denen Sharon Bolton ihr brillantes Können immer wieder unter Beweis stellte. Sie wurde bereits für zahlreiche Krimipreise nominiert und für »Schlangenhaus« mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet sowie mit dem Dagger in the Library für ihr Gesamtwerk. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Oxford.
Mehr zur Autorin und ihren Büchern finden Sie unter www.sjbolton.com
Die Lacey-Flint-Reihe in chronologischer Reihenfolge:
Dunkle Gebete. Thriller
Dead End. Thriller
Ihr Blut so rein. Thriller
Unschuldig wie der Schnee. Ein Lacey-Flint-Kurzkrimi (nur als E-Book erhältlich)
Schwarze Strömung. Thriller
Außerdem von Sharon Bolton lieferbar:
Todesopfer. Thriller
Schlangenhaus. Thriller
Bluternte. Thriller
Böse Lügen. Thriller
Sämtliche Romane von Sharon Bolton sind auch als E-Book erhältlich
Sharon Bolton
BÖSE LÜGEN
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Little Black Lies«
bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London
Für die deutsche Fassung der Zitate aus Samuel Taylor Coleridges Ballade Der alte Matrose (The Rime of The Ancient Mariner) wurde die Übersetzung von Hermann Ferdinand Freiligrath aus dem Jahr 1877 verwendet.
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2015
Copyright © der Originalausgabe
2015 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Redaktion: Eva Wagner
Landkarte: Copyright © Tom Coulson@Encompass Graphics
Umschlaggestaltung und Konzeption: Buxdesign | München, unter Verwendung von Motiven von plainpicture/Naturbild; fotolia.com/artikularis
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17025-7
www.manhattan-verlag.de
Für Anne Marie, die mir als Erste gesagt hat, dass ich es kann, und für Sarah, die dafür sorgt, dass ich es besser kann.
Und Alt und Jung mit finsterm BlickKam auf mich zugegangen;Den Albatros, den ich erschoss,Hat man mir umgehangen.
Samuel Taylor Coleridge, Der alte Matrose
TEIL I Catrin
Ich habe überlegt, ob ich wohl den Mumm habe zu töten. Ob ich einem lebenden Wesen in die Augen sehen und jenen einen, unwiderruflichen Akt durchführen kann, der ein Leben beendet. Die Frage ist dann wohl beantwortet. Zu töten fällt mir nicht schwer. Eigentlich bin ich sogar ziemlich gut darin.
Tag 2 Dienstag, 1. November 1994
1
Ich glaube, unter den richtigen Umständen kann so ziemlich jeder töten, vorausgesetzt, er ist motiviert genug. Die Frage ist nur: Bin ich schon so weit? Ich glaube schon. Weil ich in letzter Zeit nämlich anscheinend an nicht viel anderes denken kann.
Es ist eine Minute nach Mitternacht. In zwei Tagen ist der 3. November. Noch zwei Tage. Bin ich schon so weit?
Etwas bewegt sich. Nicht das Wasser um mich herum, das scheint erstarrt zu sein, sondern das Spiegelbild eines Vogels. Ich brauche nicht hochzublicken, um zu sehen, dass es ein Riesensturmvogel ist. Die Tiere sehen geradezu prähistorisch aus mit ihren fast zwei Metern Flügelspannweite und den riesigen, gekrümmten Schnäbeln. Sie folgen dem Boot oft, besonders wenn ich nachts draußen bin, und halten mit, egal, wie weit ich fahre oder wie schnell ich bin.
Im Augenblick mache ich gar keine Fahrt. Ich sitze im Cockpit und starre ein Foto von meinen beiden Söhnen an. Das tue ich bestimmt schon seit einer ganzen Weile, mir brennen nämlich die Augen. Ich kneife sie zu und zwinge mich dann wegzuschauen.
In der Ferne heben sich die Berge dunkel gegen einen etwas helleren Nachthimmel ab, und das Wasser, das mich umgibt, hat das Aussehen und die Beschaffenheit eines alten Spiegels: regungslos, hier und dort fleckig, nicht vollkommen durchsichtig. Manchmal tut er das, der Ozean, nimmt ein Wesen an, das ihm so überhaupt nicht entspricht, dass es einen ganz kurz kalt erwischt. Und man vergisst, dass man sich auf einem der rauesten, gnadenlosesten Meere der Welt befindet.
Ich liege vor der Küste der Falklandinseln vor Anker, einem winzigen Archipel im Südatlantik, so weit von allem Wichtigen entfernt, so unbedeutend auf der Weltbühne, dass ihn jahrhundertelang so ziemlich niemand beachtet hat. Und dann wurde er zum Knochen, um den sich zwei vom eigenen Ego getriebene Hunde der internationalen Politik in die Haare gerieten. Ein paar kurze Wochen lang wusste der ganze Erdkreis Bescheid über uns. Das war vor über zehn Jahren, und die Welt vergaß es bald wieder.
Wir dagegen vergessen nicht und Argentinien auch nicht. Immer wieder mal, selbst zwölf Jahre, nachdem sie den Hintern versohlt bekommen haben, wirft die argentinische Regierung scheele Blicke in unsere Richtung. Die Argentinier sagen, die Islas Malvinas gehören ihnen. Wir sagen: »Ihr könnt uns mal.«
Nicht, dass wir es so toll finden, das zu sein, zu dem wir geworden sind. Ein kostspieliger Luxus, einer der letzten verbliebenen Reste des britischen Empires. Wir sehnen uns nach Unabhängigkeit, nach einem Einkommen, um unsere Verteidigung selbst zu finanzieren. Diese Hoffnung ist dürftig. Und nie fühlen wir uns sicher.
Das Foto von meinen Söhnen ist verblasst. Jetzt sieht man es nicht so sehr, aber bei Tageslicht wird das Rot von Kits Jacke stumpfrosa aussehen, Neds gelbe Gummistiefel werden einen kränklichen Beigeton annehmen.
Um mich herum, auf dem Wasser, ist der gespiegelte Mond so regungslos und vollkommen, dass er glatt heil und unversehrt vom Himmel gefallen sein könnte. Ein kleines Stück vom Heck entfernt, liegt er auf dem Wasser, so schmal und körperlos wie ein zarter Hobelspan. Sterne liegen wie Abfall um ihn herum, als habe sie jemand nach Gutdünken auf die Meeresoberfläche gestreut. In diesem fernen Winkel des Südatlantiks gibt es keine Lichtverschmutzung, und jeder Stern, der heute Nacht am Himmel steht, spiegelt sich genau unter mir im Wasser. Ich scheine von Sternen umgeben zu sein. Als ich für kurze Zeit in den Städten der nördlichen Hemisphäre gelebt habe, wo die Sterne nur winzige Lichtpunkte und manchmal völlig unsichtbar sind, war es leicht zu vergessen, wie unermesslich zahlreich sie sind. Daheim werde ich jedes Mal, wenn ich nachts aufs Meer hinausfahre, daran erinnert, wie gewaltig groß der Himmel ist.
Ich stehe auf; genau weiß ich nicht, wie lange ich hier gesessen habe, aber ich weiß, dass ich noch ungefähr zwanzig Minuten zu arbeiten habe, ehe ich für heute Nacht fertig bin. Ich wechsle die Sauerstoffflasche aus, überprüfe den Druck, bringe Maske und Mundstück an ihren Platz und mache einen Schritt über den Rand des Hecks hinaus.
Augenblicklich legt das Wasser seine kalte Decke um mich, kühlt mich ab trotz des schützenden Neoprenanzugs, den ich trage, aber das macht mir nie etwas aus. Für mich ist das Teil des Akklimatisierungsprozesses, der Wandlung, die ich durchlaufen muss: vom Landwesen zum Meeresgeschöpf.
Das Wasser ist nicht tief, höchstens zwanzig Meter. Natürlich sollte ich nicht allein tauchen. Schon dadurch, dass ich allein auf dem Boot bin, verstoße ich gegen die erste Taucherregel, aber es ist niemand mehr am Leben, der entweder die nötige Autorität oder den nötigen Einfluss hätte, um mich daran zu hindern, und ich habe kein großes Interesse daran, mich zu schützen.
Ich schaue nach unten, sehe die Tauchleine abwärts führen und in der Dunkelheit verschwinden, dann lasse ich Luft aus meiner Weste ab und sinke. Einen guten Meter tiefer drehe ich mich herum und schwimme auf den Wald aus Kelp zu, der gerade unter mir in Sicht kommt.
Kelp – die meisten Leute sagen Seetang – wächst hier reichlich. Mit wurzelähnlichen Strukturen am Meeresgrund verankert, reckt er sich zum Licht empor; seine Wedel werden von gasgefüllten Blasen aufrecht gehalten.
Ein Schiff ist hier gesunken, vor langer Zeit, und mittlerweile ist das ganze Gebilde auseinandergebrochen und hat die majestätische Unterwasserarchitektur des Meeresbodens geformt. Riesige Holzstücke, von Meeresgetier bevölkert, ragen wie Unterwasserstädte vom Grund empor. Und über allem erhebt sich der Kelp, wie ein uralter Wald, nur in ständiger, anmutiger Bewegung.
Ich erreiche die Spitzen der Pflanzen und schwimme weiter abwärts. Bei Tageslicht und klarem Wasser wäre die schiere Leuchtkraft der Farben um mich herum verblüffend. Nachts, nur mithilfe meiner Lampe wahrgenommen, sind sie sanfter, gedämpfter. Das Senfgelb des Kelps, das Rauchblau des Wassers, das gelegentliche Aufblitzen von Rubinrot, wenn Krabben vorbeihuschen.
Ich sammle Seeigel, zu Forschungszwecken. Die Kelpwälder sind wichtige Laichgründe für Fische, aber seit Kurzem gehen sie zurück, und ein möglicher Verursacher ist der Seeigel, der an den Wurzelstrukturen nagt. Die Leute, für die ich arbeite, müssen wissen, ob hier eine neue, invasive Spezies ihr Unwesen treibt, oder ob die normale Population einfach nur ein bisschen gieriger geworden ist. Fischereilizenzen zu verkaufen, könnte für die Inselwirtschaft enorm lukrativ sein. Die Fische sind wichtig, also sind die Kelpwälder wichtig und meine Seeigel auch. Heute Nacht werden sie in Kühlbehältern auf meinem Boot gelagert, morgen früh bringe ich sie ins Labor in Stanley.
Ein paar Meter über dem Meeresgrund schwimme ich einen Pfad entlang, den ich mir bereits ins Gedächtnis eingeprägt habe. Viele Taucher mögen den Kelp nicht. Sie ekeln sich vor den glitschigen Pflanzen, die an ihnen entlangstreifen, sie fürchten die Momente, wenn sie sich wie Ranken um ihre Glieder schlingen. Ich mag das Gefühl der Geborgenheit, das die Kelpwälder mir geben. Es macht mir Spaß, verborgen zu sein, andere Lebewesen zu überraschen, manchmal auch selbst überrascht zu werden. Meine Sammelmissionen sind immer von mehr Erfolg gekrönt, wenn ich von Kelp umgeben bin.
Jäh wird mir klar, dass ich hier unten nicht allein bin. Der Kelpwald vor mir bewegt sich, und zwar nicht im sanften Takt der Wellen. Irgendetwas kommt auf mich zu. Sekunden später finden ein junger Seebär und ich uns praktisch Nase an Nase wieder. Er schaut mir in die Augen und schießt dann davon, verfolgt einen Fisch, der zu schnell ist, als dass ich erkennen könnte, um was für eine Art es sich handelt. Ich sehe zu, wie sie im Zickzack über den Meeresboden flitzen, doch das ungute Gefühl vergeht nicht.
Es geschieht binnen eines Augenblicks. Ein großer Schatten ragt über mir auf, das Wasser wird mit gewaltiger Wucht gegen mich gedrückt, und ein massiges Geschöpf schießt vorbei, hinter dem Seebären her. Sie treffen aufeinander. Ein heftiges Zappeln und Herumschleudern. Das Wasser brodelt vor Luftblasen, dann trennen sie sich wieder.
Der Neuankömmling ist ein Seeelefant, ein großes Männchen, über zwei Meter lang. Er ist viel langsamer als der Seebär, aber außerordentlich stark. Die beiden setzen zu einer verzweifelten Hetzjagd durch den Kelp an, und ich bin in Gefahr.
Normalerweise würde ein Seeelefant einen Menschen nicht angreifen, er würde nicht einmal einen großen Seebären behelligen – dieser jedoch ist ganz in seiner Jagd gefangen, getrieben vom Bedürfnis zu töten. Das Wasser um mich herum ist bereits vom Blut des jungen Seebären rot gefärbt. Wenn der entkommt und der Seeelefant mich sieht, dann könnte er rein instinktiv handeln. Ich erstarre und ducke mich tief in den Kelpwald, hoffe, dass die Jagd von mir wegführt.
Tut sie aber nicht. Der Seebär kommt genau auf mich zu; er will gerade in dem dichten Pflanzenwuchs Schutz suchen, als der Seeelefant über ihm auftaucht. Der Jäger schließt die mächtigen Kiefer um das Genick seiner Beute und schüttelt sie heftig. Binnen Sekunden hängt der Kopf des Seebären schlaff herab. Der Seeelefant schwimmt mit seiner getöteten Beute zur Oberfläche hinauf.
Und so macht man das. Schnell, brutal, ohne sich Zeit zum Zaudern oder Nachdenken zu lassen. So töten wir. Ich habe heute Nacht viel über den Tod nachgedacht, als ich oben auf der Wasseroberfläche gesessen bin, als ich darunter getaucht bin. Über den Tod und die Fähigkeit der Menschen, ihn anderen zuzufügen. Über meine eigene Fähigkeit zu töten.
Schließlich stamme ich von einer langen Ahnenreihe aus Mördern ab. Mein Großvater, ein Mann mit dem passenden Namen Bartholomew Coffin, war einer der erfolgreichsten und skrupellosesten Killer, die dieser Teil der Welt jemals gekannt hat. Tag für Tag zogen er und seine Bande aus, jagten ohne Einhalten oder Erbarmen und sahen zu, wie die See sich vom Blut rot färbte. Natürlich hat Grandpa Wale getötet, keine Menschen – aber wie groß kann der Unterschied denn sein?
Als ich mein letztes Forschungsexemplar eingesammelt und eingetütet habe, bin ich auch bereit, wieder aufzutauchen. Ich liefere mir ein Wettrennen mit den Luftblasen um mich herum und kann Sterne ausmachen, als ich noch gut einen Meter unter Wasser bin. Dann tauche ich auf und kann einen Augenblick lang das Boot nicht finden. Während ich unten war, ist der Bann, der auf dem Ozean gelegen hat, gebrochen, und das Wasser ist wieder in Bewegung geraten. Wellen wölben sich rund um mich herum empor, und einen Moment lang verspüre ich scharfe Erregung. Ich bin ganz allein, weit draußen auf See. Wenn ich es nicht aufs Boot zurück schaffe, sterbe ich hier draußen. Schon seit einiger Zeit habe ich jetzt das Gefühl, dass mein Leben seinem Ende sehr nahe kommt. Ist es jetzt also so weit? Werde ich heute sterben?
Und dann ist es da, keine zwanzig Meter entfernt.
Queenie ist aufgewacht. Sie hopst an der Reling entlang über das Deck und kläfft mich an, bis ich die Leiter zu fassen bekomme und mich hochziehe. Ich bücke mich, um sie zu streicheln, und tropfe sie dabei von oben bis unten voll. Sie rennt los und bringt mir das alte Handtuch aus ihrem Korb. Es ist voller Dreck und Hundehaare, aber gut gemeint war es trotzdem.
Queenie ist ein Staffordshire-Terrier, sehr klein für ihre Rasse, ein kompaktes kleines Bündel aus Muskeln und seidenweichem Fell. Ihre Nase, die Beine und die Schwanzspitze sind weiß, der Rest jedoch ist so schwarz wie das, was in meinem Kopf ist. Sie ist vier Jahre alt, und ich schwöre, es gibt Momente, wo sie sich auch an die Jungen erinnert. Wo sie auch um sie trauert.
Ich lichte den Anker, werfe den Motor an und nehme Kurs auf Stanley in Richtung Süden. Dabei denke ich von Neuem an meinen Großvater. Heute Nacht scheinen meine Gedanken entschlossen zu sein, auf jenem düsteren Weg zu wandeln, wo verstohlene Pläne wie klammernde Wurzeln über den Waldboden kriechen, wo die finstereren Gefilde unseres Verstandes freie Bahn haben.
Grandpa Coffin, der Vater meines Vaters, war einer der größten Walfänger im Südatlantik. Er war der Letzte einer Dynastie aus Jägern zur See, die 1804 Nantucket verließen und etliche Monate später auf New Island in den Falklands anlandeten. Die nächsten zweihundert Jahre lang plünderten sie die Inseln und die See, die sie umgab. Die Meeres- und Inselfauna müht sich noch immer ab, sich von dem zu erholen, was Grandpa Coffin und seine Vorfahren angerichtet haben.
Er ist gestorben, als ich noch klein war. Schade.
Ich fahre in das ruhigere Wasser des Port William ein und justiere meinen Kurs neu, sodass ich einen gehörigen Abstand zu dem Kreuzfahrtschiff halte, der Princess Royal. Von jetzt an bis zum Ende des Sommers werden wir einen stetigen Strom solcher Schiffe sehen, die auf dem Weg nach South Georgia und der Antarktis für ein paar Tage hier vor Anker gehen. Sie sind Fluch und Segen zugleich, die Hundertschaften von Touristen, die täglich an unseren Küsten anlanden, wenn ein Schiff im Hafen liegt, und wie jeden Segen lieben und verfluchen wir sie gleichermaßen. Heute Nacht scheinen die Leute auf dem Schiff angesichts der späten Stunde ungewöhnlich wach und laut zu sein, aber auf diesen Pötten kann mächtig gefeiert werden. Der Lärm der Partys dringt dann oft kilometerweit ins Landesinnere.
Unbemerkt von allen an Deck, schlüpfe ich vorbei und halte auf den inneren Hafen zu. Es ist fast ein Uhr morgens. Bald werde ich Stunden zählen und nicht mehr Tage. Es gibt Dinge, die ich noch erledigen muss, Versprechen, die ich anderen gegeben habe – aber stets beschäftigt zu sein ist bestimmt eine gute Sache. Rasch schaue ich mich auf dem Boot um; ich habe dafür gesorgt, dass Treibstoff- und Wassertank immer voll sind. In einem verschlossenen Schapp ist ein Betäubungsgewehr, für den seltenen Fall, dass ich ein großes Säugetier sedieren muss. Und außerdem eine alte Pistole von meinem Großvater, für den Fall, dass Euthanasie die einzige Option ist. Beide sind voll funktionsfähig. Ich bin bereit.
Bereit herauszufinden, wie viel vom Blut meiner Vorfahren durch meine Adern strömt. Ich steuere durch The Narrows in den inneren Hafen und sehe sofort, dass aus meinen sorgfältig geschmiedeten Plänen vielleicht doch nichts werden wird.
Die Polizei wartet auf mich.
2
In der kurzen Zeit, die ich auf See war, ist hier irgendetwas passiert. Die meisten Bewohner der Falklandinseln leben in Stanley, aber es ist trotzdem eine kleine Gemeinde. Nur ungefähr zweitausend Menschen in so um die siebenhundert Häusern. Vor drei Stunden, als ich ausgelaufen bin, haben die winzigen Lichtpunkte von hundert oder mehr Kürbislaternen die Hügel gesprenkelt wie Sterne, jetzt aber sind sie alle ausgebrannt. Um diese frühe Morgenstunde sollte Stanley eigentlich in fast völliger Finsternis daliegen. Dem ist aber nicht so. Ich sehe ein Polizeiauto die Küstenstraße entlangfahren, und im Hafen funkeln noch mehr Blaulichter.
Es ist fast auf den Tag genau drei Jahre her, seit ich das letzte Mal in den Hafen eingelaufen bin und die Polizei mich erwartet hat.
»Es hat einen Unfall gegeben.« Drei Jahre später kann ich noch immer Bens Stimme aus dem Bordfunkgerät dringen hören, knisternd und zittrig. »Ned und Kit sind beide auf dem Weg ins Krankenhaus, aber mehr weiß ich nicht. Fahr so schnell wie möglich hin.«
Hastig beendete er die Verbindung, und ich malte mir das Schlimmste aus. Nur eben doch nicht das Allerschlimmste. Das verbot ich mir. Ich stellte mir vor, wie sie Schmerzen litten. Ich stellte mir ihre kleinen Körper zerschlagen und zerbrochen vor, zerschnitten von rasiermesserscharfem Metall. Den ganzen Weg bis nach Stanley hörte ich ihre Stimmen in meinem Kopf, wie sie nach Mummy riefen, nicht verstehen konnten, warum ich nicht da war, wenn sie mich am dringendsten brauchten. Ich malte mir abgerissene Gliedmaßen aus, Narben auf ihren Gesichtern. Nie stellte ich sie mir als leblose Körper vor, die Seite an Seite im Leichenschauhaus lagen.
Im Klammergriff schlimmer Erinnerungen gebe ich zu viel Gas; ich sollte nicht mit solcher Geschwindigkeit in den Hafen einfahren. Hier gibt es Felsen, mehr als ein Schiffswrack, verborgene Hindernisse, die mein Boot in Stücke reißen können. Ich zwinge mich, Fahrt wegzunehmen, und warte darauf, dass auch mein Herzschlag und mein Atem langsamer werden. Beides erweist sich als schwerer zu kontrollieren als der Gashebel. Und doch muss ich den Schein des Normalseins wahren, des Zurechtkommens. Ein Weilchen muss die menschliche Hülle um mich herum noch halten.
Jemand wartet an meinem üblichen Anlegeplatz auf mich, einer von den ehemaligen Fischern, die inzwischen im Ruhestand sind. Er wohnt mit zwei Frauen in einem Cottage am Hafen; die Leute sind sich einig, dass es seine Mutter und seine Schwester sein müssen, doch wetten will niemand darauf. Er heißt Ralph Larken, hinter seinem Rücken auch Roadkill Ralph genannt. Als ich ihm die Heckleine zuwerfe, sehe ich, dass er unter seinem Ölzeug eine ausgeblichene gestreifte Pyjamahose trägt. Die Hosenbeine stecken in riesigen schwarzen Seestiefeln, und in dem merkwürdigen trüben Licht sieht er damit aus wie ein Pirat. Ich springe mit der Bugleine an Land. »Was ist denn los?«
»’n Kind wird vermisst.«
Ich starre ihn an und frage mich innerlich, wer von uns beiden es wohl laut aussprechen wird. Er tut es.
»Schon wieder eins.« Mit einem Kopfnicken deutet er auf eine Menschengruppe an der Hafenmauer. Ich kann Polizeiuniformen erkennen, jemanden in Militärkluft. »Die warten auf Sie«, sagt er. »Haben Ihre Positionslichter gesehen.«
Noch ein vermisstes Kind. Ich trieb noch immer haltlos im Strudel meiner eigenen Trauer, als das erste verschwand, vor etwas über zwei Jahren, aber ich weiß noch, dass die Leute sich erzählten, es sei ein schrecklicher Unfall gewesen, wenngleich ungeklärter Natur. Als das zweite verschwand, meinten dieselben Leute, wir hätten einfach fürchterliches Pech. Und jetzt ein drittes?
Jemand hat sich aus der Gruppe an der Mauer gelöst und kommt auf mich zu. Es ist diese junge Polizistin, die, die niemand ernst nimmt, weil sie so wahnsinnig jung und so wahnsinnig groß ist und weil sie sich anscheinend nicht rühren kann, ohne irgendetwas umzuschmeißen. Constable Skye McNair ist einer von den Menschen, von denen andere behaupten, sie würden sie gern mögen, weil sie ihnen leidtut und weil sie als mitfühlend gelten möchten. Ich habe niemandem etwas zu beweisen, also gebe ich zu, dass mich ihre Ungeschicklichkeit nervt.
Als ich sie jetzt kommen sehe, geht mir zum ersten Mal durch den Kopf, dass sie unheimlich lebendig aussieht. Ihr Haar, lang und drahtig und von exakt der Farbe frisch gekochter Orangenmarmelade, fliegt ihr um den Kopf, und ihr im Mondlicht papierblasses Gesicht verrät mir, dass sie angespannt und ziemlich aufgeregt ist. Ein paar Zentimeter um sie herum scheint die Nacht nicht ganz so dunkel zu sein.
»Catrin, entschuldigen Sie.« Sie ist viel größer als ich, beugt sich zu mir hin und biegt sich dann ein wenig zurück, als hätte sie Angst, mich zu bedrängen. »Ich muss wissen, ob Sie heute Nacht da draußen noch jemand anderes gesehen haben? Irgendwelche Boote, die Sie nicht kannten?«
Ich sage Nein. Mehrere große kommerzielle Fischkutter haben den Hafen ungefähr zur selben Zeit verlassen wie ich, aber die kannte ich alle. Viele Inselbewohner fischen nachts, aber normalerweise in kleineren Booten, dicht an der Küste.
»Es tut mir leid, das ist bestimmt sehr schwer.« Skye weiß anscheinend nie, was sie mit ihren Händen machen soll. Im Augenblick wedelt sie damit herum. »Ich weiß ja, es ist fast genau die Zeit …«
Vor drei Jahren war Skye noch nicht da. Sie war in England auf der Polizeischule. Und doch weiß sie, dass sich in zwei Tagen der Tag jährt, an dem mir mein Leben verloren gegangen ist.
»Was ist passiert, Skye?« Ich schaue kurz zu Ralph hinüber, der Queenie streichelt. »Irgendwas von wegen einem vermissten Kind?« Ich sage nicht nocheinem vermissten Kind. Das ist wohl nicht nötig.
»Eine von den Touristenfamilien.« Sie blickt sich nach der Menschenmenge hinter uns um. »Nicht vom Kreuzfahrtschiff. Sie sind selbst angereist, haben in einem von den Gästehäusern in der Stadt gewohnt. Mittags haben sie in der Nähe von Estancia gepicknickt. Die Kinder haben im Gras gespielt. Sie haben den Jüngsten aus den Augen verloren.«
Estancia ist eine Farmsiedlung, ungefähr dreißig Kilometer entfernt, an der südöstlichen Spitze einer großen Bucht.
»Er ist erst drei.« Skye sieht aus, als würde sie gleich losheulen.
Drei Jahre alt. Die beiden Kinder, die davor verschwunden sind, waren älter, aber nicht viel. Beides Jungen. Ein dreijähriges Kind, stundenlang von seiner Familie getrennt, ganz allein, mitten in der Nacht. Bestimmt friert er, hat Hunger und schreckliche Angst. Ist verlassen zu werden nicht die größte Furcht kleiner Kinder? Auf dieser Insel wird er sich nachts vorkommen, als sei er von der ganzen Welt verlassen worden.
»Wurde schon gesucht?«
Skyes Gesicht zuckt ein wenig, als sie sich zusammenreißt. »Wir hatten den ganzen Tag Leute da draußen im Einsatz. Und ein paar sind auch noch mal hingefahren. Callum Murray zum Beispiel. Er ist mit ein paar Männern aus den Kasernen losgezogen. Wir warten darauf, von ihnen zu hören.«
»Ist das da die Familie?« Ohne mir wirklich Mühe zu geben, erkenne ich die Mutter, eine rundliche, dunkelhaarige Frau von Ende dreißig. Ihr ganzer Körper wirkt wie nach innen zusammengeballt, als hätte sie Angst, sie würde in Stücke gehen, wenn sie loslässt. Wenn ich näher herangehen würde, wäre jegliches Fleisch, das dort vielleicht einmal gewesen ist, aus ihrem Gesicht verschwunden, sodass nur noch über Knochen gespannte Haut zurückgeblieben sein wird, das weiß ich. Ihre Augen werden aussehen wie tot. Sie wird so aussehen wie ich.
Nur dass dort, wo es darauf ankommt, Welten zwischen uns liegen. Sie hat noch Hoffnung.
»Das ist die Familie.« Jetzt steht Skye anscheinend auf einem Bein. »Die Wests. Das Ganze wird echt schwierig, jetzt sind da auch noch Leute von dem Kreuzfahrtschiff zugange, und, na ja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber die sind nicht gerade eine Hilfe. Anscheinend finden sie, wir sollten Häuser und Grundstücke zwangsdurchsuchen. Die wollen, dass wir ein Auslaufverbot für sämtliche Boote im Hafen verhängen, ab sofort. Können Sie sich vorstellen, was uns die Fischer erzählen, wenn wir sagen, sie können morgen früh nicht rausfahren?«
»Ich bezweifle, dass viele auf euch hören werden.« Autorität wird hier toleriert, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
»Und die Angehörigen sind doch schon aufgelöst genug. Das Letzte, was die brauchen, ist, dass ihnen die Leute alle möglichen verrückten Ideen in den Kopf setzen.«
Ich bin versucht zu erwidern, dass die verrückten Ideen in Anbetracht unserer jüngsten Vergangenheit in Sachen vermisste Kinder wohl schon präsent sein dürften.
»Das ist alles ganz furchtbar.« Während Skye weiterredet und ich so tue, als würde ich zuhören, gehen wir auf mein Auto zu. »Seit neun Uhr sind wir zu fünf Vorfällen gerufen worden. Chief Superintendent Stopford versucht, die Kreuzfahrer alle wieder auf das Schiff zu schicken, aber die wollen nicht gehen, bevor der Kleine gefunden worden ist. Das wird eine schlimme Nacht.«
Da ich weiß, dass es von mir erwartet wird, murmele ich halblaut, sie solle mir Bescheid sagen, wenn ich irgendetwas tun kann, und verdrücke mich. Queenie springt ins Auto, und ich mache mich auf den Weg zu meinem Haus auf der Westseite der Halbinsel Cape Pembroke, eine winzige Landspitze zwischen dem Doppelhafen von Stanley und dem Ozean.
Ich denke nicht an das vermisste Kind. Oder vielmehr, ich denke schon daran, aber nur insoweit, wie es mich betrifft. Wenn für alle Boote ein Auslaufverbot verhängt wird, wenn sie durchsucht werden, macht das meine Pläne zunichte. Noch zweieinhalb Tage. Ungefähr sechzig Stunden. Bis dahin muss der Junge gefunden sein.
Ich nehme nicht den kürzesten Weg nach Hause. In manchen Nächten, für gewöhnlich wenn der schwarze Nebel in meinem Kopf die Oberhand gewinnt, scheint mich irgendetwas zum Haus der Grimwoods hinauszulotsen. Immer nur nachts, wenn die Chance, die Familie zu Gesicht zu bekommen, fast gleich null ist, zieht mich irgendetwas dorthin. Heute Nacht fahre ich um die östliche Spitze von Stanleys Naturhafen herum auf das große Haus mit dem pfauenblauen Dach zu, das nach Osten über die Surf Bay hinausblickt. Ich werde langsamer, als ich um die letzte Kurve komme und die weiß getünchten Mauern sehen kann, die schwarzen Fenster, die niedrige Ginsterhecke, jetzt prallvoll mit gelben Blüten. Zu beiden Seiten des niedrigen hölzernen Gartentors steht eine Kürbislaterne, und in den kunstvollen, akkuraten Schnitzereien erkenne ich das Werk des Großvaters der Kinder. Früher hat er auch für meine Familie Kürbisse geschnitzt.
Jemand ist wach. Ich kann Licht in einem der oberen Fenster sehen. Peters Zimmer. Ich habe Peter, das jüngste Kind der Grimwoods, noch nie gesehen. Die letzten zweieinhalb Jahre hat er in meinem Kopf gelebt. Ich sehe ihn als dünnen, blonden kleinen Jungen vor mir, mit ovalem Gesicht, wie seine Brüder im selben Alter. Außerdem wird er wie sie die leuchtend blauen Augen seiner Mutter haben.
Ich war seit Jahren nicht mehr in dem Haus, schon vor Peters Geburt nicht mehr; aber ich kenne Rachels Haus so gut wie mein eigenes. Peter ist wach, mitten in der Nacht, und Rachel wird bei ihm sein, wird ihren Körper schützend um seinen schmiegen und ihn sanft in den Schlaf wiegen. Sie wird den Geruch seines Haarschopfs einatmen, wird spüren, wie er an ihrer Brust zittert, und ihre Macht genießen, seine Ängste zu vertreiben.
In diesem Augenblick hasse ich sie so sehr, dass ich nur noch aufs Gaspedal treten und weiterfahren kann.
Ja, denke ich. Rachel zu töten wird mir leichtfallen.
3
Ich stoße die Tür meines Hauses auf und spüre sofort die Abweichung von der Norm. Irgendetwas ist hier – ein Geruch, das Echo eines Kicherns, eine minimale Veränderung der Atmosphäre. Winzige Anzeichen, aber unmissverständlich. Sie sind wieder da.
Leise schließe ich die Tür hinter mir und sehe mich um. Keine leuchtenden Augen in der Dunkelheit. Keine scharrenden Bewegungen, mit denen sich kleine Gestalten tiefer in den Schatten drücken. Ich drehe langsam eine Runde durch das altmodisch eingerichtete Zimmer und trete auf den Flur hinaus. Dabei bin ich zugleich wachsam und begierig. Es ist ein sonderbarer Hunger, dieses Bedürfnis, die Toten zu sehen.
In den drei Jahren seit dem Tod der Jungen haben sie mich immer wieder heimgesucht. Meine ich das wörtlich? Ich weiß es nicht genau. Ich bin Wissenschaftlerin, würde eher an Aliens glauben als an Geister, aber nach dem Unfall wurde ihre Anwesenheit im Haus binnen Tagen realer, zwingender als die meines Mannes oder irgendeines jener wohlmeinenden Mitmenschen, die gelegentlich auftauchten.
Die lebendigen Menschen gingen fort, aber die Jungen blieben, trieben immer wieder in mein Leben hinein und wieder heraus, mit der Zuverlässigkeit der Gezeiten, wenn auch nicht mit derselben Regelmäßigkeit. Immer dann, wenn ich es am wenigsten erwarte, sehe ich ihre Schatten hinter den Vorhängen, die Wölbung ihrer Körper unter den Decken auf den Betten, die ich immer noch nicht abziehen kann. Ihre Stimmen, manchmal kichernd und geheimnistuerisch, ziemlich oft zankend, vermischen sich mit den Geräuschen aus dem Fernseher oder dem Radio. Ich fange einen Hauch ihres Geruchs auf. Jenen ganz besonderen erdigen Apfelgeruch, den Kits Haar einen Tag oder so nach dem Waschen annahm. Den ätzenden Mief von Neds Turnschuhen, wenn der Schuhschrank offen stand.
Sie sitzen nicht unten auf der Treppe oder hocken auf dem Sofa und starren den Fernseher an. Gut so, ich kann es nicht ausstehen, wenn sie das tun. Ich steige die Treppe hinauf. Das Treppengatter, das wir nie abgebaut haben, ist zu. War ich das? Warum sollte ich es zugemacht haben? Und doch kommt es selten vor, dass ich den Jungen zutraue, Einfluss auf ihre physische Umwelt nehmen zu können. Vielleicht ist hin und wieder ein Spielzeug verschoben worden. Ist eine Delle in einem der Betten zu sehen. Für beides könnte natürlich auch mein Hund verantwortlich sein.
Queenie steht unten in der Küche vor der Hintertür und winselt, wie immer, wenn die Jungen da sind. Ich habe keine Ahnung, ob sie ihre Anwesenheit auch spürt oder ob sie es einfach hasst, mich in dieser Stimmung zu sehen, aber ihre Besuche machen ihr Angst. Das ist schade, sie hat sie nämlich auch geliebt, aber Haustiere sind wohl keine Mütter.
Ich bin mir sicher, dass ich sie in Neds Zimmer finden werde, aneinandergekuschelt wie ein Paar Welpen, aber die Gestalt, die ich erblicke, als ich die Tür aufmache, ist nur ein großer Teddy, der bäuchlings auf Neds Bett lieg. In Kits Zimmer sind sie auch nicht. Jetzt gehe ich schneller; ich ermahne mich, es ruhig angehen zu lassen, verspüre aber die normale Panik einer Mutter, die ihre Kinder nicht findet. Auch wenn es ihre toten Kinder sind. Mein Schlafzimmer ist leer. Oder scheint leer zu sein.
Sie verstecken sich.
Ich wünschte, sie würden das lassen, aber Verstecken war eins ihrer Lieblingsspiele, als sie noch am Leben waren, und manchmal spielen sie das immer noch mit mir. Wieder mache ich mich daran, das Haus abzusuchen, diesmal richtig, und die ganze Zeit über wird die Gewitterwolke in meinem Kopf immer dichter und dichter. Ich öffne Schranktüren, ziehe Duschvorhänge zurück, schaue unter das Bett im Gästezimmer. Wenn ich ehrlich sein soll, hat dieses Spiel mir schon immer zugesetzt, selbst als ich wusste, dass ich am Ende der Suche zwei warme, starke Körper finden würde.
Ich bin wieder unten. Sie können nur draußen sein. Ich mache die Hintertür auf, und der Wind kommt hereingefegt, als hätte er nur darauf gewartet.
Sie sind nicht dort draußen. Ich kann spüren, wie sie davonschlüpfen. Zwei Laute sind durch den Wind hindurch zu hören, beide ein Aufstöhnen tiefster Traurigkeit. Eins von Queenie und eins von mir.
»Ned! Kit!«
Sie sind weg. Genauso, wie ich mir vorhin sicher war, dass sie da waren, bin ich mir jetzt ihrer Abwesenheit gewiss.
In meinem Kopf ist jetzt nur noch sehr wenig Licht übrig. Ich bin wieder oben, in dem kleinen Raum, der an mein Schlafzimmer grenzt und den ich als Arbeitszimmer benutze. Knie neben meinem Schreibtisch und hantiere mit der Schublade herum, die ich immer abschließe. Ich finde, wonach ich suche; ich sorge dafür, dass es stets scharf ist.
Unten fängt Queenie an zu heulen.
Einige Zeit später lichtet sich der Nebel. Mühsam stemme ich mich vom Teppich hoch und in den Schreibtischstuhl. Meine linke Hand blutet. Ich lege die Harpunenspitze wieder in die Schublade. Das Foto von Rachel zu meinen Füßen ist zu einer zerrissenen, zerfransten Fetzenmasse zerstochen und zerschnitten.
Ich bücke mich und werfe die Fetzen in den Papierkorb. Ich habe noch mehr Kopien von demselben Foto. Fürs nächste Mal.
Ich bin so müde, dass ich kaum noch denken kann; ich muss unbedingt duschen und schlafen, aber irgendetwas hält mich hier fest, lässt mich meine verletzte Hand umklammern und die Wand anstarren. Den Rest des Hauses habe ich weitgehend so gelassen, wie es war, als die Jungen noch gelebt haben und Ben noch hier gewohnt hat; dieses kleine Arbeitszimmer jedoch ist im Laufe der letzten drei Jahre zu dem Raum geworden, in dem ich mich gehen lassen kann.
Überall an den Wänden hängen Fotos von Ned und Kit, manche gerahmt, die meisten einfach mit Reißzwecken angepinnt. Die Bilder, die sie in der Schule gemalt haben, sind auch hier. Kleine Urkunden aus dem Unterricht, sogar ein paar Babysachen, die ich behalten habe, das alles hängt als düstere Andenken-Montage an der Wand.
»Mein Gott, Catrin«, sagte Ben, als er noch einmal vorbeikam, um irgendetwas vom Dachboden zu holen. »Das ist kein Arbeitszimmer, das ist ein Schrein.«
An der Wand hinter mir jedoch hängt etwas anderes. Hier sind Fotos von zwei anderen kleinen Jungen, zwei dunkelhaarigen, dunkeläugigen Jungen, die verloren gegangen sind – ganz plötzlich und auf mysteriöse Art und Weise. Der Erste, Fred Harper, ist während des Sportfestes auf West Falkland verschwunden, vor etwas über zwei Jahren, als meine Trauer noch frisch war, wund und nässend wie ein offenes Geschwür. Er war fünf Jahre alt.
Natürlich hatte ich von seinem Verschwinden gehört. Das Radio war tagelang voll davon gewesen, und Ben, der als Teil des medizinischen Betreuungsteams auf der Insel gewesen war, hatte sich an der Suchaktion beteiligt. Als ich die Geschichte in den Penguin News sah, begleitet von einem großen Porträtfoto von Fred, machte mein Herz einen Satz. Fred sah Kit so wahnsinnig ähnlich. Instinktiv schnitt ich das Foto aus, versteckte es und pinnte es schließlich an die Wand, zusammen mit allem anderen, was in den nächsten Wochen über ihn in der Zeitung erschien.
Vielleicht behielt ich die Artikel als eine Art Test meiner Menschlichkeit. Wenn Fred gefunden würde und ich mich freute, dann wäre das ein Zeichen, dass es noch Hoffnung für mich gab.
Und dann, vor etwa anderthalb Jahren, verloren die Inseln noch einen kleinen Jungen. Der siebenjährige Jim Brown war zuletzt in der Surf Bay gesehen worden, wo Rachel wohnt. Ich kannte die Familie Brown einigermaßen gut; ich war mit Gemma, der Mutter, befreundet gewesen, deren Tochter – Jimmys kleine Schwester – mit Kit in eine Klasse gegangen war. Ben kannte den Vater, er arbeitete im Krankenhaus als Laborant.
Als Jimmy verschwand, als die ganze Stadt tage- und nächtelang nach ihm suchte, während seine Familie immer tiefer in einer Art hektischer Verzweiflung versank, sagte mehr als einer zu mir, ich hätte wenigstens Gewissheit. Ich wüsste, was mit meinen Söhnen geschehen war, ich hätte sie begraben, angemessen um sie trauern können. Ein Privileg, das den Familien der Vermissten verwehrt sei.
»Ja, vielen Dank«, sagte ich zu einer Frau. »Ich bin wirklich froh, dass ich so viel Glück hatte.«
Seitdem hat sie nicht mehr mit mir geredet.
Unter den Fotos von Fred und Jimmy hängt ein anderer Zeitungsausschnitt, der nicht direkt mit den Jungen zu tun hat, der mich aber damals berührt hatte. Ein paar Monate, nachdem Jimmy verschwunden war, als die Suche noch andauerte – wenngleich in kleinerem Rahmen und ohne echte Hoffnung –, schrieb der Chefredakteur der Penguin News einen Artikel über die Auswirkung, die vermisste Kinder auf eine Gemeinschaft haben, besonders auf eine kleine. Er sprach von einem kollektiven Gefühl der Schande, von dem Glauben, dass für Kinder alle verantwortlich sind und dass es auf uns alle zurückfällt, wenn eins von ihnen zu Schaden kommt.
Der Artikel war nicht in Bezug auf meine Söhne geschrieben worden, aber ich fand trotzdem ein wenig Trost darin. Er ließ mich begreifen, dass Ben und ich und unser engster Kreis die Auswirkungen des Todes der Jungen nicht allein empfanden. Dass unser Schmerz auf gewisse Weise ein kleines bisschen geteilt wurde.
Der Verfasser, ausgerechnet Rachels Vater, hatte sich weiter darüber ausgelassen, wie verschiedene Kulturen mit vermissten Kindern umgehen. Er schrieb darüber, wie ihr Verschwinden rasch in der lokalen Folklore aufginge, wie sie zuerst als geisterhafte Erscheinungen und dann später in der mündlich überlieferten Tradition des Geschichtenerzählens auftauchten. Vermisste Kinder, führte er an, stehen hinter sämtlichen Märchen, in denen Kinder von Feen geraubt oder von Trollen und Hexen gefressen werden. Wir verarbeiten unsere Scham, indem wir sie auslagern. Indem wir übernatürlichen Mächten die Schuld geben.
Er hatte alte Legenden über Kinder ausgegraben, die hier auf den Inseln umgekommen waren, und sie mit realen ungeklärten Todes- und Vermisstenfällen in Verbindung gebracht. In fünfzig Jahren, behauptete er, würden Fred und Jimmy den Weg in die Mythologie der Falklands gefunden haben.
Ned, Kit, Fred und Jimmy. Meine kleine Sammlung toter Jungen. Wird es jetzt noch einen fünften geben, wird unsere kollektive Schande noch größer werden?
Ich beuge mich über den Schreibtisch und schalte das Radio an. Der Lokalsender ist heute länger auf Sendung als sonst. Das vermisste Kind heißt Archie West, erfahre ich. Er ist drei Jahre und zwei Monate alt. Nur ein klein wenig älter als Rachels Jüngster.
Nein, denk nicht an Rachel, nicht jetzt.
»Nur zur Erinnerung«, sagt der Sprecher, auch als Bill der Fischhändler bekannt, »Archie hat blonde Locken und braune Augen und ist kräftig gebaut. Als er das letzte Mal gesehen wurde, trug er ein Arsenal-Trikot, rot mit weißen Ärmeln, weiße Shorts und rote Stutzen. Wenn Sie glauben, ihn gesehen zu haben, melden Sie sich bitte sofort bei der Polizei. Okay, hier ist der Falklands Islands Broadcasting Service, und Bill Krill führt Sie die nächsten Stunden durch die Sendung. Es ist ein Uhr dreiundvierzig, und nicht vergessen, morgen früh – oder ich sollte wohl sagen, später am heutigen Tage – haben wir Ray Green von der Astronomy Society hier, der uns alles über die Sonnenfinsternis am kommenden Donnerstag erzählen wird: Wo man sie am besten beobachten kann, wie man Schäden an den Augen vermeidet und wie dunkel es auf den Inseln denn nun eigentlich werden wird.«
Blonde Locken und kräftig gebaut. In meiner kleinen Bildergalerie wird er auffallen. Meine vier verlorenen Jungen sind dünn und dunkel, wie so viele Inselbewohner.
Ich mache das Licht aus, gehe zum Fenster und blicke nach Westen.
»Bei mir hier im Studio ist Sally Hoskins«, verkündet Bill. »Eine Freundin der Familie; gerade hat sie uns erzählt, dass Archie ein lebhaftes, neugieriges Kind ist. Nicht wahr, Sally?«
Natürlich ist es für mich unmöglich, die Suchmannschaft auszumachen. Sie sind fast dreißig Kilometer weit weg, und es sind Berge dazwischen.
»Ja, Bill, das stimmt. Archie ist ein reizender Junge. Sehr fröhlich, hat nichts als Unsinn im Kopf. Er spielt gern Verstecken.«
Unten am Hafen sind weniger Lichter zu sehen. Bestimmt hat Skye die Passagiere doch noch überredet, auf das Kreuzfahrtschiff zurückzukehren.
»Und deswegen hat sich die Familie zuerst auch keine Sorgen gemacht?«
»Genau. Wir haben einfach gedacht, er versteckt sich. Das kann er stundenlang durchhalten.«
Ich kann gerade eben noch den Mount Tumbledown erkennen. Die Suche wird dahinter stattfinden.
»Wir haben alle über zwei Stunden nach ihm gesucht, bevor wir die Polizei verständigt haben.« Sallys Stimme stockt erneut. »Archies Eltern haben mich gebeten, allen für ihre Hilfe heute Nacht zu danken. Die Leute waren so toll. Haben suchen geholfen, haben ihre Häuser und Gärten abgesucht. Ich möchte einfach nur sagen: Bitte suchen Sie weiter. Und wenn Sie wissen, wo er ist, bitte tun Sie das Richtige. Bitte lassen Sie ihn zu seiner Familie heimkommen.«
»Sally, warum erzählen Sie uns nicht ein bisschen mehr über Archie?«, geht Bill rasch dazwischen. »Wir wissen, dass er gern Verstecken spielt. Was mag er denn sonst noch?«
»Ach, wissen Sie, Bill, er ist ein Riesenfan von Arsenal, wie eigentlich alle in seiner Familie. Er macht gerade so eine Phase durch, wo er nichts anderes anziehen will als seine Arsenal-Fußballsachen, und seine arme Mum muss die jeden Abend waschen, damit er sie am nächsten Tag wieder anziehen kann. Er kennt alle Fangesänge, und … also, ein paar von denen sind wirklich nicht für Dreijährige geeignet, aber was soll man machen?«
Ich höre nur halb zu, während Sally fortfährt, uns Archies Vorliebe für Popmusik zu schildern. Anscheinend kann er gar nicht still sitzen, wenn das Radio läuft. Und dass er nie eine Folge von »Power Rangers« versäumt.
»Und wenn jemand Archie bei sich hat, bitte tun Sie ihm nicht weh oder machen Sie ihm nicht irgendwie Angst«, sagt sie jetzt. »Wenn irgendjemand Archie entführt hat: Wir wollen ihn doch bloß wiederhaben. Bitte sagen Sie uns, wo wir ihn finden können. Bitte tun Sie ihm nichts.«
»Ja, okay. Also, vielen Dank, Sally. Aber ich denke, es lohnt sich, nur zur Erinnerung zu erwähnen, dass die Polizei davon ausgeht, dass der kleine Archie sich lediglich verlaufen hat. Darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren, Leute. Ein kleiner Junge ist ganz allein losgezogen, und wir müssen ihn finden. Okay, hier ist Bill Krill, und Sie hören den Falklands Islands Broadcasting Service.«
»Herrgott noch mal, wie seid ihr denn drauf hier?« Sallys Stimme fährt heftig vor die Eröffnungstakte des nächsten Liedes. »Wie viele Kinder müssen noch verschwinden, bevor ihr …«
Sallys Stimme verstummt. Sie haben das Mikrofon abgeschaltet. Die Musik wird lauter: Der Reggae-Song, den wir gerade gehört haben, ist Archies Lieblingslied. Ich stelle mir vor, wie Sally sanft, aber bestimmt aus dem Hinterzimmer der Lokalzeitungsredaktion gelotst wird, wo der Radiosender ansässig ist. Eine andere Kultur, sage ich mir. Wenn in England ein Kind verschwindet, besteht die Standardreaktion darin, in Pädophilen-Panik zu geraten. Hier hoffen wir, dass der Kleine nicht in eine Seelöwenkolonie hineingetappt ist.
Drei verschwundene Kinder in zwei Jahren. Ganz schön viele, um sie den Seelöwen anzukreiden.
Ich höre ein leises Seufzen, das mir verrät, dass Queenie es für ungefährlich gehalten hat zurückzukommen. Sie springt auf mein Bett und kuschelt sich in die Kuhle zwischen den Kopfkissen. Ich mache das Radio aus und schalte den Computer an. Als er hochgefahren ist, schreibe ich die Notizen dieses Abends nieder und klicke dann auf das einzige Dokument, das ich mit einem Passwort schütze.
Bevor die Jungen ums Leben gekommen sind, habe ich nie Tagebuch geschrieben. Ich hatte nie das Bedürfnis, und mit einem Mann, zwei kleinen Kindern und einem Job, wo hätte ich die Zeit dafür hernehmen sollen? Mein Leben war zu voll, als dass es nötig gewesen wäre, es zu dokumentieren. Jetzt, mit leerem Herzen und einem bedeutungslosen Leben, ist es, als bräuchte ich diese regelmäßigen Berichte über mein Kommen und Gehen, meine Gedankengänge und meine emotionalen Jahreszeiten, um mich daran zu erinnern, dass ich noch existiere.
Ich beginne zu schreiben. Dabei schildere ich die Ereignisse des Tages immer in allen Einzelheiten, nicht weil ich echtes Interesse daran habe, mich daran zu erinnern, was ich bei der Arbeit tue, sondern weil das, was ich tue, mir dabei hilft zu ordnen, was ich empfinde. Es ist von allen mir möglichen Dingen das, was für mich einer Therapie am nächsten kommt, dieses tägliche Ausgießen von Elend und Wut. Hauptsächlich Wut, wenn ich ehrlich bin, die sich ausnahmslos gegen die Frau richtet, deren Fotografie zerfetzt im Papierkorb liegt. Die Frau, die früher meine beste Freundin war.
Ich war acht, als ich Rachel kennenlernte, und sie ein paar Monate jünger. Damals lief ich gerade einen Pfad entlang, der gerade eben breit genug war, dass ein Kind sich dort hindurchquetschen konnte, so dicht wucherte das Tussockgras. Plötzlich stieß ich auf ein kleines, mit Schmetterlingen verziertes Hinterteil, das sich himmelwärts reckte. Bestimmt hatte sie mich gehört, obwohl ich mich sehr leise bewegte, denn ohne sich umzudrehen, hob sie eine schmutzige Hand mit abgekauten Fingernägeln. Es war eine so gebieterische Geste, dass sie sofort das achtjährige Teufelchen in mir weckte.
»Was machst du denn da?«
Sie krabbelte rückwärts, bis ich ein kleines rundes Gesicht sehen konnte, mit großen blauen Augen, heller, sommersprossenfreier Haut und sehr langem Haar, dass ein klein wenig zu dunkel war, um blond zu sein. Ihre Augenbrauen schienen sich in der Mitte emporzuwölben, als wäre sie ständig verblüfft, und ihre Ohren standen vom Kopf ab wie die eines Elben.
»Dracheneier«, zischte sie mich an. »Kein Wort mehr!«
Verwirrt ließ ich mich in den Sand fallen und kroch neben sie. Sie starrte zwei cremegelbe Objekte an, jedes ein vollendetes Oval, ungefähr zehn Zentimeter lang. Das Nest eines Eselspinguins.
»Die gehören Ozmadschian.« Anscheinend war sie fest entschlossen, ganz leise zu zischeln, obwohl wir die einzigen beiden Menschen im Umkreis von einem Kilometer waren. »Einem sehr mächtigen Drachen. Sie ist geboren worden, als das tausendste Herz gebrochen wurde, also ist sie sehr alt, aber Drachengedächtnisse sind auch nicht so wie unsere.«
Mit acht Jahren wusste ich, dass Eselspinguine oft im Strandgras nisten, dass die Mutter ihr Nest normalerweise nicht so lange allein lassen würde und dass sie sich wahrscheinlich wegen uns beiden nicht herwagte. Ich wusste, ich hätte eigentlich sagen sollen, dass wir weitergehen sollten, aber ich gebe es zu, das mit dem Drachen hatte mich neugierig gemacht.
»Echt nicht?« Ich schlug denselben gedämpften, geheimnistuerischen Ton an wie sie.
Sie schob sich näher heran, drängte sich mit der vollkommenen Unbefangenheit kleiner Kinder an meinen Körper. »Nein, Drachen können sich an alles erinnern, was vorher war, was jetzt passiert und was jemals noch kommen wird.«
Also, das gab mir zu denken. »Wir sollten wohl lieber gehen«, meinte ich. »Sie kann doch jeden Moment zurückkommen.«
»Oh, sie kommt nicht zurück. Die Eier bleiben hier, bis drei Monde zu- und wieder abgenommen haben. Dann tragen die schwarzen Adler mit den Saphiraugen sie davon und bewachen sie, bis die Zeit zum Schlüpfen gekommen ist. Das könnte morgen sein. Es könnte auch im nächsten Jahrtausend sein.«
Mit acht konnte ich damals fast vierzig verschiedene Vogelarten unterscheiden, die auf den Falklands nisten, der schwarze Adler mit den Saphiraugen jedoch war mir neu. Inzwischen frischte der Wind auf, trug Salzgeruch heran, und ich machte mir allmählich große Sorgen wegen der Pinguinmutter. Wenn Muttertiere zu sehr unter Stress geraten, kann es sein, dass sie ihr Nest im Stich lassen.
»Der nächste Neumond ist in fünf Nächten.« Ich wusste immer schon genau, was der Mond gerade tat, sogar als Kind. »Bis dahin bleiben sie hier. Wenn du willst, kann ich ja wiederkommen und nachschauen.«
Sie hockte sich auf die Fersen und betrachtete mich mit neuem Respekt. Plötzlich beneidete ich sie geradezu schmerzhaft um diese glänzenden blauen Augen. Es erschien mir nicht fair, dass jemand (ich) Augen haben sollte so düster wie Gewitterwolken, und die von jemand anderem (Rachel) von so verträumtem Azurblau sein sollten wie das Meer an einem Sommermorgen.
»Wir kommen zusammen her«, verkündete sie. »Wo wir doch jetzt beste Freundinnen sind.«
Ich war mir nicht ganz im Klaren darüber, wie das gehen sollte; ich wusste nicht einmal, was sie hier machte – die Insel, auf der wir uns befanden, gehörte meiner Tante und meinem Onkel. Aber gegen die Idee, eine beste Freundin zu haben, hatte ich nichts einzuwenden. »Okay«, sagte ich.
»Ist das dein Haus?« Sie war aufgesprungen und zeigte auf das grüne Blechdach von Tante Janeys Farmhaus. Ich nickte, denn im Grunde genommen stimmte das. Ich wohnte den Sommer über dort, während meine Eltern arbeiteten.
»Habt ihr Eiscreme?«
Wieder nickte ich. Tante Janey sorgte immer dafür, dass sie alles auf Lager hatte, bevor ich kam.
»Dann komm.« Sie ergriff meine Hand, und wir rannten – sie war unglaublich flink auf den Beinen – durch das Gras, über die Koppel und auf den Hof der Farm.
Und das war’s. Von diesem Tag an waren Rachel und ich beste Freundinnen, brauchten einander mit einer leidenschaftlichen Innigkeit, die ich seither wohl nie wieder in einer Beziehung gefunden habe, glaube ich. Wir hätten unterschiedlicher nicht sein können. Sie sah ineinandergeschachtelte Welten, durch Regenbögen aus endlosen Möglichkeiten miteinander verbunden. Ich sah Pinguineier. Und doch standen wir uns näher als Schwestern, denn diese Verbindung zwischen uns war eine, die wir selbst gewählt hatten. Näher als Liebende, denn Liebhaber kommen und gehen, und das, was wir hatten, war für immer. Sie war meine andere Hälfte. Der Sonnenschein auf den Felsen meiner schattigen Nische unter einem Baum. Der Dur-Ton unter meinen Moll-Akkorden. Sie war alles, was ich nicht war, und alles, was ich zu sein ersehnte, nur waren all diese Eigenschaften in ihr so viel besser, und das wusste ich. Sie und ich waren unzertrennlich, ganz gleich, wie groß die Entfernung zwischen uns war. Wir waren die Vergangenheit, das Jetzt und das Immer.
Bis zu dem Tag, als sie meine Söhne umbrachte.
Es ist fast vier Uhr morgens. Ich habe geschrieben, gedacht und nichts von beidem getan, und das sehr lange. Jetzt mache ich den Computer aus und gehe ins Schlafzimmer hinüber, um mich zu Queenie zu gesellen, als ich draußen ein Geräusch höre.
Dieses Geräusch kann ich nicht einfach ignorieren, kann nicht so tun, als sei es bloß das Wetter.
Genau kann ich nicht sagen, wann es angefangen hat. Es könnte schon Jahre so gehen, vielleicht ist es auch erst seit den letzten paar Monaten so – aber mehr als einmal, wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, habe ich spätabends etwas gehört, das mich überlegen lässt, ob jemand draußen vor meinem Haus ist. Ich habe Bewegungen gehört, die nicht mit der Natur in Einklang zu stehen scheinen, ein Scharren, das von Schritten herrühren könnte. Ein paar Mal hat sich Queenie ziemlich aufgeregt, wollte unbedingt hinaus und verharrte dann doch nervös in der Tür, wenn ich sie aufmachte. Vor einigen Monaten, als die Abende dunkler waren, hatte ich das Gefühl, dass da draußen in der Finsternis Augen waren, die mich ansahen, bevor ich die Vorhänge zuzog.
Auf den Inseln schließt niemand seine Haustür ab, aber ich habe damit angefangen und bin jetzt froh darüber, denn das, was ich gehört habe, lässt wenig Raum für Zweifel. Da draußen ist jemand. Ich verlasse das Schlafzimmer, und Queenie schnarcht weiter. Sie spielt viele Rollen in meinem Leben, Wachhund jedoch gehört nicht dazu.
Unten trete ich ans Fenster, ohne Licht anzumachen.
Selbst für Falkland-Verhältnisse ist das Gelände um mein Haus herum ungewöhnlich. Es ist ein Monument, ein Freiluftmuseum, wenn man so will. Ein Walfangmuseum. Den Ehrenplatz nimmt der Schädel eines Blauwals ein. Er steht auf dem Rasen vor der Haustür, fast drei Meter hoch, mit klaffendem Kiefer, als sei er mitten im Schlingen erstarrt. Das fast vollständig intakte Skelett eines Schwertwals liegt ganz in der Nähe. Drüben am Zaun liegt das Rückgrat eines Pottwals, den Grandpa vor der Küste von South Georgia erlegt hat. Zwischen ihm und dem Haus ist eine Schule Delfinskelette verteilt. Den größten Teil der Sammlung hat mein Großvater beschafft. Auch die Waffen haben Grandpa gehört: die Harpunen und Leinen, die mächtige Harpunenkanone. Für die Botschaft des Museums jedoch ist ganz und gar mein Vater verantwortlich. Er hat das alles nicht zusammengestellt, um den Walfang zu verherrlichen, sondern um ihn zu verdammen. »Über 2000 Wale wurden zwischen 1886 und 1902 mit dieser Kanone getötet« steht auf dem Schild unter der Harpunenkanone. Dad hat sich zutiefst für die Verheerungen geschämt, die seine Vorfahren auf See angerichtet hatten. Er hat sich sein ganzes Leben lang bemüht, das Gleichgewicht wiederherzustellen.
ENDE DER LESEPROBE