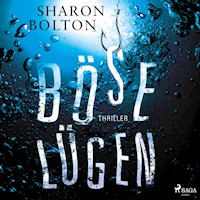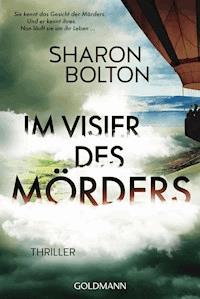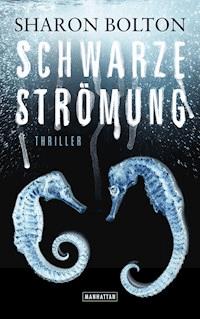
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lacey Flint
- Sprache: Deutsch
Man findet sie tot in den dunklen Fluten der Themse – junge Frauen in weiße Laken gehüllt, ermordet von einem mysteriösen Serienkiller ...
Lacey Flint weiß, dass die Themse ein gefährlicher Ort ist. Vielleicht hat sie sich den Fluss daher als Arbeitsplatz ausgesucht. Seit Kurzem arbeitet die einstige Ermittlerin für die »Marine Unit« der Londoner Polizei, und die dunklen Fluten lassen sie auch in der Freizeit nicht los. Bis sie beim illegalen Schwimmen in der Themse eine Tote entdeckt. Die junge Frau ist liebevoll in ein weißes Leichentuch gehüllt, und es scheint, als sollte sie von Lacey gefunden werden. Tatsächlich wird die unbekannte Tote nicht das einzige grausame Geschenk sein, das ein Serienkiller für Lacey hinterlässt. Irgendjemand beobachtet jeden ihrer Schritte. Und kennt sie besser, als ihr lieb sein kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Lacey Flint weiß, dass die Themse ein gefährlicher Ort ist. Vielleicht hat sie sich den Fluss daher als Arbeitsplatz ausgesucht. Seit Kurzem arbeitet die einstige Ermittlerin für die »Marine Unit« der Londoner Polizei, und die dunklen Fluten lassen sie auch in der Freizeit nicht los. Bis sie beim illegalen Schwimmen in der Themse eine Tote entdeckt. Die junge Frau ist liebevoll in ein weißes Leichentuch gehüllt, und es scheint, als sollte sie von Lacey gefunden werden. Tatsächlich wird die unbekannte Tote nicht das einzige grausame Geschenk sein, das ein Serienkiller für Lacey hinterlässt. Irgendjemand beobachtet jeden ihrer Schritte. Und kennt sie besser, als ihr lieb sein kann …
Autorin
Sharon Bolton wurde im englischen Lancashire geboren, hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaft studiert. »Todesopfer«, ihr erster Roman, wurde von Lesern und Presse begeistert gefeiert und machte die Autorin über Nacht zum neuen Star unter den britischen Spannungsautorinnen. Ihrem ersten Triumph folgten mittlerweile sieben weitere Thriller – darunter vier mit der grandiosen Ermittlerin Lacey Flint –, in denen Sharon Bolton ihr brillantes Können immer wieder unter Beweis stellte. Sie wurde bereits für zahlreiche Krimipreise nominiert und für »Schlangenhaus« mit dem Mary Higgins Clark Award ausgezeichnet sowie mit dem Dagger in the Library für ihr Gesamtwerk. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Oxford.
Von Sharon Bolton außerdem bei Goldmann lieferbar:
Todesopfer. Thriller
Schlangenhaus. Thriller
Bluternte. Thriller
Die Serie mit Lacey Flint:
Dunkle Gebete. Thriller
Dead End. Thriller
Ihr Blut so rein. Thriller
Sharon Bolton
SCHWARZE STRÖMUNG
Thriller
Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »A Dark and Twisted Tide« bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2015
Copyright © der Originalausgabe
2014 by S. J. Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Umschlaggestaltung und Konzeption:
Buxdesign | München, unter Verwendung von Motiven von
Plainpicture/NTB Scanpix; Gallery Stock/Lewis Mulatero
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15012-9V004
www.manhattan-verlag.de
Zum Andenken an Margaret Yorke, die meine Nachbarin war, meine Mentorin und meine Freundin
»Doch entsprechend dem Erfolg, mit dem man dies und jenes zusammensetzt, nimmt man eine Frau und einen Fisch auseinander oder setzt eine Seejungfrau zusammen. Und der Herr Inspector konnte nichts Besseres hervorbringen als eine Seejungfrau, an die kein Richter und kein Sachverständigenausschuss glauben würde.«
Charles Dickens, Unser gemeinsamer Freund
Prolog
Ich bin Lacey Flint, sagt sie sich, während der Morgen dämmert und sie erst einen und dann den anderen Arm hebt und dabei kräftig mit den Beinen schlägt. Beine, die dank starrer Taucherflossen länger und kräftiger sind als sonst. Mein Name ist Lacey Flint, wiederholt sie, denn dieses Identitätsmantra ist ebenso sehr Teil ihres täglichen Rituals wie das Schwimmen bei Tagesanbruch. Lacey, das ist weich und hübsch wie Spitze, und Flint, das ist kantig und hart wie Feuerstein. Manchmal findet Lacey den Kontrast lustig, der ihrem Namen innewohnt. Dann wieder gibt sie zu, dass er genau zu ihr passt.
Ich bin Constable Lacey Flint von der Londoner Flusspolizei, verkündet Lacey stumm ihrem Spiegelbild, während sie ihre makellose Uniform anzieht und sich auf den Weg zu ihrer neuen Dienststelle macht, dem Polizeirevier in Wapping. Dabei tröstet sie das Wissen, dass es sich zum ersten Mal seit vielen Monaten so anfühlt, als sei eine Polizistin genau das, was sie sein sollte.
Ich bin Lacey Flint, sagt sie sich in den meisten Nächten, wenn sie die Schotten ihres Hausbootes dicht macht und in die kleine Doppelkoje in der Bugkajüte kriecht. Dem Klatschen des Wassers am Bootsrumpf lauscht, und dem Scharren nächtlicher Wesen, die ihre Streifzüge antreten. Ich wohne auf dem Fluss, ich arbeite auf dem Fluss, und ich schwimme im Fluss.
Ich bin Lacey, und ich werde geliebt, denkt sie, als ein hochgewachsener Mann mit türkisblauen Augen wieder einmal ganz vorn in ihren Gedanken auftaucht.
»Ich bin Lacey Flint«, sagt sie manchmal halblaut vor sich hin, wenn sie in jene Welt des Was-wäre-wenn, des Könnte-sein und des Vielleicht-doch-noch hinübertreibt, die andere Menschen Schlaf nennen. Und sie fragt sich, ob wohl jemals ein Tag kommen wird, an dem sie vergisst, dass das alles eine gewaltige Lüge ist.
Samstag, 28. Juni
1Der Mörder
Das Hebewerk steht dicht an der Ufermauer der Themse in London, ganz nahe an der Grenze zwischen Rotherhithe und Deptford, wie eine Frau auf einem Ball, die es schon lange aufgegeben hat, auf einen Tanzpartner zu hoffen. Das kleine viereckige Gebäude ist von den Menschen, die jeden Tag zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto daran vorbeikommen, weitgehend vergessen worden, falls sie es überhaupt jemals bemerkt haben. Es war immer schon da, so wie die Straßen, die hohe Flussmauer, der Uferweg. Kein auffälliges Bauwerk, in keinerlei Hinsicht, und nie geschieht irgendetwas, das mit ihm in Verbindung gestanden hätte. Keine Waren werden vor den breiten Holztoren an der einen Seite des Gebäudes angeliefert, und ganz sicher kommt nichts heraus. Seine Fenster sind mit Holzplatten vernagelt. Gelegentlich bemerkt vielleicht jemand, der auf dem Uferweg eine Pause einlegt, dass das Mauerwerk schön gearbeitet ist, auf unaufdringliche Weise.
Vielen fällt das nicht auf. Das Dach liegt höher als das Blickfeld eines normalen Menschen, und auf der nächstgelegenen Straße fährt kein Bus. Der Verkehr auf dem Fluss zieht natürlich viel weiter unterhalb des Hebewerks vorüber. Deshalb nimmt nie jemand wahr, dass das Blassgrau des Gebäudes von einem Kreuzmuster aus weißen Backsteinen durchzogen ist und dass einheitlich geformte Steine diagonal darin eingearbeitet sind. Während der viktorianischen Epoche wurde alles verziert, und dieses unbedeutende Bauwerk war davon nicht ausgenommen, wenngleich nur wenige Menschen seinen ursprünglichen Zweck in vornehmer Gesellschaft angesprochen hätten. Das Hebewerk war gebaut worden, um Abwässer aus dem tiefer gelegenen Rotherhithe in die Themse zu pumpen. Früher hatte es eine wichtige Rolle dabei gespielt, die umliegenden Straßen sauber zu halten, aber größere, effizientere Pumpwerke wurden eingesetzt, und es kam der Tag, da es nicht mehr gebraucht wurde.
Wären Passanten neugierig genug gewesen, sich dort Zutritt zu verschaffen, hätten sie gesehen, dass das Innere des Gebäudes sehr viel größer ist, als sein Äußeres vermuten lässt, weil mindestens die Hälfte des Pumpwerks unter der Erde liegt. Die mit Brettern vernagelten Fenster und das große zweiflügelige Tor befinden sich hoch über dem Boden in den Wänden, in Höhe des zweiten Stockwerks. Um sie zu erreichen, muss man eine Eisentreppe hinaufsteigen und einen reich verzierten Laufgang entlanggehen, der um den ganzen Innenraum herum verläuft.
Sämtliche technischen Gerätschaften sind schon vor langer Zeit fortgeschafft worden, aber die Dekorationen sind noch da. Steinerne Säulen ragen zum Dach empor; ihre einst leuchtend rote Farbe ist zu Stumpfrot verblasst. Tudorrosen winden sich noch immer um ihre Kapitelle, wenngleich sie nicht mehr schneeweiß leuchten. Schimmel kriecht an dem glatten Mauerwerk hinauf, kann aber die gute Qualität der Backsteine nicht verbergen. Jeder, dem das Privileg zuteilwird, das Hebewerk von innen zu sehen, würde es als kleines architektonisches Schmuckstück betrachten, als etwas, das erhalten und wertgeschätzt werden sollte.
Das geht nicht. Seit Jahren ist das Hebewerk jetzt schon in privater Hand, und diese Hand hat kein Interesse an Entwicklung oder Veränderung. Diese Hand kümmert es nicht, dass ein Ufergrundstück so nahe an der City wahrscheinlich Millionen wert ist. Das Einzige, was dieser Hand wichtig ist, ist, dass das alte Hebewerk einem ganz bestimmten Zweck dient.
Außerdem ist es zufällig auch ein idealer Ort, um eine Leiche ins Grabtuch zu hüllen.
In der Mitte des Innenraumes stehen drei eiserne Maschinenfundamente, jedes etwa so groß wie ein bescheidener Esstisch. Die Tote liegt auf dem, das dem Abflussrohr am nächsten ist, und der Mörder keucht von der Anstrengung, sie dort hinzuschaffen. Wasser trieft von beiden herab. Das Haar der Toten ist schwarz und sehr lang. Es klebt an ihrem Gesicht wie Wasserpflanzen bei Ebbe an einem umgekippten Boot.
Über ihnen ist der Mond nicht viel mehr als eine gekrümmte blonde Wimper am Himmel, doch entlang des Ufers stehen Straßenlaternen, und ein wenig Licht dringt hier herein. Zusammen mit dem Schein mehrerer Öllampen, die in den Wandnischen stehen, genügt das.
Als das Haar sanft angehoben wird, kommt das bleiche, vollkommene Gesicht zum Vorschein. Der Mörder seufzt. Es ist immer so viel leichter, wenn die Gesichter keinen Schaden genommen haben. Die Wunde um den Hals ist hässlich, das Gesicht jedoch ist unberührt. Die Augen sind geschlossen, und auch das ist gut. Augen verlieren immer so schnell ihr Leuchten.
Hier kommt sie wieder, jene schwer lastende Traurigkeit. Bedauern – es gibt eigentlich kein anderes Wort dafür. Sie sind so wunderschön, diese jungen Frauen mit ihrem wallenden Haar und ihren langen Gliedern. Warum sie mit Versprechen von Rettung und Sicherheit fortlocken? Warum für den Moment leben, wenn die Hoffnung in ihren Augen sich in Entsetzen verwandelt?
Genug. Der Leichnam muss ausgezogen, gewaschen und verhüllt werden. Er kann den Rest der Nacht hier liegen bleiben und morgen zum Fluss hinausgeschafft werden. Die gesäumten Laken liegen griffbereit, ebenso die Nylonschnur und die Gewichte.
Bald ist die Frau entkleidet; das lange Hemd und die Hosen aus Baumwolle sind schnell aufgeschnitten, die billige Unterwäsche ist eine Sache von Sekunden.
Ob, aber sie ist doch so schön. Zierlich. Lange, schlanke Beine, kleine, hoch angesetzte Brüste. Blasse, makellose Haut. Die kräftigen Finger des Mörders streichen den festen, gerundeten Schenkel hinunter, zeichnen die Form der kleinen runden Kniescheibe nach und fahren an dem vollendet ausgeformten Schienbein hinab, über die platt gedrückte Wölbung der Wade. Wunderschöne Füße. Der hohe anmutige Bogen des Spanns, die winzigen rosa Zehen, das vollkommene Oval der Zehennägel. Im Tode ist sie das perfekte Abbild unerreichbarer Fraulichkeit.
Ein röchelnder Laut, dann eine kalte, starke Hand, die den Arm des Mörders umklammert.
Die Frau bewegt sich. Ist gar nicht tot. Ihre Augen sind offen. Nicht tot. Sie hustet, ringt nach Luft, ihre Hände tasten auf dem Eisenblock umher, sie versucht aufzustehen. Wie ist das passiert? Der Mörder fällt vor Schreck fast in Ohnmacht. Augen, die vor Grauen ganz schwarz geworden sind, starren. Noch mehr Flusswasser sprüht hustend zwischen jenen blassen, wund gebissenen Lippen hervor.
Lippen, die nichts mehr zu sagen haben sollten.
Der Mörder streckt die Hand aus, ist aber nicht schnell genug. Die Frau hat sich hastig rückwärtsgeschoben und ist von dem Fundament gefallen. »Aii, aii«, ruft sie, der Laut eines verängstigten Tieres. Auch der Mörder hat fürchterliche Angst. Ist jetzt alles vorbei?
Die Frau ist auf den Beinen. Verwirrt, desorientiert, aber nicht so sehr, dass sie vergessen hätte, was ihr zugestoßen ist. Sie weicht zurück, starrt um sich, sucht nach einem Fluchtweg. Jedes Mal, wenn ihr Blick dem des Mörders begegnet, werden ihre Augen vor Entsetzen noch größer. Worte kommen aus ihrem Mund; vielleicht sind es die Worte, die der Mörder hört, vielleicht auch nicht.
»Was bist du?«
Und das reicht, um die rasende Wut zurückzubringen. Nicht: »Wer bist du?«, nicht: »Warum tust du das?« Beides wären unter diesen Umständen vollkommen verständliche Fragen. Sondern: »Was bist du?«
Jetzt rennt die Frau durch den Raum, sucht nach einem Fenster – das sie hier im Erdgeschoss nicht finden wird – oder nach einer Tür, die ihr nicht helfen wird.
Sie hat das Obergeschoss entdeckt, strebt auf die Treppe zu. Dort oben führt kein Weg hinaus – die Fenster sind alle mit Brettern vernagelt, das schwere Tor lässt sich nicht öffnen –, aber es gibt dort Oberlichter, die sie vielleicht einschlagen und so Menschen draußen auf sich aufmerksam machen könnte.
Der Mörder stürmt los, knallt schmerzhaft gegen das Eisengerüst der Treppe und bekommt den Knöchel der Frau zu fassen, beißt mit aller Kraft in den fleischigen Teil der Wade. Ein schmerzliches Aufheulen. Noch ein heftiger Ruck. Ein Aufschrei, dann kommt sie die Treppe hinuntergestürzt.
Jetzt hat der Mörder sie, doch die Frau ist nackt und glitschig vom Wasser und vom Schweiß. Es ist nicht leicht, sie festzuhalten, und sie wehrt sich wie ein Aal. Das Beißen und Kratzen und das unablässige Zappeln kosten viel Kraft. Der Griff des Mörders lockert sich. Die Frau ist auf den Beinen. Den Arm ausstrecken, zupacken. Sie ist hingefallen, ist hart auf dem Steinboden aufgeprallt, hat sich den Kopf angeschlagen. Benommen ist sie leichter zu bändigen. Anheben. Das Geräusch von über Stein schürfender Haut. Arme fuchteln, klauengleiche Hände versuchen, irgendetwas zu fassen zu bekommen – egal, was –, aber sie haben das glatte Metallrohr erreicht, durch das früher das Wasser aus dem Hebewerk geströmt ist. Sie hineinheben. Ihr nachklettern. Sie weiterschieben. Das Abflussrohr ist kurz, nicht viel länger als ein Meter.
Dort unten ist Wasser, ganz nahe, und jetzt hilft die Schwerkraft mit. Vorbeugen, schieben, und, ja – sie schlagen beide auf die Wasseroberfläche auf.
Und die Welt wird wieder ruhig. Still. Weich und mühelos.
Ganz mühelos jetzt. Lass los. Lass sie untergehen. Lass sie in Panik geraten. Warte, bis sie auftaucht, um ihren letzten, verzweifelten Atemzug zu tun, und dann pack zu. Mit einem einzigen mächtigen Emporschnellen aus dem Wasser heraus, und dann wieder hinab, die Hände um ihren Hals gelegt. Hinunter, hinunter in die Tiefe. Hinunter, bis sie aufhört, sich zu wehren.
Beide fest umschlungen. Eine innige Umarmung. Eine gute Art zu sterben.
Donnerstag, 19. Juni(neun Tage zuvor)
2Lacey
Einem Regentropfen, der auf das Dorf Kemble in den Cotswolds fällt, ist es vorherbestimmt, zu einem Teil des längsten Flusses von ganz England und einem der berühmtesten Ströme der Welt zu werden.
Auf seiner knapp dreihundertfünfzig Kilometer langen Reise zur Nordsee wird sich dieser eine Wassertropfen mit Hunderten Millionen anderen zusammentun, die jeden Tag an der London Bridge vorbeiströmen.
Manchmal dachte Lacey Flint über jene Millionen von Tropfen nach, während sie mitten unter ihnen dahinschwamm, und ihr ganzer Körper erschauerte vor Erregung. Dann wieder hätte sie angesichts der unaufhaltsamen Wucht des Wassers um sie herum am liebsten vor Angst losgeschrien. Doch das tat sie nie. Wenn man so nahe bei der Themsemündung eine Ladung Flusswasser in den Mund bekam, war es durchaus möglich, dass einen das umbringen konnte.
Also hielt sie den Kopf oben und den Mund weitgehend geschlossen. Wenn sie ihn öffnete, um nach Luft zu schnappen, verließ sie sich darauf, dass die antiseptische Lösung, mit der sie vor dem Schwimmen gegurgelt hatte, die Bakterien beim ersten Kontakt abtötete.
Seit fast zwei Monaten, seit sie die alte Segeljacht gekauft hatte, die jetzt ihr neues Zuhause war, schwamm sie in der Themse, sooft die Gezeiten und die äußeren Bedingungen es erlaubten, und sie war gesünder als je zuvor.
An einem Junimorgen um 5 Uhr 22, so kurz vor der Sommersonnenwende, dass es kaum noch etwas ausmachte, war auf dem Fluss bereits eine Menge los, und selbst wenn sie sich dicht am Südufer hielt, musste sie sich in Acht nehmen. Der Schiffsverkehr beschränkte sich nicht immer auf die Flussmitte, und kein Bootsführer hielt jemals Ausschau nach Schwimmern.
Die Flut hatte ihren Höchststand erreicht. Dann gab es immer einen Moment, besonders im Sommer, wo der Fluss innezuhalten und ganz still zu werden schien. Ein paar Minuten lang – zehn, vielleicht fünfzehn – konnte man so leicht durch die Themse gleiten wie durch ein Schwimmbecken. Und Lacey konnte vergessen, dass sie ein menschliches Wesen war, auf Neoprenanzug und Flossen und antiseptisches Mundwasser angewiesen, um in diesem merkwürdigen aquatischen Umfeld zu überleben, und konnte stattdessen zu einem Teil des Flusses werden.
Eine Möwe schoss wie eine schlanke Pfeilspitze vor ihr dicht über dem Wasser dahin, ehe sie unter der Wasseroberfläche verschwand. Lacey stellte sich den Vogel vor, wie er unter ihr mit weit geöffnetem Schnabel den Fisch schnappte, den er von oben erspäht hatte.
Sie schwamm weiter, auf die schartigen schwarzen Pfähle eines der verfallenen Anleger ein Stück vor dem Ufer zu, die an diesem Teil des Flusses häufig waren. Nicht zum ersten Mal ertappte Lacey sich dabei, dass sie Ray vermisste. Sie vermisste es, seine dürren Arme ein Stück voraus zu sehen, vermisste das gelegentliche leuchtend helle Aufspritzen, wenn er zu weit mit den Beinen ausschlug. Aber er hatte sich vor ein paar Tagen eine Erkältung eingefangen, und seine Frau Eileen hatte ein Machtwort gesprochen. Er würde erst wieder in den Fluss steigen, wenn er wieder gesund war.
Keine dreißig Meter mehr bis zu den Pfählen. Diese Anleger, gebaut, als London einer der geschäftigsten Handelshäfen der Welt gewesen war, damit größere Schiffe dort festmachen und ihre Ladung löschen konnten, waren schon vor Jahrzehnten baufällig geworden. Da ihre sämtlichen Sinne – wie immer im Fluss – hellwach waren, fiel Lacey etwas auf. Dort war eine Bewegung im Wasser, nahe am Ufer. Kein Treibgut – es blieb am selben Ort. Es gab Fischotter in der Themse, aber sie hatte noch nie gehört, dass so weit flussabwärts welche lebten. Laut Ray schwammen auch andere Menschen im Fluss, aber weiter stromaufwärts, wo das Wasser sauberer und die Strömung nicht so stark war. Soweit sie wusste, waren er – und jetzt Lacey – die Einzigen, die so dicht vor dem Mündungsgebiet schwammen.
Ein wenig beklommen legte Lacey an Tempo zu, wollte plötzlich an dem Anleger vorbeikommen, in den Deptford Creek einbiegen und auf der Zielgeraden sein.
Fast geschafft. Ray schwamm normalerweise zwischen den Pfählen hindurch, sein ureigenes kleines Ritual, aber Lacey kam ihnen nie zu nahe. Das geschwärzte, muschelverkrustete Holz hatte etwas an sich, das ihr nicht gefiel.
Also doch eine zweite Schwimmerin, direkt vor ihr. Lacey empfand jenes momentane Hochgefühl, das von geteilter Freude herrührt. Vor allem von verbotenen Freuden. Sie machte sich bereit zu lächeln, wenn die Frau näher kam, vielleicht kurz Wasser zu treten und zu plaudern.
Nur – das war gar kein Schwimmen. Das war mehr Treiben. Der Arm, der eben noch zu winken schien, wedelte jetzt ziellos hin und her. Und der Arm war auch nicht einfach nur dünn – er war skelettdürr. Einen Augenblick lang war die Frau aufrecht, dann kippte sie um, ehe sie ganz verschwand; gleich darauf war sie wieder da. Vielleicht war es auch gar keine Frau; das lange Haar, das Lacey in dem blendenden, vom Wasser reflektierten Licht gesehen hatte, sah jetzt aus wie Wasserpflanzen. Und die Kleider, die wie ein Schleier hinter dem Körper herschleppten, hatten zu dem femininen Effekt beigetragen. Je näher sie kam, desto geschlechtsloser wirkte dieses Ding dort.
Lacey schwamm näher heran und redete sich ein, dass es da nichts gab, wovor man Angst haben müsste. Sie hatte noch nie miterlebt, wie eine Leiche aus dem Fluss gezogen worden war. Ungeachtet ihrer zwei Monate bei der Flusspolizei, ungeachtet der Tatsache, dass die Themse ihren Hütern allen Berichten nach mindestens eine Leiche pro Woche als fällige Zahlung bescherte, war sie entweder nicht im Dienst gewesen oder hatte anderweitig zu tun gehabt, wenn Tote geborgen worden waren.
Allerdings wusste sie von einem Einführungsgespräch in ihrer ersten Dienstwoche her, dass die Themse nicht so war wie stille Gewässer, wo ein Leichnam normalerweise versank und erst nach etlichen Tagen wieder an die Oberfläche kam. Die Strömung und die Gezeitenströme des Flusses rissen ihn mit, bis er irgendwo hängen blieb und bei Ebbe zum Vorschein kam. Es gab Stellen entlang der Themse, die als Leichenfänger berüchtigt waren und die die Flusspolizei immer zuerst abklapperte, wenn jemand verschwand. Leichen aus dem Fluss wurden für gewöhnlich recht schnell gefunden, und ihr Zustand war leicht vorherzusagen.
Nach zwei oder drei Tagen pflegten Gesicht und Hände anzuschwellen, weil sich Fäulnisgase innerhalb des Körpers sammelten. Nach fünf oder sechs Tagen fing die Haut an, sich abzulösen. Nägel und Haare verschwanden nach einer Woche, manchmal dauerte es auch bis zu zehn Tage. Und dann waren da noch die Auswirkungen der Wasserfauna. Fische, Krustentiere und Insekten, sogar Vögel, die an den Leichnam herankamen, hinterließen samt und sonders ihre Spuren. Augen und Lippen waren normalerweise zuerst an der Reihe, was dem Gesicht ein erschreckendes, monströses Aussehen verlieh. Ganze Klumpen konnten von Bootsschrauben oder harten Hindernissen im Wasser aus dem Körper herausgerissen werden. Wasserleichen waren nie frohe Kunde.
Jetzt war sie ganz nahe. Die Gestalt im Wasser schien in freudiger Erwartung auf und ab zu hüpfen. Hier bin ich. Hab auf dich gewartet. Komm und hol mich.
Kein erst vor Kurzem ertrunkenes Opfer, so viel war klar. Vom Gesicht war nur noch sehr wenig übrig: ein paar matschige Klumpen Muskelgewebe, das sich am rechten Wangenknochen entlangzog, ein bisschen mehr um Kinn und Hals. Jede Menge Bissspuren. Und auch die Pflanzenwelt des Flusses hatte sich eingenistet. Die wenigen verbliebenen Hautplacken zogen einen grünen Bewuchs an; dort hatte sich eine Art Wassermoos oder -kraut angesiedelt.
Zierliche Gesichtsknochen, noch Haare am Kopf. Wasserpflanzen schienen aus der linken Augenhöhle zu sprießen. Und Kleider, obwohl die für gewöhnlich im Fluss verloren gingen. Nur waren das eigentlich gar keine Kleider, sondern irgendetwas, das anscheinend um den Leichnam herumgewickelt gewesen war und sich jetzt löste, auf sie zutrieb, genau wie das lange Haar. Der Leichnam schien nach Lacey zu greifen, sogar die Arme waren ausgestreckt, die Finger klammernd gekrümmt.
Lacey befahl sich, sich zusammenzureißen. Sie hatte hier einen Job zu machen, eine Leiche konnte ihr nichts tun, sagte sie sich und trat Wasser. Sie musste sich vergewissern, dass der Leichnam nicht abtreiben konnte, und im Zweifelsfalle dafür sorgen, dass das nicht geschah. Und dann musste sie raus aus dem Wasser und den Vorfall melden. In einer Tasche ihres Neoprenanzugs trug sie immer eine flache Taschenlampe bei sich. Sie fand die Lampe, schluckte die aufsteigende Panik hinunter, sagte sich, dass man manchmal eben verdammt noch mal durch etwas durchmusste, und tauchte.
Nichts. Absolute Schwärze, die auch der Taschenlampenstrahl nicht durchdringen konnte. Dann eine wirbelnde Masse aus Grün- und Braunschattierungen. Aus Licht und Schatten. Völlige Verwirrung.
Und die Geräusche des Wassers waren hier unten so viel intensiver. Oben an der Oberfläche platschte, gurgelte und rauschte der Fluss, darunter jedoch deuteten die Laute eher ein Strömen, ein Abfließen, ein Schwappen an. Unter der Oberfläche hörte sich der Fluss lebendig an.
Merkwürdige, fremdartige Umrisse schienen auf sie zuzukommen. Das schwarze, von Muscheln überkrustete Holz der Anlegerpfähle. Irgendetwas streifte ihr Gesicht. Den Mund fest zugekniffen – sie würde nicht schreien. Wo war die Leiche? Dort. Fuchtelnde Arme, lang dahinwallende Kleider. Lacey ließ den Lampenstrahl an der schwebenden Gestalt hinauf- und hinunterwandern. Der Fluss wogte, und der Leichnam tauchte vollständig unter. Jetzt schienen die augenlosen Höhlen sie direkt anzustarren. Allmächtiger, als wären ihre Albträume nicht schon schlimm genug.
Nicht denken, einfach machen. Leuchte da hin. Finde raus, was sie an Ort und Stelle hält.
Da! Einer der Stoffstreifen hatte sich fest um den Anlegepfahl gewickelt. Es sah aus, als würde er halten.
Lacey hatte noch Luft übrig, als sie durch die Oberfläche stieß und an der Leiche vorbei zum Ufer schaute. Es gab keinen Uferstreifen – der Wasserstand war zu hoch –, aber sie musste aus dem Wasser raus. Der Anlegesteg über ihr war größtenteils intakt, aber zu hoch, um ihn zu erreichen. Ihre einzige Chance wäre, auf einen der Querbalken zu klettern, bis Hilfe kam. Ein paar Meter entfernt war einer, der stabil genug aussah.
Sie schwamm darauf zu und schaute sich alle paar Sekunden um, um sich zu vergewissern, dass die Tote sich nicht von der Stelle gerührt hatte. Sie blieb, wo sie war, doch sie schien sich im Wasser herumgedreht zu haben, um ihr nachzublicken.
Der Querbalken würde eine Weile halten. Als sie aus dem Wasser heraus war, streifte Lacey die Träger um ihre Schultern ab. In einer kleinen, wasserdichten Tasche, die tief auf ihrem Rücken hing, war ihr Handy. Ray bestand darauf, dass sie es mitnahm.
Er meldete sich schnell. »Alles klar, Schätzchen?«
Lacey hatte den Blick nicht von der Stoffbahn abgewendet, die von dem Steg wegwallte. Während die Wellen sich hoben und senkten, konnte sie immer wieder einen kurzen Blick auf den runden, mondähnlichen Schädel der Frau erhaschen.
»Lacey, was ist los?«
Niemand war in der Nähe, aber trotzdem hatte sie das Gefühl, sie müsse leise sprechen. »Ich hab eine Leiche gefunden, Ray. Beim alten King’s Wharf. Am Anleger festgemacht.«
»Bist du aus dem Wasser raus? Bist du in Sicherheit?«
»Ja, ich bin draußen. Und die Flut läuft aus. Ich bin in Sicherheit.«
»Die Leiche kann nicht abtreiben?«
»Sieht nicht so aus.«
»Zehn Minuten.«
Weg war er. Ray hatte vor Jahren bei der Flusspolizei gearbeitet und wusste um die Bedeutung einer Leiche im Wasser. Genau wie Lacey wohnten er und seine Frau auf einem Boot, das im Deptford Creek lag, einem nahen Seitenarm. Zehn Minuten waren sehr knapp geschätzt, er konnte sie unmöglich in weniger als zwanzig Minuten erreichen. Bis dahin musste sie sich warm halten.
Leichter gesagt als getan, so zwischen zwei Holzbalken eingeklemmt, während ihr das Wasser alle paar Sekunden über die Knöchel schwappte. Seit zwei Wochen erlebte Großbritannien eine der längsten Hitzewellen, die je dokumentiert worden waren, aber es war noch früh am Morgen, und die Sonne hatte das Südufer noch nicht erreicht.
Unter ihr waberte das Wasser um die Pfähle und bildete Miniaturwirbel. Die Tote schien zu tanzen, die Wellen ließen sie spielerisch auf und ab hopsen; der Stoff schwebte wie wallende Röcke um sie herum.
»Hey!«
Lacey wäre vor Erleichterung fast umgekippt. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie angespannt sie gewesen war. Ray musste geflogen sein, um so schnell – Vorsicht! Sie spürte, wie der Balken unter ihr ein klein wenig nachgab.
Und Ray war nirgends zu sehen. Kein kleiner, emsiger Motor kam auf sie zugetuckert, kein runzliger alter Bootsmann schaute mit gefurchter Stirn in die Sonne. Und doch war den Bruchteil einer Sekunde lang das Gefühl, dass noch jemand hier war, geradezu überwältigend gewesen. Sie hatte ihn doch rufen hören.
Lacey reckte sich in die Höhe. Das Ufer war leer. Sie konnte Autos hören, aber ein gutes Stück entfernt. Keine Fahrradreifen oder joggenden Schritte. Auf dem Fluss waren Boote unterwegs, aber keins war auch nur ansatzweise in ihrer Nähe.
Da war er endlich, hielt so schnell auf sie zu, wie es sein 20-PS-Motor erlaubte.
Sie ergriff die Leine, die er ihr hinstreckte, und machte das Boot fest, ehe sie hinabkletterte.
»Zieh das hier an.« Er warf ihr eine Tasche zu. »Oben bei Limehouse ist ein Patrouillenboot. Die sind gleich hier. Also, wir reden hier nicht vom Schwimmen. Du und ich, wir waren in meinem Boot auf dem Fluss, als du die Leiche entdeckt hast.«
Lacey nickte, während sie sich aus dem Neoprenanzug schälte und ihre nassen Sachen in die Tasche stopfte. Im Gezeitenbereich des Flusses zu schwimmen war ein Verstoß gegen die Stadtverordnung. Auch wenn man zur Flusspolizei gehörte.
»Alles okay?«, erkundigte sich Ray, während das Polizeiboot näher kam.
»Alles gut«, versicherte sie.
Der Bootsführer war ein junger Sergeant namens Scott Buckle. Er schaute zu Lacey herüber und winkte.
»Das gehört bei dem Job eben dazu«, sagte Ray halblaut zu ihr. »Wird nicht die Letzte sein, die du rausholst.«
»Ich weiß.«
»Das hier ist ein gieriger Fluss. Die Leute sind abgelenkt, passen nicht richtig auf. Er gibt ihnen keine zweite Chance.«
Vor fast einem Jahr hatte der Fluss ihr doch eine zweite Chance gegeben. Er hatte sie losgelassen; vielleicht war das der Grund, warum sie jetzt keine Angst mehr vor ihm hatte. »Das war nicht der Fluss.« Sie sah zu, wie ihre Kollegen mit Bootshaken an der Leiche herumstocherten. »Und mit den Dingern kriegen sie sie nie raus. Sie ist festgemacht, um den Pfahl herum.«
»Das weißt du doch gar nicht«, wehrte Ray ab. »Das kannst du unmöglich wissen, es sei denn, du bist mit dem Kopf unter Wasser gewesen. Bitte sag, dass du das nicht getan hast.«
»Die ist nicht aus Versehen reingefallen«, beharrte Lacey. »Sie ist eingewickelt wie eine Mumie.«
Ray seufzte. »Großer Gott, Lacey. Wie machst du das bloß?«
3Der Schwimmer
Im Schatten verharrte der andere Schwimmer vollkommen regungslos. Das Sonnenlicht reichte nicht bis hierher, doch die glänzenden Boote mit ihren überlauten Motoren kamen manchmal gefährlich nahe. Und sie hatten Lampen, diese Männer, die glaubten, der Fluss gehöre ihnen. Starke Suchscheinwerfer, die jeden ausfindig machen konnten, selbst im dunkelsten Winkel. Also stillhalten, ganz tief im Wasser, den Blick gesenkt, so ging das. Sie würden den Kopf des Schwimmers für ein mit Wasserpflanzen bedecktes Stück Holz halten, den Arm für einen abgebrochenen Ast, vom Wasser entrindet und von der Sonne gebleicht.
Anya war gefunden worden. Der Schwimmer konnte sie jetzt sehen, mit dem im Wasser wallenden Leichentuch, wie sie nach einem Fluchtweg suchte, der doch eine vergebliche Hoffnung war. Bald würden noch mehr Boote kommen. Sie würden sie aus dem Fluss heben, ihren armen, zerstörten Leib dem Sonnenlicht preisgeben, mit ihren Fingern und ihren Werkzeugen und ihren Blicken an ihr herumstochern.
Die Frau, die schwamm, als wäre sie im Wasser geboren worden, stieg mithilfe der anderen in eines der größeren Boote. Sie hoben sie mühelos heraus. Sie sah klein und zierlich aus, wenn man bedachte, wie stark und schnell sie im Fluss war. Der Wind packte ihr Haar, das bereits in der Sonne trocknete, und es flatterte hinter ihr her wie eine leuchtende Fahne. Die Männer würden auch sie mitnehmen, sie dachten schließlich, sie wäre eine von ihnen. Sie hatten ja keine Ahnung, wie viel sie vor ihnen geheim hielt.
Die Frau mit dem hellen Haar drehte sich um, und einen Moment lang schien sie den Schwimmer direkt anzusehen. Eben war es knapp gewesen. Nur ein glücklicher Zufall hatte verhindert, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht begegnet waren.
Eigentlich war ja alles dem Zufall unterworfen. Manchmal begünstigte er einen, manchmal nicht. Hätte es mehr Zeit gehabt – Tage, vielleicht auch nur Stunden –, so hätte das Wasser Anya ausgezogen, Gezeiten und Strömung hätten ihre Zeichen hinterlassen, und sie wäre einfach nur ein weiteres Opfer des Flusses gewesen. Wäre die hellhaarige Frau heute nicht geschwommen, so wäre Anya wahrscheinlich nicht innerhalb eines Zeitraums gefunden worden, in dem man ihre Geschichte noch erzählen konnte.
Alles lief auf Zufälle hinaus. Und der Zufall würde das Ganze weiterführen. Denn wenn Anya zu ihnen sprach, würden sie auch die anderen finden.
4Dana
»Sagen Sie mir eins: Eine Fünfzehnjährige, die glaubt, wenn sie schwanger wird, verleiht das der schmuddeligen Sozialhilfe-Existenz, die bei ihr als Leben durchgeht, ein bisschen Bedeutung. Wessen Erlaubnis braucht die, sich fortzupflanzen? Oder eine Cracksüchtige, die sich in den Arsch ficken lässt, um den Stoff zu bezahlen, der von Mal zu Mal schlechter wird? Wer unterschreibt das Formular, in dem steht, dass die ein Baby kriegen darf?«
Dana schloss die Augen, als könnte sie so die Stimme ihrer Lebensgefährtin ausblenden. Das war’s also. Doch kein Baby. Helen hatte schon immer ein Problem mit Autorität gehabt (eigentlich ironisch, wo sie doch in einem Beruf Karriere gemacht hatte, der genau das erforderte), und mit medizinischer Autorität tat sie sich am schwersten. Eines ihrer liebsten Hassthemen war die Arroganz der Mediziner. Nur ließ sie sich für gewöhnlich nicht in deren Gegenwart darüber aus.
Dana öffnete die Augen und schaute auf die Uhr. Sie würde es doch zu der Besprechung um zehn schaffen; sie hätte wissen müssen, dass es so enden würde. Nun ja, aus einer Kinderwunsch-Sprechstunde geschmissen zu werden, das wäre doch mal eine neue Erfahrung.
»Wir haben keinerlei Befugnis festzulegen, welcher Teil der Bevölkerung Nachwuchs haben darf und welcher nicht«, erwiderte der Arzt, der zudem noch der Chefarzt des Instituts war. Auf Helen war Verlass. Wenn man schon jemanden gegen sich aufbringen wollte, dann konnte man auch gleich ganz oben anfangen. Der Arzt war etwa Mitte sechzig, hochgewachsen und dünn, mit großen dunkelblauen Augen und dicken schwarzen Brauen. Sein Haar, noch immer dicht und ein wenig zu lang, war schwarz mit ein wenig Grau darin. Der Name an seiner Tür lautete Alexander Christakos.
Christakos’ Klinik lag direkt am Fluss, und aus dem Fenster hinter ihm hatte man einen Blick auf das honiggelbe und weiße Mauerwerk, die dem Fluss zugewandte Bogengang-Fassade und das blassblaue Dach des Old Billingsgate Fish Market. Der war jetzt ein Konferenzzentrum, ein Schauplatz großer, glamouröser Events, früher jedoch hätte man von diesem Raum aus den Fisch riechen können.
Er hatte einen ganz leichten Akzent, doch Dana konnte ihn nicht zuordnen. »Sie und ich könnten lange über die Vorteile dieser Regelung diskutieren«, sagte er gerade zu Helen, als wären nur sie beide im Raum. »Was ich aber weiß, ist, dass aus Spendergameten gezeugte Kinder – und vor allem Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Elternhäusern aufwachsen – sich beim Heranwachsen mit ganz spezifischen Problemen herumschlagen müssen. Es wäre verantwortungslos von uns und auch von Ihnen, das zu ignorieren.«
Draußen auf dem Fluss fuhr ein Boot der Flusspolizei vor dem Billingsgate-Gebäude vorbei. Hier im Zimmer hatte Christakos noch immer das Wort.
»Uns sind eine ganze Anzahl von Fragen wichtig«, sagte er – und man musste es ihm hoch anrechnen, dass er Helen dazu gebracht hatte, so lange den Mund zu halten. »Erstens, inwieweit Sie die Auswirkungen durchdacht haben, die eine unübliche Empfängnis und Erziehung auf ein Kind haben wird. Und dann natürlich …«
Dies hier war ihr erster Gesprächstermin. Helen war mit dem Flieger aus Dundee gekommen – wo sie arbeitete und die meiste Zeit wohnte –, damit sie sich als Einheit präsentieren konnten. Sie hatten mit etlichen heterosexuellen Paaren im Wartezimmer gesessen. Die Frauen hatten eifrig die Informationsliteratur der Klinik durchgeblättert, als sei das Geheimnis der Fruchtbarkeit auf einer Hochglanzseite zu finden, während die Männer verlegen und unruhig herumzappelten und überall hinschauten, nur nicht in die Augen von irgendjemand anderem.
»Unsere Philosophie hier besagt, dass es beim Elternsein um Liebe geht, nicht um Biologie.« Christakos war fest entschlossen, sich von einer großmäuligen Lesbe nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, ehe er ihnen riet, es woanders zu versuchen. Fast hätte Dana ihn bewundern können, wäre er nicht im Begriff gewesen, ihr das Herz zu brechen. Ein weiteres Polizeiboot fuhr schnell flussabwärts vorbei. Sie würde Helen umbringen.
»Zeit, Hingabe, Geduld, Großzügigkeit, sogar Humor, das ist alles wichtig, aber Liebe steht ganz oben auf der Liste. Außerdem ist ein bestimmtes Maß an gesundem Egoismus durchaus hilfreich. Die Patienten, die wir hier aufnehmen, wollen unbedingt Eltern werden. Also, ich habe keinerlei Zweifel daran, dass Miss Tulloch Mutter sein möchte. Die Frage lautet: Sie auch?«
Eben nicht, dachte Dana. Das war ja das Problem. Helen würde ihr ganzes Leben lang kinderlos bleiben können und nie das Gefühl haben, dass ihr irgendetwas fehlte. Nur Dana zuliebe hatte sie bei dem Ganzen mitgemacht. Sie würde hinausgehen, gelassen die Achseln zucken und sagen, wenigstens hätten sie es versucht. Und dann würde sie einfach weiterleben und erwarten, dass Dana dasselbe tat. Sie fragte sich, wie lange ihre Beziehung jetzt noch halten würde, nachdem Helen ihr dies verwehrt hatte.
»Um die Wahrheit zu sagen, ich habe nie über Kinder nachgedacht«, antwortete Helen gerade, weil Helen nämlich nicht lügen konnte. Dana sah zu, wie draußen ein Flugzeug gemächlich über den Himmel zog.
»Das hier ist etwas, das Dana will.« Während Danas Gedanken abschweiften, wurde Helens Stimme immer leiser. »Aber ich will mit Dana zusammen sein, egal unter welchen Umständen. Und um Ihr Argument von wegen Liebe aufzugreifen: Wenn dieses Baby Dana in Miniaturform ist, wie kann ich da anders, als es anzubeten?«
Danas Handy vibrierte in ihrer Tasche. Eigentlich gab es ja keinen Grund, nicht nachzusehen. Also, das erklärte auf jeden Fall die ganze Aufregung, die sie da eben auf dem Fluss gesehen hatte. Aber wie …? Egal, damit würde sie sich auf dem Revier befassen.
Die beiden anderen hatten aufgehört zu streiten. Christakos war aufgestanden, streckte ihr die Hand hin. Es wäre doch unhöflich, sie nicht zu ergreifen, und sie konnte ihm ja auch keine Vorwürfe machen. Es war doch Helens Schuld gewesen.
Dana ging als Erste hinaus, schritt voran den Flur hinunter und fragte sich, wie sie Helen ansprechen sollte, ohne sie anzubrüllen. Du konntest nicht anders, wie? Du konntest einfach nicht die Klappe halten.
»Das mit der ethnischen Herkunft haben wir nicht wirklich bedacht, nicht wahr?« Helen blieb stehen, um Dana zuerst in den Fahrstuhl treten zu lassen.
»Was?«
»Also, du erinnerst dich doch, dass er gesagt hat, indische Spender wären sehr selten? Wir würden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen finden. Vielleicht können wir ja einfach nach dunklem Haar und dunkler Hautfarbe suchen. Ich fänd’s schön, wenn es so aussieht wie du, wenn das irgendwie möglich ist.«
»Die Flusspolizei hat eine Leiche aus dem Fluss geborgen«, sagte Dana. »Scheint sich nicht um ein Unfallopfer zu handeln. Sie bringen sie nach Wapping. Oh, und rate mal, wer sie gefunden hat.«
Jetzt schaute Helen auf die Uhr. »Ich bin so gegen sechs zu Hause. Hör zu, vielleicht schaffe ich es nicht zu unserem ›ganz besonderen Termin‹. Ist das okay für dich? Wenn ich bei der Empfängnis nicht dabei bin? Ich hab das Gefühl, ich sollte dabei sein, es ist nur …«
Sie kamen am Empfang vorbei und traten durch die schwere Glastür hinaus. Als sie die Klimaanlage hinter sich ließen, traf die Hitze sie mit voller Wucht.
»Wovon redest du eigentlich?«, fragte Dana. Helen sah heute Morgen gut aus, selbst für ihre Verhältnisse. Sie war groß und athletisch gebaut und machte in gut geschnittenen Hosenanzügen immer eine tolle Figur. Ihr langes blondes Haar war im Nacken zu einem Knoten geschlungen; sie trug Schmuck und sogar Make-up. Der Termin, zu dem sie so eilig unterwegs war, war offenbar wichtig. Viel wichtiger als der, den sie gerade gehabt hatten.
»Dana, hast du da drinnen überhaupt zugehört?« Helen trat zur Seite, um eine Bürokraft mit einem Papptablett voller Kaffeebecher vorbeizulassen.
»Eigentlich nicht«, gestand Dana. »Ich hab abgeschaltet, als du losgelegt hast.«
»Ja, das hab ich mir gedacht. Okay, ich muss jetzt los, also konzentrier dich mal kurz. Du hast letzten Freitag deine Regel gekriegt, stimmt’s? Das heißt, du musst in ungefähr einer Woche mit den Eisprung-Analysen anfangen. Die wollen während des ersten Zyklus einen Ultraschalltermin machen, nur um sicherzugehen, dass alles richtig funktioniert.«
Helen war vor einem Taxi auf die Straße getreten. Sie reichte Dana einen großen braunen Umschlag. »Da sind die Formulare für den Hausarzt und für die Entbindung von der Schweigepflicht drin – die musst du heute abschicken. Und außerdem der Leitfaden für die Auswahl eines Spenders. Da will ich mitreden, ich will nämlich auf keinen Fall, dass mein Sohn oder meine Tochter rothaarig wird.«
Dana schaute jetzt direkt in die Sonne. Sie blinzelte. »Er hat die Formulare unterschrieben?«
Helen saß im Taxi und wollte gerade die Tür zuschlagen. »Natürlich hat er die verdammten Dinger unterschrieben. Wir werden ganz tolle Eltern sein. Ich liebe dich.«
Die Tür knallte zu, und das Taxi fuhr zurück zur Brücke. Dana ging auf, dass sie keine Ahnung hatte, wo Helen hinwollte. Sie hatte ungeheuer geheimnisvoll getan, was den Grund für ihre Reise nach London anging, abgesehen von dem Besuch in der Klinik. Und jetzt stand sie allein auf einer Straße mitten in London und hatte das vage Gefühl, dass sie eigentlich irgendwo anders sein sollte. Während sie doch an nichts anderes denken konnte als daran, dass sich ihr Leben in den letzten paar Minuten vollkommen verändert hatte.
5Lacey
»Sind Sie sicher?«, fragte Sergeant Buckle.
»Ich bin mir sicher.« Lacey sah zu, wie drei ihrer Kollegen mit der Leiche näher kamen, die jetzt ordentlich in einem schwarzen Sack mit Reißverschluss verpackt war. Ihre Bewegungen waren gemessen und respektvoll, Gespräche wurden mit leiser Stimme geführt, immer eingedenk der Tatsache, dass der Steg auf der Rückseite der Polizeidienststelle von Wapping dem Blick der Öffentlichkeit preisgegeben war.
Am Hauptteil des Kais lag ein kleines dunkelblaues Gebäude. Darin befanden sich Tische, Lagerungsmöglichkeiten und eine flache Edelstahlwanne. Jeder Leichnam, der aus dem Tidenbereich der Themse geborgen wurde, wurde zuerst hierhergebracht, zur Erstuntersuchung und nach Möglichkeit zur Identifikation. Ein unangenehmer, unbeliebter Teil des Jobs; es war höchst ungewöhnlich, dass jemand sich freiwillig dafür meldete, so wie Lacey es eben getan hatte.
»Ich kann mir ohne Weiteres jemand anders suchen«, versuchte Buckle es noch einmal.
»Diesmal muss ich das machen«, wehrte Lacey ab. »Und ich hab sie doch schon gesehen, schon vergessen?«
»DenLeichnam«, verbesserte Buckle. »Sie haben den Leichnam gesehen. Keine Mutmaßungen hinsichtlich des Geschlechts.«
»Paket für Sie, Sarge.« Die anderen gingen, und Buckle sah auf die Uhr. »Na schön, wir haben ungefähr zwanzig Minuten, bis die Kollegen von der Kriminalpolizei hier aufschlagen. Schauen wir mal, was wir denen erzählen können.«
Während der Sergeant den oberen Teil des Leichensacks festhielt, zog Lacey den Reißverschluss auf. Dabei hielt sie die Luft an, doch der Geruch, der aus dem Sack drang, war nicht schlimmer als eine Art konzentriertes Flusswasseraroma, mit einem Hauch faulender organischer Materie. Der Oberkörper der Frau – es war eine Frau, das wusste sie ganz einfach – war größtenteils skelettiert, doch um Bauch und Oberschenkel waren die Stoffbahnen fester gewickelt und hatten anscheinend die Weichteile in diesem Bereich geschützt.
Buckle hatte ein Diktiergerät in der Brusttasche seines Overalls und sprach hinein, nannte Datum und Uhrzeit der Erstuntersuchung von L23, dem dreiundzwanzigsten Leichnam, der in diesem Jahr aus der Themse gezogen worden war. Lacey nahm die Digitalkamera.
»Leichnam misst hundertfünfundsechzig Zentimeter und wiegt etwa dreißig Kilo. In Anbetracht der recht weit fortgeschrittenen Skelettierung – insbesondere am Kopf, den oberen Extremitäten und dem Rumpf – würde ich sagen, wir haben es mit den sterblichen Überresten eines zierlichen Erwachsenen oder eines Teenagers zu tun.« Lacey machte aus ein paar Schritten Entfernung Totalaufnahmen von der Leiche.
»Die Größe lässt darauf schließen, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen erwachsenen Mann handelt.« Buckle schaute auf und zwinkerte Lacey zu. Sie trat an den Rand der Wanne, um Nahaufnahmen vom Kopf zu machen. Die Wasserpflanzen, die aus der Augenhöhle hervorwucherten, waren widerwärtig, wie etwas aus einem schlechten Science-Fiction-Film. Sobald sie konnte, würde sie sie entfernen. Sie fotografierte nacheinander beide Hände und machte dann eine Reihe Nahaufnahmen, angefangen beim Kopf, und dann den ganzen Körper hinunter.
»Ein ungewöhnliches Merkmal dieses spezifischen Leichnams ist, dass er anscheinend eingewickelt war«, sagte Buckle gerade, »und zwar von Kopf bis Fuß, in eine Art Stoff. Was immer auch die Lösung dieses Rätsels ist, es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass es sich hier um einen Unglücksfall oder um Selbstmord handelt. Okay, drehen wir das Ganze mal um.«
Lacey legte die Kamera weg und half Buckle, die Leiche umzudrehen. Ein Stück der Kopfhaut, von der noch immer langes Haar herabhing, saß noch am Hinterkopf. Auf dieser Seite war die Verwesung weniger weit fortgeschritten, und das Gewebe an Schultern und Rücken leuchtete rot und wund im hellen Sonnenlicht.
»Diese Seite sieht anders aus.« Lacey griff von Neuem nach der Kamera.
»Hat wahrscheinlich auf dem Rücken unten auf dem Grund gelegen«, meinte Buckle. »Wenn’s da schlammig war, wären Fische und so da nicht so leicht rangekommen. Versucht haben sie’s – schauen Sie mal.« Er zeigte auf die linke Schulter. »Aber erst in den letzten paar Tagen, würde ich sagen.«
»Was glauben Sie, wie lange die Leiche im Wasser war?«, fragte Lacey. Buckle arbeitete schon seit etlichen Jahren bei der Flusspolizei; bestimmt hatte er während dieser Zeit viele Wasserleichen zu Gesicht bekommen.
»Länger als einen Monat, kürzer als ein Jahr. Aber ich sag Ihnen, was mir auffällt.«
»Was denn?«
»Sie war nicht groß in Bewegung. Machen wir mal den Stoff ab, um sicher zu sein, aber ich würde sagen, das Skelett ist ziemlich intakt.«
»Was ist denn das?« Lacey zeigte auf die Mitte des Rumpfes, dorthin, wo die Taille gewesen wäre. Buckle beugte sich vor. »Eine Schnur«, meinte er. »War fest um die Taille gebunden, vielleicht, um den Stoff zu halten.«
»Sieht nach Nylon aus«, bemerkte Lacey und trat ans Fußende der Wanne. »Das bedeutet, sie hätte sich nicht zersetzt. Um die Knöchel ist auch eine. Oben am Kopf auch?«
»Kann keine sehen«, erwiderte Buckle.
»Deswegen ist der Stoff um den Bauch und an den Beinen auch dort geblieben, wo er war«, sagte Lacey. »Er wurde von Nylonschnüren gehalten, die die Flusslebewesen nicht kaputt fressen konnten.«
Sie blickte auf und bemerkte, dass Buckle sie sonderbar ansah.
»Machen wir den Stoff jetzt ab?«, fragte sie.
Als Antwort griff er hinter sich und nahm eine große Schere zur Hand. »Alles eintüten«, wies er sie an. »Ich versuch mal, das Teil hier abzukriegen, ohne es zu zerschneiden.« Er zog an der Schnur um die Füße, suchte nach einem losen Ende. Lacey etikettierte zwei Beweismittel-Plastiktüten und legte sie auf den Arbeitstresen.
»Das reicht nicht bis ganz nach oben.« Sie zeigte auf den oberen Teil der Schenkel. »Da ist ein größeres Stück Stoff, unter diesen Bindenstreifen da.«
»Und weiter oben sind noch mal solche Bandagen, als sollten die das Tuch darunter halten.« Buckle schob die Hände unter den Oberkörper der Leiche. »Na schön, ich hebe an, Sie wickeln.«
Lacey hatte fast einen Meter Stoff abgewickelt, als etwas Kaltes, Scharfkantiges ihre Hand streifte. Sie fuhr zurück. »Mein Gott, da ist irgendwas drin!«
Buckle war ebenfalls zusammengezuckt. Er entspannte sich ein paar Sekunden vor ihr, und sie sahen zu, wie die kleinen Geschöpfe, die Lacey befreit hatte, über den Leichnam hinwegkrabbelten und versuchten, an den Metallwänden der Wanne hinaufzuklettern.
»Wollhandkrabben«, meinte Buckle. »Der Fluss ist voll von den Viechern.«
Lacey nickte. Chinesische Wollhandkrabben, die bis zu handtellergroß werden konnten, waren in den Dreißigerjahren in Großbritannien aufgetaucht, eingeschleppt im Schiffsballast. Da sie nur wenige natürliche Feinde hatten, hatten sie sich rapide vermehrt und an Flussufern und Hafen-Infrastrukturen sowie unter der einheimischen Tierwelt des Flusses unbeschreibliche Schäden angerichtet. Ihr Hauptmerkmal waren dicke, haarige Scheren, und bei Ebbe sah der Grund des Flusses ihretwegen aus, als befände er sich in ständiger Bewegung.
Lacey hatte schon Dutzende von den Tieren gesehen, seit sie auf dem Fluss wohnte und arbeitete. Natürlich zog verwesendes Fleisch sie an. Irgendetwas an den Viechern – sie zählte sechs Stück, die in heller Panik in der Wanne herumhasteten – war wahnsinnig gruselig.
6Nadia
Der Fluss machte Nadia Angst. Sogar hier, hoch über der Stadt. Die Flüsse, die sie bisher gekannt hatte, waren nicht so gewesen wie dieser. In den ländlichen Gegenden, die sie hinter sich gelassen hatte, waren Flüsse schnell und flach, so klar wie Glas und so kalt wie die Nacht. Sie hüpften über Felsen und eilten durch Schilfgürtel, plätscherten und funkelten in der Sonne, schimmerten wie Sternenschein im Dunkeln. Dieser Fluss war gewaltig: braun wie getrocknetes Blut und unvorstellbar tief.
Sie hatte zu lange hingestarrt. Also lehnte sie sich von dem Teleskop zurück und ließ ihre schmerzenden Augen ausruhen. So früh am Morgen, mit dem Wind im Gesicht, wehendem Haar und geschlossenen Augen, konnte sie fast glauben, sie wäre zu Hause.
Zu Hause hatte sie Zuflucht in den Hügeln gesucht, als das Getöse und der Zorn ihres kriegszerrissenen Heimatlandes zu viel geworden waren. Sie hatte den Blick fest auf den Schnee gerichtet, der sie die meiste Zeit des Jahres über bedeckte, hatte Luft geatmet, die frei von Staub und Rauch war, und sich eingeredet, das gedämpfte Gebrüll und die fernen Schreie wären gar nicht so weit von völliger Stille entfernt.
Hier, auf der anderen Seite der Welt, erwiesen sich alte Gewohnheiten als hartnäckig, und sie hatte begonnen, in diesem alten Park hoch hinaufzusteigen, um Luft und Ruhe zu finden. Selbst hier jedoch war es unmöglich, dem Fluss zu entkommen; Teleskope, die an den höchsten Aussichtspunkten aufgestellt worden waren, machten es einem nur allzu leicht, ihn zu betrachten.
Er hatte von ihr gekostet, dieser große, mitleidlose Strom, hatte sie im Mund herumgerollt und war drauf und dran gewesen, sie zu verschlucken, als sie ihm entrissen worden war wie ein Kätzchen aus dem Rachen eines hungrigen Hundes.
Vor Jahren hatte Nadias Mutter ihr eine Geschichte von einem großen, gierigen Fluss erzählt. In der Geschichte merkte sich der Fluss jeden, der jemals in seine Klauen geriet. Hatte er einmal von einem gekostet, vergaß er einen nie. Dann war man fürs Leben gezeichnet, und während die Jahre verstrichen, wuchs der Hunger des Flusses nach einem immer mehr, bis schließlich der Tag kam, wo er einen holte, ganz gleich, wie viel Mühe man sich gab, ihm fernzubleiben.
Nadias Augen schmerzten nicht mehr, und sie schaute abermals durch das Teleskop. Jetzt war nur noch ein Polizeiboot übrig. Vor einer halben Stunde waren es noch mehrere gewesen; die blauen Rümpfe und die weißen Deckaufbauten waren unverwechselbar, als sie einen Kreis bildeten und gegen die Strömung der einsetzenden Ebbe ihre Positionen hielten. Die Polizeiboote sollten leicht zu erkennen sein, auch für Menschen, die noch nie auf einem gewesen waren, die nie aus der eisigen Tiefe gezogen worden waren wie ein Fisch, dem die Kraft ausgeht. Wie sie, in jener Nacht, als sie aus dem Fluss gerettet worden war.
Aber vergessen war sie nicht. Der Fluss sprach im Dunkeln zu ihr, während sich ihre Träume in Albträume verwandelten, in denen das Wasser überall war und Schlamm und Wasserpflanzen sie umklammerten und hinabzogen. Er sagte ihr, sie werde niemals frei sein, eines Tages werde er sie holen, und das nächste Mal werde es kein Entkommen geben.
7Lacey
»Wie ich sehe, hat’s ja nicht lange gedauert, bis Sie sich wieder Ärger einhandeln.«
Lacey zuckte zusammen. Sie und Buckle waren so damit beschäftigt gewesen, die Leiche auszuwickeln, dass keiner von ihnen die beiden Männer bemerkt hatte, die auf dem Steg zu ihnen getreten waren. Detective Sergeant Neil Anderson und Detective Constable Peter Stenning vom Major Investigation Team der Dienststelle in Lewisham. Sie sahen Lacey zum ersten Mal in Uniform.
Andersons Hosenbund spannte über seinem Bauch. Anscheinend hatte er zugenommen, und er war ohnehin schon kein Fliegengewicht gewesen. Der Sergeant war Mitte vierzig, mit schütterem rotem Haar, schwammiger Kinnlinie und gerötetem Gesicht; er gehörte nicht zu den Beamten, die mit dem Stress ihres Berufs leicht fertigwurden. Stenning dagegen sah gut aus. Er war ungefähr so alt wie Lacey, groß und gut in Form. Sein dunkles, lockiges Haar hatte er mit Gel gebändigt, und er trug irgendein Rasierwasser, das nach Gewürztruhen roch.
Im März, als sie drauf und dran gewesen war, für immer aus dem Polizeidienst auszuscheiden, hatte Lacey den höchst ungewöhnlichen Schritt getan, eine Versetzung zu beantragen. Sie hatte einer vielversprechenden Karriere als Detective und einer möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Beförderung zum Sergeant den Rücken gekehrt und war in den Streifendienst zurückgekehrt. Etliche Kollegen, Anderson und Stenning eingeschlossen, hatten versucht, sie umzustimmen. Sie hatten von dem beispiellosen Pech gesprochen, durch das sie dreimal hintereinander mitten in sehr schwierige Fälle hineingeraten war, davon, wie unwahrscheinlich es war, dass dergleichen in ihrer ganzen beruflichen Laufbahn noch einmal vorkommen würde. Im Streifendienst wäre ihr Talent verschwendet, hatten sie gesagt. Und sie würde sich zu Tode langweilen. Trotzdem hatte sie an ihrem Entschluss festgehalten.
Verbrechen verhindern, das war es, was sie jetzt tun musste. Sie würde auf dem Fluss patrouillieren, Boote und Zulassungen kontrollieren und Betrunkene und Leichtsinnige davon überzeugen, dass das Wasser ja vielleicht einladend aussah, aber ihnen in Wirklichkeit ganz und gar nicht freundlich gesonnen war. Und hin und wieder würde sie mithelfen, eine Leiche aus dem Wasser zu ziehen. Die Aufklärung schwererer Verbrechen würde sie denen überlassen, die noch den Mumm dazu hatten.
Komisch, dass es gleichzeitig schön und schrecklich sein konnte, anderen Menschen zu begegnen. Die beiden hier waren beinahe zu Freunden geworden. Beinahe, weil Lacey Flint eigentlich keine Freundschaften schloss. »Guten Morgen, Sergeant.« Sie richtete sich auf und rang sich ein Lächeln ab. »Morgen, Pete.«
Anderson kam unbeholfen auf sie zu und schien im Begriff zu sein, sie zu umarmen, ehe er merkte, dass ihr Overall mit Flusswasser und verwesendem menschlichem Gewebe verschmiert war. Er hob stattdessen die Hand zum Gruß. Stenning lächelte und warf ihr eine Kusshand zu.
Die drei Männer begrüßten einander, dann wandte sich Anderson an Lacey. »Alles okay?«
»Alles bestens, Sarge«, antwortete sie rasch.
»Was haben Sie für uns?«
Aus Höflichkeit blickte Lacey schnell zu Buckle hinüber, der ihr mit einem Nicken bedeutete anzufangen.
»Einen Leichnam, der heute früh um kurz vor sechs im Fluss gefunden wurde«, berichtete sie. »Übrigens von mir. Er hing an einem alten Anleger am Südufer fest, ein kleines Stück flussaufwärts vom Deptford Creek. Das Ungewöhnlichste daran ist, dass er anscheinend von Kopf bis Fuß in diesen leinenartigen Stoff da eingewickelt war, den Sergeant Buckle gerade eintütet. Ein großes Stück, ungefähr so groß wie ein Bettlaken für ein Einzelbett, und dann noch sehr viel schmalere Streifen aus demselben Material, mehrere Meter lang. Die Streifen sind etwas über zwanzig Zentimeter breit, aus einer Art dicht gewobenem Baumwollstoff. Sie sind auf beiden Seiten von Hand gesäumt. Das ist also nicht einfach nur ein in Streifen gerissenes altes Bettlaken.«
»Männlich oder weiblich?«, wollte Anderson wissen. »Jung? Alt? Tot oder lebendig, als der oder die Betreffende im Fluss gelandet ist?«
Buckle legte die Tüte mit dem Stoff hinter sich. »Im Moment können wir Ihnen sehr wenig sagen. Keine Fingerabdrücke mehr möglich und ganz sicher keinerlei besondere Kennzeichen oder Ausweispapiere. Die Größe des Skeletts und das Vorhandensein von langen Haarresten würden auf eine Frau schließen lassen, aber ich kann zum Beispiel nicht ausschließen, dass es sich um einen jungen Sikh handelt.«
»Sie kann nicht am Leben gewesen sein, als sie ins Wasser geworfen worden ist«, meinte Lacey. »Das Leichentuch war mit absoluter Präzision befestigt. Wenn wir reingehen, können wir Ihnen Fotos zeigen. Das wäre doch unmöglich gewesen, wenn das Opfer um sein Leben gekämpft hätte.« Buckle furchte die Stirn, ließ Laceys Beharren darauf, dass die Leiche weiblichen Geschlechts sei, jedoch unkommentiert. »Außerdem«, fuhr sie fort, »gab es keinerlei Anzeichen von Blutflecken auf dem Stoff. Natürlich war er verfärbt, aber das war das Werk des Flusses und des Schlamms.«
»Da ist was dran«, bemerkte Buckle. »Außerdem ist das Skelett mehr oder weniger unversehrt, obwohl die Verwesung weit fortgeschritten ist. Für eine Wasserleiche ist das etwas sehr Ungewöhnliches.«
»Die Gezeiten und die Strömung knallen sie gegen alle möglichen harten Gegenstände, richtig?«, fragte Stenning.
»Und verursachen dabei massive Schäden«, bestätigte Buckle. »Und das, noch bevor man Dinge wie Schiffsschrauben mit einkalkuliert. Nach einer Woche ziehen wir fast nie Leichen mit intakten Knochen aus dem Wasser.«
»Sie war beschwert«, sagte Lacey. »Irgendwie hat sie sich losgemacht, aber der Stoff ist an dem Anleger hängen geblieben. Irgendwann letzte Nacht, würde ich sagen, sonst hätte sie schon gestern Abend jemand gesehen.«
»Und Ihre Beweise dafür?« Jetzt machte Buckle ein belustigtes Gesicht. Die beiden anderen auch. Nun, sie konnte ja nicht einfach vergessen, dass sie früher mal Detective gewesen war.
»An den Nylonschnüren um die Taille und um die Füße waren die Gewichte befestigt«, erklärte Lacey. »Es wurde synthetisches Material benutzt, weil sich das nicht zersetzen würde. Wir sollten sie eigentlich nicht finden.«
»Ach ja?«, ließ sich eine neue Stimme vernehmen.
Alles drehte sich nach der Frau um, die leise die Gangway heruntergekommen war. Eine junge, schlanke Frau in einem hellgrünen Hosenanzug; ihr schulterlanges schwarzes Haar hob sich in der Brise. »Hallo, Lacey«, sagte Detective Inspector Dana Tulloch.
»Guten Morgen, Ma’am.« Lacey sah, wie DI Tulloch kurz auf die Leiche hinabblickte und dann wieder sie musterte.
»Alles okay?«, fragte Tulloch.
»Vollkommen«, versicherte Lacey und überlegte, ob das vielleicht ein kleines bisschen zu schnell und zu fröhlich gewesen war, um völlig überzeugend zu wirken.
»Sind Sie hier fertig, Scott?« Andersons Blick, bemerkte Lacey, zuckte zwischen den beiden Frauen hin und her, und er sah ziemlich nervös aus. Nicht ohne Grund. Als er seine Vorgesetzte und Lacey das letzte Mal zusammen gesehen hatte, hatte er sie praktisch davon abhalten müssen, aufeinander loszugehen.
Buckle hob mit einer Sie-gehört-Ihnen-Geste die Hände, ehe er sich an Lacey wandte. »Sie müssen jetzt nach Hause. Ich schau mal, ob eins von den Booten Sie hinschippern kann. Das Wasser sollte noch hoch genug sein.«
»Also, eigentlich«, sagte Tulloch mit jenem kleinen, akkuraten Lächeln, das Lacey fürchten gelernt hatte, »hätte ich es gern, dass Lacey mit uns in die Gerichtsmedizin fährt, wenn sie sich dazu in der Lage fühlt.«
Lacey warf Buckle einen raschen Blick zu. »Ich?«, fragte sie, an Tulloch gewandt.
»Ja. Ich möchte genau wissen, was Sie heute Morgen auf dem Fluss gemacht haben. Gehen wir?«
8Pari
Die Kopfschmerzen wurden schlimmer. Der Schmerz war heute Morgen stark, er hatte sie vor dem Morgengrauen geweckt. Pari hatte mit geschlossenen Augen dagelegen und darauf gewartet, dass das Pochen in ihrem Schädel entweder einen Grad erreichte, wo sie sich übergeben musste, oder so weit nachließ, dass sie aufstehen konnte. Sie hatte sich noch immer nicht gerührt.
Das Fenster war offen. Sie machte es nicht mehr zu. Zum Teil, weil dann das Gefühl des Eingesperrtseins fast unerträglich wurde, und zum Teil, weil die Brise manchmal einen Geruch herbeitrug – nach heißem Öl, Orangen und Kardamom oder auch nur den schlichten Duft von bratendem Lammfleisch –, der sie an zu Hause erinnerte.
Durch das offene Fenster drangen die Geräusche des Flusses herein. Der starke Motor eines Bootes, Befehle, die übers Wasser gerufen wurden, eine zeternde Möwe, die wissen wollte, was der ganze Aufruhr sollte.
Pari stemmte sich hoch und stieg aus dem Bett. Dann reckte sie sich zu ihrer vollen Größe auf – was nicht sehr viel war – und drückte das Gesicht durch den kleinen freien Raum, der zu der Verbindung zwischen ihr und der Welt geworden war, die sie verloren hatte.
Frühmorgendliches Sonnenlicht schimmerte auf den Fenstern auf der anderen Seite der schmalen Wasserstraße draußen, aber nur auf denen im oberen Stockwerk. Der Kanal unter ihr war zu tief und zu eng, als dass die Sonne jemals das Wasser erreicht hätte. Die unteren Fenster jedoch fungierten als düstere Spiegel, und eins davon ermöglichte es ihr gelegentlich zu sehen, was auf dem Fluss geschah.
Ein Boot mit blauem Rumpf und weißer Kabine, das im Fluss seine Position hielt. Ein Polizeiboot.
Hier bin ich! Helft mir!
Die Worte blieben in Paris Kopf. Diese fremden Polizisten würden ihr nicht helfen. Die Polizei in ihrem Heimatland hatte ihr auch nicht geholfen, warum sollten sie es hier tun? Sie atmete ein letztes Mal frische Luft ein und drehte sich dann wieder zu dem Zimmer um, das sie am Anfang so fröhlich begrüßt hatte, wie eine Anzahlung auf das Versprechen eines besseren Lebens, und fragte sich, ob sie vielleicht darin sterben würde.
9Dana
»Haben diese Trottel in Wapping etwa wieder mit meinen Leichen rumgemacht?« Ein halb aufgegessenes Brötchen mit Rührei in der einen und eine knallrote Brille in der anderen Hand, kam der Gerichtsmediziner in den Raum geschritten. Er war Ende vierzig, groß, mit mächtigem Brustkorb, dichtem grauen Haar und leuchtend blauen Augen.
»Wenn’s im Wasser treibt, machen wir damit rum«, erwiderte Lacey. »Schön, Sie wiederzusehen, Dr. Kaytes. Neue Brille?«
Dana sah, wie Mike Kaytes unverwandt auf Lacey herabschaute, ehe er die Brille in die Tasche seinesOP-Kittels schob. »Ich sollte wohl dankbar sein, dass Sie mir zur Abwechslung mal eine gebracht haben, die noch in einem Stück ist.«
Einen Moment lang verstand Dana gar nichts. Dann ging ihr auf, dass Kaytes sich bestimmt noch vom letzten Sommer her an Lacey erinnerte, als er gebeten worden war, diverse Körperteile zu untersuchen, die im Stadtgebiet von London deponiert worden waren. Natürlich erinnerte er sich an sie. Gab es überhaupt einen lebendigen Mann, der Lacey Flint vergaß, nachdem sie einmal auf seinem Radar aufgetaucht war?
Die meisten Frauen konnten das Reizvolle nicht sehen, das dicht unter Lacey Flints Oberfläche schimmerte. Sie sahen eine Frau, die nicht sehr groß war, die ihre Athletenfigur unter weiter, schlichter Kleidung verbarg, die auf ihrem vollendet geformten, aber ansonsten wenig bemerkenswerten Gesicht nur selten Make-up trug und sich das lange, helle Haar entweder zum Pferdeschwanz band oder zum Zopf flocht. Aus irgendeinem Grund, den Dana noch nicht herausbekommen hatte, wollte Lacey Flint nicht bemerkt werden. Bei ihren Geschlechtsgenossinnen klappte das meistens auch.
»Die da ist aber nicht in einem Stück«, meinte Lacey und zeigte auf die Gestalt in dem schwarzen Sack auf dem Untersuchungstisch. »Die meisten Weichteile sind weg.«
Kaytes biss in sein Brötchen, und Dana sah, wie Eigelb gefährlich weit herausquoll und fast auf den Boden tropfte. Nun, die Absaugvorrichtung hatte schon Schlimmeres geschluckt.
»Also, es liegt mir ja fern, den Fachleuten zu widersprechen«, nuschelte er. »Könnt ihr mal den Sack abmachen, Mädels?«
Die beiden Labortechnikerinnen, die beide nicht aussahen, als wären sie unter vierzig, warteten bereits bei dem verpackten Leichnam in der Mitte des Raumes. Gemeinsam öffneten sie den Sack und zogen ihn unter der Leiche hervor. Die eine schaltete die starke Deckenlampe ein, die andere die Absaugvorrichtung, die während der ganzen Untersuchung ein hungriges, schlürfendes Geräusch machte.