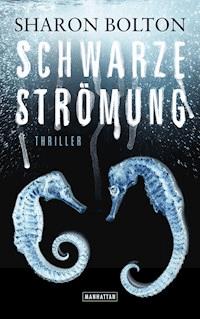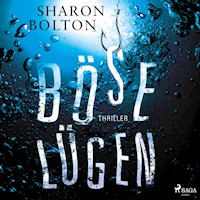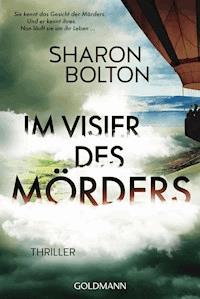9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Anlässlich der Beerdigung des ehemaligen Sargtischlers und Mörders Larry Glassbrook kehrt die Polizistin Florence Lovelady mit ihrem Sohn Ben zurück nach Lancashire – in die Stadt des spektakulären Falls, der einst ihre Karriere begründete. 1969 wurden dort mehrere Jugendliche vermisst. Es stellte sich heraus, dass sie entführt und in Särgen lebendig begraben worden waren. Florence gelang es, Grassbrook dieser grausamen Taten zu überführen und ihn lebenslang hinter Gitter zu bringen. Doch kaum ist der vermeintliche Mörder von damals selbst unter der Erde, mehren sich die Zeichen, dass der Schatten des Bösen weiter reichen könnte als vermutet ...
Der erste Fall für Florence Lovelady: »Brillant gemachter Nervenkitzel« (The Guardian)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Anlässlich der Beerdigung des verurteilten Mörders Larry Glassbrook kehrt die Polizistin Florence Lovelady mit ihrem Sohn Ben zurück nach Lancashire – in die Stadt des spektakulären Falls, der einst ihre Karriere begründete. 1969 wurden dort mehrere Jugendliche vermisst. Es stellte sich heraus, dass sie entführt und in Särgen lebendig begraben worden waren. Florence gelang es, den Sargbauer Larry Grassbrook dieser grausamen Taten zu überführen und ihn lebenslang hinter Gitter zu bringen. Doch kaum ist der vermeintliche Mörder von damals selbst unter der Erde, mehren sich die Zeichen, dass der Schatten des Bösen weiter reichen könnte als vermutet.
Weitere Informationen zu Sharon Bolton sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sharon Bolton
Der Schatten des Bösen
Thriller
Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Craftsman« bei Trapeze, an imprint of the Orion Publishing Group, London. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2019
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Uta Rupprecht
mb · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-23263-4 V002
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Carrie
»Im Norden herrscht die Dunkelheit.«
Jeanette Winterson, The Daylight Gate
Teil 1
»Ich hab mich vollgeschluckt mit so viel Grauen.«
William Shakespeare, Macbeth
1. Kapitel
Dienstag, 10. August 1999
Am heißesten Tag des Jahres ist Larry Glassbrook zum letzten Mal in seine Heimat Lancashire zurückgekehrt, und die Leute aus der Stadt sind gekommen, um ihn zu verabschieden.
Nicht auf freundliche Art und Weise.
Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber die Menschenmenge vor der Kirche scheint während des kurzen, unterkühlten Trauergottesdienstes größer geworden zu sein. Viele sind früh gekommen, um sich wie Zuschauer vor einer großen Parade einen guten Platz zu sichern.
Überall, wo ich hinschaue, zwischen Grabsteinen und entlang der Friedhofsmauer stehen Leute, sie säumen die Wege wie eine gespenstische Ehrengarde. Als wir dem Sarg hinaus ins grelle Sonnenlicht folgen, sehen sie uns an, ohne sich zu rühren oder etwas zu sagen.
Die Presse ist in voller Mannschaftsstärke erschienen, obwohl das Datum so lange wie möglich geheim gehalten wurde. Uniformierte Polizisten drängen die Medienleute zurück, halten die Wege und das Kirchenportal frei, aber die Fotografen haben Trittleitern und riesige Teleobjektive mitgebracht. Die runden, flauschigen Mikrofone der Berichterstatter sehen aus, als könnten sie noch das Huschen der Kirchenmäuse einfangen.
Ich halte den Blick gesenkt, schiebe die Sonnenbrille auf der Nase noch ein wenig höher, obgleich mir klar ist, dass ich inzwischen ganz anders aussehe. Dreißig Jahre sind eine lange Zeit.
Ein paar Meter vor mir laufen dicke Schweißperlen über die Nacken der Sargträger. Die Männer ziehen eine Geruchsspur hinter sich her, einen Dunst von Aftershave und biergesättigtem Schweiß, von nicht oft genug gereinigten Anzügen.
Das Niveau ist seit Larrys Zeiten deutlich gesunken. Die Angestellten des Beerdigungsunternehmens Glassbrook & Greenwood trugen Anzüge, so schwarz wie frisch geschlagene Kohle. Ihre Schuhe und ihr Haar glänzten, und sie rasierten sich so gründlich, dass sie immer gereizte, wunde Haut hatten. Larrys Männer trugen die Särge voller Ehrfurcht, wie die Kunstwerke, die sie waren. Solche billigen Furniersärge wie den da vor mir hätte es bei Larry niemals gegeben.
Zu wissen, dass seine eigene Beerdigung nicht die Anforderungen erfüllen würde, auf denen er immer bestanden hatte, könnte durchaus eine bittere Enttäuschung für Larry gewesen sein. Andererseits hat er vielleicht auch gelacht, laut und gemein. So, wie er es manchmal getan hatte, wenn man es am wenigsten erwartete und besonders erschreckend wirkte. Und dann fuhr er sich vielleicht mit den Fingern durch sein schwarzes Haar, zwinkerte anzüglich und tanzte weiter zu den Elvis-Songs, die er in seiner Werkstatt unablässig hörte.
Noch nach all dieser Zeit bekomme ich Herzrasen beim bloßen Gedanken an die Musik von Elvis Presley.
Wie ein riesiges krabbelndes Insekt ändern der billige Sarg und seine Träger die Richtung und verlassen den Weg. Während wir nach Süden auf das Familiengrab der Glassbrooks zuhalten, brennt die Hitze so heftig auf unseren Gesichtern wie die Bühnenscheinwerfer einer heruntergekommenen Musicalhalle. In Lancashire, so weit oben auf dem Hochmoor, sind heiße Tage selten, heute jedoch scheint die Sonne fest entschlossen zu sein, Larry schon einmal einen Vorgeschmack auf die Temperaturen zu geben, die in seinem nächsten Kerker auf ihn warten.
Ich frage mich, was wohl auf seinem Grabstein stehen wird: Treu ergebener Ehemann, liebevoller Vater, gnadenloser Mörder.
Während seine letzten Minuten über der Erde verstreichen, scheint die Menge gleichzeitig vorwärtszudrängen und zurückzuweichen, wie ein verwirrtes Meer, das nicht mehr genau weiß, ob Ebbe oder Flut ist.
Da sehe ich aus dem Augenwinkel die Teenager, halb verborgen hinter dem Rand meiner Sonnenbrille. Ein Junge und zwei Mädchen, klein, dürr, in grellbunten Polyesterklamotten. Die Blicke der Erwachsenen huschen auf dem Friedhof umher, mustern zornig die Trauergäste, streifen nervös die Polizisten und betrachten neugierig die Medienleute. Die Teenager haben nur Augen für die Hauptperson unter den Trauernden, für die Frau, die unmittelbar hinter dem Pfarrer dahinschreitet, direkt vor mir.
Sie ist schön, was ihr mit fünfzehn niemand prophezeit hätte. Ihr Haar ist jetzt honigblond, und ihr Körper hat sich gerundet. Sie sieht nicht mehr aus wie eine Marionette, deren Kopf zu groß für den dürren Strichmännchen-Körper ist. Ihre Augen, die einen immer anstarrten wie die eines erschrockenen Buschbabys in einer Tiersendung, haben jetzt genau die richtige Größe für ihr Gesicht. Der Stoff ihres schwarzen Kleides ist so glatt und frisch, dass es erst vor Kurzem gekauft worden sein muss.
Gemurmel und Flüstern verraten, dass die Zuschauer uns folgen. Die Frau in dem neuen schwarzen Kleid schaut sich um. Unwillkürlich tue ich es ihr gleich und bemerke, dass auch die drei Teenager hinter uns gehen.
Bei ihrem Anblick schmerzt die Wunde an meiner linken Hand. Ich klemme sie mir in die rechte Achselhöhle und drücke mit dem Oberarm ganz sachte dagegen, um den Schmerz zu lindern. Das hilft ein bisschen, aber ich kann spüren, wie mir der Schweiß zwischen den Schulterblättern nach unten rinnt. Der Vikar ist kaum gelassener als ich. Er hat sein Taschentuch gezückt, wischt sich den Nacken ab und tupft die Stirn trocken, doch er stimmt die Bestattungsgebete mit der Miene eines Mannes an, der weiß, dass das Ende in Sicht ist. Zum vorgegebenen Zeitpunkt lassen die Sargträger die Seile, die sie halten, langsam durch die Hände gleiten, und schwankend senkt sich der Sarg immer tiefer hinab, bis wir ihn nicht mehr sehen können.
Da bricht es los. Ich sehe meine eigenen Gedanken in den Augen der Umstehenden gespiegelt, und ein Wispern aufgewühlter Energie wogt durch die Menge.
»Besser als du’s verdienst, du Dreckskerl!«, ruft eine Stimme von hinten.
Genau das hat Larry mit seinen jungen Opfern gemacht, er hat sie in die Erde hinabgesenkt. Nur waren sie nicht tot.
Einer der Teenager, der Jüngste, ist ein Stück von seinen Freundinnen weggeschlendert und versteckt sich halb hinter einem Grabstein. Mit verschlagener Neugier späht er zu mir herüber. Stephen, der Name fällt mir rasch wieder ein. Der magere Bengel in dem blauen Hemd ist Stephen.
Ein nassgeschwitzter Sargträger bietet mir Erde an, also nehme ich eine Handvoll und gehe auf das Grab zu. Auf dem Sargdeckel liegen keine Blumen, in der Kirche waren auch keine. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal eine Kirche ohne Blumen gesehen zu haben, und habe jäh die Vision, wie die Frauen der Gemeinde gestern Abend still und ernst dort hineingegangen sind, um sie wegzuräumen, weil Blumen für diese Beerdigung nicht angemessen sind.
Dicht an der Friedhofsmauer, hinter der Menge kaum zu sehen, steht der Mann, der damals in dieser Kirche Küster war. Jetzt trägt er einen schwarzen Anzug. Er blickt nicht auf, und ich glaube nicht, dass mein alter Freund mich gesehen hat.
Ich werfe die Erde hinab und bin mir der Tatsache bewusst, dass hinter mir auch den anderen Trauergästen Erde angeboten wird. Sie schütteln höflich die Köpfe. Die Erde anzunehmen war also falsch. Das hat alle auf mich aufmerksam gemacht. Wieder einmal.
Die Gebete sind zu Ende. »Richtet nicht«, improvisiert der plötzlich mutig gewordene Vikar, »auf dass ihr nicht gerichtet werdet.« Dann verneigt er sich vor niemand Bestimmtem und eilt davon.
Die Sargträger verschwinden. Ich trete ebenfalls zurück, und die Frau mit dem honigblonden Haar bleibt am Grab allein.
Nicht lange. Die Zuschauer stacheln sich gegenseitig an, langsam schiebt sich die Masse vorwärts. Auch die Teenager kommen näher, allerdings sind sie im hellen Sonnenlicht schwerer zu sehen als die Erwachsenen.
Die Zuschauer bleiben stehen. Die Frau in Schwarz sieht sie unverwandt an, doch keiner erwidert ihren Blick. Dann tritt eine Frau in den Sechzigern vor, bis ihre Füße in den Sandalen mit den dunkel geränderten Zehennägeln ganz am Rande des Grabes stehen. Ich kenne diese Frau. Vor Jahren ist sie auf mich losgefahren, als Unglück und Zorn sie jeglichen Anstand vergessen ließen. Ich kann mich erinnern, wie sie mir den dicken Finger beinahe ins Gesicht rammte, ich rieche noch ihren bitteren Atem, als sie sich vorbeugte und mit ihren Drohungen und Anschuldigungen auf mich einstach. Ihr Name ist Duxbury; sie ist die Mutter von Susan, Larrys erstem Opfer.
Am Rand von Larrys Grab holt sie tief Luft, beugt sich vor und spuckt aus. Möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben. Die Spucke tröpfelt dünn. Falls sie beim Aufprall auf das Holz ein Geräusch macht, so höre ich es nicht. Der Nächste, der auf das Grab zutritt, hat mehr Übung. Ein gewaltiger, stiernackiger Mann mit Glatze, wahrscheinlich jünger, als die Furchen in seiner Haut andeuten. Er räuspert sich einmal, und dann klatscht ein Schleimklumpen, so zäh wie trocknende Ölfarbe, auf den Sarg. Einer nach dem anderen folgen die Umstehenden seinem Beispiel, bis der Sarg dort unten von Spuckeblumen übersät sein muss.
Der Letzte von denen, die ans Grab treten, ist ein alter Mann, dünn und dunkelhäutig, Augen wie Steine. Er sieht sich um.
»Is’ nichts Persönliches, Mädchen«, sagt er zu der Frau in Schwarz, während ich versuche, mir etwas Persönlicheres vorzustellen, als auf ein Grab zu spucken. »Dir haben wir nie die Schuld gegeben.« O-beinig und arthritisch humpelt er davon.
Eine Minute lang, vielleicht auch länger, steht die Frau in Schwarz regungslos da und starrt blicklos vor sich hin. Dann geht sie, ohne sich noch einmal umzusehen, über den Rasen zum Weg. Dabei wappnet sie sich vielleicht für den Spießrutenlauf vorbei an den Reportern und Fotografen. Während der Trauerfeier haben sie sich zurückgehalten, aber sie sind nicht hergekommen, um mit leeren Händen wieder abzuziehen.
Ich gehe ihr nach, doch ein Geräusch lässt mich aufhorchen, und ich bleibe stehen. Hinter mir am Grab höre ich, wie die Teenager hohe, saugende Laute von sich geben, sie versuchen, die Erwachsenen nachzuahmen und auf Larrys Sarg zu spucken. Sie haben wohl bessere Gründe als die meisten anderen, doch was sie da tun, erscheint mir dürftig und unter ihrer Würde. Ich überlege, ob ich mit ihnen reden, ihnen sagen sollte, dass es Zeit ist, all das hinter sich zu lassen, doch als ich mich umdrehe, sind sie nirgends zu sehen. Diese Kinder wandeln seit dreißig Jahren nicht mehr auf Erden, und doch kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass die Frau in Schwarz sie ebenfalls gesehen hat.
2. Kapitel
Was Patricia Wood in den Stunden nach ihrem Verschwinden erleiden musste, werde ich niemals genau herausfinden. Das sollte ich wohl als einen Segen betrachten.
Nachdem wir sie gefunden hatten, beteuerten alle, sie könnten es nicht ertragen, auch nur darüber nachzudenken, das sei doch alles viel zu schrecklich, um es sich vorzustellen, man sollte sich so etwas wirklich nicht gründlicher ausmalen.
Könnte ich doch nur anders. Fantasie ist ein wertvolles Werkzeug, von entscheidender Bedeutung für jeden Detective, der sein Geld wert ist. Aber sie ist auch das allerschwerste Kreuz, das wir zu tragen haben.
Und so stelle ich mir vor, dass Patsy ganz langsam wieder zu sich kam, und ihr erster klarer Gedanke war, dass ihr das Atmen schwerfiel. Der Stoff, der ihr Gesicht bedeckte, war sehr leichter Satin, doch in dem engen Raum voll verbrauchter Luft muss es sich angefühlt haben, als ersticke er sie.
Sie wird einen fürchterlichen Geschmack im Mund gehabt haben, auch weil sie seit etlichen Stunden nichts mehr getrunken hatte. Aber das Schlimmste in jenen ersten Minuten ohne die leiseste Ahnung, wo sie sich befand und wie sie dorthin gekommen war, war mit Sicherheit die Desorientiertheit. Jegliche Erinnerung, die sie mühsam heraufbeschwören konnte, dürfte nur halb ausgeformt gewesen sein, eine Masse unzusammenhängender Bilder und Gesprächsfetzen. Sie wird versucht haben, die Augen zu öffnen, wird sie wieder zugemacht und erneut geöffnet … und überhaupt keinen Unterschied bemerkt haben.
Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wird sie versucht haben, sich zu bewegen. Sich aufzusetzen. Und dann, als sie begriff, dass sie in einem sehr engen Raum eingesperrt war, dürfte die Panik richtig eingesetzt haben.
Natürlich war es noch viel schlimmer. Patsy befand sich tief unter der Erde. Lebendig begraben.
3. Kapitel
Beim Verlassen des Friedhofs starren mich ein paar der älteren Reporter an, mit zusammengekniffenen Augen kramen sie in ihrem Gedächtnis. Es war die richtige Entscheidung, heute keine Uniform anzuziehen. Wenn sie genug Zeit hätten, würden sie mich erkennen, aber ich lasse ihnen keine Zeit. Ich dränge mich durchs Tor und gehe den Hügel hinauf zu meinem Auto. Außerdem interessieren sie sich viel mehr für die Frau in dem modischen schwarzen Kleid, die mit dem honigblonden Haar. Nur mit einer Polizeieskorte schafft sie es durch die Menge, und ich erhasche einen kurzen Blick auf sie, als der Wagen, der auf sie gewartet hat, losfährt. Vom Beifahrersitz aus sieht sie mich an. In der Kirche hat sie nicht zu erkennen gegeben, dass sie meine Anwesenheit überhaupt wahrgenommen hat. Ich habe vermutet, sie hätte mich vergessen und hielte mich für eine der Schaulustigen. Dieser Blick durch das dunkel getönte Fenster verrät mir, dass sie sich sehr gut an mich erinnert.
Als ich damals nach Sabden übersiedelte, hatte ich es vorgezogen, bei den Glassbrooks zur Untermiete zu wohnen, und nicht in einer der anderen Pensionen. Diese Familie hatte etwas Exzentrisches, das mir gefiel. Die Glassbrooks waren irgendwie anders als die meisten Leute, denen ich sonst in der Stadt begegnete. Ich sah in ihnen eine kleine Schar farbenfroher exotischer Vögel inmitten eines Schwarms kleiner staubgrauer Spatzen. Schon nach ein paar Wochen in Lancashire war mir sehr klar, wie ungewöhnlich ich den Leuten um mich herum vorkam. Wahrscheinlich war ich auf der Suche gewesen nach Menschen vom gleichen Schlag. Nicht mein einziger Fehler in dieser Stadt.
Sie wohnten in einem großen Haus am Stadtrand von Sabden. Die schmale Kiesauffahrt ist jetzt völlig von Unkraut überwuchert, Löwenzahnsamen treiben auf mich zu wie eine schwebende Armee. Moos bedeckt die niedrige Mauer, die den abfallenden Garten im Zaum hält, und das Gras zwischen den Obstbäumen ist seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, nicht mehr gemäht worden. Jetzt ist dort eine kleine Wiese. Die Büschel des weißen Wiesenkerbels reichen fast bis an die untersten Äste der verwahrlosten Obstbäume, wo Wespen um bereits verfaulte Pflaumen herumsurren. Hunderte von Äpfeln hängen an den Bäumen, doch sie sind klein und wurmstichig. Breiiger Mulch am Fuß jedes Baumes deutet darauf hin, dass die Früchte seit Jahren einfach abfallen und verrotten.
Ich fahre um die einzige Biegung der Auffahrt und sehe das Haus vor mir. Eine Villa, Anfang des 20. Jahrhunderts für einen Fabrikdirektor oder einen Wollhändler erbaut. Die Farbe der Haustür mit den beiden Säulen daneben ist abgeblättert, die Scheiben der riesigen Erkerfenster sind schmutzig und haben hier und da Sprünge. Das war das Wohnzimmer der Untermieter, wo ich die Abende verbrachte, wenn ich keinen vernünftigen Vorwand fand, auf dem Revier zu bleiben, und es mir in meinem Zimmer zu einsam war. Die beiden anderen Untermieter waren Männer. Ein weiterer Police Constable namens Randall – genannt Randy – Butterworth und Ron Pickles, ein stiller, dicklicher Mann Mitte vierzig, der bei Larry im Beerdigungsinstitut arbeitete. Manchmal unterhielten wir uns oder spielten Karten, meistens jedoch starrten wir auf den flimmernden Bildschirm des kleinen Schwarz-Weiß-Fernsehers. Man munkelte, dass die Familie in dem größeren Wohnzimmer, das auf den Garten hinausging, einen Farbfernseher hatte, doch das blieb ein Gerücht.
Der kleine Fernseher ist immer noch da, und auch die Sessel mit dem Kunststoffbezug, die sich im Sommer klebrig und glitschig anfühlten und im Winter zu kalt, um gemütlich zu sein. Abgesehen von kaputten Glühbirnen, deren Scherben auf dem Teppich verstreut sind, feuchten Flecken an den Wänden und den schmutzigen Fenstern ist das Wohnzimmer der Untermieter noch genauso, wie ich es in Erinnerung habe.
Ich folge dem Weg zur Rückseite des Hauses, den Blick fest auf die Mauern und Fenster gerichtet. Im Familienwohnzimmer sind die Vorhänge zugezogen, aber an diesen Raum kann ich mich sowieso kaum erinnern. Man hatte mich nie hineingebeten. Die Hintertür ist offen.
Ich trete näher und schaue in den Raum, den sie die hintere Küche nannten. Er ist klein, mit einem riesigen Spülstein und fleckigen Arbeitsplatten aus Holz. Auf Regalen an den Wänden stehen verstaubtes Geschirr, trübe Gläser und riesige Kupfertöpfe. Meine Mutter hätte so etwas als »Butler’s Pantry« oder Anrichteraum bezeichnet, aber das Wort »Butler« stand 1969 nicht im Lexikon der Menschen in Sabden.
»Hallo?«, sage ich.
Keine Antwort. Ein schmerzhafter Stich durchzuckt meine linke Hand bis hinauf zum Ellenbogen, als ich eintrete. Durch die gegenüberliegende Tür würde ich in die größere Küche gelangen, wo Sally damals für ihre Familie und die Untermieter kochte. Ihre Tränke und Arzneien, wie Larry sie nannte, wurden hier in diesem Raum zubereitet und in einem begehbaren Schrank neben der Hintertür verwahrt. Sie hatte einen Gasherd, auch 1969 schon uralt, um die Kräuter und Wurzeln zu kochen. Er ist noch da.
Ich höre ein leises Summen hinter mir, drehe mich um und sehe, dass irgendwie Bienen hereingeraten sind. Herein, aber nicht wieder hinaus; über ein Dutzend kleine schwarz und orangegelb gestreifte Leichen liegen auf dem Fensterbrett. Sally hat Bienen gehalten. Ganz hinten im Garten standen vier Bienenstöcke, und während des Frühlings und des Frühsommers, die ich hier verbrachte, ging sie oft hin, um sie zu füttern oder zu inspizieren, in schwere weiße Gaze gehüllt und mit dicken Handschuhen. An warmen Tagen saß sie da und schaute den Arbeiterinnen bei ihren vorhersagbaren Flugrouten zu, wenn sie aus dem Stock hervorschossen und zu den Blumen surrten.
Sie hatte eine Angewohnheit, die ich merkwürdig, aber liebenswert fand – sie achtete darauf, dass die Bienen jede wichtige Neuigkeit in der Familie erfuhren. Als Cassie, ihre ältere Tochter, ein Musikstipendium bekam, wurde sie gleich hinausgeschickt, um es den Bienen zu sagen. Die Nachricht vom Tod von Larrys Tante wurde den Bienen überbracht, noch bevor Verwandte davon in Kenntnis gesetzt wurden. Unheil käme über das Haus, erklärte mir Sally, wenn man die Bienen im Ungewissen ließe.
»Kann ich Ihnen helfen?«, sagt jemand in einem Ton, der darauf schließen lässt, dass mir zu helfen das Letzte ist, was ihr einfallen würde. Ich drehe mich um und sehe eine stämmige, grauhaarige Frau Mitte siebzig in der Tür stehen. Rasch krame ich in meiner Tasche und hole meinen Dienstausweis der Londoner Polizei heraus. In Lancashire habe ich keinerlei Befugnis, aber ich bezweifele, dass sie das weiß.
»Assistant Commissioner Florence Lovelady«, stelle ich mich vor. »Ich suche die Familie Glassbrook.«
»Die wohnen schon seit Jahren nicht mehr hier«, verkündet sie mit dem triumphierenden Tonfall, mit dem sie schlechte Nachrichten stets zu überbringen pflegte.
Ich kenne diese Frau. Sally hatte eine Haushaltshilfe, die jeden Tag kam, um beim Kochen und Putzen zu helfen. Diese Frau hat mir fünf Monate lang Frühstück und Abendessen serviert, an sechs Tagen die Woche, und mir alle zwei Wochen einen Satz frische Nylonbettwäsche in mein Zimmer gebracht. Sie klopfte nie an, bevor sie hereinmarschierte, sondern rief lediglich »Bettwäsche«, bevor sie den Stapel auf mein Bett warf. Von mir wurde stets erwartet, dass ich mein Bett selbst bezog, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das für die Männer, die hier zur Untermiete wohnten, persönlich übernahm. Sie war die Sorte Frau, die mit Freuden Männer bediente, es aber für unter ihrer Würde hielt, dasselbe für eine Frau zu tun, vor allem für eine, die jünger war als sie. Ende der Sechziger gingen die schlimmsten Diskriminierungen, mit denen ich wegen meines Geschlechts konfrontiert war, immer von anderen Frauen aus.
Ich lasse den Blick über die staubigen Arbeitsflächen und die toten Insekten wandern und bemerke: »Es wundert mich, dass sie das Haus nicht verkauft haben.«
»Die Mädchen wollten auch verkaufen. Sally war’s, die es unbedingt behalten wollte.«
»Sie sind Mary, nicht wahr? Ich habe mal hier gewohnt, 1969.« Ich füge nicht hinzu: »Als es damals passiert ist.« Das ist wohl kaum notwendig.
Sie mustert mich mit zusammengekniffenen Augen.
»Die Glassbrooks haben mich Flossie genannt«, helfe ich widerwillig nach. »Mein Haar war damals anders. Sehr viel röter als jetzt.«
»Richtig rot«, meint sie. »Karottenrot.«
»Wie geht es Ihnen, Mary?«, frage ich sie.
»Und Sie waren von oben bis unten voller Sommersprossen.« Sie kommt einen Schritt näher, als wollte sie nachsehen, ob ich immer noch welche habe. Habe ich auch, allerdings sind sie im Laufe der Zeit verblasst. »Sie sind immer knallrot geworden, wenn jemand sich über Sie lustig gemacht hat.«
»Wissen Sie, wo Sally jetzt ist?«, erkundige ich mich.
»Im Northdean-Pflegeheim in Barley«, antwortet sie. »Sie wird nicht mit Ihnen reden.«
Ich halte immer noch meinen Dienstausweis in der Hand. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich mal umsehe?«
»Von mir aus«, sagt sie. »Ich brauche Kartoffeln. Dann schließe ich ab.«
Sie lässt mich stehen und geht hinüber zum Gemüsegarten, und ich wandere allein tiefer ins Haus hinein. Die Tür zum Wohnzimmer mache ich nicht auf – alte Gewohnheiten wird man schwer los –, und das Wohnzimmer der Untermieter interessiert mich nicht, also gehe ich stattdessen durch den Flur mit der hohen Decke, bis ich fast an der Haustür bin. Dort biege ich ab und steige die Treppe hinauf. Mein Zimmer war das kleinste der Untermietzimmer, es liegt ganz hinten im Haus, mit Blick auf den Hügel.
Die Tür klemmt, und einen Moment lang bin ich versucht, das als Zeichen zu nehmen, dass es nichts bringt, alte Erinnerungen aufzuwärmen. Aber meine Sturheit hat sich schon immer gegen meinen Instinkt durchgesetzt, und ich drücke mit aller Kraft dagegen.
Der gehäkelte Bettüberwurf – fliederfarben und blau –, den ich gehasst habe, ist immer noch da, aber seine Farben sind verblasst, weil er jahrelang dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Das schmale Bett unter dem Fenster ist bezogen, und es würde mich nicht überraschen, wenn das die Bettwäsche ist, in der ich vor all den Jahren geschlafen habe. Wenn man mit forensischen Techniken, die wir in den Sechzigern noch nicht hatten, immer noch Spuren von mir finden könnte. Wer sollte denn schließlich noch hier gewohnt haben, nach allem, was passiert ist? Die Tür des schmalen Kleiderschranks steht offen. Eine Schublade der Kommode neben dem Bett ist nicht richtig zu, und ich sehe darin eine Haarbürste aus Plastik, die vielleicht einmal mir gehört hat.
Es ist, als wäre niemand mehr in diesem Zimmer gewesen, seit ich es in aller Eile verlassen habe. Randy und ich durften nach Larry Glassbrooks Verhaftung nicht mehr in dieses Haus zurückkommen. Unsere Sachen wurden von anderen Polizisten abgeholt, und ich wohnte den Rest meiner Zeit in Lancashire in einer Pension auf der anderen Seite der Stadt.
Die drei Plakate, die ich an die Wand geklebt habe, sind immer noch da.
Vermisst, steht auf dem ersten, und: Haben Sie Stephen Shorrock gesehen? Vermisst, steht auch auf dem zweiten, und: Haben Sie Susan Duxbury gesehen? Auf dem dritten steht ebenfalls Vermisst. Helfen Sie uns, Patsy zu finden. Ich hatte die Plakate gegenüber von meinem Bett aufgehängt, trotz Marys Gemaule, sie seien morbide und die Raufasertapete würde Schaden nehmen. Sie waren das Erste, was ich sah, wenn ich morgens aufwachte, und abends das Letzte.
Als ich vorhin auf das Haus zugegangen bin, habe ich es vermieden, zu Larrys Werkstatt hinüberzuschauen, ein einstöckiges Backsteingebäude ein kleines Stück von der Hintertür entfernt, jetzt jedoch lässt sich das nicht verhindern. Ihr Flachdach befindet sich direkt vor meinem Fenster.
Ich strecke die Hand aus und berühre die Wand, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, und hole tief Luft, obwohl die Luft hier drin stickig und warm ist.
In der Werkstatt hat Larry den größten Teil seiner Zeit verbracht, dort hat er seine Musik gehört – nein, ich will diese Songs nicht in meinem Kopf haben! –, und dort hat er die Körperform- und Truhensärge geschreinert, die die sterblichen Überreste der Verstorbenen von Sabden aufnahmen.
Und auch ein paar sehr unselige lebendige Bewohner dieser Stadt.
4. Kapitel
Nicht alle Särge sind gleich, es gibt unterschiedliche Arten. Ein Körperformsarg ist eine Kiste mit sechs oder acht Seitenteilen, die den Konturen des Körpers nachgebildet ist: schmal am Kopfende, breiter an den Schultern und zu den Füßen hin wieder schmaler zulaufend. Stellen Sie sich vor, wie Dracula aus seinem Sarg steigt. Ein Truhensarg ist größer, rechteckig und hat für gewöhnlich einen hohen, gewölbten Deckel.
Larry Glassbrook stellte beide Formen her, Truhensärge aus Hartholz jedoch waren seine Passion. Ich wohnte 1969 fünf Monate bei seiner Familie, und einmal – vermutlich war ihm langweilig – lud er mich in seine Werkstatt ein. Er hörte beim Arbeiten immer Musik – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Elvis Presley – und machte ab und zu eine Pause, um die Hüften kreisen zu lassen oder sich das dunkle Haar zurückzustreichen. Larry war ein gut aussehender Mann, und er nutzte seine Ähnlichkeit mit dem King of Rock ’n’ Roll nach Kräften. An weiblicher Gesellschaft mangelte es ihm selten, aber um ehrlich zu sein, ich fand ihn ein bisschen gruselig. An seinem Können bestand jedoch kein Zweifel.
Er fing mit dem Deckel an, leimte und presste lange Eichenbretter in einem gerundeten Schraubstock aneinander. Dabei verwendete er starke Verbindungsklammern, um sicherzugehen, dass die Bretter sich nicht verschoben. Die Truhe wurde auf ähnliche Weise gebaut, geleimt, mit Klammern gesichert und mit Querbalken verstärkt, um ihr Stabilität zu verleihen. Larry prahlte gern, seine Truhensärge könnten Männer mit drei Zentnern oder mehr aushalten. Der Deckel wurde mit vier Metallscharnieren und sechzehn Schrauben an der Truhe befestigt.
Niemand entkam aus einem Larry-Glassbrook-Truhensarg, wenn der einmal geschlossen war. Der Fairness halber sei gesagt, dass es auch nur sehr wenige versuchten.
Damals wurden Särge nicht hermetisch versiegelt. Sonst wäre Patsy Wood vielleicht gestorben, ehe sie das Bewusstsein wiedererlangte. Larrys Truhensärge wurden mit einer Methode verschlossen, die er selbst erfunden hatte. Gleich unter dem Rand des Deckels, den äußeren Scharnieren direkt gegenüber, befanden sich unter Zierleisten zwei Schließmechanismen. Wenn der Riegel gedreht wurde, glitt ein kleiner Metallstreifen, der innen unter dem Futterstoff verborgen war, an seinen Platz und verhinderte, dass der Sarg beim Absenken ins Grab oder durch ungeschickte Handhabung aufging. Hätte Patsy gewusst, wo sie tasten musste, und es geschafft, das Satinfutter abzureißen, so hätte sie den Sarg vielleicht entriegeln können.
Dann hätte sie es aber immer noch mit der Tonne Erde darüber zu tun gehabt.
Sie fand die Schlösser nicht, das wissen wir. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, wie sie in dem winzigen Raum, in dem sie sich wiederfand, verzweifelt um sich tastete. Ich denke, dann wird sie geschrien haben, mit lauter, angstvoller Stimme, aber auch zornig. Mit vierzehn können wir uns nicht vorstellen, dass uns etwas wirklich Schreckliches zustößt. Zu diesem Zeitpunkt wird sie noch geglaubt haben, das Opfer eines schlechten Scherzes zu sein, entsetzlich, aber zeitlich begrenzt. Wenn sie laut und lange genug brüllte, dann würden die anderen sie hier herausholen, wo immer sie sich auch befand.
Sie wird die Namen jener gerufen haben, an die sie sich erinnerte, die der Freunde, mit denen sie zusammen war, bevor es passierte. Eine der Fragen, die ich mir stelle, wenn ich an Patsy in dem Sarg denke, ist, wie schnell sie wohl aufgehört hat, nach ihren Freunden zu brüllen, und angefangen hat, nach ihrer Mutter zu rufen.
Ich schätze, weniger als dreißig Minuten, nachdem sie zu sich gekommen war, aber die Zeit vergeht wohl sehr langsam, wenn man tief unter der Erde gefangen ist.
Truhensärge sind größer als Körperformsärge. Sie wird in der Lage gewesen sein, nach oben zu greifen und den glatten, gefältelten Satin nur Zentimeter über ihrem Kopf zu betasten. Ich glaube, dann wusste sie, worin sie steckte. Sie kannte die Glassbrooks. Sie wusste, womit Larry Glassbrook seinen Lebensunterhalt verdiente. Wahrscheinlich hatte sie seine Werkstatt schon einmal betreten dürfen oder sich mit Freundinnen dort hineingeschlichen, um die großen Holzkisten in verschiedenen Stadien der Vollendung zu sehen. Daher wird sie gewusst haben, dass sie in einem Truhensarg gefangen war, obwohl sie wohl einfach »Sarg« gesagt hätte.
Ich stelle mir vor, dass sie verstummte, weil sie glaubte, ihre Kumpels (und natürlich waren es ihre Kumpels, wer sonst würde ihr so einen Streich spielen?) stünden draußen vor dem Sarg und lauschten ihren Schreien. Patsy wird sich gezwungen haben, still zu sein, weil sie dachte, die anderen würden sie schneller herauslassen, wenn sie glaubten, sie wäre wirklich in Gefahr. Vielleicht hat sie sogar ein- oder zweimal gejapst, als bekäme sie kaum noch Luft.
Als das nicht funktionierte, weil es nicht funktionieren konnte – ihre Freunde waren nämlich nicht einmal in der Nähe –, dann hat sie wohl wieder geschrien, denke ich, diesmal laut und aus vollem Hals. Ich weiß nicht, wie lange ein Mensch schreit, bis er einfach nicht mehr kann – ich hoffe, ich finde es nie heraus. Doch irgendwann, vermutlich, nachdem sie etwa eine Stunde lang wieder bei Bewusstsein war, wird Patsy verstummt sein, und wenn auch nur für einige Zeit.
Die Anstrengung wird sie erschöpft haben. Sie keuchte wohl, war heiß und verschwitzt. Ihr wird der Gedanke gekommen sein, dass die Luft wahrscheinlich knapp war. Ich denke, da wird sie angefangen haben, sich Möglichkeiten zu überlegen, um sich zu befreien. Behutsam und so ruhig sie konnte, wird sie angefangen haben, ihre Umgebung zu erkunden. Und dann muss sie etwas entdeckt haben, was noch entsetzlicher war als die Tatsache, dass sie in einem Sarg gefangen war.
Sie war nicht allein.
5. Kapitel
Der Anblick von Larrys Werkstatt hat mir gewaltig zugesetzt. Ich setze mich aufs Bett, um wieder zu Atem zu kommen, wende mich dabei so, dass ich sie nicht mehr sehen kann, und blicke stattdessen hinaus auf den Hügel. Von allen Zimmern im Haus sieht man ihn aus diesem hier am besten.
Der Hügel ist natürlich unverändert. Ich bezweifle, dass er sich jemals verändern wird. Im Sonnenschein, im August, ist ihm eine wilde Schönheit zu eigen, die seine schreckliche Vergangenheit, die erbarmungslose Verfolgung hilfloser Frauen, fast vergessen macht. Das Gras hat sich golden verfärbt, und auf der ganzen Südflanke blüht das Heidekraut. Die nackten Felsen strahlen im hellen Licht wie Juwelen. Es ist ein mächtiger, von einem Plateau gekrönter Sandsteinmonolith, der Ursprung von tausend Legenden, die allesamt düster sind. Hoch ragt er über dieser kleinen Stadt auf, wirft seinen Schatten auf das Leben der Menschen, die an seinem Fuße wohnen.
Dies hier ist Pendle. Hexenland.
Hoch über dem Hügel, fast unsichtbar im wolkenlosen kornblumenblauen Himmel, steht die gekrümmte Silhouette des abnehmenden Mondes. Noch einen Tag, dann wird er ganz verschwinden, bevor er wieder zunimmt. Schon lange versuche ich nicht mehr, mein ständiges Wissen um die jeweilige Mondphase auszublenden, sie nicht zu beachten wird mir wohl nie gelingen. Jede Nacht sehe ich den Mond an, bevor ich ins Bett gehe. Ich ziehe meine Vorhänge ein wenig fester zu, wenn er voll ist, und wenn die Nacht am dunkelsten ist, am Ende des abnehmenden Sichelmondes, dann weiß ich, dass mir das Einschlafen schwerfallen wird.
Die Kinder wurden bei Neumond entführt.
Ich höre ein lautes Summen, gefolgt vom Anrennen eines winzigen Körpers gegen etwas Hartes. Auf dem Fensterbrett bemüht sich unter den verstreuten Kadavern eine Biene verzweifelt, ins Freie zu gelangen. Als ich die Hand nach dem Fensterriegel ausstrecke, vermeide ich es, auf die Werkstatt hinunterzublicken, und sehe stattdessen die Bienenstöcke ganz hinten im Garten an.
Als ich Larry das letzte Mal gesehen habe, war er dem Tode nahe. Er saß mir im Besuchszimmer gegenüber und hustete immer wieder in ein blutbeflecktes Taschentuch. Fast siebzig, sah er um Jahre älter aus. Sein Haar, noch immer dicht und ein wenig zu lang, war schneeweiß geworden, während sein Gesicht zusammengeschnurrt und voller Runzeln war. In jeder Falte schien ein dünner Streifen Gefängnisdreck zu sitzen. Menschen, die schon lange einsitzen, sehen niemals sauber aus. Seine Nase war mehr als einmal gebrochen, und eine Verletzung dicht über dem rechten Auge hatte seine Braue zu einem derben Zickzackwulst verzerrt.
»Nie fragen Sie mich irgendwas, Florence«, bemerkte er, während seine zitternden Hände von Neuem nach den Zigaretten griffen, die ihn umbrachten. »Warum?«
»Ich frage Sie doch alles Mögliche. Andauernd.« Ich bemühte mich, seine entstellten arthritischen Hände nicht anzustarren. Diese Hände, die einst so geschickt gewesen waren; jetzt konnten sie kaum die Zigarette ruhig halten.
Er schürzte die Oberlippe wie Elvis, eine affektierte Angewohnheit, die er nie abgelegt hat. »Nach Sally und den Mädchen, und wie’s mir geht und ob ich irgendwas brauche. Das meine ich nicht.« Er beugte sich ein wenig weiter zu mir vor. »Ich meine, wegen früher. Danach fragen Sie mich nie.«
In all den Jahren, die ich Larry jetzt schon besuchte, hatte ich mit voller Absicht niemals über den Fall gesprochen. Ich wusste alles über die Machtspielchen, die zwischen verurteilten Mördern und den Polizisten, die sie geschnappt hatten, abliefen, darüber, wie das Bedürfnis nach Informationen selbst den klügsten Officer zur emotionalen Geisel machen konnte, die danach gierte, endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Im Glassbrook-Fall gab es viele Wissenslücken, doch damit konnte ich leben. Ich würde nicht betteln.
»Da frage ich mich schon« – mit einem verschlagenen Lächeln auf den Lippen ignorierte er mein Schweigen –, »ob es daher kommt, dass Sie Angst haben, die Wahrheit zu erfahren.«
Ich gab ein gespieltes tiefes Aufseufzen von mir. »Gibt’s irgendetwas, was Sie mir sagen wollen, Larry?«
Er schien einen Moment nachzudenken, doch da ich Larry inzwischen recht gut kannte, sah ich, wann das Nachdenken echt war. Schließlich schüttelte er den Kopf. »Nö«, antwortete er. »Ich hab’s den Bienen gesagt.«
Irgendetwas knarrt im Haus, ein alter Balken, vielleicht eine Bodendiele, und in meinem nervösen Zustand hört sich das plötzliche Geräusch wie ein Schritt auf der Treppe an. Ich fahre herum, fürchte den Anblick einer kleinen Prozession aus toten Teenagern, die die Treppe heraufkommen, vielleicht sogar von Larry selbst. Natürlich ist die Treppe leer.
Einen Großteil der letzten dreißig Jahre habe ich damit verbracht, mich mit meinen »Gespenstern« zu arrangieren. Mir ist klar, dass es sie eigentlich gar nicht gibt. Ich glaube nicht daran, dass die Toten bei uns bleiben oder dass wir sie nach dem Tod jemals wiedersehen. Manchmal jedoch bilde ich mir ein, dass ich doppelt sehe, dass ich zwei Welten erkennen kann: die, von der ich weiß, dass sie real ist und auch von allen anderen wahrgenommen wird, und die andere, erschaffen aus den dunklen Ecken in meinem eigenen Kopf.
In der Welt meiner beschädigten Fantasie sind Gespenster meine Dauerfreunde.
Ich muss jetzt weg aus diesem düsteren Haus und eile die Treppe hinunter. Von Mary ist nichts zu sehen, also trete ich in den Garten hinaus, finde sie dort aber auch nicht. Ich sollte ihr Bescheid sagen, dass ich gehe, also schlage ich einen Bogen um die Werkstatt und begebe mich dorthin, wo meiner Erinnerung nach das Gemüsebeet ist. Dort ist sie nicht, doch mir wird klar, dass ich mich ganz in der Nähe der Bienenstöcke befinde.
Sag’s den Bienen.
Eine alberne Idee. Bienen bleiben nicht in verwahrlosten Stöcken. Die vier verrottenden Kästen sind bestimmt schon vor Jahren verlassen worden. Und doch bin ich gerade in Stimmung für Rituale, für einen Schlussstrich – wieso bin ich sonst hergekommen? –, und so gehe ich vorsichtig auf die Stöcke zu, obgleich keine Chance besteht, dass Wächterbienen aufsteigen, um einen Angriff abzuwehren.
Nichts geschieht. Die Stöcke sind leer. Trotzdem trete ich näher.
Sag’s den Bienen.
»Larry ist tot.« Ich spreche leise, bin mir darüber im Klaren, wie blöd ich dastehen werde, wenn Mary hier irgendwo in der Nähe ist. »Er ist vor zwei Wochen im Gefängnis gestorben.«
Die Bienen antworten nicht.
»Mein Beileid.« Ich komme mir vor wie eine Idiotin und will mich gerade abwenden, als ich bemerke, dass an einem der Stöcke das Oberteil lose ist, als hätte es jemand angehoben und ihn dann nicht wieder richtig zugemacht. Meinem Ordnungssinn widerstrebt das, also trete ich an den Stock und versuche ganz vorsichtig – weil ich noch immer nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass er leer ist –, das Oberteil wieder an seinen Platz zu schieben.
Es geht nicht. Entweder hat sich das Holz verzogen, oder irgendetwas ist im Weg. Vorsichtig hebe ich das Ganze hoch, halte den Atem an und spähe hinein. Die Rahmen für die Honigwaben sind weg und haben einen kleinen, leeren Hohlraum hinterlassen.
Nicht ganz leer.
Leer bis auf etwas völlig Unmögliches.
Ich blicke auf etwas hinab, das die Leute hier in der Gegend ein »Lehmbildnis« nennen, eigentlich ist es eine dreidimensionale Plastik. Ungefähr zwanzig Zentimeter hoch und aus Lehm geformt, soll es eine Frau darstellen, das verraten mir das Haar, die Brüste, der runde Bauch und die breiten Hüften. Die Beine der Figur sind gebeugt, und ihre Füße sind hinter dem Rücken an die Hände gefesselt. Schlimmer noch, spitze Holzsplitter durchbohren beide Augen und Ohren, den Mund, den Kopf, die Brust und die Genitalien. Ich weiß, dass es sich um Schwarzdorn handelt, es ist immer Schwarzdorn.
Die Geräusche des Sommertags sind verstummt. Alles, was ich hören kann, ist das stetige Pochen meines eigenen Herzens.
Das ist unmöglich. Das Grundstück ist von vorne bis hinten abgesucht worden, vom Dachboden bis zum Keller, von der Hecke bis zur Gartenmauer. Dieses Bildnis kann sich nicht bereits seit Larrys Verhaftung hier befinden.
Und doch, wer könnte es in der Zwischenzeit hier hineingelegt haben?
Sag’s den Bienen.
Meine Linke schmerzt jetzt fürchterlich. Das tut sie immer, wenn ich gestresst bin, aber noch nie so schlimm wie heute. Ich strecke die Hand aus und berühre die Plastik mit einer Fingerspitze, kippe sie ein Stück. Sie zerbröckelt teilweise, und mir wird richtiggehend schlecht, doch es gelingt mir, sie weit genug zu verschieben, um nachzusehen. Das lange, lockige Haar habe ich bereits bemerkt. Der Verdacht ist mir schon gekommen, als ich die Lehmplastik erblickt habe. Jetzt weiß ich es ganz sicher.
Jedes von Larrys Opfern war mit einer von diesen Plastiken aufgefunden worden. Das Fesseln der Hände und Füße symbolisiert die Unfähigkeit, sich zu bewegen. In den Truhensärgen konnten sie sich nicht rühren. Schwarzdorn durchbohrte Augen, Ohren und Mund, weil sie in der Erde taub, stumm und blind waren. Die Verletzung von Kopf, Brust und Genitalien symbolisierte das Davonrinnen des Lebens, das unvermeidlich war, nachdem sie begraben worden waren.
Zumindest haben wir das angenommen. Larry hat den Beamten, die ihn verhörten, nie verraten, warum die Plastiken wichtig waren. Mir hätte er es vielleicht erzählt, aber ich habe ihn nie gefragt.
Ich hätte ihn fragen sollen. Ich hätte ihn fragen sollen, solange ich noch Gelegenheit dazu hatte.
Diese neue Plastik ist detailliert genug – vor allem die gefesselten Hände –, dass ich die Botschaft laut und deutlich vernehmen kann. Die rechte Hand hat fünf weit gespreizte Finger, so, wie sich unsere Hände instinktiv spreizen, wenn wir Schmerzen haben. Die Linke liegt schlaff da, vier Finger sind sanft gekrümmt. Nur vier. Der vierte Finger, der, an dem ein Ehering sitzen würde, fehlt.
In meiner eigenen linken Hand wüten jetzt Höllenqualen. Ich hebe beide Hände an den Mund, um die Schmerzen zu lindern, und der vierte Finger meiner Rechten gleitet leicht in die Lücke an der Linken. Meinen Ehering trage ich an einer Kette um den Hals; mein linker Ringfinger wurde nämlich vor Jahren abgetrennt.
Das Lehmbildnis bin ich.
6. Kapitel
Menschen, die in Särgen eingesperrt sind, überleben nicht lange. Die Aussagen der Experten, die wir fragten, variierten zwischen ein paar Minuten und ein paar Tagen, in einem jedoch waren sich alle Fachleute einig: Es kommt auf die Größe des Sarges an, und auf die des darin befindlichen Menschen. Wir lernten in diesem Sommer eine Menge über Luftvolumen, Körpervolumen und den Sauerstoffverbrauch eines Menschen.
Patsy war klein, ihr dünner Körper wird in dem großen Sarg nicht viel Raum eingenommen haben: Es wäre viel Platz für Sauerstoff gewesen, hätte sie nicht auf einem Leichnam gelegen.
Patsys Sarg war nicht versiegelt, und wäre er nicht begraben worden, hätte sie eine Chance gehabt. (Möglicherweise die Chance zu verdursten, aber trotzdem eine Chance.) So, wie die Dinge lagen, war die über ihr aufgehäufte Erde die effektivste Versiegelung, die man sich nur wünschen konnte. Von dem Zeitpunkt, als sie begraben wurde, hatte sie noch ein paar Stunden, entschieden wir, bestenfalls acht.
Irgendwann musste sie sich wohl entscheiden, ob sie weiter an allem in ihrer Umgebung herumzerren sollte, um sich freizukämpfen, oder ob sie still liegen bleiben und Sauerstoff sparen sollte. Irgendjemand hatte sie ja hier hineingelegt, und irgendwann würde man sie doch um Himmels willen wieder herauslassen.
Wie lange kann ein junges Mädchen geduldig darauf warten, dass irgendein Witzbold zurückkommt und sie aus einem bereits begrabenen Sarg herauslässt? Eine Stunde? Sagen wir zwei.
Wir wissen, dass Patsy das Vertrauen schließlich verloren hat, wegen des Zustandes, in dem wir sie fanden – und wegen des Zustandes des Sarges. Die Haut ihrer Hände war abgeschürft, etliche der Fingernägel waren abgerissen, und das Satinfutter war mit ihrem Blut beschmiert. Es war in Fetzen gerissen, sie hatte sich lange Streifen des Stoffs um die Fäuste gewickelt, um sie vor dem harten Eichenholz des Deckels zu schützen. Trotzdem waren mehrere Fingerknöchel gebrochen. Der Sarg hingegen war unversehrt.
Als Patsy spielende Kinder hörte – ganz schwach, wie durch dichten Nebel, weil sie sich mehr als einen Meter über ihr befanden und Erde genauso gut gegen Schall isoliert wie Wasser –, wird sie angenommen haben, ihre Gebete seien erhört worden, und ich vermute, dann hat sie richtig Krach gemacht. Sie wird gebrüllt und geschrien und gefleht haben, sie sollten sie rausholen. Sie sollten ihr um Gottes willen helfen und sie befreien.
Wir können mit einiger Genauigkeit sagen, wann das war. Sie befand sich seit viereinhalb Stunden unter der Erde, als sie das erste Mal wirklich Hoffnung auf Rettung hatte.
Allerdings hatte sie nicht mit der Riesenangst kleiner Kinder gerechnet, die aus einem ganz frischen Grab eine Stimme schreien hören.
7. Kapitel
»Mary!« Ich stehe an der Hintertür des Hauses und rufe sehr laut nach ihr. »Mary, Sie müssen sofort herkommen!« Ich klinge wütend. Wäre es doch nur so.
Etliche Sekunden lang passiert gar nichts. Ich sehe zu, wie eine Biene von einem Lavendelstängel zum nächsten hopst, dann kommt Mary hinter Larrys Werkstatt hervor.
»Wo kommt das her?« Ich zeige auf die Lehmplastik, die jetzt mit dem Gesicht nach unten auf der Arbeitsplatte liegt. »Nein, nicht anfassen. Haben Sie eine durchsichtige Plastiktüte? Oder vielleicht etwas Küchenfolie? Das Ding muss vielleicht auf Fingerabdrücke untersucht werden.«
Ich rede wirres Zeug. Also atme ich tief durch und versuche es noch einmal. »Mary, wer kommt außer Ihnen sonst noch hierher? Wen haben Sie im Garten gesehen?«
Sie antwortet nicht.
»Das ist wichtig!« Ich bin drauf und dran, die Beherrschung zu verlieren. »Wir können uns auch auf dem Revier unterhalten, wenn Ihnen das lieber ist.«
Anstatt zu antworten beugt sich Mary vor, um die Plastik zu betrachten, und tut dann etwas, was ich noch nie gesehen habe. Sie faucht. Ich weiß keine bessere Beschreibung dafür. Sie fletscht die Zähne und funkelte mich böse an.
»Haben Sie das Ding schon mal gesehen?«
Sie schüttelt den Kopf. »Wo haben Sie’s gefunden?«
»Das bin ich, nicht wahr? Da fehlt ein Finger.« Ich halte meine linke Hand hoch, dabei weiß Mary ganz genau, was mir zugestoßen ist. Jeder in der Stadt wusste davon.
Sie wühlt in der Tasche und zieht einen Schlüsselbund hervor. Als er klirrend auf dem Tisch landet, bröckelt noch mehr Lehmstaub von der Plastik ab, und ich hätte sie beinahe angebrüllt, dass sie gefälligst aufpassen soll.
»Schließen Sie ab, wenn Sie gehen«, sagt sie, während sie auf die Tür zustrebt. »Behalten Sie die Schlüssel. Ich brauche sie nicht mehr.«
Sie lässt mich allein in einem Haus zurück, aus dem ich am liebsten sofort verschwinden würde, aber ich kann mich nicht vom Fleck rühren. Ich stehe in der Küche, innerlich blicke ich jedoch in einem verlassenen Schlafzimmer in eine offene Schublade. Meine Haarbürste. Ich habe meine Haarbürste hier zurückgelassen.
Ich bin nicht wütend. Ich habe Angst.
Rasch wickele ich die Lehmplastik in ein altes Geschirrhandtuch und legte sie behutsam in eine Supermarkt-Plastiktüte, ehe ich die Tür abschließe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinwill. Alles, was ich denken kann, ist: Sie haben meine Haare.
Sie haben meine Haare.
8. Kapitel
Ich denke nicht nach, als ich die Auffahrt der Glassbrooks hinunterrenne, und ich achte auch nicht darauf, wo ich hinlaufe. Die hochgewachsene Männergestalt, die mir entgegenkommt, sehe ich erst, als wir schon zusammengestoßen sind. Ehe ich mich beherrschen kann, jaule ich auf wie ein geprügelter Hund.
»Scheiße, was ist denn los?« Der Junge, der mich fast umgerissen hat, packt mich an den Oberarmen und macht einen halben Schritt rückwärts, damit wir beide auf den Beinen bleiben. »Mum, Mum, ich bin’s. Nein, nein, Mum, schau mich an.«
Ich bekomme keine Luft.
»Komm, schau mich an und zähl bis zehn. Eins, zwei …«
Als er bei zehn ankommt, atme ich wieder und zähle mit. Das haben wir schon öfter gemacht.
»Es geht schon wieder.« Das Ganze ist mir peinlich, also mache ich ein strenges Gesicht. »Und was hab ich dir über Schimpfwörter gesagt?«
»Was ist denn passiert?« Mein fünfzehnjähriger Sohn, acht Zentimeter größer als ich und schön wie eine wolkenlose Morgendämmerung nach einer langen Winternacht, ignoriert die Zurechtweisung. »Vor ein paar Minuten hab ich so ein altes Mütterchen die Auffahrt runterfegen sehen. Und dann dich. Was ist das für ein Haus?«
Er lässt meine Arme los und macht einen Schritt auf das Gebäude zu.
»Ben, nicht …«
Langsam dreht er mir den Kopf wieder zu. »Ist das das Haus, in dem du gewohnt hast? Du hast Dad doch versprochen, dass du das nicht tust.«
»Du hast bestimmt Mary gesehen. Sie schaut hier nach dem Rechten.« Jetzt tut auch meine rechte Hand weh, und als ich nach unten schaue, sehe ich, dass ich den Bund mit den Hausschlüsseln umklammere. Ich habe keine Ahnung, warum Mary ihn mir gegeben hat. Oder was ich damit machen soll.
Ben starrt von Neuem die Auffahrt der Glassbrooks hinauf. Als Teenager fasziniert ihn das Makabre natürlich, er wäre nie im Auto geblieben, wenn ich ihm gesagt hätte, wo ich hinwollte.
»Ich kann nicht fassen, dass es keiner von euch gemerkt hat«, sagte er leise, als spräche er mit sich selbst. »Ihr habt die ganze Zeit im selben Haus gewohnt und habt es nicht gemerkt.« Er schaut erneut zu mir, aber nur ganz kurz. »Hat er sie hierher gebracht? Die Kids, die er entführt hat?«
»Wir sollten uns auf den Weg machen. Hast du keinen Hunger?«
Wir gehen die letzten paar Schritte die Auffahrt hinunter zum Auto. Ich öffne den Kofferraum und stopfe die Lehmplastik hinter meine kleine Reisetasche.
»Und was hast du so getrieben?«, erkundige ich mich.
Er schnieft. »Die Luft aus ’n paar Autoreifen rausgelassen. In dem Laden da unten ’ne Packung Zigaretten geklaut. ’ne Garage abgefackelt. Ach ja, und es könnte sein, dass ich mit dem Zeug aus deinem Handschuhfach ’nen Hund kaltgemacht habe.«
»Was?« Ich blicke doch tatsächlich die Straße hinunter und halte Ausschau nach einem toten Hund. »Bitte sag, dass du das Zeug nicht angefasst hast …« Dann sehe ich sein Gesicht.
»Woher wusstest du überhaupt, dass es da drin war?«, frage ich.
»Ich hab nach Streichhölzern gesucht.« Er reicht mir die Autoschlüssel, die ich ihm zur Verwahrung gegeben habe. »Okay, ich hab nach Pfefferminzbonbons gesucht. Aber ich hab im Kofferraum Streichhölzer gefunden; die sind aus deiner Tasche gefallen. Du hast echt ein paar abgefahrene Sachen dabei, Mum.«
»Steig ein«, sage ich. »Und lass ja das Handschuhfach in Ruhe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gefährlich das Zeug ist.«
Wir steigen ein, und das Erste, was Ben tut, ist, das Handschuhfach zu öffnen.
»Lass das.« Ich beuge mich herüber und klappe es zu.
»Was ist das eigentlich?«
»Tränengas. Gilt laut Gesetz als Schusswaffe. Ich dürfte das Zeug gar nicht dabeihaben, und wenn du damit erwischt wirst, kriegen wir beide Riesenärger.«
»Ist das tödlich?«
»Nein, aber schmerzhaft, und man ist mehrere Minuten kampfunfähig. Damit kann man sich genug Zeit verschaffen, um einen gewalttätigen Verdächtigen zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen.«
»Und du hast so was? Gegen wen willst du das denn benutzen? Gegen ’ne Kellnerin, die dir dumm kommt?«
Ben ist vollkommen klar, dass ranghohe Polizeibeamte kurz vor der Pensionierung nur selten an vorderster Front zu finden sind, doch das hält ihn nicht davon ab, weiter zu sticheln. Als wir wegfahren, wirft er einen sehnsüchtigen Blick auf das Handschuhfach.
»Weißt du, wir sollten einfach nach Hause fahren«, schlage ich vor. »Nach dem Mittagessen.«
»Wir sind doch gerade erst angekommen.«
»Um sechs könnten wir zu Hause sein. Spätestens um sieben.«
»Und was soll Dad dann machen? Die M6 runtertrampen?«
Wir erreichen das untere Ende der Straße. Als ich hier wohnte, war hier überall Kopfsteinpflaster, und wir mussten beim Fahren aufpassen. Langsam lautete die goldene Regel. Inzwischen ist die Straße asphaltiert worden.
»Mum, hast du das etwa vergessen?«
»Natürlich nicht. Wir holen ihn nach dem Abendessen am Terminal 2 ab, und das bedeutet, ich muss heute Abend nüchtern bleiben.«
Das ist nicht gelogen. Unsere Familienpläne sind mir nur ganz kurz entfallen, das ist alles. Ich merke, dass Ben mich beobachtet, und drehe mich nicht zu ihm um. Damit würde ich nämlich zur Kenntnis nehmen, was er denkt. Dass er und sein Dad von Anfang an recht hatten. Ich hätte nicht zurückkommen sollen.
»Und da wären wir.« Ich biege von der Hauptstraße ab und fahre auf den Parkplatz hinter dem Hotel, in dem ich für die nächsten beiden Nächte Zimmer reserviert habe. Als ich den Motor ausmache und nach meinen SMS schaue, sehe ich, dass mein Sohn das riesige rußgeschwärzte Gebäude mit dem gemauerten Zierrat, den Türmchen und Kreuzblumen und den Dutzenden schmutziger Fenster entsetzt anstarrt.
»Ein paar Kilometer die Autobahn runter gibt es einen Premier Inn.« Ich lege ihm die Hand auf die Schulter. »Wir können auch da übernachten. Die sind bestimmt nicht voll, hier sind die Hotels nie voll.«
Langsam schüttelt er den Kopf. »Wenn’s für die Addams Family gut genug ist …« Er hebt unsere beiden Taschen aus dem Kofferraum, und wir gehen zusammen zur Haustür des Black Dog.
Ben lässt mir den Vortritt – wie immer sind seine Manieren in der Öffentlichkeit makellos –, und als ich über die Schwelle in einen düsteren Flur trete, höre ich das leise Knurren eines wütenden Hundes. In diesem Moment ertönt irgendwo im Innern des Hotels Musik – Elvis Presleys »Are You Lonesome Tonight?« –, und ein Mann, groß und dunkelhaarig, etwas jünger als ich, taucht aus dem Hinterzimmer auf und stützt sich auf den Empfangstresen.
»WPC Lovelady«, sagt er lächelnd, doch in meinem erregten Zustand kommt es mir vor wie ein höhnisches Grinsen. »Schön, dass Sie wieder da sind.«
Mir ist, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Das ist Larry.
9. Kapitel
Nachdem die Kinder vom Friedhof geflohen waren, wird Patsy noch lange nach ihnen geschrien haben. Lebenszeichen zu hören hatte ihr vermutlich neue Hoffnung gegeben. Sie hatte die Kinder gehört, also mussten sie ihre Rufe doch auch gehört haben. Sie waren losgelaufen, um es ihren Eltern zu sagen. Und die würden bald kommen, mit Schaufeln.
Jeden Augenblick würde sie rennende Schritte hören, das Schaben von Metall im Erdreich. Sie würde das leise Plumpsen hören, wenn die Erde weggeschippt wurde. Stimmen, die ihr zuriefen, dass sie durchhalten solle, sie wären gleich da, sie würden sie dort herausholen. Sie würden sie ans Tageslicht ziehen, ihre Augen vor der hellen Sonne schützen und ihr Orangensaft einflößen, um diesen fürchterlichen Durst zu stillen.
Sie wird sich mit all ihrer Willenskraft gezwungen haben, ruhig liegen zu bleiben und Sauerstoff zu sparen, denn jetzt würden sie bald kommen.
Es kam niemand.
Die vier Kinder, aus drei verschiedenen Familien, erzählten niemandem, was sie gehört hatten. Sie durften nicht auf dem Friedhof spielen, und sie hatten mehr Angst vor einer Tracht Prügel von ihren Vätern als vor dem Monster unter der Erde, auf das sie gestoßen zu sein glaubten.
10. Kapitel
»Mum?«, fragt Ben.
Der Mann hinter dem Tresen streckt meinem Sohn die Hand hin. »John Donnelly«, stellt er sich vor. »Ich habe deine Mutter früher mal gekannt. Sie war hier in der Gegend eine richtige Heldin.«
Ich atme wieder. Das ist nicht Larry. Jetzt, wo sich meine Augen an das schummrige Licht hier drin gewöhnt haben, sieht er Larry nicht einmal besonders ähnlich. Gleiche Größe und gleicher Körperbau, Haut- und Haarfarbe stimmen auch, aber die Kieferpartie seines Gesichts ist breiter, und seine Nase auch. Dieser Mann sieht nicht annähernd so gut aus. Das ist John Donnelly, er ist erwachsen geworden.
Wir checken ein und tauschen ein paar Nettigkeiten aus; er gibt uns die Schlüssel, und Ben und ich gehen nach oben.
»Das ist ja eine Voodoo-Puppe«, sagt Ben, der auf meinem Bett sitzt, als ich aus dem Badezimmer komme. Er war schlau genug, sich eine Plastiktüte über die rechte Hand zu stülpen, sodass er die Figur nicht berührt. »Scheiße, sollst du das etwa sein?«
»Das habe ich jedenfalls gedacht«, erwidere ich. »Deshalb war ich auch ein bisschen von der Rolle, als du mich vorhin gesehen hast. Aber wie kann das möglich sein? Woher sollte irgendjemand wissen, dass ich heute hier sein würde? Und hörst du bitte mit den Kraftausdrücken auf?«
Er schaut zu mir auf. »Vielleicht solltest du das Ding ja gar nicht finden.«
»Ich bin ja so froh, dass ich dich mitgenommen habe.«
Ben bedenkt mich mit seinem breiten Grinsen, bei dem er die Lippen stets geschlossen hält. In der Grundschule haben ein paar von seinen Freunden ihn immer Goofy genannt – er hat nämlich viele ziemlich große weiße Zähne –, und seitdem geniert er sich deswegen. Wirklich schade, wenn er sich nämlich vergisst und richtig lächelt, wenn er seine Freude richtig leuchten lässt, dann blendet er einen mit seinem Lächeln.
»Dad hat angerufen.« Er zeigt auf mein Handy neben dem Bett.
»Alles okay?«
»Ihm geht’s gut, aber er schafft’s vielleicht heute nicht mehr.«
»Wieso denn das?«
»Gewitter über Charles de Gaulle. Jede Menge verspätete Flüge. Nach London kommt er vielleicht noch, aber nicht nach Manchester.«
Nick hätte sich eigentlich mit uns treffen sollen. Wir wollten den nächsten Tag und die nächste Nacht in Lancashire verbringen und dann gemeinsam nach Hause fahren. Es war eine Gelegenheit, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, meinen Jungs zu zeigen, wo ich mir meine Sporen verdient habe. Zumindest hatten wir so getan, als ob es so wäre.
»Du sollst ihn anrufen«, sagt Ben. »Er findet, wir sollten nach Hause fahren.«
Ich finde auch, dass wir nach Hause fahren sollten. Das habe ich auch schon gesagt. Wenn Nick nicht kommt, gibt es keinen Grund, noch länger zu bleiben. »Und was meinst du?«, frage ich.
Ein paar Minuten lang herrscht Schweigen im Zimmer.
»Warum sind wir hier?«, fragt Ben.
»Das haben wir doch alles schon durchdiskutiert. Du bist noch zu jung, um allein zu bleiben.«
Er sieht mich mit diesem ganz speziellen Blick an, bei dem sich in seiner Miene absolut nichts verändert. Ich schwöre, er zuckt mit keiner Wimper, und doch ist sein Gesichtsausdruck plötzlich ein vollkommen anderer. »Ist es eigentlich eine Diskussion«, will er wissen, »wenn nur eine Person etwas sagt?«
»Viele von uns gehen auf Beerdigungen von Leuten, die wir ins Gefängnis gebracht haben«, erkläre ich. »Das ist so eine Art Schlussstrich unter das Ganze.« Ich setze mich neben ihm auf das schmale Bett. »Vielleicht, weil wir uns, wenn sie im Knast sitzen, die ganze Zeit vor dem Tag fürchten, an dem sie rauskommen. Wenn sie sterben, geht diese Angst weg. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, sonst niemanden aus dem alten Team in der Kirche zu sehen.«
Ben streckt sich aus und legt die Füße auf meinen Schoß. »Das war vor dreißig Jahren. Die sind doch bestimmt schon tot.«
»Du bist ein echter Sonnenschein, weißt du das?«
Ein paar Sekunden lang starrt er zur Decke hinauf, und ich genieße diesen Moment, in dem ich ihn dicht bei mir habe. Dann huscht sein Blick zu der Plastik hinüber, die noch immer auf dem Nachttisch liegt, und er setzt sich wieder auf. »Mum, was ist mit deinem Finger passiert?«
Binnen eines Augenblicks ist die Stimmung umgeschlagen.
»Das weißt du doch. Ich hab’s dir erzählt.«
»Nein, ich meine, was ist, du weißt schon, hinterher damit passiert? Hast du ihn behalten?«
Ich muss tief Luft holen, bevor ich antworte. Ich habe meinen vor langer Zeit verlorenen Finger nicht mehr gesehen, seit … Darüber will ich nicht einmal nachdenken. »Nein, ich habe ihn nicht behalten«, sage ich. »Er ist erst in die Asservatenkammer gekommen und dann … Ich habe nicht nachgefragt, aber er ist wohl im Sektionsraum des Krankenhauses gelandet, und die haben ihn entsorgt, so wie andere amputierte Gliedmaßen.«
»Dann könnte er also nicht in falsche Hände gefallen sein?«
»Die falschen Hände waren an der Anklagebank festgekettet«, entgegne ich.
Ein Schweigen, das das absolute Gegenteil von behaglich ist, senkt sich zwischen uns herab.
Sie haben meine Haare. Sie haben meine Haare. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, als ich aus dem Haus der Glassbrooks gestürzt bin. Es gibt doch gar keine sie. Es gibt keine falschen Hände. Jetzt nicht mehr.
Ben springt auf. »Auf einer Skala von eins bis zehn, wie angepisst bist du jetzt gerade wegen mir?«, will er wissen.
Ich sehe ihm in die Augen. »Wenn du nicht ›angepisst‹ gesagt hättest, wär’s eine Sechs gewesen, jetzt ist es eine Sieben.«
Er zieht eine vollendet geformte dunkle Braue hoch. »Dann hab ich also noch ein bisschen Spielraum?«
Eins habe ich in fünfzehn Jahren über meinen Sohn gelernt: Wenn ihm etwas im Kopf herumgeht, lässt er nicht locker.
»Was ist?«, frage ich.
»Sind wir wegen dem Brief hier?«
Ich starre zurück. »Was denn für ein Brief?«
»Der mit dem Gefängnis-Poststempel.« Der Brief, der vor zwei Wochen gekommen ist, aufgegeben am Tag vor seinem Tod.
Ich antworte nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und dann sage ich das Falsche.
»Du hast meine Briefe gelesen? In meiner Handtasche rumgeschnüffelt?«
Bens Gesicht läuft dunkelrot an. »Scheiße, nein. Du hast gestern Abend deine Tasche auf dem Küchentisch ausgeräumt. Ich hab den Umschlag gesehen, als ich aufgestanden bin, um mir was zu trinken zu holen. Ich hab ihn nicht gelesen.«
»Entschuldige«, sage ich. »Komm, wir suchen uns was zum Mittagessen und überlegen, ob wir hierbleiben oder nicht. Dann kannst du ihn lesen. Wird nicht lange dauern.«
11. Kapitel
»Hier war mal eine Pastetenbäckerei«, sage ich, als Ben sich mit einem Tablett voll mit verpacktem Essen und eimergroßen Getränkebechern zu mir gesellt. Seit er sieben Jahre alt war und Geld zählen konnte, habe ich bei McDonald’s nichts mehr bestellt. Die Menüs und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten sind mir zu kompliziert.
»Der Verkaufstresen reichte um die beiden Wände da herum«, fahre ich fort. »Die Verkäuferinnen hatten braune Overalls an, mit weißen Trägerschürzen und kleinen weißen Mützen, und die haben so kleine Fleischpasteten gemacht, unglaublich köstlich. Da drüben standen Tische, und die waren immer besetzt.«