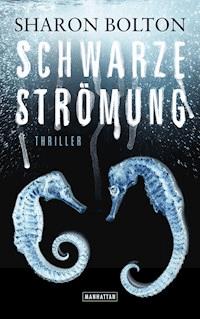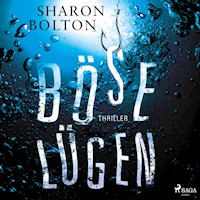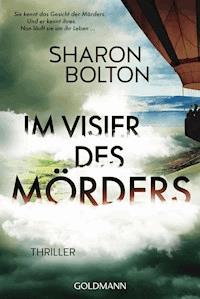8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Etwas Dunkles braut sich in London zusammen ...
Mitten in London wird ein Baby aus dem Kinderwagen gerissen und auf einem Floß in die Themse gestoßen. Lacey Flint von der Flusspolizei ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um eine Katastrophe zu verhindern. Aber wer könnte ein unschuldiges Kind töten wollen? Für DCI Mark Joesbury kommt der Angriff nicht überraschend. Schon lange hat er eine Gruppe junger Männer im Visier, die vom Hass auf Frauen angetrieben wird. Joesbury und sein Team befürchten, dass weitere Gewalttaten folgen werden. Und Lacey Flint könnte das nächste Opfer sein, denn der Anführer der Gruppierung kennt ihr dunkelstes Geheimnis …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Mitten in London wird ein Baby aus dem Kinderwagen gerissen und in die Themse gestoßen. Lacey Flint von der Flusspolizei ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle, um eine Katastrophe zu verhindern. Aber wer könnte ein unschuldiges Kind töten wollen?
DCI Mark Joesbury vermutet einen Zusammenhang mit einer Gruppe junger Männer, die er schon länger im Visier hat. Sie fühlen sich von der Gesellschaft abgehängt und werden vom Hass auf erfolgreiche Frauen angetrieben. Joesbury und sein Team befürchten, dass weitere Gewalttaten folgen werden. Und Lacey Flint könnte das nächste Opfer sein, denn der Anführer der Gruppierung kennt ihr dunkelstes Geheimnis …
Weitere Informationen zu Sharon Bolton sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sharon Bolton
Das Dunkle in dir
Thriller
Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel»The Dark« bei Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung August 2023
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Covermotiv: Arcangel Images/Trevor Payne; FinePic®, München
Redaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze
LS · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-30078-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für Belinda, die meine allerbeste Freundin ist, und für Simon, der ihr allerbester Freund war
Prolog
Ein paar Stunden nach Mitternacht saßen zwei junge Frauen in einem Auto, das dicht vor dem Rand einer Klippe stand. Eine von ihnen war tot, die andere fühlte sich nur so. Der Ort, an dem sie angekommen waren – wobei sie die Straße verlassen und die letzten Meter über die unwegsame Landzunge zurückgelegt hatten –, war der höchste Kreidefelsen Britanniens. Außerdem galt er als eine der beliebtesten Stellen der Welt für Selbstmörder. Vorsichtigen Schätzungen zufolge war er seit den frühen Sechzigern für knapp unter fünfhundert Suizide verantwortlich gewesen.
Die Frau, deren Herz rein technisch gesehen noch schlug, überlegte, ob zwei weitere wohl ausreichen würden, um das hübsche runde halbe Tausend vollzumachen. Sie machte den Motor aus, ließ das Summen, mit dem er abkühlte, in der Nacht verklingen und öffnete die Tür, um der Welt Lebewohl zu sagen.
Die Augen ihrer fest angeschnallten Gefährtin waren geschlossen, doch als die Luft ins Auto strömte, wehte ihr das Haar übers Gesicht und verlieh ihm ganz kurz einen Anschein von Leben.
Ein gemeiner Trick. Die Frau, die sich noch ans Leben klammerte – noch für ein paar Minuten –, stieg aus, schloss die Autotür und sah erleichtert zu, wie es im Wagen dunkel wurde. Die hundertzwanzig Kilometer vom Süden Londons bis hierher, nur von ihren eigenen Gedanken und den Schuldzuweisungen eines Leichnams neben ihr begleitet, waren schwerer gewesen, als sie gedacht hatte. Sie wandte sich von dem Auto ab und trat auf jene schwarze Leere zu, die, wie sie genau wusste, hinter dem Klippenrand wartete.
Für September war die Nacht kühl, eine leichte Brise wehte von Westen. Da der Wind fast direkt von der Isle of Wight kam, trug er einen Hauch des gestrigen Fischfangs heran, außerdem den Geruch früher Herbstfeuer und reifer Früchte, die von schwer beladenen Bäumen fielen. Andererseits hatte sie schon immer eine lebhafte Fantasie gehabt. Vielleicht war es auch nur der salzige Gestank des Strandes hundertsechzig Meter unter ihr.
Bestimmt war es ein grauenvoller Strand. Er hatte zu viele zerschlagene und zerschellte Körper in die Arme geschlossen, zu viel Blut der Sterbenden aufgesogen, um irgendetwas anderes zu sein. Jetzt war es zu spät, viel zu spät, aber bestimmt gab es bessere, schönere Orte zum Sterben.
Als die Augen der jungen Frau sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie die silberweiße Linie der Kreidefelsen ausmachen, die sich nach Westen erstreckten, und sah das Blinken des Leuchtturmes in der Bucht. Der Mond war etwas mehr als halb voll, missgebildet und merkwürdig unbefriedigend in seiner Unvollständigkeit, doch er strahlte wie eine polierte Silbermünze und beleuchtete sanft die Wolken. Die Sterne waren winzig und flackerten wie Lichterketten, deren Batterie gleich den Geist aufgibt. Das Meer war endlose Schwärze, ein riesiges, solides Glänzen, das schimmerte, als stiege sein dunkler Schein aus seinen Tiefen empor. Es war ein stummes Meer, seiner Stimme beraubt: Weder brandeten noch murmelten die Wellen an den Felsen, von donnern ganz zu schweigen.
Der Schmerz zu vieler zu großer Verluste lastete schwer auf der jungen Frau, und als sie auf den Rand der Klippe zuging, dehnte er sich in ihrer Brust aus wie aufgehender Teig und füllte allen Raum aus, sodass selbst das Atmen schwer wurde. Gleichzeitig brannte der Wind ihr in den Augen und trieb Tränen hervor, die sie bis jetzt nicht hatte vergießen können. Tränen waren für erträglichen Kummer gedacht, für geringeres Leid; dieser Schmerz konnte unmöglich durch kleine Wassertropfen gelindert werden. Er würde hervorbrechen, wenn er kam, würde ihre Haut, ihr Fleisch und ihre Knochen auseinanderbersten lassen wie Schrapnell. Natürlich würden die Felsen dort unten ihm dabei behilflich sein.
Wenigstens würde es dann ein Ende haben.
Als die Gestalt aus der Finsternis auftauchte, dachte sie, ihrer toten Freundin sei die Geduld ausgegangen und sie habe die übernatürliche Kraft heraufbeschworen, auf eigenen Beinen zu ihrem Grab zu schreiten. Ihr Schreckensschrei zerplatzte im Wind.
Nicht ihre Freundin, ein Fremder, aber einer mit derselben schaurigen Absicht.
»Ihr könnt mich nicht daran hindern!« Der Junge war angespannt, er bebte wie ein Läufer vor dem Wettrennen seines Lebens. Auch er war nur ein kleines Stück vom Klippenrand entfernt. Wenn er lossprintete, würde der Schwung ihn darüber hinaustragen.
»Okay«, sagte sie.
Er war ungefähr in ihrem Alter, knapp unter zwanzig, allerdings ließ sich das in der Düsternis nur schwer sagen. Kleiner als sie, mit schmalen Schultern und molliger Taille, und er keuchte, als sei der Fußmarsch hierher – auf dem Parkplatz hatten keine anderen Fahrzeuge gestanden – Schwerarbeit gewesen. Oder vielleicht hatte er auch geweint. Sein Gesicht sah im schwachen Mondlicht fleckig und streifig aus. Er musste ganz dicht am Rand gesessen haben, vom Gras halb verborgen, und aufgesprungen sein, als sie näher kam.
»Es ist meine Entscheidung«, stieß er hervor, noch immer bereit loszurennen. »Mein Leben.«
»In Ordnung.«
Seine Kleider, feucht vom Regen, der vor Kurzem gefallen war, rochen frisch und sahen sauber aus. Sie waren ziemlich neu, seine Sneakers waren keine Billigware, und sein dunkles Haar war vor nicht allzu langer Zeit geschnitten worden.
»Du bist einer von denen, stimmt’s?« Hektisch sah er sich um, als dächte er, andere – ihre fiktiven Mitverschwörer – könnten sich gerade an ihn anschleichen. »Von denen, die versuchen, uns davon abzuhalten.«
Sie seufzte. »Ich werde dich nicht davon abhalten.«
»In dem Forum, in dem ich bin, da haben sie mich gewarnt, dass hier Leute sein würden wie du. Da hieß es, man soll zwischen zwei Uhr nachts und sechs Uhr morgens kommen, dann wär’s am unwahrscheinlichsten, dass ich jemandem begegne.«
Sein Atem ging stoßweise, seine Stimme stockte. Einen Moment lang ärgerte sie sich maßlos darüber, dass ihre letzten Momente nicht friedlich sein würden, weil ihre Gedanken von diesem weinerlichen Teenager in Anspruch genommen wurden, der in seinem kurzen, verwöhnten Leben wahrscheinlich noch nie richtige Probleme gehabt hatte.
Doch das war unfreundlich, und sie wollte nicht unfreundlich sein, nicht in den letzten Minuten ihres Lebens.
»Deine Freundin da im Auto.« Er zeigte nach hinten, als könnte sie vergessen haben, wo der Wagen stand. »Telefoniert die gerade? Ruft sie, wie nennt ihr das, Verstärkung?«
Das Auflachen, so kurz und bitter es auch war, überraschte sie. Lachen fühlte sich an wie etwas, das sie endgültig aus ihrem Leben ausgesperrt hatte. »Das bezweifle ich.«
Er machte einen Schritt auf den Klippenrand zu. »Komm mir nicht zu nahe«, rief er schrill wie eine erschrockene alte Frau.
»Hab ich nicht vor.«
Sie wollte nicht unfreundlich sein, aber das hier nervte allmählich, und außerdem würde früher oder später jemand anderes vorbeikommen: ein Streifenwagen, jemand von der Telefonseelsorge, ein Gutmensch mit Schlafstörungen. Sie hatte nicht ewig Zeit.
»Ist doch ’ne große Klippe. Ich komm dir nicht in die Quere, wenn du mir nicht in die Quere kommst.«
Damit trat sie an den Rand und schaute hinunter. Sie hatte noch nie Höhenangst gehabt, doch jetzt flutete eine Woge der Übelkeit über sie hinweg. Einen Augenblick lang schien es, als bewege sich der Boden unter ihren Füßen. Kreide war alles andere als stabil; die Felsen bröckelten ständig. Sie wippte ein wenig auf den Füßen. Nichts gab nach, und sie war ein bisschen enttäuscht. Wie viel leichter wäre es gewesen, sich die Entscheidung abnehmen zu lassen.
»Meinst du das ernst?«, fragte der Junge.
Wahrscheinlich ernster als er. Sie fragte sich, wie lange er wohl schon hier war, über sein Leid nachgrübelte und sich vormachte, dass er tatsächlich springen würde.
»Du bist nicht von der, wie heißen die noch, von der Küstenwache oder diesen Samariter-Typen?«
»Ich bin hier, um da runterzuspringen, genau wie du.«
»Du lügst. Das ist ein Trick, irgend so ein psychologischer Rückkopplung-Scheiß. So zu tun, als wär’s dir egal, damit es mir nicht mehr egal ist.«
»Und, funktioniert’s?«
»Nein!«
»Verdammt«, brummte sie halblaut. »Ich lasse echt nach.«
Schweigen. Dann: »Ich heiße Nick.«
Es klang zögerlich, als sei er sich seines eigenen Namens nicht sicher. »Ich hab nicht gefragt«, erwiderte sie.
»Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, an meine Mum und meinen Dad.«
»Das hilft ihnen bestimmt unheimlich.«
Einen Moment lang nur Wind, und, ja, jetzt konnte sie die Wellen dort unten hören.
»Echt jetzt?«, fragte er. »Du willst echt springen?«
»Also, eigentlich werde ich fahren. Das Gaspedal durchtreten und ins Nirwana rauschen wie Thelma und Louise am Grand Canyon.«
»Was?« Er hatte die Popkultur-Anspielung nicht verstanden.
»Ach, egal. Mach’s gut, Nick. Einen schönen Tod noch.«
»Warte!«, rief er ihr nach, noch bevor sie den Weg zum Auto zur Hälfte zurückgelegt hatte. Sie drehte sich um und wusste dabei, dass schon das ihr etwas sagen sollte: Noch konnte sie zurückgerufen werden.
»Es passiert doch sofort, oder? Das mit dem Tod, meine ich. Ich kriege doch nichts davon mit?«
Seufzend ging sie wieder zum Rand der Klippe und trat neben ihn.
»Normalerweise ist man nicht sofort tot«, sagte sie. »Wenn man geköpft wird, dann wahrscheinlich ja. Vielleicht auch bei einer Explosion. Sonst dauert es eine Weile, bis der Körper total abschaltet. Also, nein, man ist nicht sofort tot. Sehr schnell, aber nicht sofort.«
»Wie schnell?«
Sie tat so, als denke sie darüber nach, obgleich sie auf der Fahrt hierher an wenig anderes gedacht hatte. »Sekunden, wenn du Glück hast. Deine Knochen zerbrechen auf den Felsen. Teile von deinem Schädel werden in dein Gehirn gedrückt, und von da an gibt’s kein Zurück mehr. Vielleicht bohren sich auch ein paar Rippen in dein Herz, und das blutet dann aus. Und deine Lunge könnte auch in Fetzen gerissen werden, auch von deinen eigenen Knochen, sodass das Atmen unmöglich wird.«
Sie sah, wie er schauderte.
»Wenn du kein Glück hast, werden deine lebenswichtigen Organe nicht allzu schwer beschädigt. Dann liegst du stundenlang da am Strand, wahrscheinlich gelähmt, hast tierische Schmerzen und wartest darauf, dass du verblutest oder dass dein Herz versagt. Aber was weiß ich denn schon? Ist ja nicht so, als hätte ich das schon mal gemacht.«
»Du bist doch eine von denen, von diesen Psychotypen. Du versuchst, mir Angst zu machen, damit ich’s nicht tue.«
Genug jetzt. Sie machte einen Schritt auf ihn zu. »Möchtest du, dass ich dich schubse?«
Seine Augen wurden vor Schreck riesengroß. »Was?«
»Wenn du willst, schubse ich dich. Brauchst es bloß zu sagen.«
Die Hände abwehrend vorgestreckt, wich er zurück. »Bleib ja weg von mir.«
»Wie du meinst.« Sie musste zurück zum Auto, musste es hinter sich bringen, doch irgendetwas hielt sie zurück.
»Der Aufprall wird noch nicht mal das Schlimmste sein«, sagte sie. »Am schlimmsten wird der Moment sein, wo du springst, wenn du im freien Fall bist. Dann wirst du’s bereuen, würdest alles dafür geben, wieder oben auf festem Boden zu stehen, auch mit all dem Schmerz, den du durchmachst, aber dann wird es zu spät sein.«
»Wenn du das glaubst, warum machst du’s dann?« Rasch schaute er zu dem Auto hinüber. »Habt ihr irgend so einen Selbstmordpakt, du und die andere da?«
Eine neue Woge des Schmerzes. »Sie ist schon tot. Sie ist vor ein paar Stunden gestorben, an einer Überdosis.«
»Wart ihr, äh, ein Liebespaar?«
»Nein, sie war nur die einzige Freundin, die ich noch hatte.«
»Tut mir echt leid.«
Er sah auch aus, als meine er das ernst. »Danke.«
Sekunden verstrichen.
»Und wieso bist du hier?«, erkundigte sie sich.
Er antwortete nicht.
»Hat deine Freundin mit dir Schluss gemacht?«
»Ich hatte noch nie eine Freundin.« Seine Stimme klang hässlich vor Bitterkeit. »Mädchen interessieren sich nicht für Typen, die aussehen wie ich.«
Trotz allem neugierig, musterte sie ihn noch einmal und schaute diesmal genau hin. Er war klein, und das Gewicht um seine Taille wäre an Schultern und Armen besser aufgehoben, doch da war nichts, was gesunde Ernährung und ein paar Monate Fitnesstraining nicht beheben könnten. Seine Nase war ein bisschen krumm, und seine Augen lagen ziemlich tief in den Höhlen, was ihm etwas Falkenhaftes gab, doch sein Haar war dunkel und glänzte, und seine Lippen waren voll und wohlgeformt. Das Unansehnlichste an ihm waren schlimme Aknepickel, die auf der unteren Hälfte seines Gesichts wucherten und auf Wangen und Stirn sprossen, aber die Zeit und die richtige Behandlung würden das schon regeln. Keine Narben, keine entstellenden Muttermale. Sie öffnete schon den Mund, um irgendeine Plattitüde über sein Aussehen von sich zu geben, und beschloss dann, dass es ihr egal war.
»Würdest du das tun?« Er war nicht bereit, es gut sein zu lassen.
»Baggerst du mich etwa an?«
»Mädchen, die so aussehen wie du, interessieren sich nicht für Jungs wie mich«, fuhr er fort. »Sogar die hässlichen Mädchen sind scharf auf die gut aussehenden Typen. Solche wie ich haben keine Chance.«
Er wollte, dass sie ihm widersprach, ihm versicherte, dass er sich irrte, dass ihn viele Mädchen attraktiv finden würden. Die eine Hälfte von ihr wollte das tun, und sei es nur, damit er sie in Ruhe ließ, aber sie war so unfassbar müde. Mehr als alles andere wollte sie schlafen. Das Problem beim Schlaf war allerdings, dass er immer irgendwann endete. Wenn man schlief, wachte man auf. Aus der Sorte Schlaf, die sie im Sinn hatte, gab es kein Erwachen.
»Würdest du nicht, stimmt’s? Du würdest nichts mit mir anfangen.«
»Nein«, antwortete sie wahrheitsgemäß. »Willst du mitkommen?«
»Was?«
»Ich steige jetzt ins Auto, und dann fahre ich da über den Rand. Ich glaube nicht, dass du dich traust, allein zu springen, aber wenn du dich hinten reinsetzt, nehme ich dich mit.«
Sie war auf dem Rückweg zum Auto, und diesmal blieb sie nicht stehen. »Letzte Gelegenheit«, rief sie über die Schulter. »Und komm uns nicht in die Quere, ich halte nämlich nicht an.«
»Ich komme mit.« Er holte sie ein, als sie beim Auto ankam.
»Sicher?«, fragte sie.
Er sah aus, als würde ihm gleich schlecht werden, doch er nickte.
Sie öffnete die hintere Wagentür. »Setz dich auf diese Seite«, wies sie ihn an. »Ich will nicht, dass du dich an mir festkrallst, wenn wir über den Rand fliegen.«
»Tolle Kiste«, bemerkte er, während er hinter dem Beifahrersitz Platz nahm.
»Geklaut.«
Sie verriegelte die Türen und ließ den Motor an, testete das Gaspedal, obwohl sie wusste, dass der Wagen vollkommen in Ordnung war. Ihre Hand lag auf der Handbremse, bereit, sie zu lösen.
»Scheiße!« Er hatte die Frau auf dem Beifahrersitz berührt. »Die ist ja wirklich tot. Voll abartig. Die ist echt tot!«
»Hast du gedacht, ich lüge dir was vor?«
Er zerrte am Türgriff, bekam die Kindersicherung nicht auf. »Ich dachte, das ist ein Trick, und ihr beide wärt von der Küstenwache und bringt mich wieder runter nach Eastbourne.«
»Pech gehabt.« Sie löste die Handbremse und ließ den Fuß auf der Kupplung. Eine minimale Bewegung im linken Fußgelenk, und das Auto würde vorwärtsschießen. Sie hatte bereits gesehen, dass das Gelände zur Klippe hin abfiel.
»Lass mich raus!«
Ach, Herrgott noch mal!
Er fing an, gegen das Fenster zu hämmern. »Hilfe!«, schrie er. »Lass mich raus! Hilfe!«
Also, bei diesem Geschrei würde sie nicht sterben. Außerdem könnte er jeden Moment kapieren, dass er die Hände um ihren Hals legen und zudrücken könnte, und dann würden sie nirgendwo hinfahren.
Sie entriegelte die Türen. Binnen eines Sekundenbruchteils war der Junge draußen und rannte auf den Klippenpfad zu. Sie sah ihm nach, bis er verschwand, bis es wieder still auf der Felskuppe war.
»Wo waren wir?«, fragte sie ihre tote Begleiterin.
Die Frau neben ihr hatte keine Antwort darauf.
»Klar zum Angriff?«
Immer noch keine Antwort, und so saß sie da und wartete darauf, dass der Schmerz von Neuem kam, über sie hinwegflutete und ihr einen Grund gab, den einen Fuß hinunterzudrücken und den anderen anzuheben.
Er kam nicht.
Sie dachte an den Jungen, der gerade in Richtung Eastbourne rannte und sein Pech verfluchte, dass er Sekunden, bevor er allem ein Ende machen konnte, einer Irren begegnet war. Heute Nacht hatte sie einem Menschen das Leben gerettet.
Verdammt, das fühlte sich gut an.
»Ich wünschte, ich hätte dich retten können«, sagte sie zu der Frau neben ihr.
»Wie wär’s, wenn ich stattdessen dich rette?«, antwortete ihre tote Freundin.
Und dann drehte sie sich ohne ersichtlichen Grund nach dem Rücksitz um, wo der Junge eben noch gesessen hatte. Auf dem hellgrauen Leder lag der Stoß Dokumente, die sie aus der besetzten Wohnung im Süden von London mitgenommen hatte, in der sie beide gewohnt hatten. Keine Pässe oder Führerscheine; so etwas hatten beide Mädchen nie beantragt, und auch keine Geburtsurkunden, weil die schon vor Jahren im Behördendschungel verloren gegangen waren. Eine Karte mit einer Sozialversicherungsnummer, ein Bibliotheksausweis, ein Studentenausweis. Sehr wenig, um zwei Teenagerleben zu dokumentieren. Von denen eines definitiv vorbei war.
Die Frage war: Welches?
Vollkommen unerwartet hatte sich aus völliger Verzweiflung eine Chance ergeben, und jetzt sah sie sich der Möglichkeit gegenüber, ganz neu anzufangen. Den Schmerz und den Verlust und die Hoffnungslosigkeit zurückzulassen. Sie wäre blöd, sie nicht zu nutzen.
Blöd war sie noch nie gewesen.
Sie machte den Motor aus und nahm rasch alle Papiere im Wagen an sich, die auf dessen letzte Insassen schließen lassen könnten. Als Nächstes wischte sie das Lenkrad sowie sämtliche Oberflächen im Innenraum sauber, an die sie herankam. Dann löste sie den Sicherheitsgurt ihrer Freundin, schob die Hände unter den Körper der Toten und zerrte sie auf den Fahrersitz hinüber. Schließlich schaltete sie in den Leerlauf und löste die Handbremse. Einen Moment lang rührte das Auto sich nicht vom Fleck, also packte sie den Rand des offenen Fensters, stemmte die Füße in den felsigen Boden und schob.
Bewegung. Sie schob noch einmal an, und der Wagen rollte los. Mit einem letzten Blick auf ihre tote Freundin rannte sie zum Heck des Fahrzeugs, wo sie sich besser dagegenstemmen konnte. Das Auto wurde schneller, wich ein wenig nach links ab und fand ein stärkeres Gefälle. Es rollte weiter, und sie brauchte nicht mehr zu schieben.
Sie blieb stehen und sah zu, wie es Fahrt aufnahm, bis die Vorderräder den Rand der Klippe erreichten. Ganz kurz hielt es inne, und sie dachte schon, es würde vielleicht doch nicht klappen. Doch dann kippte der Kühler ab, das Scharren von Metall auf Stein zerriss die Stille, und der Wagen überschlug sich, zeigte der Nacht das Fahrgestell. Gleich darauf war er verschwunden.
Es kam ihr sehr lange vor, bis das Krachen ertönte. Sie schaute nicht hinab; sie hatte nicht das Bedürfnis, die Verwüstung dort unten zu sehen. Stattdessen verließ sie die Heidelandschaft und machte sich auf den langen Fußmarsch zurück nach London.
Sie würde ein neues Leben beginnen. Noch einmal ganz von vorn anfangen.
Nach etwa einem Jahr bewarb sie sich erfolgreich bei der Londoner Polizei.
Teil 1
1
Mehr oder weniger auf den Tag genau zwölf Jahre später
Seit sie zur Flusspolizei von London gegangen war, hatte Constable (mit ein bisschen Glück demnächst Sergeant) Lacey Flint sich daran gewöhnt, von der Themse überrascht zu werden. Riesig und prachtvoll, manchmal zugleich herzzerreißend schön und lautlos beängstigend, war sie zu einer ständigen Präsenz in ihrem Leben geworden. Ihr Geruch verließ sie niemals, und auch ihre Geräusche nicht. Ihr endloser Takt gab jetzt den Rhythmus ihres Lebens vor. Sie wohnte auf dem Fluss, arbeitete auf dem Fluss, vertrieb sich die Zeit auf dem Fluss. Sie liebte ihn mit einer Leidenschaft, die sie in ihrem Leben nur wenigen anderen Dingen und praktisch keinem anderen Menschen entgegenbrachte. Fast keinem. Einen Menschen gab es, weit weg, den sie immer geliebt hatte und immer lieben würde, und noch einen anderen. Den anderen.
Die Themse jedoch, die Themse war wie ein Zuhause, nährend, tröstend, sicher und zugleich ein wildes Abenteuerland.
Sie wusste, dass der Fluss niemals ihr Freund werden würde. Niemand, der Grips im Kopf hatte, war sich der Themse jemals sicher, schon gar nicht jenes Teils, der durch London floss und durch die Gezeiten beeinflusst wurde, des gefährlichen Teils. In etwas über einem Jahr bei der Marine Policing Unit hatte Lacey Flint in Leichentücher gehüllte tote und halb ertrunkene lebendige Frauen aus dem Wasser geborgen, die vor unaussprechlichen Gefahren in fernen Ländern geflohen waren. Sie hatte Waffen aus der Eisenzeit gefunden, Knochen prähistorischer Tiere und Flaschenpostnachrichten, die sich als Abschiedsbriefe von Selbstmördern erwiesen. Sie hatte Schmuggelware und betrunkene Junggesellenabschieds-Piraten aus dem Fluss gefischt. Sogar einer Meerjungfrau war sie begegnet.
Manchmal hatte sie das Gefühl, sie hätte alles gesehen, was der Fluss zu bieten hatte, deshalb machte sie das aufblasbare Einhorn nicht stutzig, das verlassen und schmutzig in der Gezeitenzone des Ufers lag. Es hätte sie stutzig machen sollen, aber selbst Lacey Flint konnte gelegentlich falschliegen.
September: Die schönste Zeit des Jahres, voll goldenem Licht und silbrigem Dunst, wenn der Fluss eine Zeit lang zur Ruhe kommt, weil die meisten leichtsinnigen Touristen heimreisen und die Säufer nicht mehr so oft auf den Ufermauern hocken. Lacey liebte den September, schließlich war sie in diesem Monat geboren worden. Na ja, irgendwie.
Vor etwas mehr als vierzig Minuten war sie von ihrem Zuhause aufgebrochen, einer alten Segeljacht, die im Deptford Creek lag. Allerdings nicht zur Arbeit, ihr Dienst begann nämlich erst am Nachmittag, sondern zu einem privaten Treffen. Lacey Flint hatte persönliche Freundschaften sehr lange gemieden, weil Freunde die Angewohnheit hatten, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und Geheimnisse auszugraben, die niemals das Tageslicht erblicken sollten. Doch sie hatte gelernt – manchmal zu ihrem Schaden, öfter zu ihrem Nutzen –, dass das Leben ein nerviges Geschäft war und so eine Art hatte, einen einzuholen, ganz gleich, wie gut man sich vor ihm versteckte. Also hatte sie jetzt Freunde, und zwei davon hatten sich mit ihr in einem süßen kleinen Café (ihre Worte, nicht Laceys) an der Tower Bridge zu einem späten Frühstück verabredet. Normalerweise brauchte man keine vierzig Minuten vom Deptford Creek zur Tower Bridge, nicht einmal im Londoner Verkehr, aber Lacey Flint war auf dem Wasserweg unterwegs.
Natürlich.
Ihr weißes Kajak flog selbst gegen die starke Strömung nur so übers Wasser. Seit fast drei Stunden herrschte jetzt Ebbe, und der Fluss erreichte gerade seine höchste Fließgeschwindigkeit von etwa vier Knoten. Er riss alles mit sich, was nicht genug eigenen Antrieb hatte, hinab zu seiner Mündung und schließlich hinaus in die Nordsee.
Lacey hielt sich dicht am Nordufer, denn auf dem Wasser rechts – oder steuerbord – zu fahren war eine Vorschrift der Londoner Hafenbehörde, und indem sie im Flachen blieb, mied sie die volle Kraft des Gezeitenstroms. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass die Schwimmbagger, die Lastkähne und die Thames Clippers, die Katamarane des Londoner Bootdienstes in der Mitte des Flusses ein einsames Kajak bemerkten. Oder ihm auswichen, wenn sie es sahen. Wenn man auf der Themse unterwegs war, war es wirklich besser, sich am Rande des Geschehens zu halten.
Lacey kannte den Fluss gut, und seit sie nach Deptford Creek gezogen war, hatte sie enorm an Kraft zugelegt. An den meisten Tagen ging sie paddeln oder sogar schwimmen, obwohl das Schwimmen im Gezeitenbereich gesetzlich verboten war. Laut ihrem Vorgesetzten Superintendent David Cook würde sie fristlos gefeuert werden, wenn sie noch einmal dabei erwischt würde. Und diesmal ist es mir ernst, Lacey. Nach dem Frühstück zurückzufahren würde ein Kinderspiel sein. Der Gezeitenstrom würde auf ihrer Seite sein. Sie würde ganz locker dahinrauschen und das Paddel nur zum Steuern benutzen.
Fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit hielt sie auf die St. Katharine Docks zu. Einen Steinwurf weit entfernt flussaufwärts ragte die Tower Bridge in ihrer ganzen viktorianischen Pracht hoch und protzig empor, und unter den zahlreichen Fußgängern darauf schienen zwei sie zu beobachten.
Eigentlich waren es drei, aber sie konnte nur zwei sehen.
Eine von beiden, die Größere, winkte, und Lacey riskierte es, einen Paddelschlag lang aus dem Takt zu kommen, um zurückzuwinken. Die kleinere dunkelhaarige Frau hielt die Arme weiter fest um den Brustkorb geschlungen, ein Brustkorb, der dicker und unförmiger aussah als sonst.
Plötzlich wurde Lacey durch etwas in der Nähe des Piers abgelenkt, das dort nicht hinpasste. Ein Gummitier lag auf dem schmalen Landstreifen zwischen der Ufermauer und dem Wasser. So ein aufblasbares Pool-Schwimmtier für Kinder, weiß, mit regenbogenbunten Streifen. Am Kopf etwa anderthalb Meter hoch und ungefähr genauso lang, und weit hinten in ihrem Kopf hörte sie ein ganz leises Flüstern, dass aufblasbare Gummitiere auf einem der gefährlichsten Flüsse der Welt nichts verloren hatten.
2
Helen sah Lacey natürlich als Erste, weil sie niemals ihren Polizei-Instinkt verloren hatte, sich ständig umzuschauen, Inventur zu machen und Probleme zu erkennen, noch bevor die überhaupt wussten, dass sie zu Problemen werden würden. Dana hatte das früher auch gekonnt.
Heutzutage machte es sie nervös, über die Brücke zu gehen. Was, wenn die nun anfing, in der Mitte aufzuklappen, während sie noch versuchte, auf die andere Seite zu gelangen, und nicht hinunterkonnte? Soweit sie wusste, war das noch nie vorgekommen, seit über hundert Jahren nicht, aber trotzdem.
Helen, die nichts von möglichen Brückenkatastrophen ahnte, blickte flussabwärts.
»Die hat sie ja nicht alle«, stellte sie fest und meinte natürlich Lacey in dem weißen Boot, das aussah, als könnte eine ordentliche Heckwelle es zum Kentern bringen.
Dana widersprach ihr nicht. Sie war schon vor geraumer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass Lacey Flint sie nicht alle hatte. Inzwischen wusste sie nicht mehr, wie oft der Leichtsinn der jungen Frau sie seit dem Abend, an dem sie sich zum ersten Mal begegnet waren, in Angst und Schrecken versetzt hatte. Damals hatte Lacey, von oben bis unten mit dem Blut einer Sterbenden beschmiert, an einem ganz besonders schauerlichen Tatort bemerkenswerte Geistesgegenwart gezeigt. Andererseits war Lacey einer der tapfersten Menschen, die Dana kannte, und ihre Instinkte waren fast schon brillant.
Inigo zappelte an Danas Brust, und automatisch umfasste ihre Hand seinen Kopf, um ihn zu beruhigen. Sie trug ihn gern in der Babytrage, ganz dicht an den Körper geschnallt. So konnte sie sich das Bedürfnis am besten erfüllen, ihn wieder in ihrem Bauch zu haben, wo niemand ihn anrühren, ihm etwas tun oder ihn ihr wegnehmen konnte.
Dana hatte niemandem – nicht einmal Helen – erzählt, dass sie nie wirkliche Angst gekannt hatte, bevor ihr Sohn zur Welt gekommen war, doch dass diese jetzt ihr ganzes Leben bestimmte: Angst vor ungewöhnlichem Schreien oder Wimmern, vor zu langer Stille während der Nacht, vor erhöhter Temperatur, vor Ausschlag, davor, ihn jenen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen, der nötig wäre, damit er spurlos verschwand. Sicher fühlte sie sich nur, wenn sie alle drei im Schlafzimmer lagen, Inigo in dem Bettchen auf ihrer Seite des Bettes. Und, nein, er mochte ja vielleicht fast sechs Monate alt sein, aber für ein eigenes Zimmer war es noch zu früh. Danas Welt war plötzlich voller Furcht, und doch würde sie ihn schon in wenigen Tagen stundenlang in der Kindertagesstätte in Southwark lassen, die sie gerade besichtigt hatten, damit sie wieder arbeiten gehen konnte.
Dana Tulloch war Detective Inspector bei der Londoner Polizei, oder zumindest war sie das gewesen, bevor sie Mutter geworden war.
Sie spürte, wie die Erleichterung sie durchströmte, als sie von der Brücke herunterkamen und das kleine Stück bis zu ihrem Treffpunkt gingen. Das Café, nebenbei ein beliebter Feinkostladen, gehörte einem Sizilianer, und obwohl der normalerweise nicht erlaubte, dass Tische reserviert wurden, machte er für die beiden ranghohen Polizistinnen stets eine Ausnahme. Während er für einen wartenden Kunden Trüffelöl und getrocknete Pilze in eine Papiertüte packte, begrüßte er Dana und Helen mit einem schmalen Lächeln und deutete auf einen Tisch an der Wand gegenüber.
Mit schmerzendem Rücken befreite Dana Inigo aus der Trage und setzte ihn auf ihren Schoß. Für den Rest ihres Aufenthalts würde sie die Arme nicht heben, damit er nicht herunterfiel, doch Ini war ein aktives, ungeduldiges Baby, das höchst ungern still saß und es noch mehr hasste, festgehalten zu werden.
»Da kommt sie ja«, sagte Helen. Dana wandte sich um und erblickte draußen auf der Straße eine schlanke blonde Frau in Sportkleidung.
Es war seit Juni das erste Mal, dass die beiden Lacey zu Gesicht bekamen. Damals war sie von ihrem gemeinsamen Freund Mark Joesbury für eine schwierige Undercover-Aktion im Nordwesten vereinnahmt worden. Technisch gesehen war die Operation ein Erfolg gewesen, und ein paar sehr gefährliche Männer warteten nun auf ihren Prozess. Andererseits war dabei eine junge Frau ums Leben gekommen. Kein anständiger Polizist kam über so etwas leicht hinweg. Mark machte das immer noch zu schaffen, und es war unwahrscheinlich, dass es Lacey anders ging.
Die Klingel an der Ladentür ertönte, und Lacey setzte ein Lächeln auf, das für Dana gezwungen aussah. Es war jedenfalls nicht ganz leicht gewesen, sie zu dem Treffen heute Vormittag zu überreden.
»Mein Gott, der ist ja riesengroß geworden!« Laceys Blick blieb auf das Baby gerichtet, während sie Helen auf die Wange küsste und Dana anlächelte. »Wie war’s in der Kindertagesstätte?«
»Mindestens zwei Grad zu warm, und die brauchen dringend ein paar Polstermöbel, um den Krach zu absorbieren«, antwortete Dana. »Da drinnen rennen große Kinder ganz dicht neben den Bettchen von den Kleinen herum, und ich bin mir nicht sicher, dass das Essen da so bio ist, wie die behaupten.«
»Ganz toll«, sagte Helen. »Supernette Erzieherinnen und sehr fröhliche Kinder. Die haben die besten Bewertungen in ganz Südlondon, und am Montagmorgen geht’s für ihn los. Du freust dich drauf, stimmt’s, Knirps?« Helen schnitt Inigo eine Grimasse, der daraufhin quietschte und mit den Händen in der Luft herumwedelte.
»Babys brauchen soziale Interaktion«, fügte sie hinzu. »Und ihre Mütter auch. Und selbst wenn nicht, müssen die Mütter wieder arbeiten.«
»Er ist immer so fröhlich.« Lacey lächelte Inigo an. »Ich glaube, ich habe ihn noch nie weinen hören.«
»Weil Dana ihn nie absetzt«, sagte Helen. »Fragen Sie sie mal, ob Sie ihn auf den Schoß nehmen dürfen. Na los, versuchen Sie’s. Sie wird irgendeine Ausrede finden, ihn nicht herzugeben.«
»Natürlich darf Lacey Ini auf den Schoß nehmen«, wehrte Dana schroff ab. »Aber sie ist doch gerade erst von Deptford hier raufgepaddelt, und wahrscheinlich will sie erst mal wieder zu Atem kommen.«
Lacey setzte sich.
»Kommt mir vor, als wär’s schon eine Ewigkeit her«, begann Helen. »Wir haben Sie nicht mehr gesehen, seit Sie aus Cumbria zurück sind.«
Typisch Helen, schwierige Themen direkt anzusprechen, dachte Dana.
»Und, froh, wieder auf dem Fluss zu sein?«, fuhr Helen fort. »Oder haben Sie sich das mit der Arbeit als Zivilpolizistin in Cumbria noch mal überlegt?«
Vor achtzehn Monaten hatte Lacey, die damals kurz davor gewesen war, der Polizei für immer den Rücken zu kehren, eine Versetzung beantragt, ein Schritt, zu dem normalerweise Beamte gezwungen wurden, die in Ungnade gefallen waren. Lacey jedoch hatte eine vielversprechende Karriere beim CID aufgegeben, der Abteilung für Schwerverbrechen, und war bei der Flusspolizei in den Streifendienst zurückgekehrt.
»Das ruhige Leben hat durchaus seinen Reiz.« Lacey lächelte, wohl um zu zeigen, dass das halb als Witz gemeint war. Die Themse war eine der befahrensten urbanen Wasserstraßen der Welt, eine viel genutzte Route sowohl bei Drogen- als auch bei Menschenschmugglern. Und sie forderte zahlreiche Opfer.
»Dana möchte Sie etwas fragen«, verkündete Helen.
Verdammt. Damit hatte sie warten wollen.
»Was denn?« Lacey machte ein neugieriges Gesicht. Ein ganz klein bisschen argwöhnisch sah sie auch aus.
Dana hatte vorgehabt, erst einmal zu sondieren, wie es Lacey ging, und das Gespräch vielleicht sogar zu vertagen.
»Sie wissen doch, dass Neil stellvertretender DI war, während ich im Mutterschutz war?«, begann sie.
Neil Anderson war Danas Stellvertreter im Major Investigation Team – oder MIT – des Reviers von Lewisham, ein Officer, mit dem Lacey schon mehrmals zusammengearbeitet hatte.
»Seine Beförderung wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Wochen bestätigt, und er wird sich bald versetzen lassen«, fuhr Dana fort. »Das Team wird neu zusammengestellt, und dann gibt es eine freie Stelle. Ich habe ganz oben vorgefühlt, und wenn Sie Interesse daran haben, zum CID zurückzukommen, würde Ihre Bewerbung wohlwollend aufgenommen werden.«
Dana sah, dass Laceys Augen dunkel wurden. Sie wusste, dass alle sie gewarnt hatten. Helen, Mark, sogar David Cook, Laceys Boss bei der Flusspolizei, alle hatte ihr versichert, dass Lacey da, wo sie war, gut aufgehoben sei. Um eine junge Frau zu schützen, die ihnen allen am Herzen lag, hatten sie gesagt, Lacey sei in zu viele gefährliche und schwierige Fälle involviert gewesen und habe in ihrer jungen Karriere mehr Tod und Finsternis erlebt als die meisten Polizisten in ihrem ganzen Berufsleben.
Dem konnte Dana nicht widersprechen, doch es machte sie rasend, ein solches Talent vergeudet zu sehen. Lacey hatte das Zeug zu einer großartigen Zivilfahnderin.
»Ich kann ja mal darüber nachdenken«, sagte Lacey, den Blick fest auf die Tischplatte gerichtet. »Vielen Dank.«
Dana achtete nicht auf Helens »Ich hab’s dir ja gesagt«-Blick. »Da wäre allerdings noch eins …«
Das Frühstück kam, bevor sie den Satz beenden konnte. Haferbrei mit Beeren für sie, ein Croissant für Lacey und eine Riesenportion Eggs Benedict auf Ciabatta für Helen, die anscheinend nie auch nur ein Gramm zunahm, ganz egal, was sie aß. Inigo, der seit Kurzem Interesse an richtigem Essen zeigte, griff nach der Schale seiner Mutter. Dana nahm ihn auf den Arm und probierte. Viel zu heiß, und wahrscheinlich war da Salz drin. Sie würde ihn mit einer Himbeere abspeisen.
»Und, irgendwelche Verehrer?«, erkundigte sich Helen bei Lacey. Das war ein weiteres Thema, das man Danas Meinung nach besser vermied. Laceys »Ja-Nein-Weiß nicht«-Beziehung mit Mark Joesbury schien sich endgültig festgefahren zu haben.
»Was ist denn mit diesem Kollegen, Sie wissen schon, der Kletteraffe? Wie nennen sie den noch mal? Batman?«
Mark sagte auch nichts dazu. Davon abgesehen ging er Dana und Helen fast ebenso sehr aus dem Weg, wie Lacey es getan hatte. Wahrscheinlich versuchte er, genau diese Fragen zu umschiffen.
»Spiderman«, antwortete Lacey. »Alias Finn Turner. Und nein, der macht für meinen Geschmack zu sehr auf Frauenheld.«
»Haben Sie in letzter Zeit mal den neuen Boss von der SCD10 gesehen?«
Helen meinte Mark, der nach dem Cumbria-Fall vor Kurzem zum Leiter der Abteilung für Undercover-Ermittlungen befördert worden war.
Ganz ehrlich, kannte diese Frau die Bedeutung des Wortes »Takt«?
Unten am Wasser, keine zweihundert Meter entfernt, blies ein Mann das Schwimmtier ein wenig fester auf.
3
»Sie wollten mich etwas fragen«, sagte Lacey zu Dana, als sie aufstanden, um zu gehen.
Die Rechnung war bezahlt, die Babysachen waren zusammengesucht und in Helens Rucksack verstaut, und Inigo saß wieder sicher verpackt in seiner Bauchtrage. Die drei Frauen verabschiedeten sich von dem Cafébesitzer und traten auf die Promenade hinaus. Der Tag war heller geworden. Die Wolken verzogen sich und hinterließen einen kornblumenblauen Himmel, doch vom Wasser wehte eine frischere Brise herüber.
»Das können wir auch ein andermal besprechen«, erwiderte Dana. Die anderen hatten recht gehabt: Lacey war noch nicht bereit für eine Rückkehr zum CID. Ihre Weigerung, über Cumbria zu reden, ihre ausweichenden Antworten auf Fragen nach Mark, ihr Widerwille, über sich selbst zu sprechen – das alles führte zu ein und derselben Schlussfolgerung: Lacey war noch nicht so weit.
»Nein, könnt ihr nicht«, ging Helen dazwischen. »Bringt’s hinter euch, sonst zieht sich das noch ewig so hin.«
Dana seufzte deutlich hörbar. »Es ist nur – alle sind wirklich ganz scharf darauf, Sie wieder ins CID zurückzuholen, Lacey. Sie wissen, wie wertvoll Sie wären, aber …«
Verdammt noch mal, Helen, dies war doch wirklich nicht der richtige Moment.
»… es gibt da einige … also, ich will nicht Bedenken sagen, nur ein bisschen … na ja, man könnte es Unbehagen nennen … Und wie sehr Sie die Leute beruhigen könnten … das wäre sehr hilfreich, um die Wogen zu glätten.« Helen atmete laut durch die Nase aus.
»Spucken Sie’s schon aus.« Laceys Miene war ein Sinnbild geduldiger Belustigung.
»Es werden Fragen über Ihre monatlichen Besuche in der Haftanstalt Durham gestellt«, stieß Dana hastig hervor. »Ich verstehe ja, dass Sie und Victoria Llewellyn sich schon lange kennen, und jeder weiß, dass Sie eine entscheidende Rolle bei ihrer Festnahme gespielt haben, und es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass Sie sich damals falsch verhalten hätten, das hat die Anhörung ja klargestellt. Es ist nur …«
»Es sieht nicht gut aus.« Laceys Gesicht hatte dichtgemacht. Ohne Danas Blick zu erwidern, zückte sie ihr Handy. »Hören Sie, ich muss los, sonst verpasse ich die Flut. Besprechen wir das doch wirklich ein andermal. War schön, Sie wiederzusehen.«
Und damit hatte es sich. Ein flüchtiger Wangenkuss für beide, ein längerer auf Inigos Köpfchen, und Lacey hatte sie stehen lassen und war zum Tower Bridge Quay marschiert.
»Hab’s dir ja gesagt«, bemerkte Helen.
4
Als Dana und Helen sie nicht mehr sehen konnten, erlaubte Lacey sich, langsamer zu gehen. Sie hatte immer gewusst, dass das passieren würde; in gewisser Weise hatte sie Glück gehabt, dass sie nicht schon früher damit konfrontiert worden war. Ihre regelmäßigen Besuche bei einer der berüchtigtsten Serienmörderinnen Großbritanniens hatten früher oder später zum Thema werden müssen.
Weitere Fragen würden folgen, das wusste Lacey, von Personen, die nicht ihre Freunde waren, bis ihre Lage unmissverständlich klar wurde. Entweder sie stellte ihre allmonatlichen Besuche im Gefängnis von Durham ein, oder sie konnte sich jegliche Chancen auf eine Beförderung abschminken. Sogar ihr Job könnte auf dem Spiel stehen.
Eine Fähre legte gerade vom Pier ab und zog einen funkelnden Silberfächer hinter sich her. Vor ihr auf der Bootsrampe zankten sich zwei Möwen um die Überreste einer Wollhandkrabbe, und ein goldener Luftballon, der irgendjemandem zum einundzwanzigsten Geburtstag gratulierte, versuchte, sich von der Brücke loszureißen, wo er hängen geblieben war. Lacey, die tief in Gedanken versunken war, bemerkte kaum etwas davon.
Nur wenige zu langen Freiheitsstrafen verurteilte Gefängnisinsassen erregten auch nur einen Bruchteil der öffentlichen Aufmerksamkeit und des Medieninteresses, die Victoria Llewellyn auch fast zwei Jahre nach ihrer Festnahme zuteilwurden. Zum Teil konnte man ihre Berühmtheit damit erklären, dass sie jung und schön war, und genauso durch die große Sympathie, die ihr Fall geweckt hatte.
Victoria, damals gerade sechzehn Jahre alt, und ihre vierzehnjährige Schwester Cathy waren in einem Park in Cardiff von fünf englischen Privatschülern vergewaltigt worden. Die Eltern der Jungen hatten all ihren Reichtum und Einfluss eingesetzt und dafür gesorgt, dass keine Anklage erhoben wurde.
Das Leben der beiden Schwestern, das ohnehin schon aus dem Ruder lief, war völlig aus den Fugen geraten. Cathy, die Jüngere, war vollkommen entgleist. Sie war von zu Hause weggelaufen und hatte in London auf der Straße gelebt. Alle Welt glaubte, dass sie ein paar Jahre später bei einem tragischen Unglücksfall auf einem Flussboot ums Leben gekommen wäre, denn sie wurde offiziell für tot erklärt. Als Victoria vom Tod ihrer Schwester erfuhr, hieß es, hatte sie einen brutalen Racheplan geschmiedet. Wild entschlossen, die Jungen, die sie vergewaltigt hatten, zu vernichten, ihr Leben zu zerstören, so wie das ihre zerstört worden war, hatte sie ihre Wut gegen deren Mütter gerichtet.
Eine nach der anderen hatte sie vier der Frauen mittleren Alters entführt und sie grauenvoll und öffentlichkeitswirksam ermordet. Während sie noch darauf aus war, ihr letztes Opfer zur Strecke zu bringen, war sie gestellt und verhaftet worden – und zwar von Lacey.
Die Welt – oder zumindest jener Teil der Welt, den die Londoner Polizei darstellte – glaubte, dass Lacey Flint und Victoria Llewellyn alte Freundinnen gewesen waren, die sich kennengelernt hatten, als Victoria nach ihrer Schwester gesucht und Lacey ebenfalls auf der Straße gelebt hatte. Die Polizei nahm an, dass langjährige Loyalität der Grund für Laceys Besuche in Durham war.
Was die Welt glaubte, stimmte natürlich nicht. Die Wahrheit war ein Geheimnis, das niemals ans Licht kommen durfte. Lacey durfte die Welt niemals wissen lassen, wer die Frau in der Haftanstalt in Durham wirklich war, genauso wenig, wie sie sie aus ihrem Leben verbannen konnte.
Ein Glück, dachte sie, dass sie nicht die Absicht hatte, zum CID zurückzukehren und dass sie ihre Tage bei der Londoner Polizei glücklich und zufrieden als kleiner Constable bei der Flusspolizei verbringen konnte. Sie konnte sogar aus dem Polizeidienst ausscheiden, wenn sie wollte. Denn die Frau, die die Welt – fälschlicherweise – als Victoria Llewellyn kannte, war für Lacey so lebenswichtig wie das Atmen.
5
»Okaaay«, sagte Helen in jenem gedehnten, nervösen Tonfall, den Menschen anschlagen, wenn sie eigentlich sagen wollen, dass irgendetwas überhaupt nicht okay ist.
Die beiden Frauen waren die Treppe zur Tower Bridge zu einem Drittel hinaufgestiegen, und Helen hatte aus irgendeinem Grund nach unten geschaut. Vielleicht wollte sie zusehen, wie Lacey davonpaddelte.
»Was ist denn?« Instinktiv legten sich Danas Hände um Inigos Bauchtrage.
Helen antwortete nicht, also folgte Dana ihrem Blick mit den Augen. Unten auf der Uferpromenade waren zwei Personen stehen geblieben, um zu plaudern, ein Mann und eine Frau, die beide Kinderwagen vor sich herschoben. Und zwei andere Männer, die sich Schals über Mund und Nase gewickelt hatten, gingen rasch auf sie zu. Als sie den Kinderwagen der Frau erreichten und einer von ihnen sich darüber beugte, rannte Helen die Treppe wieder hinunter.
Von ihrer Warte aus sah Dana entsetzt zu, wie der Mann das Baby der Frau – ein in Rosa gekleidetes Mädchen – aus dem Kinderwagen riss und mit ihm auf den Kai zurannte.
Direkt vor ihren Augen wurde ein Baby entführt!
Als Helen am Fuß der Treppe ankam, sprintete sie los, doch der zweite Mann war dem ersten gefolgt, und beide donnerten die Rampe zum Pier hinunter. Passanten, die den Vorfall mitangesehen hatten, brüllten, einer rannte hinter den Männern her. Die Mutter begann zu schreien. Der Mann, mit dem sie sich unterhalten hatte, schrie, dass sie Hilfe bräuchten: Könnte ihnen vielleicht mal jemand helfen, und ob jemand die Polizei rufen würde.
Dana konnte an nichts anderes denken als an das Kind in ihren Armen. Es zu beschützen, das war jetzt ihre Aufgabe. Ihre einzige Aufgabe.
»Dana!«, schrie Helen ihr zu. »Meldung!«
Während Helen die Rampe hinunter aus ihrem Blickfeld verschwand, mühte Dana sich ab, ihr Handy aus der Tasche zu ziehen. Sämtliche Telefonnummern, die sie jahrelang im Kopf gehabt hatte – sie hatte doch immer so ein gutes Zahlengedächtnis gehabt –, waren ihr abhandengekommen, also wählte sie den Notruf und hoffte, dass der noch funktionierte.
Die Mutter des entführten Kindes, mittlerweile völlig hysterisch, beugte sich über die Promenadenmauer und schrie zu den Leuten unten auf dem Pier hinab. Zu Leuten, die Dana nicht sehen konnte, zu denen aber die beiden Entführer sowie mehrere unschuldige Zuschauer gehören mussten. Und außerdem Helen, die sich, ohne nachzudenken, geradewegs in die Gefahr gestürzt hatte, weil sie das immer so machte. Und natürlich Lacey Flint, die inzwischen bestimmt unten am Wasser war und die Ärger anzog wie violette Blumen Bienen.
Danas Notruf wurde beantwortet, und sie fand die nötigen Worte.
»Entführung im Gange, Promenade am Nordufer, ein paar Meter südlich von der Tower Bridge. Ein Baby ist der Mutter weggerissen worden, Täter ist zu Fuß auf dem Tower Bridge Quay unterwegs zum Fluss. Brauche dringend Hilfe.«
Sprechen konnte sie, doch sie konnte sich nicht bewegen. Früher wäre sie Helen dicht auf den Fersen gewesen.
»Dana Tulloch, Detective Inspector, MIT Lewisham, zurzeit nicht im Dienst.«
Inigo, der ihre Angst spürte, begann zu wimmern.
»Zwei männliche Täter, weiß, glaube ich, vermummt. Sie müssen noch auf dem Pier sein, es sei denn, sie haben es irgendwie aufs Wasser geschafft. Ich kann’s nicht richtig sehen.«
Wenn sie näher heranginge, könnte sie mehr erkennen.
»Sie müssen die Wasserpolizei verständigen! Bestimmt planen die eine Flucht auf dem Fluss.«
Trotzdem verharrte sie wie festgewachsen an Ort und Stelle, wusste nicht, ob sie hierbleiben sollte, wo sie und ihr Baby sicher waren. Oder sollte sie sich ins Getümmel stürzen, den Tatort sichern, die schreiende Mutter beruhigen, ihren Job machen?
Und dann wurde ihr die Entscheidung abgenommen, denn der andere Mann in diesem furchtbaren Tableau, der Vater, der unbeachtet zurückgeblieben war, hob seinen eigenen Kinderwagen hoch und schleuderte ihn über die Promenadenmauer. Der Wagen verschwand und stürzte dem Fluss tief unter ihnen entgegen.
6
Detective Chief Inspector Mark Joesbury saß an seinem Schreibtisch, und davon bekam er immer schlechte Laune. Oft und regelmäßig sagte er sich, er sei bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit befördert worden, und in letzter Zeit war seine Stimmung so düster, dass er das wirklich glaubte. In jüngeren Jahren und in weniger ranghohen Positionen hatte er sich hervorgetan. Als Streifenpolizist hatte er einen guten Draht zu den Leuten in den Stadtvierteln gehabt, in denen er tätig war, einen Draht, der ihm eine Menge an Informationen eingebracht hatte, von der die meisten Polizisten nur träumen konnten. Rasch zum Detective befördert, war seine Aufklärungsrate unerreicht gewesen, und sein Potenzial für Undercover-Arbeit war entdeckt worden. Als verdeckter Ermittler der SCD10 der Londoner Polizei war er dank seiner unkonventionellen Herangehensweise mehr als einmal nur knapp an einer Entlassung vorbeigeschrammt, aber er hatte stets geliefert. Er hatte einige der gefährlichsten und aufsehenerregendsten Operationen im ganzen Land geleitet und als deren Gipfel die Familie des Präsidenten der Vereinigten Staaten gerettet. Damals hatten seine Vorgesetzten ihn versetzen wollen. Sie hatten gesagt, er sei drauf und dran, eine bekannte Persönlichkeit zu werden – der Todeskuss für jeden Undercover-Polizisten. Doch er hatte auf einem letzten Einsatz bestanden. Einem Einsatz, bei dem er fast (und nicht zum ersten Mal) die Frau verloren hätte, die er liebte, und einen Menschen getötet hatte. Zum ersten Mal.
Und das war’s dann. Ein Schreibtischjob für DCI Joesbury. Von jetzt an würde er Operationen planen, würde die jungen Kollegen ins Feld schicken, würde andere Männer und Frauen Gefahren aussetzen. Von jetzt an würde alles Blut an seinen Händen kleben, denn über ihm kam niemand mehr.
Und in so etwas war er wirklich nicht besonders gut.
»Sir.«
Ein Mitarbeiter seines neuen Teams streckte den Kopf in sein Büro. Theo Cox hatte in Cambridge Informatik studiert und war Spezialist für Online-Finanzvergehen und -betrug. Eine Zeit lang hatte er in der City gearbeitet, ehe er als Berater zur Metropolitan Police gegangen war. Nach den nötigen Schulungen war er Joesburys Team zugeteilt worden.
Für einen Polizisten war Theo immer sehr gut angezogen, und Joesbury hatte so ein Gefühl, dass der heutige Anzug aus einem Seidengemisch war, wenn nicht gar aus reiner Seide. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit maßgeschneidert. Immer trug er Hemden und Krawatten in leuchtenden Blau- oder Fliedertönen, um die Farbe seiner tief liegenden Augen zu betonen. Sein Haar war skandinavisch blond und tadellos frisiert.
Dankbar für die Störung schloss Joesbury den Bericht, den er gerade überflogen hatte. »Theo, was kann ich für Sie tun?«
Mit der unerschütterlichen Selbstsicherheit eines Absolventen von Privatschulen und einer Eliteuniversität stand Theo bereits im Büro. »Sie haben doch gesagt, wir sollen es Sie sofort wissen lassen, wenn in der Nähe der Tower Bridge irgendetwas Ungewöhnliches vorgeht?«
Theo überwachte »das Rauschen«, die Online-Aktivitäten in der Hauptstadt und ihrer Umgebung und hielt Ausschau nach dem Wirbel im Datenstrom, dem besonderen Augenblick, dem Anfang eines Musters. Nach allem, was darauf hindeuten könnte, dass sich irgendwo etwas zusammenbraute.
»Was haben Sie denn?«
Die Hände des Jungen waren leer. Offenbar hatten er und seinesgleichen noch nie von schriftlichen Unterlagen gehört. »Ist vor ein paar Sekunden reingekommen, und das System hat’s mit einem Warnhinweis versehen. Ich hab’s an Sie weitergeleitet.«
Joesbury öffnete sein Postfach. Ein paar Zeilen Text, ein Internetalarm.
Theo gab ihm kaum Gelegenheit, den Text zu verarbeiten. »Entführung eines Babys auf der Promenade südlich der Tower Bridge. Eine Polizistin außer Dienst war vor Ort. Streife ist unterwegs.«
»Dana«, sagte Joesbury, als er den Namen seiner besten Freundin und der Patentante seines Sohnes auf dem Bildschirm entdeckte. Rasch blickte er auf. »Und die Entführung ist noch im Gange?«
Ein heftiges, erregtes Nicken. »Sieht so aus.«
Die Tower Bridge war etwas mehr als anderthalb Kilometer von Scotland Yard entfernt.
Joesbury war auf den Beinen. »Holen Sie Ihren Mantel.«
7
Die Themse hat einen beeindruckenden Gezeitenbereich, zwischen Hoch- und Niedrigwasser kann sie mit bis zu sieben Metern aufwarten. Obgleich das absolut gesehen nicht bemerkenswert ist (der Severn, der fünfzehn Meter schafft, findet das vielleicht lustig), bedeutet es doch, dass ein Fluss, der zu Beginn des Tages bis hoch an die Promenadenmauer heranreicht, sechs Stunden später einen recht breiten Uferstreifen frei lassen kann.
Als Lacey Flint an jenem Morgen Mitte September wieder auf dem Tower Bridge Quay ankam, hatte gut vier Stunden lang Ebbe geherrscht, und ein schmaler grauer Strand war erschienen, übersät mit schmierigen Steinen und Müll. Die Ufermauer, bekränzt mit alten Ketten zum Festmachen, ragte fünfzehn Meter empor. Schmutzgeschwärzte Steine im oberen Teil, während der untere von triefendem smaragdgrünen Seegras bedeckt war.
Lacey strebte auf den inneren Rand des Piers zu, wo sie ihr Kajak festgemacht hatte. Die Besitzer der Landungsbrücke hatten kein Problem damit. Die meisten Leute, die am oder auf dem Fluss arbeiten, ziehen es vor, sich mit der Flusspolizei gut zu stellen, und Lacey hatte sich während ihrer Zeit bei der Einheit bei den gesetzestreuen Mitgliedern der Flussgemeinschaft recht beliebt gemacht. Bei den weniger gesetzestreuen war sie weniger beliebt.
Das Schwimmtier, das ihr vorhin aufgefallen war, war immer noch da. Es lag ein paar Meter flussabwärts am Strand und wurde jetzt von einem Mann im dunklen Jogginganzug an einer dünnen Schnur festgehalten. Laceys erste instinktive Reaktion war Erleichterung, dass es nicht in den Händen von Kindern war, ein Gefühl, das weniger als eine Sekunde anhielt.
Kaum hatte sie sich ins Kajak gesetzt, als auf der Promenade über ihr ein Tumult ausbrach. Schreie gellten durch das Alltagsbrausen des Londoner Straßenverkehrs, und eine Frau – Lacey glaubte, Helens Stimme zu erkennen – brüllte etwas. Eine Hupe ertönte. Rennende Schritte. Der Steg, der von der Promenade zum Pier hinabführte, begann zu hüpfen und zu beben, als schwere Schritte ihn entlangpolterten. Zwei Männer kamen auf sie zugeeilt.
Lacey reagierte augenblicklich. Hastig kletterte sie aus dem Kajak und zückte ihr Handy, während der erste Läufer, das Gesicht halb von einem Schal verborgen, ihren Blick erwiderte und langsamer wurde. Helle Augen. Ein Weißer. Jung, dünn. Er hielt etwas an die Brust gedrückt.
Ein dritter Mann erschien auf dem Steg, älter, mit dunklerer Haut und in Arbeitskleidung. Er verfolgte die beiden.
»Haltet sie auf!«, rief er und rannte den Steg hinunter.
Die beiden Männer wurden wieder schneller; dann erschien auch Helen auf der Bildfläche. Der erste Mann erreichte den Pier, und, großer Gott, das war ja ein Baby da in seinen Armen. Er sprang über das Geländer, landete auf dem Uferstreifen und rannte an ihr vorbei.
»Lacey, er hat ein Baby!«, schrie Helen unnötigerweise. Das Baby, das instinktiv begriff, dass seine sichere, ordentliche Welt auf den Kopf gestellt worden war, brüllte aus vollem Hals.
Lacey nahm die Verfolgung auf und wusste, dass ihre Chancen nicht gut standen. Weder trug sie Uniform, noch hatte sie ihren Dienstausweis bei sich. Kein Funkgerät, um die Zentrale in Wapping zu kontaktieren, keine Verstärkung. Sie war nur eine junge Frau, die sich drei Kerlen gegenübersah, die irgendetwas Unfassbares vorhatten. Als sie vom Pier sprang, sank sie tief in den grauen Schlamm ein und konnte nur entsetzt zusehen, wie die drei Männer das Baby in das Schwimmtier legten und es aufs Wasser hinausstießen.
Sie hatte doch gewusst, dass mit diesem Schwimmdings etwas nicht stimmte. Warum hatte sie nicht früher gehandelt?
Dann kamen die drei Männer auf sie zu wie die vorderste Reihe einer Rugbymannschaft. Der Erste schlug mit der rechten Faust zu. Der Schlag traf sie seitlich am Kopf und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Der Zweite brüllte etwas, das sie nicht verstand. Fast wäre sie hingefallen; sie schwankte, während sie versuchte, sich zu fangen. Gleichzeitig entfernten sich die quatschenden Schritte der Männer.
Sie drehte sich nicht um, um ihnen nachzusehen, wie sie davonliefen. Das Baby!
Lacey rannte zum Wasser. Die Schnur an dem Schwimmtier, vielleicht bekam sie die zu fassen … Doch der gierige Fluss hatte sich sein neuestes Opfer bereits geholt, und das Gummieinhorn, weiß mit Regenbogenstreifen, trieb fast zwanzig Meter flussabwärts.
Eine Hand berührte ihre Schulter. »Wie tief ist es hier?«, fragte Helen. »Kann ich da rauswaten?«
Lacey wirbelte herum. »Nie im Leben. Rufen Sie in Wapping an. Die haben ein paar Minuten, um es abzufangen.«
Allerhöchstens ein paar Minuten. Normalerweise machte die Ebbe vier Knoten, und die Dienstelle Wapping, wo die Flusspolizei stationiert war, lag nicht weit stromabwärts. Als Lacey wieder über das Geländer des Piers kletterte, sah sie, wie der vierte Mann, ein Pakistani in Arbeitskleidung, den drei Männern auf dem Uferstreifen hinterherrannte, doch er war älter und langsamer, und sie hatten einen ordentlichen Vorsprung. Sie hörte Helen telefonieren; sie nannte ihren Namen und Dienstgrad und verlangte, sofort nach Wapping durchgestellt zu werden. Und Lacey wusste, dass sie das alles hinter sich lassen musste. Der Fluss, das Baby – das war alles, woran sie jetzt denken konnte.
Polizisten werden dazu ausgebildet, zu sehen, zu registrieren, und die Officers der Wasserpolizei konnten nicht auf der Themse unterwegs sein, ohne ständig ihre Umgebung wahrzunehmen. Bei Lacey Flint war das nicht anders, wenn überhaupt, so war sie besser darin als die meisten anderen. Am Anleger von Wapping hatte eine Targa-Motorjacht gelegen, als sie vorhin vorbeigepaddelt war, eines der Boote, mit denen sie und die anderen auf dem Fluss patrouillierten, und außerdem zwei schnelle Festrumpfschlauchboote. Ihre Kollegen könnten wirklich binnen weniger Minuten auf dem Wasser sein.
»Ich kann mir das Ding schnappen«, schrie sie Helen zu und sprang wieder in ihr Kajak. »Lassen Sie den Fluss für alle Fahrzeuge sperren. Und die Jungs in Wapping sollen sich …«
Als der Gezeitenstrom sie mitriss, sah sie, wie Helen herumfuhr und nach Luft schnappte. Ein Kinderwagen war oben auf der Promenadenmauer erschienen. Er verharrte kurz dort, dann stürzte er herab und schlug fünfzehn Meter tiefer hart auf dem Sand auf.
8
Am Fuß der Treppe zur Tower Bridge hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Irgendwo in der Ferne näherte sich eine Sirene.
Der Mann, der den Kinderwagen geworfen hatte, war auf der anderen Seite der stark befahrenen Straße. Er ging nach Norden, in Richtung Innenstadt, und Dana musste ihn laufen lassen. Ein anderer Mann, im Anzug und mit einer Ausgabe der Financial Times in der Hand, löste sich aus der Menge und strebte auf den Pier zu. Eine Hand fest um Inigos Kopf gelegt, rannte Dana auf ihn zu.
»Sir!«
Oben an der Rampe machte er halt und drehte sich um.
»Sir, ich bin Polizeibeamtin außer Dienst. Meine Kollegen sind unterwegs. Könnten Sie bitte hierbleiben und alle daran hindern, zum Fluss hinunterzugehen, bis sie hier sind?«
Der Mann deutet auf das Wasser. »Er hat ein Baby da runtergeworfen.« Er schluckte. »Der Kinderwagen, den er runtergeschmissen hat … da war ein Baby drin. Er hat ein Baby über die Mauer geworfen!«
»Ich weiß, Sir. Meine Kollegin ist da unten, und ich gehe gleich selbst hin. Das hier ist jetzt ein Tatort, und wir müssen ihn sichern. Können Sie uns helfen, bitte? Ein paar Minuten?«
Der Mann sah erst unsicher und dann erleichtert aus. Er nickte zustimmend, also schob Dana sich an ihm vorbei. Inigos Kopf noch immer fest umfasst, rannte sie die Rampe hinunter.
Drei Personen tauchten in ihrem Blickfeld auf. Helen, die in ihr Handy sprach, den Blick fest auf den umgestürzten Kinderwagen gerichtet. Ihre Lebensgefährtin, der mutigste Mensch, den sie kannte, den nichts aus der Ruhe brachte, sah aus, als müsse sie sich gleich übergeben. Der Mann, der die Entführer verfolgt hatte, lehnte völlig außer Atem am Geländer des Piers. Auch er starrte voller Grauen den halb im Schlamm steckenden Kinderwagen an. »Babys«, stammelte er halblaut, als Dana näher kam, »wer tut denn kleinen Kindern so was an?« Und Lacey, die wieder in ihrem Kajak saß und wie wild vom Pier wegpaddelte. Von dem Baby oder den beiden Männern, die es entführt hatten, war nichts zu sehen.
»Ja, Constable Lacey Flint hat die Verfolgung aufgenommen«, sagte Helen gerade. »In einem Kajak. Sie ist ungefähr …« Dana sah, wie Helen den Blick mühsam zum Fluss wandte, »… fünfzig Meter flussabwärts von der Tower Bridge. Das Aufblas-Schwimmtier kann ich nicht sehen. Ja, weiß, an der höchsten Stelle ungefähr anderthalb Meter hoch, mit Regenbogenstreifen. Ein Einhorn. Wir brauchen Rettungsteams auf dem Fluss, sofort!«
Als Dana ihrer Partnerin die Hand auf die Schulter legte, fuhr Helen zusammen und entspannte sich erst, als sie sah, wer da zu ihr getreten war. Sie beendete das Telefonat, und ihr Blick huschte rasch zu Inigo.
»Ihm fehlt nichts«, sagte Dana. »Was ist hier los?«
»Drei Männer, einer hat hier unten auf die beiden anderen gewartet. Das Baby treibt auf dem Fluss, in einem aufblasbaren Gummitier, das sehr wackelig aussieht, und Lacey ist ihm auf den Fersen. Und dann ist das da passiert.«
Mit einer knappen Kopfbewegung deutete Helen auf den umgekippten Kinderwagen.
Lacey war bereits außer Sicht. Auch sie war mutig, war superfit und mehr als kompetent, aber wie konnte ein Baby da draußen auf dem Fluss überleben? Und in der Zwischenzeit hatte sich nur ein paar Meter entfernt eine weitere Tragödie ereignet.
»Wir müssen nachsehen«, sagte Dana.
»Ich weiß.«
Keine der beiden Frauen rührte sich von der Stelle. »Ich glaube, ich kann das nicht«, stieß Helen hervor.
Dana hakte die Bauchtrage los. »Hier, nimm Ini.«
Ihr Körper fühlte sich kalt an, als sie Helen ihren Sohn reichte. Und als sie auf das zuging, das, wie sie instinktiv wusste, das Allerschlimmste sein würde, was sie jemals gesehen hatte, fühlte es sich an, als wäre irgendetwas Lebenswichtiges in ihr plötzlich nicht mehr da. Als würde ihr gemeinsamer Sohn verschwinden, wenn sie sich zu Helen umdrehte. Während ihre Füße in den Schlamm einsanken, ertappte sie sich dabei, dass sie bezweifelte, jemals Mutter gewesen zu sein.
Doch das hier war ihr Job, sie musste dorthin.
Der Schlamm war tief. Danas Schuhe waren bereits völlig verdreckt, und das war ja bestimmt gut. Es musste eine weiche Landung gewesen sein. Aber der Wagen war über fünfzehn Meter tief hinuntergestürzt, und selbst wenn das Kind angeschnallt gewesen war, hatte es sich bestimmt schwer verletzt. Wenn überhaupt, dürften die Gurte alles noch schlimmer gemacht und den kleinen Körper festgehalten haben, als die Wucht des Aufpralls ihn zerriss. Das arme kleine Ding hätte bessere Chancen gehabt, wenn es nicht festgeschnallt gewesen wäre. So wie die Dinge lagen, war Dana klar, dass das Kind sich höchstwahrscheinlich das Genick gebrochen hatte.
Was für ein Vater stürzte sein kleines Kind in den beinahe sicheren Tod? Überhaupt kein Vater, begriff sie. Das Baby, das sie gleich vor sich sehen würde, war entführt worden, um ermordet zu werden. Zwei tote Babys, denn das Kind auf dem Fluss konnte unmöglich überleben. Wie konnte so ein schöner Tag so fürchterlich entgleist sein?
Als sie den Kinderwagen erreichte, erkannte sie Marke und Modell, ein Silver Cross Pioneer in Taubengrau. Er kostete fast neunhundert Pfund und war einer von sechs auf ihrer Auswahlliste gewesen.
Ach, Herrgott noch mal, Dana, ich kann mir nicht noch einen Kinderwagen anschauen. Würdest du dich bitte mal entscheiden?
Der Wagen stand auf dem Kopf, das graue Stoffverdeck war größtenteils im Schlamm verborgen, und die Räder drehten sich immer noch.
Dana war sich auch nicht sicher, ob sie das konnte. Ein ermordetes Baby, es war unvorstellbar. Und doch, wenn es denn getan werden musste, dann sollte es von einer Mutter getan werden.
Der Gedanke verlieh Dana Mut, jedenfalls ein wenig, und sie packte das Aluminiumgestell und zerrte daran. Der Schlamm zerrte zurück. Sie spürte jemanden an ihrer Seite, und ihr wurde klar, dass es Helen war. Jetzt hatte sie sich Inigo vor die Brust geschnallt.