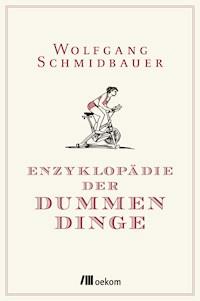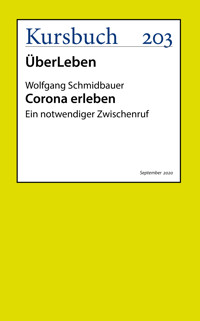14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Immer mehr Menschen denken, nicht sie selbst, sondern ihre Eltern seien die Schmiede ihres Glücks. Kritik an schlechten Eltern ist daher etabliert, denn sie gelten als belastbar und sollen Verantwortung tragen. Anklagende Kinder dürfen dagegen Kinder bleiben, Verständnis und Mitgefühl erwarten. In seinem Essay richtet sich Schmidbauer an alle, die sich für Familien interessieren, vor allem aber an Eltern, die unter den Vorwürfen erwachsener Kinder leiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
Böse Väter, kalte Mütter?
Warum sich Kinder schlechte Eltern schaffen
Reclam
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: FinePic®
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962222-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011467-4
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
1. Zur Entwicklung der Elternrolle
2. Die animalischen Verluste
Die Angst der Mutter vor dem Kind
Der Weg in die Autonomie
3. Von der Parentifizierung zur Elternschelte
Das falsche Bild von emotionaler Autonomie
Parentifizierung als Interaktion
Der Versuch einer Reparatur
Konstruierte Kausalitäten
4. Infantifizierte Eltern
5. Rekonstruktion einer Entfremdung
Der Verlust des Rituals
6. Inszenierte Kälte
Zeit heilt nicht alle Wunden
7. Der verwandelte Ödipus
Opfermythen zwischen Eltern und Kind
Grenzen der Versöhnung
8. Großelternkonflikte
Die übersprungene Stufe
Enkelentzug
Heiße, kalte und warme Antworten
Interkulturelle Spannungen
Spaltungen ertragen, Brücken bauen
: Das Geheimnis der Gnade
Literaturhinweise
Fachliteratur
Belletristik
Einleitung
Es würde unserer Vorstellung von einem nachvollziehbaren Verhalten entsprechen, dass wir die Gesellschaft von Personen suchen, die uns guttun, und Kontakte mit Menschen meiden, die uns kränken. Kinder und Eltern verhalten sich oft gänzlich anders. Sie suchen, längst erwachsen und wirtschaftlich getrennt, immer noch nach Nähe und klagen über einen Mangel an Aufmerksamkeit. Sie weisen Geschenke zurück, die sie von anderen annehmen würden. Sie wollen verstanden werden.
Entwertend und voller Klagen über nahe Verwandte zu sprechen bedeutet keineswegs, dass die Bindung an sie schwach, die Wünsche an sie zurückgenommen sind. Sie werden nach wie vor gebraucht. Manches an den Äußerungen hört sich an, als ginge es um die Rechtfertigung für einen eigenen Mangel an Lebenszufriedenheit oder Zukunftshoffnung.
Während Klagen über missratene Kinder seit Anbeginn der Schriftkultur überliefert sind, sind Klagen von Kindern über Erziehungsfehler und Zuwendungsmängel der Eltern recht neu. Die Kinder vergleichen ihre Eltern mit dem Bild, das sie von »wirklich guten« Eltern haben. Sie gewinnen diese Bilder aus populären Texten über ein in ihnen fortlebendes »inneres Kind«, aus Fallgeschichten über frühe Traumatisierungen, aus Erinnerungen an Widersprüche und Übergriffe, wie Franz Kafka in seinem Brief an den Vater. Sie überzeugen sich, dass die Probleme, die sie als Erwachsene haben, mit der Differenz zwischen den realen Eltern und diesem Idealbild zusammenhängen.
Der Gedanke, dass Eltern nicht nur körperliche Bedürfnisse befriedigen und die Kinder in der Anpassung an die gesellschaftliche Realität unterstützen, sondern sie verstehen und glücklich machen, hat durchaus zweischneidige Folgen. Implizit steckt er in den Konzepten der Primärtherapie und in Abwandlungen der klassischen Psychoanalyse durch Heinz Kohut und Alice Miller.
Begonnen hat diese Entwicklung im Aufarbeiten der seelischen Erschütterungen durch den Faschismus, den Holocaust, die Atombombe und die drohende ökologische Katastrophe. Zu den wesentlichen Neuerungen der sechziger Jahre gehörte das Konzept einer antiautoritären Pädagogik, die sich gegen den »autoritären Charakter« und damit gegen die willigen Vollstrecker bösartiger Befehle richtete. In Deutschland war es ein wesentliches Anliegen der 68er-Bewegung, sich kritisch mit den autoritären »Nazi-Eltern« auseinanderzusetzen und später zu den eigenen Kindern ein emotional nahes, freundschaftliches, ja romantisches Verhältnis zu finden.
Damit sind die Eltern nicht in der Vergangenheit und in der äußeren Welt angesiedelt. Sie halten einen Brückenkopf im Inneren der erwachsenen Kinder. Diese fiktiv fortbestehende Einflussnahme ruft nach Verteidigungsmaßnahmen. Die Eltern ahnen oft nicht, welche Macht ihnen zugeschrieben wird. Sie sind hilflos gegenüber Aktionen des erwachsenen Kindes, die sich gegen eine Besatzungsmacht richten, von der die Eltern gar nicht wissen, dass sie existiert.
Es gibt zwischen Menschen keine einseitige Transformation. Eine transformierende Beziehung (wie die Erziehung) wirkt in beide Richtungen. Indem die Eltern an das Kind Phantasien herantragen, indem sie ihm Bilder vermitteln, was sie selbst gerne geworden wären und was sie sich wünschen, dass das Kind werde, wecken sie in dem Kind Gegenphantasien. Es baut Bilder auf, wie die Eltern beschaffen sein müssten, um die eigenen Ziele zu erreichen und ein befriedigendes Leben zu führen.
In vormodernen Kulturen ernähren und schützen die Eltern ihr Kind, solange es klein ist. Sobald es selbständiger wird, ist es ebenso wie die Eltern Traditionen unterworfen, die über beiden stehen.
Das ändert sich in der individualisierten Gesellschaft. Jetzt werden die Phantasien der Eltern mächtiger – und ebenso die des Kindes. Das Kind ist vor die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie konform die Phantasien der Eltern mit seinen eigenen sind. Der Vater findet es beispielsweise »normal«, dass seine 15-jährige Tochter zur vorgeschriebenen Stunde zu Hause ist und ihm jeden jungen Mann vorstellt, mit dem sie Kontakt haben möchte. Die Tochter findet diese Auflagen sinnlos und grausam, gehen sie doch ebenso über das hinaus, was unter ihren Altersgenossinnen als »normal« gilt, wie sie die Tatsache ignorieren, dass sie ebenso intelligent wie der Vater ist (was den IQ angeht), körperlich vielleicht schon fitter als er und überzeugt, zu wissen, was sie tut.
Stellen wir uns vor, dass diese 15-Jährige inzwischen 30 Jahre alt ist und auf ihre Vaterbeziehung zu sprechen kommt. Wir werden zwei Extreme entdecken:
Position A: »Mein Vater hat mein Leben zerstört. Immer wenn ich ihn sehe, steigt diese Wut in mir hoch. Er kapiert einfach nicht, was er da mit mir gemacht hat.«
Position B: »Mein Vater war total überfordert, als ich in die Pubertät kam, damals habe ich ihn gehasst, jetzt denke ich nicht viel an ihn, aber wenn wir uns sehen, kommen wir miteinander aus.«
Die Unterschiede zwischen beiden Positionen sind nicht durch die faktischen Aktionen zwischen Vater und Tochter bestimmt, sondern durch deren Verarbeitung im bewussten und unbewussten Erleben. Es geht unter anderem darum, Verantwortung für das Gelingen wie das Scheitern der Liebesbeziehungen im erwachsenen Leben zu übernehmen.
Im ersten Fall wird der »böse« Vater festgehalten in der unbewussten Erwartung, doch noch einen guten zu bekommen. Im zweiten spielt der Vater keine wichtige Rolle mehr, die junge Frau beschäftigt sich nicht mehr mit ihm und interessiert sich mehr für ihr eigenes Erleben in ihren aktuellen Beziehungen. So fehlen die Erwartungen, eine Person zu finden, die z. B. versteht, was dem Kind angetan wurde.
Das heißt: Diesmal ist es die Tochter, die sich bemüht, den Vater zu transformieren. Sie denkt nach, wie sie ihm klarmachen kann, was er ihr angetan hat und was er hätte tun müssen, um ihr eine gute seelische Entwicklung zu ermöglichen. Sie fasst diese Gedanken zusammen zu Urteilen, wie ein »richtiger Vater« sein müsste und wie viele Defizite sie ertragen musste, weil er diesem Bild nicht entspricht.
Wenn die soziale Kindheit in europäischen Familien länger dauert als die körperliche, ergeben sich nicht nur Konflikte zwischen den Adoleszenten und ihren Eltern. Eine zweite Konfliktquelle sind Dankesschulden, welche die Beziehung zwischen den erwachsenen Kindern und ihren Vätern oder Müttern belasten. Hier wie in vielen anderen Bereichen wird deutlich, dass Zivilisationsschritte die Menschen komfortabler leben lassen, gleichzeitig aber psychischer Stress wächst.
Die seelischen Belastungen ergeben sich daraus, dass mehr imaginäre Elemente in die Kind-Eltern-Beziehung eindringen. Je länger die Abhängigkeit des Kindes von den Eltern dauert, desto mehr Phantasien wachsen in den Eltern, das Kind müsste ihnen ihre Mühe danken. Umgekehrt wachsen aber auch in den Kindern zum Teil unbewusste Phantasien, die Eltern müssten dankbar sein, dass sie sich so lange über alle möglichen Hürden gequält haben, um die Erwartungen der Eltern an ihren sozialen Erfolg zu erfüllen. Das Kind hat acht Jahre den Eltern zuliebe Cello geübt; die Eltern haben acht Jahre dem Kind zuliebe Instrument und Musikstunden bezahlt.
In einer hochentwickelten Gesellschaft beruhen gute Beziehungen auf Anerkennung. Diese ist erheblich schwieriger zu geben und anzunehmen als etwa das Teilen der Beute in einer Jägerkultur oder die Versorgung der gebrechlichen Eltern mit Nahrung. Da beide Seiten wenig Gelegenheiten haben, ihre Dankesschulden durch körperliche Präsenz und physische Gaben abzugelten, kommen Eltern ebenso wie Kinder in die familientherapeutische Praxis, wenn die Kränkungen überhandnehmen, insbesondere dann, wenn eine imaginäre Schuld nicht nur ignoriert wird, sondern Gegenforderungen auftauchen: Nicht ich bin dir, nein, du bist mir etwas schuldig geblieben.
Eine Frau klagt die Eltern an, sie hätten sie nicht ausreichend in ihrer Autonomieentwicklung unterstützt und nach ihrem Abitur in ein Fach gezwungen, das sie nicht interessiert. Die Eltern erinnern sich an eine unsichere Tochter, die sie dringend um Rat fragte, was sie denn studieren solle. Der erwachsene Sohn zieht wieder in sein Kinderzimmer, wo ihn seine alleinerziehende Mutter aus Furcht vor seinen Wutausbrüchen versorgt und ihm ihr WLAN überlässt. Er begründet das damit, dass sie ihn im Babyalter vernachlässigt hat. Sie fühlt sich schuldig, plädiert aber auf mildernde Umstände, der Vater des Sohnes habe sie während der Schwangerschaft verlassen, sie musste in ihren Beruf zurück, das Kind kam in eine Krippe. Die Tochter kann sich als Künstlerin nicht durchsetzen. Sie überzeugt sich von der Schuld ihrer Mutter, die nach der Geburt ihren Beruf aufgegeben hat und als abhängige Hausfrau der Tochter kein Vorbild war.
Wer als Psychotherapeut gearbeitet und später Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet hat, wird vielleicht irgendwann der Scham begegnen, dass seinesgleichen und womöglich er selbst zu Konstruktionen schuldiger Eltern beigetragen hat. Es ist für die helfenden Berufe attraktiv, sich positiv von kritisch gesehenen Eltern abzuheben.
Wenn ein Therapeut unsicher ist, ob seine Arbeit Früchte trägt, wenn er an sich selbst zweifelt und diesen Zweifel nicht sinnvoll findet und produktiv nutzt, sondern mit Schuld- und Schamgefühlen auf ihn reagiert, dann stehen ihm zwei Auswege offen. Er kann selbst die Abstinenz verletzen und hoffen, bei seinen Klienten Trost zu finden – die auffälligste Folge ist der sexuelle Übergriff –, oder aber er kann die Eltern (oder Partner) seiner Patienten schwarzmalen, um aus dem Kontrast zu diesen heller zu leuchten.
Wenn der Patient klagt, dass sich sein Befinden nicht bessert, liegt das eben daran, dass sich die Eltern an ihm heftiger versündigt haben als bisher angenommen. Die defensiven Eigenschaften solcher Manöver sind an ihrer Schwarz-Weiß-Zeichnung und am Mangel an Selbstreflexion erkennbar. Aber gerade diese Qualitäten machen auch ihre Faszination aus.
Wie wir von guten Eltern alles Gute erhoffen, können wir fehlerhafte Eltern für alles Böse verantwortlich machen. Wer Prestige hat und Sinn stiftet, muss eine reine Gestalt sein. Er weckt Neid, der in voller Wut losbricht, wenn er sich als eigennützig entlarven lässt. Die nun sich selbst ernennenden Richter projizieren auf ihr Feindbild ein Stück eigener narzisstischer Unersättlichkeit. Sie selbst sind sich – mit gutem Grund – der Reinheit ihrer Motive nicht ganz sicher. Aber solange sie eindeutige Teufel bekämpfen, stehen sie fleckenlos da.
Die erwachsenen Kinder halten das Bild von Eltern fest, die stark und differenziert genug wären, um bei gutem Willen und entsprechendem Einsatz der nächsten Generation genau das zu geben, was ihr fehlt. Leider entziehen die Eltern sich böswillig oder gleichgültig dieser Aufgabe. Sie verweigern dem Kind etwas, auf das es ein Recht zu haben glaubt: Eltern, die so stark und einsichtig sind, wie man sie gerne hätte.
Die Tochter hat ein Psychologiestudium abgeschlossen.1 Sie lebt in einem Dauerkonflikt mit ihrer Mutter, die nach langen Arbeitsjahren als Hilfskraft in der Paketsortierung in Rente ist. Die Tochter erscheint mit rotgeweinten Augen in ihrer Analysesitzung. »Ich habe meine Mutter besucht, bin eigens die vierhundert Kilometer gefahren, und was hat sie gemacht? Sie hat mir einen Geldschein zugesteckt. Ich will doch kein Geld von ihr, ich verdiene selbst genug, ich will, dass sie endlich versteht, wie ich lebe und was ich geleistet habe! Aber das interessiert sie nicht, sie fragt nur, wann ich endlich schwanger werde, weil sie sich ein Enkelkind wünscht. Ich habe das Geld natürlich nicht genommen, aber ich hatte dann doch ein schlechtes Gewissen, als ich sah, wie sie das gekränkt hat. Aber ich bin es leid, mich selbst zu verleugnen, nur damit sie glaubt, es sei alles in Ordnung.«
Im Erleben der Tochter ist die Mutter zur Psychologin mitgewachsen. Gleichzeitig vertieft die Mutter, ohne um diese Verletzung zu ahnen, eine Wunde im Selbstgefühl der Tochter. Diese hat sich bisher nicht zugetraut, schwanger zu werden; die Männer, die sich an sie binden wollten, fand sie uninteressant, zu weich, während die Männer, mit denen sie sich Kinder vorstellen konnte, selbst gebunden waren und ein sexuelles Abenteuer suchten. Hätte die Mutter Verständnis für diese Probleme? Sicher ist das nicht, aber die Tochter versucht gar nicht, ihre Geschichte zu erzählen.
Die Tochter hält umso energischer an einem Mutterbild fest, das ihr ebenbürtig ist, je weiter sie sich seit ihrem Eintritt in eine höhere Schule und ihrem Studium von der realen Mutter entfernt hat. Die Psychologin erinnert mit heftiger Scham, wie sie in den ersten Gymnasialklassen die Mutter entwertete und sich versteckte, wenn diese einmal vorbeikam, um sie abzuholen. Erst wenn die Kameradinnen verschwunden waren, wagte sie sich aus ihrem Versteck und näherte sich der Mutter wie einer Fremden. Neben den Müttern ihrer Klassenkameradinnen wirkte die Hilfsarbeiterin plump, war schlecht gekleidet und wusste nichts von Small Talk.
Die Tochter wünschte sich eine andere Mutter, sie schämte sich dieser Frau und fühlte sich schuldig über diese Scham. Sie lernte fleißig, um zu verhindern, dass die Schule Kontakt zu ihren Eltern aufnahm. Sie fälschte die Unterschrift der Eltern unter den Mitteilungen über Elternsprechtage, weil sie vermeiden wollte, dass ihre Lehrer die Mutter kennenlernten. Das fiel nie auf, da die Eltern getrennt waren, der Vater die Tochter nur selten sah und die Mutter erleichtert war, wenn sie ihre Ruhe hatte.
Die Tochter hätte das Rüstzeug, die Mutter zu verstehen und die Differenz zwischen der eigenen und der Entwicklung der Mutter wahrzunehmen. Sie unterdrückt diese Möglichkeit, um ihre Schuldgefühle abzuwehren, dass sie es nicht nur weitergebracht hat als ihre Mutter, sondern dass sie ihr tatsächlich geistig überlegen ist. Sie ist doch nicht eingebildet! So leugnet sie die Differenz zur Mutter und erklärt sich deren begrenztes Verständnis als Desinteresse, gar bösen Willen: Die Mutter ignoriert ihr Studium und macht der Tochter klar, dass sie keine richtige Frau ist.
So erwarten erwachsene Kinder ihre eigenen Stärken von den Eltern. Besonders ausgeprägt scheint das im Mutter-Tochter-Verhältnis. Verglichen mit dem Mutter-Sohn-Verhältnis und der Vater-Tochter-Beziehung sind Mutter und Tochter einander primär näher. Sie reagieren auf Aggressionen mit Schuldgefühlen und verstärktem Bemühen, das Gegenüber von ihren absolut guten Absichten zu überzeugen.
Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für Familien interessieren, vor allem aber an Eltern, die unter den Vorwürfen erwachsener Kinder leiden. Kritik an schlechten Eltern ist etabliert, denn sie gelten als belastbar und sollen Verantwortung tragen. Anklagende Kinder dürfen dagegen Kinder bleiben, Verständnis und Mitgefühl erwarten. Die Rolle angeklagter Eltern hingegen ist unattraktiv und führt oft in einen einsamen, depressiven Rückzug.
Meine Darstellung ist eher essayistisch als systematisch. In der Familiendynamik hängt vieles mit vielem zusammen; Fallbeispiele können das am besten beleuchten. Ich werde vor allem drei Faktoren herausarbeiten, die mir gegenwärtig in ihrem Gewicht unterschätzt scheinen:
1. Den Verlust der gemischten Spielgruppe, in der nicht Erwachsene »erziehen«, sondern ältere Kinder die jüngeren sozialisieren. In der menschlichen Evolution haben diese Gruppen das Heranwachsen der Kinder geprägt; das hat sich erst in den letzten zweihundert Jahren mit der Individualisierung der Gesellschaft und der wachsenden Bedeutung mobiler Kleinfamilien verändert. In diesen Gruppen gab es sehr viel bessere Möglichkeiten, den Umgang mit Aggressionen und Selbstverantwortung zu erlernen; wo sie zurücktreten, erkranken mehr Erwachsene an Depressionen, Kinder werden wegen ihrer Aufmerksamkeitsdefizite medikamentös behandelt, denn was in einer solchen Gruppe willkommen ist, missfällt Erzieherinnen und Lehrern.
2. Den Verlust animalischer Orientierungen2 Die Rückbesinnung auf die animalischen Grundlagen unserer Familienbeziehungen schützt vor einer destruktiven Romantisierung, in der illusionäre Erwartungen an Eltern- und Kindesliebe hochgehalten werden. Wenn sich diese Ziele als unerreichbar erweisen, geht die Möglichkeit verloren, sich nach einem Streit zu versöhnen. Kontakt wird abgebrochen, gegenseitige Entwertungen und die Suche nach Schuldigen bestimmen das Bild. Sobald unter Primaten die Geschlechtsreife erreicht ist, sind Eltern nicht mehr zuständig. Erwachsene regulieren ihre Beziehungen spontan, Nähe wird gesucht, unerwünschte Nähe abgewehrt, es fehlen die hohen Anforderungen an die Kontrolle der Aggression durch Schuldgefühle und Dankbarkeit. In einer für beide Seiten zufriedenstellenden Entwicklung der Familie werden diese animalischen Orientierungen integriert. Eltern und erwachsene Kinder gestalten ihren Kontakt freundlich, wahren auch Grenzen und scheuen sich nicht, diese notfalls zu verteidigen. Es gibt beides, die Freude an der Nähe und die Erlaubnis zur Distanz.
3. Die Psychologisierung der Gesellschaft. Seit die in schriftlosen Gesellschaften selbstverständliche Sozialisation in einer Gruppe Halbwüchsiger mehr und mehr dem Modell der Alleinverantwortung der Eltern für das Kind wich, wurden vor allem die Mütter für die seelische Entwicklung und das glückliche Leben ihrer Kinder verantwortlich gemacht. Die »richtige« Eltern- oder Kindesliebe soll durch Leistungen bewiesen werden. Angesichts von Mangelerlebnissen greifen Schuldgefühle, Anklagen über falsche Erziehung und ausbleibende Dankbarkeit um sich.
1. Zur Entwicklung der Elternrolle
Ich beginne mit einer Tierfabel. Die Kuh gab ihrem Kalb reichlich Milch, leckte und beschützte es. Die Bäuerin, die eben auch ein Baby bekommen hatte, sah gerne dabei zu. Das Kalb wurde groß und stark und begann, Gras zu fressen. Manchmal wollte es zur Kuh zurück und Milch trinken, die viel besser schmeckte als das Gras, das zweimal gekaut werden muss, um verdaulich zu sein. Die Kuh war nicht mehr zärtlich. Sie schubste ihr Kalb weg.
»So würde ich mit meinem Kind niemals umgehen«, sagte die Bäuerin. »Du zerreißt ein Band der Liebe. Ist dir dein Kalb egal?«
»Es ist kein Milchkalb«, sagte die Kuh. »Siehst du das nicht?«
Die Tochter wuchs heran. Die Bäuerin dachte, sie sollte es besser haben, nicht so schwer arbeiten wie sie. Auf dem Hof musste die Tochter nicht helfen. Sie lernte fleißig, machte ihr Abitur, studierte und wurde Lehrerin.
Die Eltern steckten ihr das Geld zu, das sie entbehren konnten, viel war es nicht, ein Stipendium half. Wenn die Tochter die Eltern besuchte, gab es Kuchen zum Kaffee. Die Tochter trank den Kaffee schwarz und wollte den guten Butterkuchen nicht essen, sie habe keinen Appetit. Die Mutter wollte ihr ein großes Stück einpacken. Die Tochter lehnte ab. Sie lebe vegan.
Dann begann die Tochter Fragen zu stellen. Ob sie gestillt worden sei? Wie lange sie Windeln tragen musste? Warum war sie nicht im Kindergarten? Die Mutter gab Auskunft, so gut sie konnte, und fragte, warum sie das wissen wolle, das sei lange her. Die Tochter sagte, sie mache jetzt eine Psychotherapie.
Die Bäuerin wusste, dass eine Therapie etwas ist, um kranke Menschen gesund zu machen. Aber ihre Tochter war doch gesund! Nur unglücklich, weil sie keinen Freund hat, dachte die Bäuerin. Wenn ich mit 29 Jahren keinen Freund gehabt hätte, wäre ich auch nicht froh gewesen.
Dann erklärte ihr die Tochter, während sie in dem Apfelkuchen stocherte, den die Mutter butterfrei vor ihrem Besuch gebacken hatte: »Als ich klein war, hattest du zu wenig Zeit für mich, du warst entweder im Stall oder auf dem Feld. Du hast mich nie verstanden, und was ich in meinem Studium geleistet habe, interessiert dich nicht. Eine richtige sexuelle Aufklärung habe ich von dir auch nicht bekommen, nur Warnungen und Verbote.«
»Aber ich habe dir gegeben, was ich konnte. Du warst ein zufriedenes Kind«, verteidigte sich die Bäuerin.
»Daran kann ich mich nicht erinnern«, sagte die Tochter. »Vielleicht habe ich dir etwas vorgespielt. Ich hatte immer Angst, zu versagen. Wenn ich mich so falsch fühle in meinem Leben, dann musst du doch etwas falsch gemacht haben!«
Die Bäuerin ging in den Stall. Sie lehnte ihre Stirn an die Schulter einer Kuh und spürte, wie tief unter den großen Muskeln das Herz schlug. »Deine Mutter war klüger als ich«, flüsterte sie. »Aber du hast wohl auch nie daran gedacht, ihr Noten für die Qualität ihrer Milch zu geben.«
In den biblischen Religionen ist der Mensch den Tieren überlegen; er steht ihnen gottähnlich gegenüber. Die moderne Naturforschung hat das entkräftet: Wir teilen über 99 Prozent unserer Erbanlagen mit Menschenaffen und sind das Produkt einer biologischen Evolution. Sigmund Freud hat diese biologischen Grundlagen in die psychologische Einsicht übersetzt, dass wir nicht seelisch gesund bleiben können, wenn wir unsere animalischen Traditionen über den Forderungen der Gesellschaft missachten. Das Animalische fundiert zwar unser Leben, aber in der Zivilisation gelingt es oft nicht mehr, diese Grundlage ernst zu nehmen und zu festigen. Erst wenn wir sie verloren haben, erschrecken wir.
Die Kuh in unserem Beispiel erlebt eine konstante Welt, in der die Grenze der Fürsorge instinktiv und emotional gezogen wird. Der Mensch betritt das gefährliche Gebiet des Richtigen, des Rechtmachens, des Perfektionismus. Die Bäuerin will eine gute Mutter sein, indem sie ihrem Kind ein Leben als Akademikerin ermöglicht. Sie ahnt nicht, wie schwer es ihre Tochter als Aufsteigerin aus einer bildungsfernen Schicht haben wird, sich in der Stadt zurechtzufinden und ihre Liebesbeziehungen selbstbewusst zu gestalten.
Wer solche Szenen ohne Parteinahme betrachtet, kann die Trauer über ein tragisches Scheitern zulassen. Die Mutter hat das Beste gewollt, die Tochter hat es angestrebt, die Therapeutin wollte ihr helfen, und doch ist das Ergebnis eine Quälerei. Warum können nicht zwei erwachsene Frauen mit unterschiedlichen Lebenswelten zusammensitzen und sich, so gut es gehen will, darüber austauschen, wie sich diese Welten gerade anfühlen, darüber aber niemals vergessen, dass es lustvoll ist, zusammen zu sein, nicht zu frieren oder zu schwitzen, Gutes zu essen und zu trinken?
Wer solche Gedanken an eine der beteiligten Personen heranträgt, sollte damit rechnen, dass sofort die Frage kommt: Wie mache ich das, wie finde ich zu diesen Gefühlen? Ich wäre gern anders, ich würde gern gelassen bleiben, Dutzende Male habe ich schon gehört, ich sollte genussfähig werden, aber das nützt mir nichts, nach solchem Zureden geht es mir eher noch schlechter, weil ich mich als Versagerin fühle!
Willkommen in einer Welt, die uns das Dilemma aufgenötigt hat, die Orientierung an Lust und Unlust dem gesellschaftlichen Fortschritt zu opfern! Wir sind aber nicht ganz verloren, es ist auch nicht notwendig, um die ganze Welt herumzulaufen, um den Hintereingang zum Paradies zu finden, wie Heinrich von Kleist vorgeschlagen hat. Das Animalische ist in uns erhalten, mit ein wenig Geduld werden wir es wiederfinden und ausbauen können.
Es geht um den Umgang mit dem Unberechenbaren, von dem wir nicht wissen, ob es richtig ist oder falsch, das einfach da ist und erst einmal den Mut erfordert, sich einen Kompetenzmangel einzugestehen, die negative capability, von der John Keats gesprochen hat, ein Merkmal der großen Dichter. William Shakespeare hat um sie gewusst, Heinrich von Kleist, Sokrates und immer wieder auch Sigmund Freud.
Eine Frau suchte nach Antworten, warum in ihr seit Jahren jeder sexuelle Wunsch erloschen war. Ihr Partner ertrug das geduldig, sie schilderte die Beziehung als respektvoll, als gute Zusammenarbeit in der Erziehung des 10-jährigen Sohns. Nach der Geburt hatte sie sich überfordert gefühlt. Sie war äußerst nervös, wollte alles richtig machen, schlief kaum noch und saß viele Stunden im Wartezimmer verschiedener Kinderärzte. Der Sohn gedieh, aber ihre Ängste ließen nicht nach. Sie las Ratgeberbücher und erfuhr, dass es richtig und wichtig ist, ein Kind loszulassen. Oft blieb dieses Wissen machtlos gegen ihre Ängste. Sie begann wieder, zu kontrollieren, zu konsultieren und sich vorzuwerfen, ihr mangle das gesunde Gefühl und die Instinktsicherheit einer guten Mutter.
Nach der Geburt war sie stolz gewesen, dass auf der körperlichen Ebene alles so gut geklappt hatte – und sie hatte sich ein zweites Kind gewünscht. Ihr Mann riet ab, sie sei doch durch ein Kind schon mehr als ausgelastet. »Ich meine, wenn ich wirklich darauf bestanden hätte, hätte er auch das zweite Kind mitgetragen. Eigentlich muss ich ihm dankbar sein, es wäre wirklich zu viel gewesen!«
Bewusst hatte sie sich mit ihm geeinigt, versuchte sogar, ihn zu bewundern, dass er so vernünftig war. Aber auf der animalischen Ebene war sie enttäuscht und wütend über seinen Mangel an Vertrauen, an Unterstützung für ihren kühnen Wunsch, ihrer Angst und Unsicherheit zu trotzen. Sie fühlte sich nicht mehr begehrt. Es gibt kaum ein Thema, das so viel unbewusste Wut, Neid- und Racheimpulse auslösen kann wie die Verletzung eines Kinderwunschs. Es ist immer gefährlich, sich zwischen Mutter und Nachwuchs zu stellen.