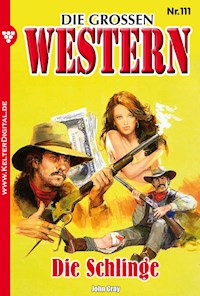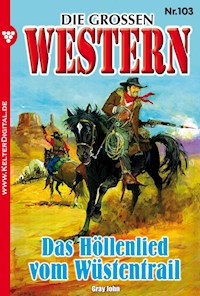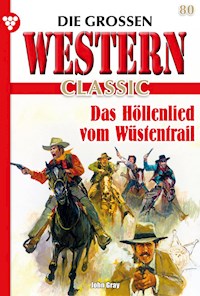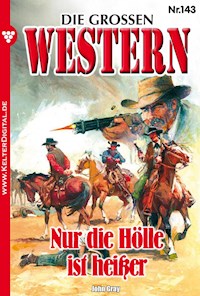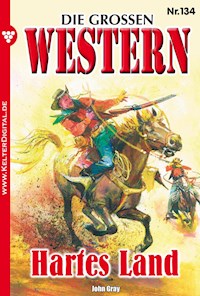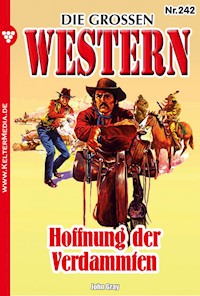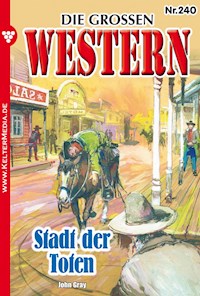Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Gordon Tabor sah die fremden Reiter. Er spürte die Gefahr, riss sein Pferd herum und richtete sich steil im Sattel auf. Für einen Moment wirkten Pferd und Reiter wie ein aus Erz gegossenes Standbild in dem goldenen Licht der Spätherbstsonne. Leise singend strich ein milder Wind von Westen über das Land und bewegte sanft das in dichten Büscheln wuchernde, steigbügelhohe Büffelgras, das die weite Ebene bedeckte. Gordon Tabor hob eine Hand zum Schutz gegen die gleißenden Sonnenstrahlen über die pulvergrauen Augen. Schweigend beobachtete er die bronzehäutigen Reiter, die in langer Reihe langsam von Osten durch die Ebene heranzogen, direkt auf die Hügel zu. Es waren Indianer – Apachen. Staub wallte unter den Hufen ihrer Ponys. – Und Tabor kannte ihr Ziel. Er wusste, was sie wollten. Er war groß, breitschultrig und starkknochig, und er saß geschmeidig im Sattel. Ein breitrandiger Stetson beschattete die obere Hälfte seines Gesichts. Unter dem Hut hervor quollen im Nacken lange dunkelblonde Haarsträhnen, die bis über den Hemdkragen reichten. Um die schmalen Hüften des Reiters wand sich ein breiter Waffengurt mit doppelter Patronenreihe, der rechts die Halfter mit dem langläufigen Peacemaker-Colt hielt. Als Gordon Tabor jetzt sein Pferd antrieb und den Hügel hinunterritt, schwappten schwerlederne, mit Fransen verzierte Flap-Chaps an seinen Beinen. Er ritt schnell. Sein sehniger, hagerer Wallach streckte sich. Die hämmernden Hufe des Tieres pflügten das hohe Gras zur Seite. Nach fünfzig Yard tauchte vor dem Reiter ein ausgefahrener Karrenweg auf. Dann sah er die schweren Wagen heranrollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 68 –
Boss Tabor und der Wagentreck
Ein Mann muss viele Gräber schaufeln
John Gray
Gordon Tabor sah die fremden Reiter. Er spürte die Gefahr, riss sein Pferd herum und richtete sich steil im Sattel auf. Für einen Moment wirkten Pferd und Reiter wie ein aus Erz gegossenes Standbild in dem goldenen Licht der Spätherbstsonne. Leise singend strich ein milder Wind von Westen über das Land und bewegte sanft das in dichten Büscheln wuchernde, steigbügelhohe Büffelgras, das die weite Ebene bedeckte.
Gordon Tabor hob eine Hand zum Schutz gegen die gleißenden Sonnenstrahlen über die pulvergrauen Augen. Schweigend beobachtete er die bronzehäutigen Reiter, die in langer Reihe langsam von Osten durch die Ebene heranzogen, direkt auf die Hügel zu. Es waren Indianer – Apachen. Staub wallte unter den Hufen ihrer Ponys. – Und Tabor kannte ihr Ziel. Er wusste, was sie wollten.
Er war groß, breitschultrig und starkknochig, und er saß geschmeidig im Sattel. Ein breitrandiger Stetson beschattete die obere Hälfte seines Gesichts. Unter dem Hut hervor quollen im Nacken lange dunkelblonde Haarsträhnen, die bis über den Hemdkragen reichten.
Um die schmalen Hüften des Reiters wand sich ein breiter Waffengurt mit doppelter Patronenreihe, der rechts die Halfter mit dem langläufigen Peacemaker-Colt hielt. Als Gordon Tabor jetzt sein Pferd antrieb und den Hügel hinunterritt, schwappten schwerlederne, mit Fransen verzierte Flap-Chaps an seinen Beinen.
Er ritt schnell. Sein sehniger, hagerer Wallach streckte sich. Die hämmernden Hufe des Tieres pflügten das hohe Gras zur Seite.
Nach fünfzig Yard tauchte vor dem Reiter ein ausgefahrener Karrenweg auf. Dann sah er die schweren Wagen heranrollen. Drei Conestoga- und ein Studebakerschoner mit verwaschenen Planen polterten ihm entgegen. Zwei Männer ritten neben den Wagen her. Dumpf knarrten die Achsen.
Gordon Tabor schmeckte Staub auf seinen Lippen. Er zügelte sein Pferd neben dem ersten Wagen. Die beiden Reiter lenkten ihre Tiere heran.
Einer von ihnen hieß Ed Stanton und war ein rattengesichtiger, sehniger Bursche. Der andere war ein dunkel gekleideter Mann, der ein männerhandgroßes Kreuz aus Ebenholz an einer silbernen Kette um den Hals trug. Der Mann war so wuchtig und breit gebaut, dass es schien, als ob seine Schultern bei der nächsten Bewegung den schwarzen Prince-Albert-Rock sprengen würden. Er war Methodistenprediger und hieß Will O’Donnel. Sein Gesicht war großporig, wirkte aber gutmütig. Am Sattel seines fast haarlosen, knochigen Gauls hing eine metallverstärkte Lederhalfter, in der ein alter Walker Colt steckte, eine Waffe von fast fünf Pfund Gewicht.
»Es wird Ärger geben.«
Gordon Tabors raue Stimme übertönte das Knarren und Poltern der Wagenräder und Hufe.
»Ärger?«, fragte der Prediger. Er nahm sich den steifen Hut vom Kopf. Kurz geschorenes feuerrotes Haar, das den kantigen Schädel bewucherte, kam zum Vorschein.
»Ja, Reverend. Ich denke, wir werden bald wissen, ob Sie Ihre Sattelkanone nur zur Zierde mit sich herumschleppen, oder damit auch schießen können.«
Der vierschrötige Hank Olden auf dem Bock des ersten Wagens blickte Tabor fragend an. »Wie meinen Sie das?«
»Indianer.«
Gordon Tabor zog sein tänzelndes Pferd ein Stück vom Wagen weg zum Wegrand und rief zu den anderen hinüber: »Indianer kommen – Apachen. Ich habe euch gesagt, dass sie kommen würden, seit ich den Kundschafter vor zwei Tagen gesehen habe. Jetzt sind sie da. – Die Frauen gehen sofort in die Wagen und legen sich drinnen flach auf den Boden. Wir halten an.«
Die Männer zügelten widerspruchslos die Gespanne. Unruhig schnaubten die muskelschweren Zugpferde.
»Indianer? Wird das gefährlich?« Martha Palmer, die Frau vom zweiten Wagen, richtete sich auf dem Bock auf. Ihr Mann fasste beruhigend ihre linke Hand.
»Das hängt von uns ab, Mrs Palmer. Zusammenstöße mit Indianern sind immer gefährlich.«
Gordon Tabor warf einen raschen Blick zu den Hügeln im Osten. Doch dort war noch nichts zu sehen, nur das wogende Büffelgras.
»Es ist eine kleine Gruppe. Apachen reiten immer in kleinen Gruppen. Wahrscheinlich sind es nicht viel mehr als ein Dutzend. Vierzehn würde ich sagen, genau habe ich sie nicht gezählt.«
»Nur vierzehn Rothäute?« Der Reverend lachte. »Heilige Jungfrau von Connemara! Und deshalb machen Sie so einen Lärm, Tabor?«
»Unterschätzen Sie die Apachen nicht«, entgegnete Gordon Tabor. Er verzog dabei keine Miene. »Sie sind gefährlich, egal wie viele es sind.«
»Sollen wir zu einer Wagenburg zusammenfahren?«, rief Rod Fuller vom letzten Wagen. Der stämmige, schnauzbärtige Mann zog die Peitsche aus der Bockhalterung.
»Ja. Die Pferde müssen beim Angriff geschützt sein. Wir dürfen kein Tier verlieren, der Wagen wegen. Beeilt euch!«
»Ich würde die Wagen nicht zu einer Burg zusammenfahren lassen.« Ed Stanton beugte sich im Sattel vor und stützte sich auf das breite Knot-Iron-Horn.
Die Wagenlenker hatten indessen schon die Pferde angetrieben und wendeten auf dem Karrenweg. Sie sprangen von den Böcken, als die Wagen in einem Viereck zusammenstanden und schirrten die Pferde aus. Sie wurden in die Burg geführt.
»Die Apachen können uns belagern«, sagte Stanton weiter. »Dann sitzen wir hier fest, haben wenig Wasser und können nicht vor und nicht zurück. Wir sollten weiterfahren und die Indianer im Fahren abwehren.«
Gordon Tabor lächelte. Er zog die Winchester-66 aus dem Sattelscabbard.
»Sie werden uns nicht belagern, Stanton. Apachen kämpfen anders. Wenn wir den ersten Angriff zurückschlagen können, haben wir erst mal Ruhe und können weiterfahren.«
Tabor lenkte sein Pferd auf eine Lücke in der Wagenburg zu.
»Apachen greifen nicht ständig an, dafür sind die Kriegergruppen zu klein. Sie können sich kaum Verluste leisten. Wenn sie sich einmal blutige Köpfe geholt haben, ziehen sie sich zurück. – Sie verschwinden nicht, aber sie warten auf eine günstigere Gelegenheit, ehe sie noch einmal einen Versuch machen. Und dass sie keine Gelegenheit mehr bekommen, dafür zu sorgen, ist unsere Sache. Außerdem sind unsere Waffen besser, und wir haben in den Wagen gute Deckung. Das muss reichen.«
»Ich würde trotzdem keine Wagenburg zusammenstellen.« Stanton krampfte die Fäuste um die Rohlederzügel seines Pferdes. Auf seinem Gesicht erschienen hektische rote Flecken. Seine Stimme klang nun gepresst. Er spürte die Überlegenheit des Treckführers, und sie machte ihn wütend.
»Sie wissen alles besser, wie, Tabor?«, fragte er gereizt.
»Vielleicht.«
Gordon Tabor war inzwischen abgestiegen und band sein Pferd an der Seitenbracke eines Wagens im Innern der Wagenburg fest. »Jeder trägt die Stiefel, die ihm passen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Nun, Sie sind der Treckboss.« Stanton zuckte mit den Schultern und folgte Tabor in die Burg.
»Ja«, entgegnete Gordon Tabor, starr nach Osten blickend, »ich bin der Wagenboss.«
»Hufschlag!«, schrie Fuller vom letzten Wagen her. »Ich höre Hufschlag.« Der Mann warf den Unterhebel seiner Winchester herum.
»In die Wagen. Vorwärts!«
Tabor schwang sich in den Conestogaschoner der Oldens. Der rothaarige Reverend folgte ihm.
Sekunden später lagen alle, die zu dem kleinen Treck gehörten, in den Wagenkästen und hielten Waffen in den nervös verkrampften Fäusten. Sie atmeten schneller und schmeckten salzigen Schweiß auf ihren Lippen. Sie lüfteten die Planen der Wagen an den Außenseiten leicht an und schauten durch schmale Sehschlitze hinaus. Der Wagenboss schob den Lauf seines Gewehrs über die Seitenbracke. – Leise singend strich der Westwind um die Wagen. Dumpf und unruhig schnaubten die Pferde.
*
Die Apachen kamen über die Hügel, und der Hufschlag ihrer zähen, kräftigen, gescheckten Ponys ließ den Boden vibrieren. Die Krieger saßen wie angewachsen in den Sätteln. Sie trugen Kakikohemden und Wildlederhosen. Ihre Füße steckten in kniehohen Mokassins. Ihre Haut war wie gehämmertes Kupfer, rot gebrannt in tausend Schmiedefeuern. Ihre Gesichter waren starr wie aus Holz geschnitzte Masken.
»Noch nicht schießen!«, rief Gordon Tabor aus dem Wagen.
Der Conestogaschoner, in dem er lag, war mit seiner Breitseite direkt auf die Hügel gerichtet. Die Apachen ritten in gerader Linie auf die kleine Wagenburg zu. In knapp hundert Yard Entfernung fächerten sie auseinander und griffen in breiter Front an. Sie waren vierzehn Reiter und zu allem entschlossen.
»Näher herankommen lassen!«, schrie Tabor. »Nur nicht nervös werden.«
Von vorn krachten die ersten Schüsse. Die Apachen hatten Spencer-Repetierer. Der Anführer trug eine Volcanic-Rifle bei sich. Er warf sie jetzt an die Schulter und feuerte.
Klatschend bohrten sich Geschosse in die zwei Zoll starken Seitenwände der Wagenkasten. Einige Kugeln fetzten mit hässlichen Lauten durch die festen Planen. Die Frauen in den Wagen pressten sich hart gegen die Bodenbretter. Ihre Gesichter waren bleich, in ihren Augen spiegelte sich Furcht.
Die Apachen hatten sich jetzt bis auf knapp fünfzig Yard genähert.
»Feuer!«, schrie Tabor. Dann stieß er den Repetierbügel seiner Winchester herum.
Die Apachen ritten gegen eine Mauer aus Feuer und Blei, die ihnen aus den Wagen entgegenschlug. Im krachenden Stakkato der Schüsse kam der wilde Angriff jäh ins Stocken. Flammenblitze stachen durch den heißen Spätnachmittag. Pulverdampf wogte auf wie ein feiner, ätzender grauer Nebel.
Schrill wieherte ein Pferd, als es von einer Kugel getroffen wurde und sich überschlug. Der Reiter wurde durch die Luft gewirbelt, stürzte ins hohe Gras und sprang sofort wieder auf. Er hastete weiter. Furchtlos. Sein schweißglänzendes Gesicht war vor Anstrengung verzerrt.
Die Apachen umrundeten die Wagenburg jetzt. Sie hatten sich aus den Sätteln gleiten lassen und hingen seitlich an den Flanken ihrer Ponys. Hagelschauer von Geschossen prasselten gegen die Wagen.
Vorn, im ersten Gefährt, saßen Gordon Tabor, der Reverend O’Donnel, der Siedler Hank Olden und sein Sohn Bill nebeneinander und wehrten die Angriffe ab.
Wieder rissen die Apachen unvermittelt ihre Pferde herum und sprengten frontal auf die Wagenburg zu. Sie schwangen sich hoch auf die Rücken ihrer Tiere, beugten sich weit nach vorn und kamen heran wie leibhaftige Teufel. Sie feuerten aus allen Rohren.
Gordon Tabor schoss die letzte Patrone seines Colts ab. Einer der Krieger wuchs steil im Sattel hoch und kippte langsam nach hinten. Sein linker Fuß steckte noch in dem hölzernen Steigbügel des flachen Sattels.
Das Pony des Kriegers wandte sich von der Wagenburg ab und raste die Hügel im Osten hinauf. Dort blieb es stehen.
Die anderen Krieger wichen nun zurück. Sie zerrten ihre Tiere herum und sprengten auf die Hügel zu. Einige Schüsse, die ihnen folgten, trafen nicht.
Gordon Tabor richtete sich auf und wischte sich mit dem Handrücken über sein pulverrauchgeschwärztes Gesicht.
»Die sind vielleicht gelaufen! So schnell kommen die nicht wieder«, sagte der Reverend und lachte dröhnend. Er stülpte sich den steifen Hut wieder auf den kantigen Schädel.
Tabor verließ wortlos den Wagen. Er trat aus der Wagenburg und blickte aus schmalen Augen zu den Hügeln hinüber. Die Apachen hatten sich dort gesammelt und schienen zu beraten. Dann lenkten sie ihre Ponys hinter die Hügelkuppen. Ein Krieger blieb zurück. Mit stoischer Ruhe beobachtete er die Wagen.
»Mr Tabor, Ed ist verletzt.« Frank Palmer schlug die Plane seines Wagens zurück. »Er hat eine Kugel in der linken Schulter. Es sieht böse aus.«
Tabor fluchte leise. Er eilte zum Wagen der Palmers und stieg auf den Bock. Wortlos blickte er ins Innere des Conestogaschoners. Aus geweiteten Augen schaute Martha Palmer ihm entgegen. Pulverrauchspuren zeichneten auch ihr Gesicht.
»Helfen Sie ihm, Mr Tabor. Bitte! Helfen Sie ihm. Er verblutet.«
Der Treckführer stieg in den Wagen und beugte sich über Ed Stanton. Der rattengesichtige Mann war bewusstlos. Aus einem Loch in der linken Schulter sprudelte stoßweise Blut und sickerte in den Stoff seines blauen Kattunhemdes. Das Gesicht des Mannes wirkte noch hagerer als sonst und hatte eine fahle Farbe.
»Schaffen Sie ihn raus, und legen Sie ihn ins Gras.«
Gordon Tabor sprang vom Wagen.
»Die Apachen verhalten sich ruhig. – Ist es etwas Schlimmes?« Der Reverend blickte Tabor besorgt an.
»Schulterschuss. Er wird es überstehen. Die Apachen werden abwarten, was wir jetzt tun. – Bringen Sie bitte ein paar Tücher und etwas Wasser, Mrs Olden.«
»Sind Sie sicher, dass Stanton es schaffen wird?«
Der Reverend runzelte skeptisch die Stirn.
»Wir können uns doch nicht aufhalten, und er braucht doch sicher Ruhe. Außerdem verliert er Blut.«
»So schlimm ist das nicht. Nur keine falsche Hoffnung, Reverend. Wir haben Sie nicht mitgenommen, damit Sie uns beerdigen.«
Gordon Tabor fasste mit an, als Frank und Martha Palmer den Verletzten aus dem Wagen hoben und ins Gras legten.
Der schnauzbärtige Fuller spie grimmig aus.
»Die verdammten Rothäute.«
»Wenn die erst wüssten, was du in deinem Wagen hast, Fuller.« Buck Stanford, ein wortkarger Einzelgänger, der sich in Fort Stockton dem Treck angeschlossen hatte, blickte den anderen böse an. »Es war ein schwerer Fehler von uns, dich mitzunehmen, mitsamt deinen achtzig Winchester-Gewehren. Sie sind deine Fracht, aber das Risiko tragen wir alle. Wir werden noch einen mächtigen Ärger deswegen bekommen. Sobald jemand erfährt, was du geladen hast, sind wir alle erledigt. Die Gegend wimmelt von Halunken.«
»Die Apachen wissen es aber nicht. Und wer sollte es ihnen sagen?«, erwiderte Fuller gereizt. »Ich habe niemanden außer euch gesagt, dass ich eine Ladung Gewehre nach Lovington in New Mexico bringen soll. Wieso sollte uns jemand wegen der Gewehre angreifen?«
»Hört auf, ihr verdammten Narren!« Tabor hob den Kopf. Seine Stimme klirrte vor Härte.
»Der Apachenangriff hat überhaupt nichts mit den Gewehren von Fuller zu tun, Stanford. Ich möchte nur wissen, auf was für Gedanken Sie noch kommen werden. Ich dulde keinen Streit, versteht ihr? Wenn ihr euch nicht zusammennehmt, könnt ihr von mir aus hierbleiben und euch allein mit den Apachen herumschlagen. – Reißen Sie Stanton das Hemd auf, Mrs Palmer.«
Gordon Tabor griff nach einem Tuch, das Clara Olden ihm reichte und tupfte das Blut von der Schulterwunde des Mannes ab. Schweigend schaute er auf den Kugeleinschlag.
»Brecht ein paar Patronen auf. Wir werden die Wunde ausbrennen«, sagte er dann und zog sein Jagdmesser. »Halten Sie ihn fest, Palmer.«
Der breitschultrige Frank Palmer stemmte die schwieligen Fäuste auf den Oberkörper des anderen. Gordon Tabor senkte die Messerspitze in den Wundkanal, ertastete das Geschoss und hob es beim dritten Versuch heraus. Ein Schwall von Blut folgte der Kugel.
»Das Pulver!«, rief der Mann. Er packte die aufgebrochenen Patronen und schüttete das grobkörnige Schwarzpulver auf die Wundränder. Sekunden später brannte es mit bläulicher Stichflamme ab.
Ed Stanton bäumte sich in der Bewusstlosigkeit kreischend auf. Frank Palmer konnte ihn kaum halten. Die Gesichter der Menschen verkanteten sich. Betretenes, entsetztes Schweigen herrschte für einen Moment. Die Frauen wandten sich ab, die Männer schluckten schwer.
Dann war es vorbei. Ein hässlicher schwarz-rot verbrannter Wundkrater blieb zurück. Die Wunde blutete nicht mehr. Der Bewusstlose atmete rasselnd. Mit geschickten Handgriffen legte der Treckführer dem Mann einen festen Verband an. Dann richtete er sich auf.
»Sie können ihn in den Wagen legen, Palmer. Wenn er aufwacht, geben Sie ihm Wasser, nur nicht zu viel. Wenn wir in einigen Stunden rasten, braucht er eine kräftige Brühe.«
»Sicher, Mr Tabor. Danke. Das haben Sie großartig gemacht.«
Gordon Tabor wandte sich ab und trat auf Buck Stanford zu.
»Hören Sie, Stanford.« Tabor hakte die Daumen hinter den Revolvergurt. Seine Stimme klang rau. »Seit wir aus Fort Stockton weggefahren sind, haben Sie Tag für Tag Streit gesucht, mit jedem von uns. Ich werde nicht länger dabei zusehen. Bis jetzt sind wir sehr zügig vorangekommen. Ab heute aber haben wir Indianer auf dem Hals. Und es werden noch andere Dinge auf uns zukommen, die uns das Leben schwer machen werden. Das heißt, jetzt beginnen die Schwierigkeiten, und niemand kann mehr aus der Reihe tanzen. Merken Sie sich, dass Sie hier nicht allein sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, die zusammenhalten muss, wenn wir nicht vor die Hunde gehen wollen. Also lassen Sie den Streit, sonst lernen Sie mich kennen.«
»So?« Der andere wippte auf den Stiefelabsätzen. »Und wie würde das aussehen, Tabor?«
»Wünschen Sie sich, es nie festzustellen, Stanford.«
Gordon Tabor wollte sich abwenden. Die harte Stimme des anderen hielt ihn zurück: »Ich lasse mich nicht bedrohen. Tabor, verstehen Sie? Ich bin ein freier Mann. Sie stehen in zu großen Stiefeln, Tabor. Passen Sie auf, dass Sie nicht stolpern.«
Der Treckboss schluckte eine heftige Antwort hinunter. Er wollte Streit vermeiden.
»Meine Sache, Stanford«, sagte er nur.
»Wagen Sie nur nicht, mich zu schlagen, Tabor, nie!«
»Machen Sie sich nicht lächerlich, Stanford.« Gordon Tabor grinste schmal und verächtlich. »Warum sollte ich Sie schlagen? Sie werden sich auch so meinen Anordnungen fügen, Stanford.«
»Meinen Sie?«, bellte der andere.
»Ja. Weil Sie sonst vor die Hunde gehen, Stanford.«
»Denken Sie etwa, ich hätte Angst vor den paar Apachen und würde mir ohne Sie in die Hosen machen? Da kann ich ja nur lachen!«, schrie der untersetzte Mann. Sein Gesicht war nun vor Wut gerötet. Gordon Tabor aber blieb ganz ruhig, und die anderen Trecker blickten Stanford schweigend und kalt an.
»Ich habe keine Angst vor den Rothäuten. Ich bin nicht auf Sie angewiesen, Tabor.«
»Wie schön für Sie.« Gordon Tabor atmete schwer. »Dann können Sie ja mit Ihrem Wagen hier zurückbleiben. Wir fahren nämlich jetzt weiter.«
»Sie halten sich wohl für unüberwindlich, wie?«, kreischte Stanford. »Ihre verdammte Ruhe, Ihre Arroganz und Ihre ständigen Befehle kotzen mich an. Ich will Ihnen zeigen, wie viel Sie wert sind.« Seine Faust fiel auf den Colt, den er rechts in einer hochgeschnallten Halfter trug.
Gordon Tabor bewegte sich kaum. Ein leichtes Zucken lief durch seinen rechten Arm. Dann hielt er bereits den bläulich schimmernden Revolver in der Faust.
»Ich warne Sie, Stanford.« Tabor sprach mit sanfter Stimme. »Nehmen Sie die Hand von der Waffe. In diesem Treck bin ich der Boss. Was ich sage, geschieht. Nicht weil es mir großen Spaß macht, zu befehlen, sondern weil wir sonst alle verloren sind. – In Fort Stockton habt ihr mich angeworben. Und alle habt ihr gehört, was ich euch über die Gefahren auf dem Weg nach New Mexico gesagt habe. Ihr habt auch gehört, dass ich absolute Gewalt über euch und die Wagen verlangt habe, weil ihr alle zu unerfahren seid und nicht wissen könnt, wie man sich in gefährlichen Situationen verhält. Ihr habt mir gesagt, dass jeder von euch meinen Anweisungen nachkommen würde. Und wer es jetzt nicht tut, spielt nicht nur mit seinem eigenen, sondern mit unser aller Leben.«
Tabor ließ die Waffe zurück in die Halfter gleiten. Buck Stanford stand wie erstarrt, und sein Gesicht hatte sich gründlich verfärbt. Wie hypnotisiert starrte er noch jetzt auf die Waffe des Treckführers.
Gordon Tabor wandte sich ab. »Schirrt die Pferde ein. Wir fahren weiter. Drei Meilen schaffen wir bestimmt noch, bis es dunkel wird. Dann haben wir die Hügel hinter uns und können die Indianer besser beobachten.«
»Werden sie uns folgen?«, fragte Rod Fuller.