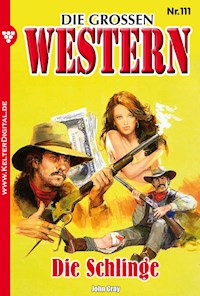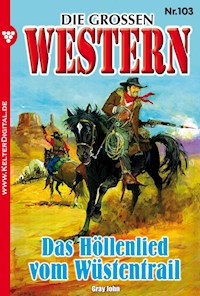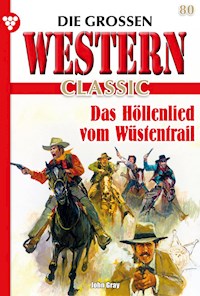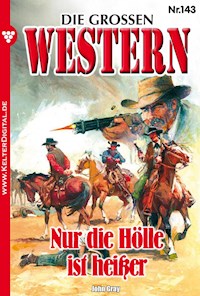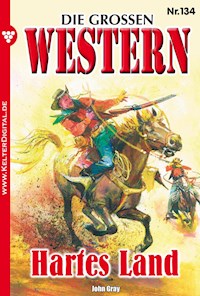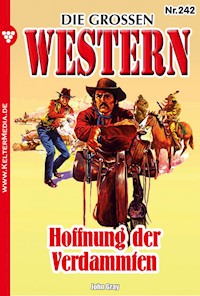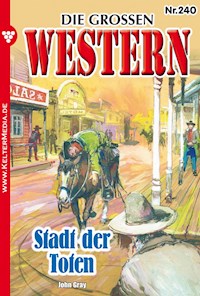Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Männer, die ihr in den Ausschnitt starrten, hatte Bella McCoy nie leiden können. Schon gar nicht, wenn sie fett waren und schwitzten. In solchen Momenten hasste sie ihren Job im plüschigen, mit Kronleuchtern und Goldbeschlägen verschwenderisch ausgestatteten Salon der "Delta Queen". Während sie zwischen den mit weißem Damast bedeckten Tischen hindurchschritt, spürte sie das Vibrieren der kräftigen Maschine unter ihren Füßen, das den bauchigen Leib des Schaufelraddampfers mit einem geheimnisvollen Leben erfüllte. Als sie wieder zur Messingtheke zurückkehrte, saß der fette Kerl immer noch da. Er glotzte sie an und hielt sich an einem Whiskyglas fest. "Pass gut auf, Mann", sagte sie. "Gleich fallen dir die Augen aus dem Kopf." Ihr mit Rüschen besetztes Kleid aus grünem Samt raschelte. Es lag wie eine zweite Haut an ihrem Körper und brachte ihr strohblondes Haar besonders gut zur Geltung. "Ich warte darauf, dass dein Kleid platzt", sagte er. Er trug einen teuren Anzug und einen Brillantring an der rechten Hand. "Da kannst du lange warten." Sie trat hinter die Theke und stellte mehrere Gläser auf ein silbernes Tablett. "Ich würde es mich etwas kosten lassen, wenn ich nachhelfen dürfte", sagte er. "Wir haben noch zwei Stunden Zeit bis zur Abfahrt nach Baton Rouge", sagte sie. "Du hast Zeit genug, Miss Ellenbys Rote Laterne aufzusuchen und bei einem der Mädchen Dampf abzulassen." "Ich will nicht so weit laufen", antwortete er. "Außerdem bin ich sicher, dass wir uns gut verstehen werden." Bella musterte ihn auf eine Weise, die einen anderen Mann glatt umgeworfen hätte. Der Dicke aber war von imponierendem Selbstbewusstsein. Bella langte in
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 152 –
Trail der harten Frauen
John Gray
Männer, die ihr in den Ausschnitt starrten, hatte Bella McCoy nie leiden können. Schon gar nicht, wenn sie fett waren und schwitzten. In solchen Momenten hasste sie ihren Job im plüschigen, mit Kronleuchtern und Goldbeschlägen verschwenderisch ausgestatteten Salon der »Delta Queen«.
Während sie zwischen den mit weißem Damast bedeckten Tischen hindurchschritt, spürte sie das Vibrieren der kräftigen Maschine unter ihren Füßen, das den bauchigen Leib des Schaufelraddampfers mit einem geheimnisvollen Leben erfüllte.
Als sie wieder zur Messingtheke zurückkehrte, saß der fette Kerl immer noch da. Er glotzte sie an und hielt sich an einem Whiskyglas fest.
»Pass gut auf, Mann«, sagte sie. »Gleich fallen dir die Augen aus dem Kopf.« Ihr mit Rüschen besetztes Kleid aus grünem Samt raschelte. Es lag wie eine zweite Haut an ihrem Körper und brachte ihr strohblondes Haar besonders gut zur Geltung.
»Ich warte darauf, dass dein Kleid platzt«, sagte er. Er trug einen teuren Anzug und einen Brillantring an der rechten Hand.
»Da kannst du lange warten.« Sie trat hinter die Theke und stellte mehrere Gläser auf ein silbernes Tablett.
»Ich würde es mich etwas kosten lassen, wenn ich nachhelfen dürfte«, sagte er.
»Wir haben noch zwei Stunden Zeit bis zur Abfahrt nach Baton Rouge«, sagte sie. »Du hast Zeit genug, Miss Ellenbys Rote Laterne aufzusuchen und bei einem der Mädchen Dampf abzulassen.«
»Ich will nicht so weit laufen«, antwortete er. »Außerdem bin ich sicher, dass wir uns gut verstehen werden.«
Bella musterte ihn auf eine Weise, die einen anderen Mann glatt umgeworfen hätte. Der Dicke aber war von imponierendem Selbstbewusstsein.
Bella langte in eine Schublade unter der Theke, zog eine schwarze Zigarre heraus und steckte sie sich an. Dabei betrachtete sie den Mann herablassend.
»Du hast einen eigenwilligen Geschmack«, sagte er. »Wir sind uns sehr ähnlich.«
Er beugte sich vor und griff ihr mit der rechten Hand tief in den Ausschnitt. Er umfasste ihre linke Brust. Bella verzog keine Miene. Sie schlug dem Mann auf den Handrücken.
Er stieß ein heiseres Gebrüll aus. Seine Hand zuckte zurück. Fast gleichzeitig schlug er mit der Linken zu, Tränen der Wut und des Schmerzes in den Augen.
Bella wich blitzschnell aus. Sie wurde von seiner Hand nur gestreift. Im nächsten Moment hielt sie eine Bourbon-Flasche in der Rechten und schlug über die Theke hinweg zu.
Der Kerl verdrehte die Augen und stürzte röchelnd vom Barhocker.
Mehrere Gäste, die sich bereits im Salon befanden, sprangen von den Plätzen. Einige der schlanken Berufsspieler in ihren eleganten Prince-Albert-Röcken eilten heran. Auch Jeff Crown tauchte auf, der Kapitän, ein rotnasiger Säufer mit Triefaugen.
»Bist du wahnsinnig geworden?«, schrie er. »Weißt du, wer das ist?«
»Eines von diesen fetten Schweinen, die meinen, dass sie für Geld alles kaufen können.«
»Das ist Mr Vandervoort, dem dieser Kasten zur Hälfte gehört.«
Der Dicke rührte sich stöhnend. Zwei Männer halfen ihm auf die Beine. Ein anderer flößte ihm etwas Whisky ein. Mit wirrem Blick kam Vandervoort hoch. Er lallte: »Dieses verdammte Flittchen! Schnappt sie euch!«
Bella langte mit raschem Griff unter die Theke und riss einen Pocket-Revolver hoch. »Kommt mir bloß nicht zu nahe!«
»Du bist gefeuert!«, schrie Kapitän Crown.
»Du kannst diesen Dreckjob allein tun«, antwortete Bella. Sie umrundete die Theke, ohne die Waffe zu senken oder die Männer aus den Augen zu lassen, die nur darauf warteten, sich auf sie zu stürzen und Mr Vandervoort zeigen zu können, wie gern sie ihm behilflich sein wollten.
»Das wirst du noch büßen!«, ächzte Vandervoort. Er stützte seinen Kopf mit beiden Händen. »Du kriegst in St. Joseph kein Bein mehr auf den Boden, das schwöre ich dir, dafür sorge ich!«
Bella McCoy antwortete nicht. Sie erreichte die Tür und trat auf den Gang des Salondecks hinaus. Es war bereits dämmrig über St. Joseph. Von den Straßen der Stadt, die ein gutes Stück über dem Missouri lag, grüßten bereits die vielen Lichter herüber. Über dem Hafen lagen die typischen Gerüche, die Bella so gut kannte, und obwohl der Tag schon zu Ende ging, wurde noch immer auf den Kais und vor den Frachtschuppen gearbeitet.
Bella hastete zu ihrer Kabine und packte ihre schmale Tasche. Als sie die Gangway erreichte, über die sie an Land gehen wollte, wurde sie bereits erwartet.
»Hier kommst du nicht raus, Bella«, sagte ein magerer, spitznasiger Bursche mit Knopfaugen. Er hatte die Aufsicht über die Berufsspieler an Bord, und er spielte falsch, wie Bella wusste, aber er war sehr geschickt und ebenso gefährlich.
Bella hatte sich ein graues Cape übergeworfen. Sie war fast so groß wie der Spieler. In der Linken hielt sie ihre Tasche, den Revolver in der Rechten hielt sie unter dem Cape versteckt.
»Du wirst erst gehen, wenn Mr Vandervoort mit dir fertig ist«, sagte der Spieler.
Bella ging einfach weiter. Der Spieler gab zwei Decksarbeitern ein Zeichen. Die stämmigen Männer traten ihr in den Weg. Bella spuckte dem einen einfach ins Gesicht.
Der Mann zuckte zusammen und wandte sich fluchend ab, während er sich den Speichel vom Gesicht rieb. Dem zweiten versetzte Bella einen Tritt gegen das Schienbein. Dann sah sie den doppelläufigen Derringer in der Faust des Spielers, und sie schoss durch ihr Cape hindurch.
Die Schussdetonation war weithin über den abendlichen Strom zu hören. Der Mündungsblitz wurde von ihrem Cape aufgefangen. Die Kugel zerfetzte den Stoff. Dann wurde der Spieler getroffen, der rücklings gegen die Reling taumelte. Er klammerte sich hier mit der Linken fest und versuchte, auf den Beinen zu bleiben. Sein bleiches, spitzes Gesicht verfiel immer mehr. Seine Rechte mit dem Derringer sank unaufhaltsam nach unten. Schließlich polterte die kleine Waffe auf die Planken.
Bella betrat die Gangway und schritt hochaufgerichtet an Land, während hinter ihr der Spieler vollends zusammenbrach. Bella behielt den Revolver, aus dessen Mündung sich eine dünne Rauchfahne kräuselte in der Hand. Sie steckte ihn erst weg, als sie das ausgetretene Pflaster des Anlegers unter ihren Füßen spürte.
Ein paar schwarze Schauerleute und einige Fahrgäste der »Delta Queen«, die soeben angekommen waren, um an Bord zu gehen, standen neugierig herum und starrten sie an.
»Haltet sie fest!«, schrie jemand vom Salondeck des Dampfers herunter. Aber niemand näherte sich der Frau.
Bella erreichte eine der dunklen Gassen, die zur Oberstadt hinaufführten. Sie schlug diesen Weg ein. Hinter ihr wurde es still.
Ihr Herz klopfte heftig. Sie bemerkte kaum die Menschen, die an ihr vorbeiliefen, sie wusste kaum, wohin sie selbst schritt. Als sie eine der breiteren, beleuchteten Straßen erreichte, blieb sie stehen und atmete tief durch.
Erst jetzt kam ihr erst richtig zu Bewusstsein, was geschehen war. Sie hatte keinen Job mehr, und sie war allein. Es gab niemanden in St. Joseph oder in der näheren Umgebung, bei dem sie hätte unterschlüpfen können. Außerdem musste sie damit rechnen, dass ihr die Männer von Vandervoort noch immer folgten.
Sie überlegte, wie viel Geld sie in der Tasche hatte. Es reichte kaum für eine Woche, denn in St. Joseph waren die Preise hoch.
Trotzig reckte sie das Kinn vor und nahm ihre Tasche fester. Sie schritt weiter. Die Abendkutsche der Butterfield Overland verließ soeben die Stadt. Bella blieb vor der Station stehen. Ein verwachsener Mann mit einer Schirmmütze schloss soeben die Tür ab. An der Frontwand des Gebäudes prangte ein großes Plakat. Bella las:
FRAUEN GESUCHT!
Welche alleinstehenden Frauen haben Mut und wollen ihr Glück wagen?
In Kalifornien, dem Land des Goldes, warten reiche Minenbesitzer nur darauf, Ihnen den Himmel auf Erden zu bereiten.
Hohe Prämien winken denen, die in den Westen gehen und einen dieser Männer heiraten.
Melden Sie sich in Orkney’s Boardinghouse!
»Wo ist das, Orkney’s Boardinghouse?«, fragte Bella den kleinen Clerk.
»Wie?« Er starrte sie verständnislos durch die dicken Gläser seines Kneifers an. »Ach so!« Er deutete auf das Plakat. »Baton Rouge Street, Lady. Am Stadtrand, im Norden. Wollen Sie etwa nach Kalifornien?«
Bella ging wortlos weiter.
*
Die Lagerhalle von Duff Farleen war kühl und zugig. Mehrere Petroleumlaternen verbreiteten trübes Licht.
Ben Callahan lehnte an einem hohen Kistenstapel und rückte sein tief hängendes Holster zurecht, in dem ein wuchtiger Colt-Revolver Modell Dragoon Nr. 2 im Kaliber 44 steckte. Er hatte Elfenbeingriffschalen und wirkte besonders gepflegt. Allein der Gürtel war ein Prunkstück – Handarbeit mit Lederschnitzerei.
Ansonsten machte Ben Callahan keinen besonders gepflegten Eindruck. Er hatte einen struppigen blonden Bart, und das strähnige Haar hing ihm bis auf die breiten Schultern. Er trug einen formlosen, breitrandigen Hut aus schwerem Filz und ein Wildlederhemd mit langen Fransen an den Nähten. Links am Gürtel hing ein Green-River-Messer mit zehnzölliger Klinge, der Griff eines weiteren Messers ragte aus seinem rechten Stiefel.
»Wir haben eine besondere Aufgabe«, sagte er. Er redete ungern und musterte bei jedem Wort die fünf Männer, die vor ihm standen oder auf Kisten und Fässern saßen. Duff Farleen zählte er nicht mit, der hielt sich abseits – ein großer, schwer gebauter Mann mit sichelförmigem Schnauzbart.
»In den Goldfeldern drüben in Kalifornien zahlen sie inzwischen Geld dafür, sich nur die Bilder von Weibern ansehen zu dürfen. Meine Auftraggeber wollen ein bisschen mehr, sie wollen heiraten. Ich werde hier in St. Joseph vierzig Frauen anwerben, die bereit sind, nach Kalifornien zu gehen und dort einen Digger zum Ehemann zu nehmen.«
Callahan räusperte sich und spuckte einen Priem Kautabak auf den Boden. Er fuhr fort: »Ich weiß nicht, was diesen Kerlen im Kopf rumgeht. Anstatt froh zu sein, ihre Ruhe zu haben, wollen sie sich mit Gewalt neue Weiber auf den Pelz holen und zahlen dafür auch noch einen Haufen Geld. Nun gut, wir werden einen Treck zusammenstellen und die Frauen über den Oregon Trail nach Kalifornien bringen.« Er machte einen Moment Pause und sagte dann: »Ich habe bisher Siedlertrecks geführt. Ich sehe einen Haufen Ärger für diesen Trail voraus. Weiber sind nach meinen Erfahrungen zickig, brechen beim Anblick einer Maus in wildes Gebrüll aus und werden in Ohnmacht fallen, wenn sie eine Rothaut zu Gesicht kriegen. Außerdem werden sie vermutlich alle an Blasenentzündung und verdorbenem Magen eingegangen sein, bevor wir in Kalifornien ankommen, aber das ist das Risiko der Kerle, die diesen Treck finanzieren. Mr Farleen hier wird unseren Treck ausstatten. Er hat bereits die Wagen und die Maultiergespanne besorgt und stellt die Vorräte zusammen. Ich werde in den nächsten Tagen die Frauen begutachten. Wir müssen spätestens nächste Woche aufbrechen, da wir mit den Weibern bestimmt länger unterwegs sein werden als mit einem normalen Treck, und in Kalifornien sein müssen, bevor das Wetter über den Bergen zu schlecht wird. Wir haben also eine harte Aufgabe vor uns.«
»Das ist genau der Job, auf den ich seit Jahren gewartet habe«, sagte ein junger, athletischer Bursche mit breitem Grinsen. »Wäre es nicht besser, wenn wir alle dabei sind, wenn die Frauen ausgesucht werden? Ich meine, wir müssen doch sichergehen, ob für uns während der langen Reise das Richtige dabei ist.«
Callahan schnitt sich einen neuen Priem ab, schob ihn in den Mund und starrte den Sprecher mit schief gelegtem Kopf an.
»Hau ab«, sagte er, ohne die Stimme zu erheben. »Du bist draußen.«
»Was soll das heißen?«
»Hast du was an den Ohren?«, fragte Callahan. »Ich sage, du bist draußen. Also verschwinde und lass dich nicht mehr blicken.«
»Moment mal«, sagte der Junge. »So geht das nicht. Ich bin hergekommen, weil mir gesagt wurde, dass ich hier einen Job kriege.«
»Und jetzt sage ich dir, dass du ihn nicht kriegst«, sagte Callahan. »Das ist alles.«
»Warum nicht?«, fragte ein anderer.
»Damit eines klar ist«, sagte Callahan. »Ich bin der Boss. Das geht hier schon los. Was ich sage, wird gemacht. Es gibt auf diesem Trail nur einen, der bestimmt, und das bin ich. Wenn ich sage, dass der Junge draußen ist, dann gibt es darüber kein Palaver. Aber ich will euch sagen, warum: Weil wir einen Treck führen werden, und weil das harte Arbeit ist, und weil wir kein Bordell eröffnen, sondern anständige Frauen zu Männern bringen werden, die für die Reise eine Menge Geld bezahlt haben. Das bedeutet: Die Frauen haben uns nicht zu kümmern. Wir bringen sie nach Kalifornien, mehr nicht.«
»Ich kann mich zusammenreißen«, sagte der junge Bursche.
»Das kannst du nicht. Verschwinde endlich, bevor ich wütend werde!«
»So kannst du nicht mit mir reden, verdammt! Wer bist du denn, dass du dich so aufspielst?«
Callahan wartete, bis der junge Bursche sich herausfordernd vor ihm aufgebaut hatte. Dann zuckte seine rechte Faust hoch und krallte sich in das Hemd des anderen. Er zerrte ihn so heftig an sich heran, dass der andere sich nicht wehren konnte. Er verlor das Gleichgewicht, torkelte und wurde von Callahan gegen einen Kistenstapel geschleudert.
Hier drehte er sich um, blieb mit Mühe auf den Beinen und stürzte sich mit lautem Gebrüll auf den Wagenboss.
Callahan rührte sich kaum vom Fleck. Er hob das rechte Bein und ließ den Angreifer auflaufen. Der junge Mann krümmte sich zusammen. Callahan griff in sein Haar, zerrte ihn heran und hieb ihm die Rechte auf das Kinn.
Der junge Kerl verdrehte die Augen und sackte schnaufend zu Boden.
Duff Farleen packte ihn, zog ihn hoch und schleppte ihn zur Tür der Lagerhalle. Callahan lehnte sich wieder gegen die Kisten und blickte die anderen Männer lauernd an. Er sagte: »Die Sache ist geklärt. Der nächste Punkt ist, dass ich jeden zum Teufel jagen werde, der eine Flasche Fusel mitnimmt. Wir werden einen kleinen Whiskyvorrat dabeihaben, aber der bleibt unter Verschluss und wird nur als Medizin benutzt. Wer sich nicht daran hält, den lasse ich zu Fuß zurück nach St. Joseph laufen, und wenn wir mitten in der Prärie sitzen. Gibt es Einwände?«
Die Männer schwiegen. Callahan fuhr fort: »Wer sich an die Frauen ranmacht oder sich unterwegs gegen meine Anordnungen stellt, den werde ich eigenhändig in der Steppe begraben.« Er legte die Rechte auf den Elfenbeingriff seines Dragoon Colts. »Kommen wir zum nächsten Punkt. Jeder von euch erhält in Kalifornien zweihundertfünfzig Dollar. Dafür, dass ihr die Wagen am Laufen haltet und euch um die Gespanne kümmert, ist das ein fürstlicher Lohn. Wer den Job jetzt noch haben will, soll es sagen.«
»Ich nehme den Job«, sagte der Erste. Die anderen nickten.
Callahan schob sich den Hut wieder in den Nacken. Er sagte: »Mr Farleen wird euch ein Quartier besorgen. Wir bleiben ab jetzt zusammen. Übrigens gelten die Bedingungen ab sofort: Wen ich ab jetzt betrunken erwische, bleibt hier.«
Er wartete nicht auf Antwort. Er bewegte sich mit den wiegenden Schritten eines Mannes, der den größten Teil seines Lebens auf einem Pferderücken zugebracht hat, zum Tor der Halle. Er trat hinaus. Von dem jungen Mann, den Farleen hinausgeworfen hatte, war nichts mehr zu sehen.
In der Nähe floss der Missouri vorbei. Vom Wasser stieg es kühl auf. Jenseits des großen Stromes lag die Prärie des Kansas-Territoriums. Callahan würde froh sein, wenn er erst wieder dort war und St. Joseph hinter sich lassen konnte. Er hatte Städte noch nie leiden können, genauso wenig wie er Frauen leiden konnte. Deshalb gefiel ihm die ganze Sache nicht, und er bereute bereits, dass er sich in Kalifornien dazu hatte überreden lassen. Jetzt konnte er nicht mehr aussteigen.
Widerwillig trat er den Weg zu seinem Quartier an.
*
Sie waren zu sechst. Sie kamen durch eine der Gassen vom Stadtzentrum herunter. Voraus gingen zwei schlanke Männer in grauen Prince-Albert-Röcken. Sie trugen doppelläufige Schrotflinten in der Armbeuge.
Die Wagen standen am Stadtrand von St. Joseph oberhalb des Missouri. Es waren zwanzig Conestoga-Schoner mit weißen Segeltuchplanen. Ben Callahan marschierte, die Fäuste in die Hüften gestemmt, im Lager auf und ab und brüllte mit heiserer Stimme: »Stellt euch nicht so an, verdammt noch mal! Ihr müsst in ein paar Tagen in der Lage sein, die Mulis selbst ein- und auszuspannen und die Wagen zu lenken. Wer das nicht schafft, kann gleich zu Hause bleiben. Zuckerpuppen brauchen wir im Westen nicht.«
Die Frauen standen zwischen den Maultiergespannen und versuchten, die Tiere zu den Deichseln der Wagen zu drängen und sie anzuschirren. Andere hatten die Böcke bestiegen und versuchten, mit den breiten starken Zügeln zurechtzukommen.
Die Frauen trugen Männerhemden und Hosen. Es waren Frauen jeder Sorte dabei, groß und breithüftig, schlank, kräftig, mager und von einem harten Leben geprägt. Einige konnte man hübsch nennen, andere hatten scharf geschnittene Gesichter und graue Falkenaugen.
Sie schwangen die großen Bullpeitschen, und Callahan sah, dass einigen schon jetzt die Muskeln schmerzten und sie die Arme kaum noch hochkriegten. Aber er kannte kein Mitleid.
»Was ihr hier macht, ist ein Kinderspiel gegen das, was euch bevorsteht!«, schrie er. »Also strengt euch an. Es gibt auf diesem Trail nichts geschenkt. Schon gar keinen Mann, der euch das Gold nur so hinterherträgt.«
»Nehmen Sie sich in Acht, Mr Callahan«, sagte eine der Frauen vom Bock eines Wagens aus. Sie war schon um die dreißig und damit die Älteste der Gruppe. Sie hatte Schultern wie ein Erntearbeiter, und Callahan dachte manchmal mit Schadenfreude an den allenfalls mittelgroßen, hageren Goldgräber, den sie sich aufgrund von Fotografien ausgesucht hatte.
»Sie sprechen mit Ladys, Mr Callahan. Also mäßigen Sie Ihren Ton!«
»Sie werden im Laufe des Weges nach Westen noch ganz andere Töne zu hören kriegen, Miss Lola. Also üben Sie nicht nur das Schwingen der Peitsche, sondern auch das Weghören, wenn es sein muss.«