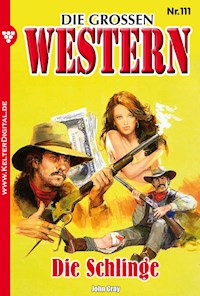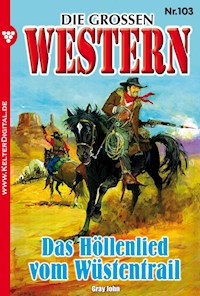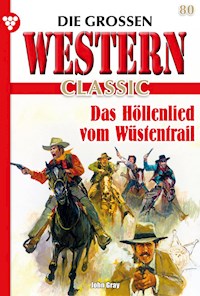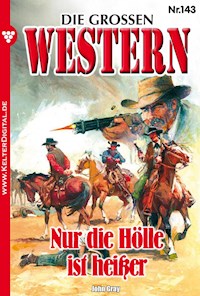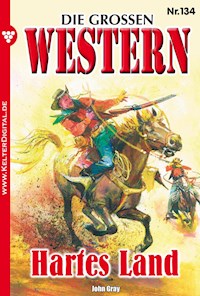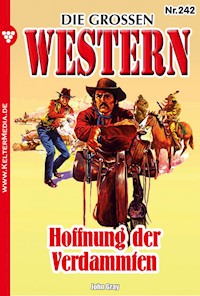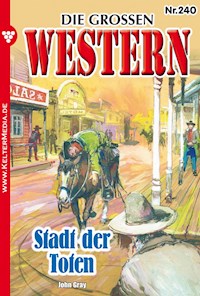Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Er liebte den Nebel. Im Nebel verwandelten sich alle festen Linien in konturenlose Schemen, und er verschluckte Spuren und Geräusche. Der Mann war mittelgroß, drahtig schlank und kräftig. Er hielt ein fünfschüssiges Revolvergewehr locker in der Rechten, während er die Gasse zum Fluß hinunterschritt. Er trug eine schwarze enganliegende Hose und eine hüftkurze Jacke. Den breitkrempigen Hut hatte er tief in die Stirn gezogen. An seinen Stiefeln klirrten leise die kleinen Radsporen, aber das Geräusch hallte nicht sehr weit. Der Nebel schluckte es. Am Fluß wurde er noch dichter. Die grauen Schwaden schoben sich wie rastlose Tiere über den Strom. Gedämpft klang der Schrei eines Vogels von den grünen Wäldern jenseits des Shenandoah. Die Luft war kühl, aber der Mann spürte die Kälte nicht. Er passierte die letzten Hütten am Strom, hatte längst die gepflasterte Gasse verlassen und blieb jetzt zwischen dichtem Weidengehölz oberhalb der Uferböschung stehen. Der Shenandoah gurgelte dumpf. Der Mann wandte sich um und blickte zur Stadt hoch: Harpers Ferry. Eine kleine Stadt, aber ein pulsierender Verkehrsknotenpunkt. Die Häuser waren solide aus Stein gebaut, die Straßen befestigt. Den Bewohnern ging es gut, denn es gab ein Bundesarsenal der US-Armee hier, das brachte Geld in die Stadt. Der Mann spähte zum Fort hinüber. Er erkannte im Nebel nur die klotzigen Umrisse. Er zog eine silberne Taschenuhr hervor, warf einen Blick darauf und bewegte sich am Fluß entlang auf die Hafenanlage zu. Er passierte einige schäbige Lagerschuppen, sah die wuchtigen Poller aus dem Uferwasser ragen und gewahrte die Kaimauern vor sich. Hier dümpelten einige
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 230 –
Tod aus dem Hinterhalt
John Gray
Er liebte den Nebel. Im Nebel verwandelten sich alle festen Linien in konturenlose Schemen, und er verschluckte Spuren und Geräusche.
Der Mann war mittelgroß, drahtig schlank und kräftig. Er hielt ein fünfschüssiges Revolvergewehr locker in der Rechten, während er die Gasse zum Fluß hinunterschritt. Er trug eine schwarze enganliegende Hose und eine hüftkurze Jacke. Den breitkrempigen Hut hatte er tief in die Stirn gezogen. An seinen Stiefeln klirrten leise die kleinen Radsporen, aber das Geräusch hallte nicht sehr weit. Der Nebel schluckte es. Am Fluß wurde er noch dichter. Die grauen Schwaden schoben sich wie rastlose Tiere über den Strom.
Gedämpft klang der Schrei eines Vogels von den grünen Wäldern jenseits des Shenandoah. Die Luft war kühl, aber der Mann spürte die Kälte nicht. Er passierte die letzten Hütten am Strom, hatte längst die gepflasterte Gasse verlassen und blieb jetzt zwischen dichtem Weidengehölz oberhalb der Uferböschung stehen.
Der Shenandoah gurgelte dumpf. Der Mann wandte sich um und blickte zur Stadt hoch: Harpers Ferry. Eine kleine Stadt, aber ein pulsierender Verkehrsknotenpunkt. Die Häuser waren solide aus Stein gebaut, die Straßen befestigt. Den Bewohnern ging es gut, denn es gab ein Bundesarsenal der US-Armee hier, das brachte Geld in die Stadt.
Der Mann spähte zum Fort hinüber. Er erkannte im Nebel nur die klotzigen Umrisse. Er zog eine silberne Taschenuhr hervor, warf einen Blick darauf und bewegte sich am Fluß entlang auf die Hafenanlage zu.
Er passierte einige schäbige Lagerschuppen, sah die wuchtigen Poller aus dem Uferwasser ragen und gewahrte die Kaimauern vor sich. Hier dümpelten einige flache Kähne. Auf den Kais stapelten sich Kisten und Fässer. In deren Schutz blieb der Mann stehen. Er hob das Revolvergewehr an, zog den Hahn zurück, ließ die lange Trommel rotieren und überprüfte den Sitz der Zündhütchen.
Als er wieder aufschaute, sah er die Fähre auf dem Fluß auftauchen – ein flaches, breites Boot an einer Stahltrosse, die über eine Winde auf dem Boot lief, an der der Fährmann kurbelte und die Fähre auf diese Weise über den Strom setzte.
Das Holz der Planken ächzte, die Winde knarrte. Der Mann hinter den Frachtkisten sah eine Gestalt am Bug der Fähre stehen, einen Mann in Uniform, mittelgroß, dunkelhaarig, sehnig. Die gelben Stulpenhandschuhe waren deutlich zu erkennen.
Der Mann trat hinter den Kisten hervor und schritt auf den Kai hinaus. Seine Sporen klirrten wieder. Die Fähre stieß mit dumpfem Laut gegen den Anleger. Im nächsten Moment stand der Mann in Schwarz auf dem Kai.
»Major Graves!« Seine Stimme hatte einen harten Klang.
»Ja?« Der Offizier hob den Kopf. Er griff nach dem Zügel seines Pferdes, das hinter ihm auf dem Flachboot stand. »Sind Sie die Ordonnanz vom Fort, die mich abholt? Sind Sie allein?«
»Der Tod ist immer allein«, sagte der Mann.
Er hob das Revolvergewehr an die Hüfte, richtete den Lauf auf den Offizier und drückte ab.
Ein peitschender Knall, der vom Nebel gedämpft wurde. Im dichten Grau zuckte das Mündungsfeuer.
Der Offizier wurde zurückgeschleudert. Sein Pferd tänzelte scheuend und stieß ein trompetendes Wiehern aus. Der Offizier schlug der Länge nach auf die Planken.
Der Fährmann an der Winde stand wie erstarrt. Er schaute fassungslos zu der düsteren Gestalt auf dem Kai hoch.
Der Mann drehte sich halb, zog den Hahn zurück und zielte auf den Fährmann.
»Nein!« Der Fährmann wich zurück. Der Schuß krachte. Der Fährmann hatte sich bereits abgestoßen und hechtete von Bord der Fähre. Der Schuß streifte ihn nur. Klatschend schlug er im Wasser auf und ging unter.
Das Pferd des Offiziers spielte jetzt verrückt. Es keilte nach allen Seiten aus und zerrte an seinem Zügel, mit dem es an einem Eisenhaken festgebunden war. Die Fähre schlingerte. Das Pferd wieherte und schnaubte, die Augen quollen ihm fast aus den Höhlen.
Der Mann auf dem Kai sprang auf die Fähre hinunter und versetzte dem Offizier einen Tritt. Die reglose Gestalt wurde herumgewälzt. Die Augen schimmerten glasig.
Der andere empfand Zufriedenheit und stieg zurück auf den Kai. Da hörte er bereits Hufschlag aus einer der Gassen, die vom Fort zum Flußhafen führten.
Er bewegte sich jetzt schnell. Aber ohne übermäßige Hast glitt er in eine der Seitengassen und hörte hinter sich, daß sich Türen und Fenster öffneten. Da war er schon weiter. Der Nebel verschluckte ihn.
Drei uniformierte Reiter erreichten den Kai. Ein Sergeant sprang aus dem Sattel und lief zur Fähre. Gerade schwamm der Fährmann auf die Mauer zu.
Er schrie immer wieder: »Das war kaltblütiger Mord! Er hat nach dem Namen des Majors gefragt und einfach geschossen!«
Die Soldaten rissen ihre Pferde herum. Der Sergeant sprang auf die Fähre hinunter und kniete neben dem Offizier nieder, während sich der Fährmann an der Kaimauer hochzog.
Die Soldaten trieben ihre Pferde im Galopp die Hafengassen hoch. Irgendwo schrie eine Frau mit schriller, überschnappender Stimme: »Er ist hier hochgelaufen! Ich habe ihn gesehen! Hier lang, Soldat!«
Der Soldat hörte seinen Kameraden eine andere Gasse hochreiten, die Hufe des Pferdes knallten hell auf das Pflaster.
Noch war der Nebel über der Stadt dicht, besonders über dem Hafen am Fluß. Der Soldat spähte angestrengt nach vorn. Er hatte seinen Revolver gezogen und hielt ihn schußbereit in der Rechten.
Überall glaubte er Schatten zu sehen. Ständig drehte er sich im Sattel hin und her, weil er sicher war, in einem der Hofeingänge eine dunkle Gestalt zu bemerken.
Aus dem kühlen Grau klangen Rufe, verzerrte Stimmen. Sein Pferd schnaubte. Der Soldat zog die Zügel an und lauschte angespannt.
Auf einmal vernahm er klirrende Schritte ganz in seiner Nähe. Ein Mensch bewegte sich ohne Hast durch den Nebel.
Der Soldat sah die Umrisse einer Gestalt. Sie war völlig schwarz.
»Wer ist da?« rief er. »Haben Sie jemanden fliehen sehen?«
Er sah den Mann im Nebel. Er hatte kein Gesicht, nur einen schwarzen Fleck. Der Soldat begriff nur mit Verzögerung, daß der andere ein Halstuch vorgebunden hatte.
Etwas in ihm lähmte ihn. Er starrte in den orangefarbenen Blitz und hörte den peitschenden Knall.
Sein Pferd wieherte schrill und ging mit der Vorderhand hoch. Es kippte auf die Seite und verdrehte den Kopf. Mit hervorquellenden Augen und gebleckten Zähnen schlug es seitlich auf das Pflaster. Der Soldat fühlte den gewaltigen Schmerz, als sein linkes Bein unter dem Pferdeleib eingeklemmt wurde.
Dann war auf einmal die Angst da, die ihn wie mit einem Würgegriff erfaßte. Hilflos lag er halb unter dem Pferd, das sich nicht mehr rührte. Seinen Revolver hatte er beim Aufprall auf die Gasse verloren. Er wußte, daß sein linkes Bein gebrochen war. Seine linke Körperhälfte war schwer geprellt und nahezu gelähmt. Aber das interessierte ihn in diesem Moment kaum.
Er starrte wie hypnotisiert dorthin, wo der düstere Mann mit dem Halstuch vor dem Gesicht gestanden hatte. Er war verschwunden. Aber der Soldat war sicher, daß er sich noch in der Nähe befand.
Er spannte alle Muskeln an, sammelte alle Kräfte, um zu versuchen, sich zu befreien. Es gelang nicht.
Jetzt schrie er: »Hilfe! Hört mich denn niemand?«
Ihn hörte niemand. Der Nebel erstickte jeden Laut. Die Hafenkais waren zu weit entfernt. Dort unten konzentrierte sich die gesamte Aufregung. Dort, wo der tote Major an Land getragen wurde, sammelten sich Neugierige und Zuschauer. Die Gasse, in der sich der Soldat befand, blieb leer.
Er hörte die Schritte des Killers. Er war hinter ihm. Der Soldat wollte den Kopf wenden. Aber selbst das konnte er nur begrenzt. Er wollte noch einmal schreien. Doch seine Kehle war wie zugeschnürt.
Er hörte ein leises, abgehacktes Lachen. Der Killer stand direkt hinter ihm.
Die Furcht raubte dem Soldaten fast den Verstand. Der Killer beugte sich über ihn, zog den Karabiner aus dem Scabbard, hob ihn und zerschlug ihn direkt neben dem Soldaten auf dem Pflaster. Der Kolbenhals brach splitternd.
Der düstere Mann öffnete die Satteltaschen und durchsuchte sie. Er entnahm zwei braune Umschläge. Bei all dem kümmerte er sich nicht um den Soldaten, der unter seinem Pferd festgeklemmt war. Er tat so, als sei der gar nicht vorhanden.
Schließlich wandte er sich ihm zu. Der Soldat sah nur die Augen. Schmale, dunkle, hart schimmernde Pupillen.
»Alle werden sterben«, sagte der Mann. »Alle…«
»Nein«, flüsterte der Soldat. Er schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Du nicht«, sagte der Fremde. »Du bist nicht wichtig genug.«
Er schlug mit dem Kolben seines Revolvergewehrs zu. Die Kolbenplatte traf den Soldaten. Der Soldat spürte es nicht mehr. Nach dem ersten, berstenden Schmerz war er rücklings auf das Pflaster geprallt und hatte das Bewußtsein verloren.
*
Phil Crowley war kaum zu übersehen: Er maß sechs Fuß und fünf Zoll. Seine Schultern waren breit, die Hüften schmal. Er bewegte sich mit der lässigen Geschmeidigkeit eines Mannes, der sein Gewicht nicht in Fett mit sich herumträgt.
Crowley war in einen eleganten, paßgenau geschnittenen Prince-Albert-Rock gekleidet. Er trug einen breitrandigen, flachkronigen Hut, wie er unter südstaatlichen Pflanzern üblich war, und eine sorgfältig geknüpfte Schnürsenkelkrawatte.
In der Linken hielt er eine Tasche aus abgewetztem Leder. Rechts bauschte sich seine Jacke etwas, und wer genau hinschaute, erkannte, daß er einen großkalibrigen Revolver unter dem Stoff trug.
Crowley streifte mit kühlem, abschätzendem Blick einige Männer auf dem Bahnsteig, verharrte etwas bei zwei schlanken, hochgewachsenen, dunkelhaarigen Südstaaten-Ladys und ging dann mit festen Schritten zum Ausgang. Hinter ihm fuhr puffend und schnaufend der Zug wieder an. Die Dampfpfeife gellte schrill.
Crowley verließ die Bahnstation von Richmond. Er war nicht das erste Mal hier. Er kannte die gepflegten Alleen mit den weißen, herrschaftlichen Häusern im Kolonialstil. Ein milder Wind strich vom James River herauf. Da war bereits die süße, verführerische Trägheit der Atmosphäre, die verhaltene Eleganz zu spüren, die man überall in den größeren Städten des Südens antraf. Ladys in Krinolinen promenierten auf schattigen Wegen. Pflanzer und Geschäftsleute waren zur Baumwollbörse unterwegs. Fuhrwerke rollten durch die Straßen.
Crowley blieb vor der Bahnstation stehen und schaute sich um.
»Mister Crowley, Sir?« fragte eine Stimme.
Crowley bemerkte einen schlanken Farbigen in der Kleidung eines Hausdieners. Er war seitlich herangetreten und deutete auf einen eleganten Zweispänner, der im Schatten einiger Akazien stand. »Würden Sie mir bitte folgen?«
Crowley nahm die Tasche fester und überquerte mit dem Farbigen die Straße. Der Kutschenschlag öffnete sich. Crowley stieg ein, und im nächsten Moment rollte der Wagen an. Crowley ließ sich auf der weinrot gepolsterten Lederbank nieder.
»Ich freue mich, Sie zu sehen, Crowley.« Ihm gegenüber saß ein kleiner, drahtiger, falkenäugiger Mann, der sich auf einen Stock mit einer Krücke aus Sterling-Silber stützte. »Der Zug war pünktlich.«
»Gut, daß überhaupt noch Züge fahren«, sagte Crowley.
»Wir wollen die Situation nicht schlimmer darstellen, als sie ist.« Der andere lehnte sich zurück. »Vielleicht können wir etwas dazu tun, daß sich gar nicht erst weitere Probleme ergeben.«
»Im Norden werden bereits Spekulationen darüber angestellt, wie lange es noch dauern kann, bis der Krieg ausbricht«, sagte Crowley. »Und auf der Fahrt hierher habe ich mehreren Pflanzern zugehört, die schon morgen ihr letztes Hemd hergeben würden, um eine eigene Südstaatenarmee auf die Beine zu stellen. Ich glaube, ich hätte nicht herreisen müssen.«
»Die Leute auf der Straße sind sehr schnell in Erregung zu versetzen«, erwiderte der andere. »Entscheidend ist, was die Männer sagen, die an der Spitze stehen. Nicht jede Drohgebärde muß man sofort ernst nehmen. Hinter den Kulissen wird viel vorsichtiger gesprochen als nach außen hin.«
»Es sind nicht nur die Leute auf der Straße, die vom Krieg reden«, sagte Crowley. »Seit der Wahl Lincolns zum Präsidenten…«
»Sie werden bald einige Gespräche mit wichtigen Persönlichkeiten führen«, sagte der andere. »Sie werden sich deren Meinungen anhören. Sie werden hören, daß die Pflanzer hier der Meinung sind, daß der Kampf gegen die Sklaverei im Norden nur geführt wird, um die wirtschaftliche Grundlage der Südstaaten zu zerstören. Wenn diese Besorgnisse zerstreut werden können, wäre schon viel gewonnen. Sie haben sich im Stab von Abraham Lincoln aufgehalten, vielleicht können Sie dazu beitragen, daß das Bild von dem, was der Norden in nächster Zeit tun will, hier klarer wird.«
»Senator Blaid«, sagte Crowley. »Ich bin kein Politiker. Ich bin auch kein Diplomat. Ich war Angestellter der Pinkerton-Detektiv-Agentur und zum Schutz Lincolns eingesetzt. Man hat mir gesagt, daß ich mich hier umsehen soll, ob es führende Persönlichkeiten gäbe, die bereit seien, sich für eine Zusammenarbeit mit der neuen Regierung einzusetzen. Ich bin nicht dazu da und auch nicht dazu geeignet, selbst Einfluß zu nehmen.«
»Das verlangt niemand von Ihnen, Crowley.« Der Senator musterte ihn durchdringend. »Sie sind für diesen Auftrag ausgewählt worden, weil Sie sich als scharfer Beobachter hervorgetan haben und als unerschrocken eingeschätzt werden. Außerdem haben Sie in Lincolns Umgebung bewiesen, daß Sie sich auch in guter Gesellschaft bewegen können, ohne aufzufallen. Gerade darin besteht Ihre Aufgabe: Sie sollen in Gesprächen Bemerkungen äußern, die von den richtigen Leuten als Friedensangebote verstanden werden.«
Der Einspänner war am Gouverneursitz von Virginia vorbeigerollt und hielt in einer schmalen Straße vor einem Haus mit Marmorsäulen und Freitreppe an. Der schwarze Hausdiener riß den Seitenschlag auf. Senator Blaid stieg aus, Crowley folgte. Wenig später stand er in einem englisch eingerichteten Salon.
»Alles, was ich Ihnen sagen kann, Senator, ist: Man wird wegen der Sklaverei im Norden keinen Krieg führen. Es geht dem neuen Präsidenten nur um eins: Das Land darf nicht geteilt werden.«
»Sind Sie sicher, Crowley?«
Der kleine, drahtige Senator blieb vor Crowley stehen und drückte ihm ein schweres Kristallglas mit rötlich schimmerndem Whisky in die Hand. Er sagte: »Diese Information kann entscheidend sein.«
»Ich habe es mehr als einmal gehört«, sagte Crowley. »Der Erhalt der Union geht Lincoln über alles. Er hat nicht vor, die Plantagenbesitzer zu enteignen. Es sei denn, man würde ihn dazu zwingen.«
»Was könnte ihn dazu zwingen?«
»Wenn sich der Süden auf einen Krieg gegen den Norden einläßt… Ich glaube, dann ist alles möglich.«
»Sehen Sie, Crowley.« Der Senator nahm sich selbst ein Glas. Er ging zu einem der Fenster und schaute auf den weitläufigen Garten mit den hohen, alten Bäumen hinaus. »So wie die Dinge stehen, glauben Pflanzer und Politiker im Süden den Politikern im Norden kein Wort mehr. Aber wenn jemand wie Sie, der völlig unverdächtig ist, im Norden einen Posten innezuhaben, derartige Informationen ausstreut, könnte das die Erregung hier dämpfen.« Blaid drehte sich um. »Es sind bereits Gespräche im Gang, ein eigenes südliches Parlament ins Leben zu rufen. Es werden Namen für einen südstaatlichen Präsidenten gehandelt.«
»Immerhin haben sich schon einige Staaten aus der Union verabschiedet«, sagte Crowley.
»Das kann wieder aufgehoben werden.« Blaid trat dicht vor Crowley hin. »Ich bin ein alter Virginier, Crowley. Aber ich will nicht, daß dieses Land zerreißt. Zum Teufel, ich habe Lincoln nicht gewählt, aber er ist Präsident, und es wird immer Präsidenten geben, die manchen nicht passen. Nur weil jemand zum Präsidenten gewählt worden ist, dem viele im Süden mißtrauen, kann man nicht die Vereinigten Staaten auflösen. Dazu müssen stärkere Gründe angeführt werden.«
»Die Gründe liegen viel tiefer, Sir«, sagte Crowley. Er setzte sein Glas ab, ohne getrunken zu haben. »In den letzten zehn Jahren ist vieles entstanden, was Norden und Süden trennt. Aber Sie haben recht: Ich werde mich umhören, ich werde sagen, was ich weiß, und ich werde nach Norden berichten.«
Es klopfte an die Tür. Blaid wandte sich unwillig um und rief: »Bitte!«
Der schlanke Farbige trat ein. Er hatte etwas Hoheitsvolles in seinen Bewegungen. Er sagte: »An der Tür ist ein Gentleman, der sich nicht abweisen läßt. Er sagt, daß er aus dem Amt des Gouverneurs komme.«
Blaid nickte, er hatte die Stirn gerunzelt. Der Diener verschwand und führte wenig später einen hageren, krummrückigen Mann mit einem Kneifer auf der Nase in den Salon. Der Mann starrte Crowley an.
Blaid sagte ungeduldig: »Was ist los, Mann?«
»Major Graves ist ermordet worden, Sir. Ich habe die Nachricht gerade erhalten und bin sofort zu Ihnen…«
»Graves? Wo?«
»In Harpers Ferry, Sir. Nach allem, was bis jetzt bekannt ist, sollte der Major Instruktionen in das Arsenal bringen. Als die Fähre anlegte, ist ein Mann auf dem Kai aufgetaucht und hat ihn ohne viel Federlesens erschossen. Niemand weiß, wer der Täter war. Er ist ungehindert entwischt.«
»Es war richtig, daß Sie mich benachrichtigt haben.« Blaid begleitete den Mann zur Tür. »Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will alles wissen.«
Als er zurückkehrte, glich sein Gesicht einer Maske. Er sagte: »Es kann Zufall sein. Aber ich glaube in dieser Zeit nicht mehr an Zufälle. Kennen Sie den Namen Graves, Crowley?«
»Nein.«
»Graves ist nicht nur Major der regulären Armee, er ist zugleich Colonel in der Miliz von West-Virginia. Ein einflußreicher Offizier, von dem angenommen wird, daß er im Falle eines Kriegsausbruchs sofort in die Führung einer vom Süden aufzustellenden Armee rücken würde.«
»Und was hat das zu bedeuten?«