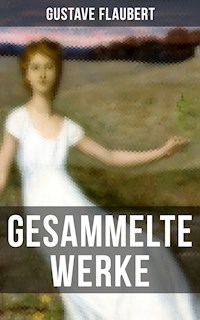Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: red.sign Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei ehemalige Pariser Büroangestellte, durch eine Erbschaft finanziell unabhängig geworden, ziehen aufs Land, entdecken dort ihren Intellekt und widmen sich nun den großen Themen ihrer Zeit sowie den Wissenschaften. Und das in rascher Folge. Egal, wie komplex ein Zusammenhang auch sein mag, Bouvard und Pécuchet fühlen sich berufen mitzureden. Nicht gerade von Selbstzweifeln gehindert stürzen sie sich in Theorie und praktischer Anwendung eifrig auf immer neue Themen – auf Landwirtschaft und Liebe, Medizin und Politik, Religion und Pädagogik, Geschichte und Naturwissenschaften … Natürlich stolpern die dilettierenden Anfänger dabei von Verlegenheit zu Peinlichkeit, von Scheitern zu Scheitern. Gustave Flauberts unvollendet gebliebener satirischer Schelmenroman (er starb buchstäblich bei der Arbeit; das Ende des letzten Kapitels konnte er nur noch skizzieren) ist eine Auflehnung gegen die menschliche Dummheit, die er in all ihren Formen schildert und anprangert. Und er ist ein stets amüsanter Gang durch die Welt des Wissens des 19. Jahrhunderts – an der Seite zweier Biedermänner, die wesentliche Charakteristika des „Wutbürgers“ unserer Zeit tragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Coverfoto: Man Illustration, shutterstock.com/Eugene Ivanov
Gustave Flaubert
»Bouvard und Pécuchet«
Aus dem Französischen übersetzt von Georg Goyert. In dieser Übersetzung erschien »Bouvard und Pécuchet« in zahlreichen, vom Übersetzer selbst immer wieder intensiv bearbeiteten Ausgaben, zuletzt 1996 im Insel-Verlag, Frankfurt am Main.
Für diese E-Book-Ausgabe wurde der Text neu gesetzt und gemäß den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung behutsam modernisiert.
Mit einem Nachwort von Adolf Schulte aus dem »Jahrbuch für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark«,
(heute: »Märkisches Jahrbuch für Geschichte«) Jg. 88, 1990, S. 85-96
ISBN 978-3-944561-48-6
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen
© Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei dem Erben des Nachlasses von Georg Goyert
© für das Nachwort: Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark
© Deutsche E-Book-Ausgabe 2016 red.sign medien GbR, Stuttgart
www.redsign-media.de
I
Bei dreiunddreißig Grad im Schatten lag der Boulevard Bourdon vollständig verlassen da. Etwas weiter unten gluckste zwischen den beiden geschlossenen Schleusen das tintenfarbene Wasser des Kanals Saint-Martin. In der Mitte lag ein holzbeladener Kahn; an der Ufermauer standen zwei Reihen Fässer.
Jenseits des Kanals, zwischen den durch Lagerschuppen getrennten Häusern, hob sich der reine Himmel in ultramarinblauen Flecken ab und warf das blendende Licht der Sonne auf die weißen Fassaden zurück, auf die Schieferdächer und die Quais aus Granit. Verworrener Lärm erhob sich fern in die laue Luft, und in der Trägheit des Sonntags, in der Traurigkeit der Sommertage, schien alles erschlafft.
Zwei Männer tauchten auf.
Der eine kam von der Bastille, der andere aus dem Jardin des Plantes. Der Größere trug einen Leinenanzug, hatte den Hut in den Nacken geschoben, die Weste aufgeknöpft und sein Halstuch in der Hand. Der Kleinere, dessen Gestalt in einem kastanienbraunen Gehrock steckte, hielt den Kopf unter einer Mütze mit spitzem Schirm gesenkt.
Als sie die Mitte des Boulevards erreicht hatten, setzten sie sich gleichzeitig auf dieselbe Bank.
Um sich die Stirn abzuwischen, nahmen sie ihre Kopfbedeckung ab, die jeder neben sich legte, und der kleine Mann sah, dass in dem Hut seines Nachbarn ›Bouvard‹ geschrieben stand, während dieser mühelos in der Mütze des Mannes im Gehrock das Wort ›Pécuchet‹ entzifferte.
»Sieh an«, sagte er, »beide haben wir den Gedanken gehabt, unseren Namen in unsere Kopfbedeckung zu schreiben.«
»Weiß Gott, ja; man könnte mir meine sonst im Büro vertauschen.«
»Genau wie bei mir; ich bin auch Angestellter.«
Und sie betrachteten sich.
Das liebenswürdige Äußere Bouvards gefiel Pécuchet sofort.
Seine bläulichen, immer halbgeschlossenen Augen lächelten in seinem gesunden Gesicht. Eine Hose mit großer Klappe, die auf seinen Kastorschuhen Falten warf, saß um den Leib wie angegossen und bauschte sein Hemd über dem Gürtel; sein blondes, von Natur leicht gewelltes Haar verlieh ihm etwas Kindliches.
Von seinen Lippen tönte ständig ein leises Pfeifen.
Das ernste Aussehen Pécuchets fesselte Bouvard.
Man hätte annehmen können, er trüge eine Perücke, so schlicht waren die schwarzen Strähnen, die seinen hohen Schädel bedeckten. Die sehr lange Nase gab seinem Gesicht etwas Scharfes. Seine Beine, die in Lastingröhren steckten, standen in keinem Verhältnis zur Länge des Oberkörpers; seine Stimme klang laut und hohl.
»Wie herrlich wäre es jetzt auf dem Lande«, sagte er.
Aber nach Bouvards Ansicht waren die Vorstädte wegen des Lärms in den Kneipen unerträglich. Das war auch Pécuchets Meinung. Trotzdem war er, genau wie Bouvard, die Hauptstadt leid.
Und ihre Augen schweiften über Haufen von Bausteinen, über das hässliche Wasser, in dem ein Strohbündel schwamm, über den Schornstein einer Fabrik, der sich am Horizont abhob; der Gestank der Abflüsse verpestete die Luft. Sie wandten sich nach der anderen Seite und hatten nun die Mauern eines Getreidespeichers vor sich.
Ganz entschieden – und Pécuchet war hierüber sehr erstaunt – war es in den Straßen noch heißer als zu Hause. Bouvard redete ihm zu, seinen Rock auszuziehen. Er kümmere sich nicht um das, was die Leute dazu sagen würden.
Plötzlich torkelte ein Betrunkener über den Bürgersteig; und da er anscheinend zur Arbeiterklasse gehörte, fingen sie ein politisches Gespräch an. Sie hatten die gleichen Ansichten, wenn Bouvard vielleicht auch liberaler war.
Jetzt kam etwas in einer Staubwolke über das Pflaster gerasselt. Es waren drei Mietkutschen, die in der Richtung nach Bercy fuhren: Eine eben getraute junge Frau, mit einem Blumenstrauß im Schoß, Bürger in weißer Halsbinde, Damen, die bis zu den Achseln in ihren Kleidern vergraben waren, zwei oder drei junge Mädchen und ein Schüler unternahmen eine Spazierfahrt.
Als Bouvard und Pécuchet diese Hochzeitsgesellschaft sahen, kamen sie auf die Frauen zu sprechen, die sie für frivol, widerspenstig und eigensinnig erklärten. Trotzdem waren sie oft besser als die Männer; manchmal aber auch schlimmer. Kurz, es war klüger, ohne sie zu leben; deshalb war Pécuchet Junggeselle geblieben.
»Ich bin Witwer«, sagte Bouvard, »und habe keine Kinder.«
»Vielleicht ist das Ihr Glück? Aber die Einsamkeit ist auf die Dauer doch sehr traurig.«
Dann erschien am Rand des Quais eine Dirne mit einem Soldaten. Sie war blass, hatte schwarze Haare und Blatternarben im Gesicht; sie hing am Arm des Soldaten, schlurrte in ihren abgetragenen Schuhen und wiegte sich in den Hüften. Als sie vorüber war, erlaubte sich Bouvard eine obszöne Bemerkung. Pécuchet errötete und wies, um nicht antworten zu müssen, mit dem Blick auf einen Priester, der näherkam.
Der Geistliche schritt gemächlich über die Avenue mit den mageren Ulmen, die die Linie des Fußwegs andeuteten; als Bouvard den Dreispitz nicht mehr sah, sagte er, er fühle sich wie erleichtert, denn er hasse die Jesuiten. Pécuchet sprach sie zwar nicht ganz frei, zeigte aber doch eine gewisse Achtung vor der Religion.
Unterdessen fing es an zu dämmern; die Jalousien gegenüber waren schon aufgezogen. Die Passanten wurden jetzt zahlreicher. Es schlug sieben Uhr.
Unaufhörlich sprachen sie, Bemerkungen wechselten mit Anekdoten, philosophische Betrachtungen mit persönlichen Meinungen.
Sie schimpften auf die Brücken- und Straßenbauämter, die Tabakregie, den Handel, die Theater, die Marine und die ganze Menschheit wie Leute, die schweren Verdruss gehabt haben. Während sie einander zuhörten, glaubte der Eine, im Anderen etwas von seinem eigenen Wesen wiederzufinden, das er vergessen hatte. Und lag auch das Alter kindlicher Begeisterungsfähigkeit hinter ihnen, so empfanden sie doch beide ein neues Vergnügen, etwas wie herzliche Freude, wie den Reiz der zärtlichen Gefühle in ihrem Entstehen.
Zwanzig Mal waren sie schon aufgestanden, hatten sich aber jedes Mal wieder gesetzt, waren über den Boulevard von der oberen bis zur unteren Schleuse gegangen, wollten sich trennen, fanden aber nicht die Kraft und wurden jedes Mal wie durch einen Zauber festgehalten.
Endlich verabschiedeten sie sich; und als sie einander die Hand schüttelten, sagte Bouvard: »Wie wär‘s denn, wenn wir noch zusammen essen gingen?«
»Daran habe ich auch schon gedacht«, erwiderte Pécuchet, »aber ich wagte nicht, Ihnen den Vorschlag zu machen.«
Und er ließ sich in ein kleines Restaurant führen, in dem es gemütlich sein sollte. Es lag dem Rathaus gegenüber. Bouvard bestellte das Menü.
Pécuchet vermied ängstlich jedes Gewürz, denn er fürchtete, es könne ihm das Blut erhitzen. Das gab Anlass zu einer Unterhaltung über Medizin.
Dann priesen sie den Nutzen der Wissenschaften: Was gab es nicht alles zu lernen und zu erforschen … wenn man nur Zeit hätte! Ach, der Beruf nahm sie ganz in Anspruch; und sie hoben die Arme vor Staunen, sie hätten sich beinahe über den Tisch hinweg umarmt, als sie entdeckten, dass sie beide Schreiber waren: Bouvard in einem Handelshaus, Pécuchet im Marineministerium, was ihn nicht hinderte, jeden Abend einige Augenblicke dem Studium zu widmen. Er hatte in Thiers‘ Werken Fehler entdeckt und sprach mit größter Achtung von einem gewissen Professor Dumouchel. Bouvard war ihm in anderer Hinsicht überlegen. Seine Uhrkette aus Haaren und die Art, wie er die Remoulade rührte, verrieten den erfahrenen Schlemmer; er hatte einen Zipfel der Serviette in die Achselhöhle gesteckt und erzählte während des Essens allerlei, worüber Pécuchet lachte. Es war ein ganz besonderes Lachen, ein einziger, sehr tiefer Ton, der immer derselbe blieb und in langen Zwischenräumen neu ausgestoßen wurde. Bouvard lachte anhaltend und laut; er zeigte dabei seine Zähne, bewegte lebhaft die Schultern, und die Gäste in der Tür drehten sich nach ihm um.
Als sie gegessen hatten, gingen sie in ein anderes Lokal, um Kaffee zu trinken. Pécuchet betrachtete die Gaslampen, seufzte über das Überhandnehmen des Luxus und schob dann mit verächtlicher Miene die Zeitungen beiseite. Bouvard war nachsichtiger. Er liebte alle Schriftsteller im Allgemeinen und hatte in seiner Jugend Lust gehabt, Schauspieler zu werden. Er wollte equilibristische Kunststücke mit einem Billardqueue und zwei Elfenbeinkugeln machen, wie Barberou, einer seiner Freunde, sie auszuführen pflegte. Aber immer wieder fielen die Kugeln auf den Fußboden, rollten den Gästen zwischen die Beine und verschwanden im Hintergrund. Der Kellner, der jedes Mal aufstand und sie auf allen Vieren kriechend unter den Bänken suchte, wurde es schließlich leid. Pécuchet geriet mit ihm in Streit; der Wirt kam hinzu, hörte nicht auf seine Entschuldigungen und machte sogar bissige Bemerkungen über die Zeche.
Pécuchet schlug dem neuen Freund vor, den Abend friedlich in seiner Wohnung zu beschließen, die ganz in der Nähe, in der Rue St. Martin, lag.
Kaum hatte er das Zimmer betreten, als er eine Art Wams aus Kattun anzog und dann den liebenswürdigen Wirt spielte.
Ein Schreibtisch aus Tannenholz, der genau in der Mitte stand, störte durch seine Ecken; überall, auf Brettern, auf den drei Stühlen, auf dem alten Lehnsessel und in den Ecken, lagen in wildem Durcheinander mehrere Bände der Encyclopédie Roret, der Manuel du Magnétiseur, ein Band Fenelon, andere Schmöker, dazu Haufen von Papieren, zwei Kokosnüsse, verschiedene Denkmünzen, ein Fez und Muscheln, die Dumouchel aus Le Havre mitgebracht hatte. Eine Schicht von Staub überzog samtartig die Wände, die früher gelb gestrichen waren. Die Schuhbürste lag auf dem Rand des Bettes, aus dem die Laken heraushingen. An der Decke sah man einen großen schwarzen Fleck, der durch den Rauch der Lampe entstanden war.
Bouvard bat um die Erlaubnis, das Fenster öffnen zu dürfen – zweifellos wegen der schlechten Luft im Zimmer.
»Die Papiere würden fortfliegen«, rief Pécuchet, der vor jedem Luftzug Angst hatte.
Dabei schnappte auch er nach Luft in diesem kleinen Zimmer, das seit dem Morgen durch die Schiefer des Daches erhitzt war.
Bouvard sagte zu ihm: »An Ihrer Stelle würde ich die Unterjacke ausziehen.«
»Was?«
Bei dem Gedanken, seine Gesundheitsweste nicht mehr tragen zu sollen, senkte Pécuchet erschreckt den Kopf.
»Begleiten Sie mich«, fing Bouvard wieder an, »die Luft draußen wird Sie erfrischen.«
Brummend zog Pécuchet seine Stiefel wieder an: »Sie behexen mich; auf Ehrenwort.«
Und trotz der Entfernung begleitete er Bouvard bis zu seiner Wohnung, die an der Ecke der Rue de Béthune lag, dem Pont de la Tournelle gegenüber.
Bouvards Zimmer war fein gebohnert, vor den Fenstern hingen Perkalvorhänge, die Möbel waren aus Mahagoni. Es hatte einen Balkon, von dem man auf den Fluss sah. Die beiden Hauptschmuckstücke waren ein Likörservice, das auf der Kommode stand, und längs des Spiegels Daguerreotypien, die seine Freunde darstellten. Ein Ölgemälde hing im Alkoven.
»Mein Onkel.«
Und das Licht des Leuchters, den er hielt, fiel auf einen Herrn. Rote Koteletten umsäumten das Gesicht; eine Locke hing ihm in die Stirn. Seine hohe Halsbinde, der Hemdkragen, der Aufschlag der Samtweste und der des schwarzen Rocks ließen ihn gedrungen erscheinen. Auf das Jabot waren Diamanten gemalt. Seine Augen waren zu den Backenknochen hin geschlitzt; er lächelte verschmitzt.
Pécuchet konnte sich nicht enthalten zu Bouvard zu sagen: »Man könnte es tatsächlich für ein Bild Ihres Vaters halten.«
»Es ist mein Pate«, erwiderte Bouvard leichthin; dann fügte er hinzu, dass seine Taufnamen François Dénys Bartholomée wären. Pécuchet hieß Juste Romain Cyrille, und beide hatten dasselbe Alter: siebenundvierzig Jahre. Dieser Zufall machte ihnen Freude, überraschte sie aber auch, denn jeder hatte den Anderen für älter gehalten. Dann staunten sie über die Vorsehung, deren Wege oft wunderbar sind.
»Wären wir vorhin nicht spazieren gegangen, wären wir vielleicht gestorben, ohne uns kennengelernt zu haben.«
Dann tauschten sie die Adressen ihrer Brotherren aus und wünschten einander gute Nacht.
»Laufen Sie nicht mehr zu den Mädchen!« rief Bouvard auf der Treppe.
Pécuchet ging die Stufen hinunter, ohne auf den Scherz zu antworten.
Am nächsten Morgen rief im Hof der Messieurs Gebrüder Descambos, Elsässische Stoffe, Rue Hautefeuille 92, eine Stimme:
»Bouvard! Monsieur Bouvard!«
Dieser streckte den Kopf zum Fenster heraus und erkannte Pécuchet, der deutlicher und noch lauter rief: »Ich bin nicht krank. Ich habe sie ausgezogen.«
»Was denn?«
»Sie«, sagte Pécuchet und deutete auf seine Brust.
Was sie am Tag gesprochen, dazu die Temperatur im Zimmer und die Verdauungsarbeit, hatten ihn am Schlaf gehindert, sodass er schließlich, als er es nicht mehr aushalten konnte, seine Flanellunterjacke weit von sich warf. Am Morgen hatte er sich dieser Handlung, die glücklicherweise ohne Folgen geblieben war, erinnert und wollte sie Bouvard mitteilen, der jetzt gewaltig in seiner Achtung gestiegen war.
Pécuchet war der Sohn eines kleinen Kaufmanns. Seine Mutter, die sehr früh gestorben war, hatte er nicht gekannt. Als er fünfzehn Jahre alt war, hatte man ihn aus dem Internat genommen und zu einem Gerichtsvollzieher getan. Unvermutet kamen die Gendarmen, und der Prinzipal wurde auf die Galeeren geschickt; eine grausige Geschichte, an die er heute noch nicht ohne Entsetzen denken konnte. Dann hatte er sich in mehreren Berufen versucht: Apothekerlehrling, Studienaufseher, Rechnungsführer auf einem der Postschiffe auf der oberen Seine. Schließlich hatte ihn ein Abteilungsvorsteher, von seiner schönen Handschrift angetan, als Expedienten eingestellt. Aber das Bewusstsein einer mangelhaften Vorbildung und die geistigen Bedürfnisse, die er in sich fühlte, reizten ihn beständig und machten ihn mürrisch; er lebte ganz allein, ohne Verwandte und ohne Freundin. Seine einzige Zerstreuung war am Sonntag die Besichtigung der öffentlichen Anlagen.
Die ältesten Erinnerungen Bouvards versetzten ihn an die Ufer der Loire auf einen Pachthof. Ein Mann, der sein Onkel war, hatte ihn mit nach Paris genommen, wo er den Kaufmannsberuf erlernen sollte. Als er volljährig war, zahlte man ihm ein paar tausend Francs aus. Dann hatte er geheiratet und einen Süßwarenladen eröffnet. Sechs Monate später ging seine Frau mit der Kasse durch. Die Freunde, das gute Leben und vor allem seine Faulheit ruinierten ihn bald völlig. Aber ihm kam der gute Gedanke, aus seiner schönen Handschrift Nutzen zu ziehen; und seit zwölf Jahren hatte er nun schon die Stelle bei den Gebrüdern Descambos, Elsässische Stoffe, Rue Hautefeuille 92. Was seinen Onkel betrifft, der ihm seiner Zeit als Andenken besagtes Bild geschickt hatte, so wusste Bouvard nicht einmal, wo er wohnte, und erwartete nichts mehr von ihm. Fünfzehnhundert Francs Rente und sein Schreibergehalt erlaubten ihm, jeden Abend in einer Kneipe ein Schläfchen zu machen. So erhielt ihre Begegnung die Bedeutung eines Abenteuers. Gleich hatten sie sich wie durch geheime Fäden miteinander verbunden gefühlt.
Wie soll man Sympathien erklären?
Warum bezaubert bei dem einen eine Eigentümlichkeit, eine Unvollkommenheit, die bei jedem anderen gleichgültig oder gar hassenswert ist? Was man den zündenden Blitz nennt, gilt für jede Leidenschaft. Bevor noch die Woche zu Ende war, duzten sie sich.
Oft holten sie einander im Büro ab. Sobald der eine erschien, schloss der andere sein Pult, und sie schlenderten gemeinsam durch die Straßen. Bouvard machte große Schritte, während Pécuchet, dem der Gehrock um die Fersen schlug, die seinen verdoppelte, sodass es aussah, als liefe er auf Rollen.
Auch ihre besonderen Neigungen vertrugen sich sehr gut miteinander. Bouvard rauchte Pfeife, aß gern Käse und trank regelmäßig seine halbe Tasse Kaffee. Pécuchet schnupfte, aß zum Nachtisch nur Eingemachtes und tauchte ein Stück Zucker in den Kaffee. Der eine war vertrauensselig, unbesonnen, edelmütig; der andere verschwiegen, nachdenklich, sparsam.
Bouvard, der Pécuchet eine Freude machen wollte, stellte ihm Barberou vor. Dieser war früher Reisender und jetzt Börsenspekulant. Er war ein gutmütiger Kerl, liebte sein Vaterland und die Frauen und sprach gern Vorstadtdialekt. Pécuchet mochte ihn nicht und nahm Bouvard mit zu Dumouchel. Dieser Schriftsteller (er hatte eine kleine Mnemotechnik veröffentlicht) gab in einem Mädchenpensionat Literaturunterricht, war in seinen Ansichten sehr orthodox und in seinem Benehmen äußerst ernst. Bouvard fand ihn langweilig.
Keiner hatte dem anderen seine Meinung vorenthalten. Jeder schloss sich dem Urteil des anderen an. Sie gaben ihre Gewohnheiten auf, verließen ihre bürgerliche Pension und aßen schließlich alle Tage zusammen.
Sie stellten Betrachtungen an über die Theaterstücke, von denen man sprach, über die Regierung, die hohen Preise für Lebensmittel, die Betrügereien im Handel. Von Zeit zu Zeit tauchten die Halsbandaffäre oder der Prozess Fualdès in ihren Gesprächen auf, und dann wieder versuchten sie, die Ursachen der Revolution zu ergründen.
Sie schlenderten an den Antiquitätenläden entlang, besuchten das Conservatoire des Arts et des Metiers, Saint-Denis, die Gobelinwebereien, den Invalidendom und alle öffentlichen Sammlungen.
Wurde ihr Ausweis verlangt, taten sie, als hätten sie ihn verloren, und gaben sich für Fremde, als Engländer, aus. Staunend standen sie in den Galerien des Museums vor den ausgestopften Vierfüßlern, freuten sich an den Schmetterlingen, gingen gleichgültig an den Metallen vorbei. Die Fossilien regten sie zum Träumen an, die Schaltiere langweilten sie; die Treibhäuser betrachteten sie durch die Glasscheiben und zitterten bei dem Gedanken, dass alle diese Blätter giftig waren. An der Zeder bewunderten sie vor allem, dass man sie in einem Hut nach Frankreich herübergebracht hatte.
Im Louvre versuchten sie, sich für Raffael zu begeistern. In der großen Bibliothek hätten sie gern die genaue Anzahl der Bände gewusst.
Einmal gingen sie im Collège de France in die Vorlesung über Arabisch, und der Professor war erstaunt, als er die beiden Unbekannten sah, die versuchten, sich Notizen zu machen.
Barberou verschaffte ihnen Zutritt hinter die Kulissen eines Theaters. Dumouchel besorgte ihnen Eintrittskarten zu einer Sitzung der Akademie. Sie unterrichteten sich über die Entdeckungen, lasen Prospekte, und durch diese Neugierde entwickelte sich ihre Intelligenz.
An einem fernen Horizont, der sich alle Tage erweiterte, nahmen sie Dinge wahr, die zugleich undeutlich und wunderbar waren.
Wenn sie ein altes Möbelstück bewunderten, bedauerten sie, nicht zu der Zeit gelebt zu haben, als man es benutzte, obwohl sie keine Vorstellung von dieser Zeit hatten.
Bei gewissen Namen stellten sie sich ferne Länder vor, die umso schöner wurden, je undeutlicher ihre Vorstellung war.
Die Werke, deren Titel sie nicht verstanden, schienen ihnen ein Geheimnis zu umschließen.
Und da sie jetzt mehr dachten, litten sie auch mehr. Wenn eine Postkutsche an ihnen vorbeifuhr, hatten sie das Bedürfnis, in ihr fortzureisen.
Der Quai aux fleurs erweckte in ihnen die Sehnsucht nach dem Landleben.
Eines Sonntagmorgens machten sie sich in aller Frühe auf den Weg, gingen über Meudon, Bellevue, Suresnes, Auteuil und bummelten den ganzen Tag zwischen den Weinbergen umher, pflückten am Rand der Felder Mohn, schliefen im Gras, tranken Milch, aßen unter den Akazien der Schenken und kamen sehr spät nach Hause: bestaubt, erschöpft und entzückt.
Solche Spaziergänge machten sie nun öfter. Aber die nächsten Tage waren dann immer so traurig, dass sie schließlich darauf verzichteten.
Die Eintönigkeit der Büros wurde ihnen verhasst. Immer Federmesser und Sandarak, dasselbe Tintenfass, dieselben Federn und die gleichen Kollegen. Sie hielten sie für stumpfsinnig und sprachen immer weniger mit ihnen. Das trug ihnen allerlei Hänseleien ein. Sie kamen jeden Tag zu spät und wurden abgekanzelt.
Früher fühlten sie sich fast glücklich. Aber seit sie sich höher einschätzten, schämten sie sich ihrer Tätigkeit. Der Widerwille, in dem sie sich gegenseitig bestärkten, wurde immer größer und wandelte ihr Wesen. Pécuchet nahm das brüske Verhalten Bouvards an, während dieser von der Brummigkeit Pécuchets angesteckt wurde.
»Lieber als Seiltänzer auf den öffentlichen Plätzen auftreten«, sagte der eine.
»Oder als Lumpensammler durch die Straßen ziehen«, schrie der andere.
Welch scheußliche Lage! Keine Aussicht herauszukommen! Nicht die kleinste Hoffnung!
Eines Nachmittags, es war der 20. Januar 1839, erhielt Bouvard im Büro einen Brief, den der Postbote brachte. Er hob die Arme, sein Kopf sank langsam nach hinten, und er fiel ohnmächtig zu Boden. Die Gehilfen eilten herbei und lösten ihm die Halsbinde. Man holte einen Arzt. Bouvard öffnete die Augen und antwortete auf die Fragen, die man an ihn richtete:
»Ah, ja ... ein bisschen frische Luft wird mir gut tun. Nein, lassen Sie mich! Erlauben Sie!«
Trotz seiner Beleibtheit lief er spornstreichs und in einem Zuge bis zum Marineministerium, während er sich mit der Hand über die Stirn fuhr, verrückt zu werden glaubte und vergeblich versuchte, sich zu beruhigen.
Er ließ Pécuchet rufen.
Pécuchet erschien.
»Mein Onkel ist tot, und ich bin sein Erbe.«
»Nicht möglich!«
Bouvard zog den Brief hervor und zeigte folgende Zeilen:
Kanzlei des Rechtsanwalts und Notars Tardivel
Savigny-en-Septaine 14. Januar 1839
Mein Herr,
ich ersuche Sie, sich in meine Kanzlei zu bemühen, um hier von dem Testament Ihres natürlichen Vaters, Monsieur François Denys Bartholomée Bouvard, vormaligen Kaufmanns in der Stadt Nantes, in dieser Gemeinde am 10. cr. gestorben, Kenntnis zu nehmen. Dieses Testament enthält eine sehr wichtige Verfügung zu Ihren Gunsten.
Empfangen Sie, mein Herr, die Versicherung meiner Hochachtung
Tardivel, Notar
Pécuchet musste sich auf einen Stein im Hof setzen. Dann gab er das Schriftstück zurück und sagte langsam: »Wenn das nur nicht irgendein ... schlechter Scherz ist ...«
»Du glaubst, es sei ein schlechter Scherz?« erwiderte Bouvard. Seine erstickte Stimme klang wie das Röcheln eines Sterbenden.
Aber der Poststempel, der Name der Kanzlei in Druckschrift, die Unterschrift des Notars, alles sprach für die Echtheit der Nachricht. Sie blickten einander an. Auf einmal wurde ihnen alles zu eng. Ihre Mundwinkel zuckten, und Tränen kamen in ihre starren Augen.
Sie gingen bis zum Triumphbogen, kehrten am Fluss entlang zurück, an Notre-Dame vorbei. Bouvard war sehr rot. Er puffte Pécuchet in den Rücken und redete fünf Minuten lang wirres Zeug.
Diese Erbschaft belief sich doch mindestens auf …
»Ach, das wäre zu schön, sprechen wir lieber nicht mehr davon.«
Sie sprachen weiter davon. Nichts hinderte sie, sich gleich genauer zu erkundigen. Und Bouvard schrieb an den Notar. Der Notar sandte die Abschrift des Testaments, das so endete:
›Demzufolge vermache ich meinem natürlichen Sohn, den ich als solchen anerkenne, dem François Denys Bartholomée Bouvard, den Teil meines Vermögens, der gesetzlich verfügbar bleibt.‹
Der biedere Mann hatte diesen Sohn in seiner Jugend gehabt, aber er hatte ihn immer sorgfältig beiseite gehalten und als seinen Neffen ausgegeben; und der Neffe hatte ihn immer Onkel genannt, obwohl er wusste, was er davon zu halten hatte. Als Monsieur Bouvard ungefähr vierzig Jahre alt war, hatte er geheiratet, war aber bald Witwer geworden. Seine zwei legitimen Söhne waren nicht geraten, wie er es wünschte, und Gewissensbisse hatten ihn gequält, dass er sein erstes Kind so viele Jahre vernachlässigt hatte. Wäre seine Haushälterin nicht gewesen, er hätte ihn bestimmt zu sich genommen. Durch die Ränke der Familie verließ sie ihn, und in seiner Einsamkeit, angesichts des Todes, wollte er sein Unrecht dadurch wieder gutmachen, dass er der Frucht seiner ersten Liebe von seinem Vermögen so viel hinterließ, wie er konnte. Es belief sich auf eine halbe Million, was für den Schreiber zweihundertfünfzigtausend Francs ausmachte. Etienne, der ältere der Brüder, hatte geschrieben, er erkenne das Testament an.
Bouvard verfiel in eine Art Stumpfsinn. Immer wieder sagte er mit leiser Stimme, wobei er friedlich wie ein Trunkener lächelte:
»Fünfzehntausend Francs Zinsen!«
Aber auch Pécuchet, dessen Kopf klarer geblieben war, konnte sich nicht beruhigen.
Durch einen Brief Tardivels wurden sie aus ihrem Taumel gerissen. Der zweite Sohn, Alexandre, hatte erklärt, er beabsichtige, alles vor Gericht zu regeln und wenn möglich das Vermächtnis anzufechten; vor allem verlange er aber Versiegelung, Inventuraufnahme, Ernennung eines Sachwalters und so weiter. Das schlug Bouvard auf die Galle. Kaum fühlte er sich wohler, reiste er nach Savigny, musste aber, ohne etwas erreicht zu haben, zurückkehren. Er jammerte über die Reisekosten.
Schlaflose Nächte folgten. Zorn und Hoffnung, ausgelassene Freude und Niedergeschlagenheit wechselten miteinander ab. Nach einem halben Jahr gab Alexandre nach, und Bouvard konnte seine Erbschaft antreten. Sein erster Ausruf war: »Wir ziehen aufs Land.«
Pécuchet fand diese Worte, die ihn mit dem Glück seines Freundes verbanden, ganz natürlich. Der Bund dieser beiden Männer war eng und unlösbar.
Aber da er nicht auf Bouvards Kosten leben wollte, würde er erst nach seiner Pensionierung Paris verlassen. Nur noch zwei Jahre; das war nicht schlimm! Er war unbeugsam, und es blieb bei seinem Entschluss.
Um zu entscheiden, wo sie sich niederlassen sollten, gingen sie alle Provinzen durch. Der Norden war fruchtbar, aber zu kalt; der Süden bezauberte durch sein Klima, war aber der Mücken wegen bedenklich. Und das Zentrum bot, offen gestanden, keinerlei Reiz. Die Bretagne hätte ihnen schon gefallen, wäre nicht die Frömmelei ihrer Bewohner gewesen. Die östlichen Gegenden kamen wegen ihres germanischen Dialekts nicht in Betracht. Doch es gab noch andere Landstriche. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Forez, dem Buguey oder dem Roumois? Die Landkarten gaben keinen Aufschluss. Ob ihr Haus hier oder dort stand, die Hauptsache war, dass sie eins hatten.
Schon sahen sie sich in Hemdsärmeln am Rand eines Beetes, die Rosenstöcke ausschneiden, die Erde umgraben, wenden, bearbeiten und Tulpen umpflanzen. Beim Gesang der Lerche würden sie wach werden, um dem Pflug zu folgen, würden Äpfel pflücken und zusehen, wie man Butter macht, das Korn drischt, die Schafe schert, die Bienenstöcke versorgt, würden sich über das Brüllen der Kühe und den Duft des Heues freuen. Keine Schreiberei und keine Vorgesetzten mehr, nicht einmal mehr Miete würden sie bezahlen! Sie würden ein eigenes Haus besitzen! Sie würden die Hühner ihres Geflügelhofs, das Gemüse aus ihren Gärten verzehren und beim Mittagessen die Holzschuhe nicht auszuziehen brauchen.
»Wir werden tun, was uns gefällt. Einen Bart werden wir uns wachsen lassen.«
Sie kauften zuerst Gartengeräte, dann einen Haufen Dinge, die ›vielleicht dienlich sein könnten‹, einen Werkzeugkasten – der in keinem Haus fehlen darf – eine Waage, eine Messkette, eine Badewanne für den Fall, dass sie krank würden, ein Thermometer und sogar ein Barometer ›System Gay-Lussac‹ für physikalische Experimente, wenn sie dazu die Lust anwandeln sollte. Da man nicht immer draußen arbeiten kann, wäre es vielleicht nicht übel, einige gute Bücher zu besitzen. Sie suchten danach und waren oft in großer Verlegenheit, denn sie wussten nicht, ob dieses oder jenes Buch wirklich ›ein Buch für eine Bibliothek‹ war. Bouvard entschied die Frage.
»Ach was, wir brauchen keine Bibliothek!«
»Ich habe ja meine«, sagte Pécuchet.
Im Voraus richteten sie sich ein. Bouvard sollte seine Möbel, Pécuchet seinen großen schwarzen Tisch mitnehmen; auch die Vorhänge würde man verwenden, und mit ein wenig Küchengerät wäre die Sache erledigt.
Sie hatten sich geschworen, über dies alles zu schweigen; aber ihre Gesichter strahlten. Ihren Kollegen kamen sie sonderbar vor. Bouvard lag beim Schreiben auf dem Pult, streckte die Ellbogen nach außen, um seine Rundschrift besser zu drechseln, und ließ sein seltsames Pfeifen hören, wobei er die schweren Augenlider schelmisch zusammenkniff. Pécuchet, der auf einem hohen Schemel hockte, verwandte besondere Sorgfalt auf die langen Grundstriche seiner steilen Schrift, blähte die Nasenflügel und kniff die Lippen zusammen, als fürchte er, sein Geheimnis zu verraten. Schon anderthalb Jahre suchten sie und hatten noch nichts gefunden. Sie unternahmen Reisen in die ganze Umgebung von Paris, von Amiens bis Evreux, von Fontainebleau bis Le Havre. Sie wollten eine ländliche Gegend, legten auf malerische Lage keinen großen Wert; doch stimmte sie ein beengter Horizont traurig.
Sie flohen die Nähe menschlicher Behausungen und hatten doch Furcht vor der Einsamkeit.
Manchmal waren sie entschlossen, dann aber fürchteten sie, später ihre Wahl zu bereuen und änderten ihre Meinung, da ihnen der Ort ungesund, dem Seewind ausgesetzt, zu nahe bei einer Fabrik oder zu schwer zugänglich erschien. Barberou erlöste sie.
Er kannte ihren Traum; und eines schönen Tages kam er zu ihnen und sagte, man habe ihm von einer Besitzung in Chavignolles, zwischen Caen und Falaise, erzählt. Das Gut bestand aus einem Pachthof von achtunddreißig Hektar, hatte eine Art Schloss und einen sehr ertragreichen Garten. Sie reisten ins Calvados und waren begeistert. Nur verlangte man für den Hof und das Haus (der eine sollte ohne das andere nicht verkauft werden) hundertdreiundvierzigtausend Francs. Bouvard wollte aber nicht mehr als hundertzwanzigtausend geben.
Pécuchet bekämpfte seinen Eigensinn, bat ihn, nachzugeben und erklärte schließlich, er wolle den Rest, bezahlen. Das war sein ganzes Vermögen, das aus seinem mütterlichen Erbe und seinen Ersparnissen stammte. Nie hatte er hierüber ein Wort verloren, denn er wollte dieses Kapital für besondere Fälle verwahren.
Gegen Ende des Jahres 1840, ein halbes Jahr vor seiner Pensionierung, wurde alles bezahlt.
Bouvard war nun kein Schreiber mehr. Zuerst war er seinem Beruf treu geblieben, da er der Zukunft nicht traute; aber dieses Misstrauen hatte er aufgegeben, als er der Erbschaft sicher war.
Doch ging er noch gern zu den Messieurs Descambos, und am Abend vor seiner Abreise lud er das ganze Büro zum Punsch ein.
Pécuchet dagegen war mürrisch gegen seine Kollegen, und als der letzte Tag gekommen war, ging er fort und knallte die Tür hinter sich zu.
Er musste das Einpacken überwachen, eine Menge Besorgungen machen, noch einkaufen und sich von Dumouchel verabschieden.
Der Professor schlug ihm einen Briefwechsel vor, durch den er ihn über Literatur auf dem Laufenden halten wollte; nochmals wünschte er ihm Glück und Wohlergehen.
Barberou zeigte mehr Gefühl, als Bouvard von ihm Abschied nahm. Er ließ eine Partie Domino im Stich, versprach, ihn zu besuchen, bestellte zwei Anisette und umarmte ihn.
Zu Hause trat Bouvard auf den Balkon, holte tief Atem und sagte: »Endlich!«
Die Lichter der Kais zitterten im Wasser, in der Ferne verklang das Rollen der Omnibusse. Er dachte an die glücklichen Tage, die er in der Stadt verbracht hatte, an das Tafeln im Restaurant, die Abende im Theater, das Geschwätz der Portiersfrau, an alle seine Gewohnheiten; er fühlte, wie ihm schwach ums Herz wurde, wie Traurigkeit ihn befiel, die er sich nicht eingestehen wollte.
Pécuchet ging bis zwei Uhr morgens in seinem Zimmer auf und ab. Hierher würde er nicht wieder zurückkommen! Umso besser! Aber er wollte ein Andenken hinterlassen und kritzelte seinen Namen in den Gips des Kamins.
Die großen Stücke waren schon am Abend vorher abgegangen. Die Gartengeräte, die Bettstellen, die Matratzen, die Tische und Stühle, ein Sparherd, die Badewanne und drei Fass Burgunder sollten auf der Seine nach Le Havre und von dort nach Caen geschickt werden, wo Bouvard sie in Empfang nehmen und nach Chavignolles weiterbefördern lassen sollte.
Aber das Bild seines Vaters, die Sessel, der Kasten mit den Likörflaschen und Gläsern, die Bücher, die Uhr, alle wertvollen Gegenstände, wurden in einen Möbelwagen gepackt, der über Nonancourt, Verneuil und Falaise fahren sollte. Pécuchet wollte ihn begleiten.
Er setzte sich neben den Kutscher auf den Bock und verließ in seinem ältesten Gehrock, mit einem Halstuch, Fausthandschuhen und seinem Fußsack aus dem Büro am Sonntag, dem 20. März., in aller Frühe die Hauptstadt.
Die Bewegung und das Ungewohnte der Reise füllten die ersten Stunden aus. Dann gingen die Pferde langsamer, was zu allerlei Auseinandersetzungen mit dem Wagenführer und dem Fuhrmann führte. Sie suchten ganz erbärmliche Herbergen auf, und obwohl sie für alles verantwortlich waren, schlief Pécuchet aus übergroßer Vorsicht doch mit ihnen in denselben Schenken.
Kaum graute der Tag, fuhren sie weiter. Die immer gleiche Straße zog sich steigend bis an den Rand des Horizonts. Ein Steinhaufen folgte dem anderen, die Gräben waren voll Wasser, in großen Flächen von eintönigem und kaltem Grün lag das Gelände da. Wolken jagten am Himmel und von Zeit zu Zeit regnete es. Am dritten Tag wurde es windig. Die Wagendecke, die schlecht befestigt war, klatschte wie das Segel eines Schiffes. Pécuchet neigte das Gesicht unter der Mütze und musste sich jedes Mal, wenn er die Schnupftabakdose öffnete, ganz umdrehen, um die Augen zu schützen. Wurde der Weg holprig, hörte er hinter sich das Gepäck gegeneinanderstoßen und ließ es nicht an Ermahnungen fehlen. Als er sah, dass das nichts nutzte, versuchte er es auf andere Weise: Er spielte den Liebenswürdigen, war voller Gefälligkeit; wurde der Weg zu steil, schob er mit den Männern am Rad; er spendierte ihnen sogar nach dem Essen den Kaffee mit Kognak. Jetzt ging es schneller; aber in der Nähe von Gauburge brach die Achse und der Wagen neigte sich auf die Seite. Pécuchet untersuchte gleich das Innere: Die Porzellantassen lagen in Scherben. Er hob die Arme, knirschte mit den Zähnen, verfluchte die beiden Tölpel. Der folgende Tag ging verloren, weil der Fuhrmann sich betrank. Pécuchet aber konnte nicht mehr klagen; der Kelch des Leidens war voll bis zum Rand.
Bouvard, der noch einmal mit Barberou zusammen essen wollte, hatte erst am übernächsten Tag Paris verlassen. Im letzten Augenblick kam er in der Posthalterei an; erst vor der Kathedrale in Rouen wurde er wieder wach – er war in den falschen Postwagen gestiegen.
Am Abend waren alle Plätze nach Caen vergeben; da er nicht wusste, was er anfangen sollte, ging er in das Theâtre des Arts, lächelte seinen Nachbarn zu und erzählte ihnen, er habe sich vom Handel zurückgezogen und kürzlich in der Umgebung ein Gut gekauft. Als er am Freitag in Caen ankam, waren seine Sachen noch nicht da. Er bekam sie am Sonntag und beförderte sie auf einem Bauernwagen weiter; dem Pächter ließ er sagen, er käme in einigen Stunden nach.
Am neunten Tag seiner Reise mietete Pécuchet in Falaise zur Verstärkung noch ein Pferd, und bis Sonnenuntergang kam man gut voran. Hinter Bretteville verließ er die Landstraße, schlug einen Seitenweg ein, da er meinte, er müsse in jedem Augenblick die Giebel von Chavignolles sehen. Aber die Wagenspuren wurden undeutlicher, verschwanden, und sie befanden sich mitten auf gepflügten Feldern. Die Nacht brach an. Was tun? Schließlich verließ Pécuchet den Wagen und machte sich durch den Schlamm watend auf die Suche. Wenn er den Bauernhöfen näher kam, bellten die Hunde. Er schrie aus Leibeskräften, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Keine Antwort. Er bekam Furcht und lief davon. Plötzlich leuchteten zwei Laternen. Er sah ein Cabriolet, lief darauf zu, und Bouvard saß darin.
Aber wo war der Möbelwagen geblieben? Eine Stunde lang riefen sie in der Dunkelheit. Endlich fand er sich ein, und sie gelangten nach Chavignolles.
Ein mächtiges Feuer aus Reisig und Tannenzapfen brannte im Saal. Zwei Gedecke waren aufgelegt. Die Möbel, die mit dem Karren angekommen waren, füllten die Vorhalle.
Nichts fehlte, und sie setzten sich zu Tisch.
Man hatte für sie eine Zwiebelsuppe, ein Huhn, Speck und harte Eier zubereitet. Die alte Frau, die die Küche versorgte, kam von Zeit zu Zeit, um sich zu erkundigen, wie es ihnen schmecke. Sie antworteten: ›Sehr gut, sehr gut.‹ Das grobe Brot, das sich nur schwer schneiden ließ, die Sahne, die Nüsse, alles schmeckte ihnen herrlich.
Die Fliesen des Fußbodens zeigten Löcher, die Wände waren feucht. Dennoch blickten sie voll Zufriedenheit um sich, aßen an dem kleinen Tisch, auf dem eine Kerze brannte. Ihre Gesichter waren von der frischen Luft gerötet. Sie streckten die Bäuche vor, lehnten sich gegen die Rückenlehnen ihrer knarrenden Stühle und sagten immer wieder: »Nun sind wir also hier! Welches Glück! Es ist ein Traum.«
Obgleich es Mitternacht war, kam Pécuchet auf den Gedanken, einen Gang durch den Garten zu machen. Bouvard hatte nichts dagegen. Sie nahmen die Kerze, schützten sie mit einer alten Zeitung und gingen an den Beeten entlang.
Es machte ihnen Spaß, das Gemüse laut beim Namen zu nennen: »Sieh, Karotten! Ach, Kohl!«
Dann besahen sie die Spaliere. Pécuchet versuchte, Knospen zu entdecken. Ab und zu lief eine Spinne über die Mauer, und der vergrößerte Schatten wiederholte ihre Bewegungen. Von den Spitzen der Gräser tropfte der Tau; die Nacht war pechschwarz, und alles verharrte unbeweglich im großen Schweigen tiefen Wohlbehagens.
In der Ferne krähte ein Hahn.
Ihre beiden Zimmer hatten eine kleine Verbindungstür hinter der Tapete. Mit der Kommode war man gegen sie gestoßen, und die Nägel hatten sich gelöst. Sie fanden die Tür weit offen stehen. Welch eine Überraschung!
Als sie sich ausgezogen und zu Bett gelegt hatten, plauderten sie noch einige Zeit und schliefen dann ein: Bouvard auf dem Rücken, mit offenem Mund und barhäuptig; Pécuchet auf der rechten Seite, mit hochgezogenen Knien und einer baumwollenen Mütze auf dem Kopf.
Und beide schnarchten im Schein des Mondes, der durch die Fenster fiel.
II
Welche Freude, als sie am nächsten Morgen erwachten! Bouvard rauchte eine Pfeife, Pécuchet nahm eine Prise, und jeder behauptete, es sei die beste seines Lebens. Dann stützten sie sich auf die Fensterbank und betrachteten die Landschaft.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!