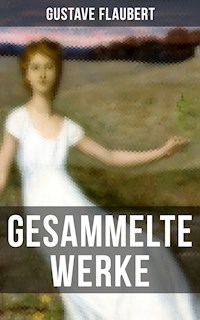Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gustave Flauberts hinreißendes Drama und seine Heldin sind zum Skandal und Mythos geworden: Emma Bovary lebt in der Provinz und träumt von großer Leidenschaft, großer Liebe und großem Leben. Gelangweilt von ihrer Ehe mit dem Landarzt Charles, sucht sie die ersehnten Erregungen bald im Ehebruch, doch sie scheitert an ihrem Verlangen und ihrer Umwelt. Als das Buch 1857 in Frankreich erschien, wurde Flaubert wegen „Unmoral“ der Prozess gemacht. Zugleich begann „Madame Bovarys“ Ruhm als der vollkommenste Roman der Geschichte und Gründungsroman der literarischen Moderne. Elisabeth Edl hat eine Neuübersetzung geschaffen, die zeigt, worin Flauberts unvergleichliche Modernität liegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 961
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Gustave Flaubert
MADAME BOVARY
Sitten in der Provinz
Herausgegeben und übersetzt
von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die Übersetzung wurde gefördert vom
Deutschen Literaturfonds e. V.
ISBN 978-3-446-24070-4
© 2012 Carl Hanser Verlag München
Alle Rechte vorbehalten
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
INHALT
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Die Staatsanwaltschaft gegen Gustave Flaubert
ANHANG
Nachwort
Zur Ausgabe
Zu Sprache und Übersetzung
Die Streichungen der Revue de Paris
Charles Baudelaire: Madame Bovary
Zeittafel zur Biographie
Anmerkungen
Für
Marie-Antoine-Jules Senard
Mitglied der Anwaltskammer zu Paris
ehemaliger Präsident der Nationalversammlung
und vormaliger Innenminister
Teurer und erlauchter Freund,
gestatten Sie mir, Ihren Namen an den Anfang dieses
Buches und sogar noch vor die Widmung zu stellen;
denn Ihnen im besonderen verdanke ich seine
Veröffentlichung. Durch Ihr grandioses Plädoyer hat
mein Werk für mich selbst so etwas wie eine unverhoffte Autorität erlangt. Nehmen Sie darum hier den
Ausdruck meiner Dankbarkeit entgegen, die,
so groß sie auch sein mag, Ihrer Eloquenz und
Ihrer Hingabe niemals gerecht wird.
GUSTAVE FLAUBERT
Paris, den 12. April 1857
Anmerkungen
Für
Louis Bouilhet
ERSTER TEIL
I.
Wir saßen im Arbeitssaal, als der Direktor hereintrat, gefolgt von einem Neuen in bürgerlichem Aufzug und einem Schuldiener, der ein großes Pult schleppte. Wer geschlafen hatte, erwachte, und jeder sprang hoch, wie aufgeschreckt beim Lernen.
Der Direktor gab ein Zeichen, wir sollten uns wieder setzen; dann wandte er sich an den Hilfslehrer:
»Monsieur Roger«, sagte er halblaut, »ich lege Ihnen diesen Schüler ans Herz, er kommt in die Quinta. Sind Fleiß und Betragen lobenswert, bleibt er bei den Großen, wo er dem Alter nach hingehört.«
Der Neue, im Winkel hinter der Tür stehengeblieben, so dass man ihn kaum sah, war ein Bursche vom Land, etwa fünfzehn und größer als irgendeiner von uns. Seine Haare waren auf der Stirn gerade abgeschnitten, wie bei einem Dorfkantor, er wirkte brav und sehr verlegen. Obwohl er keine breiten Schultern hatte, schien die Joppe aus grünem Tuch und mit schwarzen Knöpfen unterm Arm zu spannen, und durch die Schlitze an den Aufschlägen sah man rote Handgelenke, die es gewohnt waren, nackt zu sein. Die blaubestrumpften Beine steckten in einer gelblichen, von Trägern stramm hinaufgezogenen Hose. Er trug grobe, schlecht gewichste Nagelschuhe.
Nun begann das Abfragen des Stoffs. Er lauschte mit gespitzten Ohren, aufmerksam wie bei der Predigt, wagte nicht einmal die Schenkel übereinanderzuschlagen oder den Ellbogen aufzustützen, und um zwei, als die Glocke läutete, musste der Hilfslehrer ihn ermahnen, damit er sich mit uns in Reih und Glied stellte.
Wir hatten die Gewohnheit, beim Betreten des Klassenzimmers unsere Mützen auf den Boden zu werfen, um die Hände frei zu haben; bereits auf der Türschwelle musste man sie so unter die Bank schleudern, dass sie gegen die Mauer knallten und viel Staub aufwirbelten; das war inMode.
Doch entweder war ihm der Trick nicht aufgefallen, oder er hatte sich nicht getraut mitzumachen, jedenfalls war das Gebet zu Ende und der Neue hielt seine Mütze noch immer auf dem Schoß. Es handelte sich um eine jener Kopfbedeckungen gemischter Natur, welche Elemente der Pelzkappe, der Tschapka, des runden Huts, der Otterfellkappe und der Zipfelmütze in sich vereinte, ja, um eines jener armseligen Dinger, deren stumme Hässlichkeit die gleiche ausdrucksvolle Tiefe besitzt wie das Gesicht eines Idioten. Eiförmig und durch Fischbeinstäbchen gewölbt, begann sie mit einem dreifachen Wurstring; dann kamen abwechselnd, durch ein rotes Band getrennt, Rauten aus Samt und Kaninchenfell; hierauf folgte eine Art Sack, der in einem pappverstärkten, mit kunstvoll gesticktem Litzenbesatz verzierten Vieleck endete, und daran baumelte, als Abschluss einer langen, allzu dünnen Kordel, ein kleines Goldfadenknäuel in Form einer Eichel. Die Mütze war neu; der Schirm glänzte.
»Stehen Sie auf«, sagte der Lehrer.
Er stand auf; seine Mütze fiel zu Boden. Die ganze Klasse lachte.
Er bückte sich, um sie aufzuheben. Ein Banknachbar stieß ihn mit dem Ellbogen, sie fiel ein zweites Mal, wieder las er sie auf.
»Legen Sie doch Ihren Helm ab«, sagte der Lehrer, denn er war ein geistreicher Mann.
Die Schüler brachen in schallendes Gelächter aus, was den armen Kerl so verwirrte, dass er nicht wusste, ob er seine Mütze in der Hand behalten sollte, auf dem Boden lassen oder aufsetzen. Er nahm wieder Platz und legte sie in den Schoß.
»Stehen Sie auf«, verlangte der Lehrer noch einmal, »und sagen Sie mir Ihren Namen.«
Der Neue nuschelte einen unverständlichen Namen.
»Noch einmal!«
Das gleiche Silbengenuschel war zu hören, übertönt vom Johlen der Klasse.
»Lauter!« schrie der Lehrer, »lauter!«
Da fasste sich der Neue ein Herz, riss den Mund sperrangelweit auf und brüllte, als riefe er jemanden, aus vollem Hals das Wort: Schahbovarie.
Sogleich erhob sich ein Heidenlärm, schwoll an im crescendo, mit schrillen Tönen (man kreischte, jaulte, trampelte, wiederholte: Schahbovarie! Schahbovarie!), grollte in vereinzelten Noten weiter, legte sich nur mühsam und brauste in einer Bankreihe immer wieder plötzlich auf, wenn hier und dort, wie ein schlecht gelöschter Knallfrosch, ersticktes Lachen hervorsprang.
Unter dem Hagel von Strafarbeiten kehrte jedoch langsam Ordnung ein in der Klasse, und als der Lehrer endlich den Namen Charles Bovary verstand, nachdem er ihn sich hatte diktieren lassen, buchstabieren und repetieren, befahl er dem armen Teufel stante pede, sich in die Eselsbank zu setzen, gleich vor den Katheder. Der gab sich einen Ruck, zögerte jedoch, bevor er losging.
»Was suchen Sie?« fragte der Lehrer.
»Meine Mü…«, antwortete zaghaft der Neue mit ängstlich wanderndem Blick.
»Fünfhundert Verse, die ganze Klasse!« mit zorniger Stimme gerufen, unterdrückte, wie das Quos ego, einen neuerlichen Sturm. »Geben Sie doch Frieden!« fuhr der aufgebrachte Lehrer fort und wischte sich die Stirn mit einem Taschentuch, das er aus seiner Kappe gezogen hatte: »Und Sie, Neuer, Sie schreiben mir zwanzigmal das Verb ridiculus sum.«
Dann, mit sanfterer Stimme:
»Na! Die finden Sie schon wieder, Ihre Mütze; die ist nicht gestohlen!«
Alles wurde ruhig. Die Köpfe beugten sich über Schulmappen, und der Neue saß zwei Stunden in beispielhafter Haltung, obwohl von Zeit zu Zeit das eine oder andere Papierkügelchen aus einer Federspitze geflogen kam und auf sein Gesicht klatschte. Doch er wischte sich mit der Hand ab und verharrte reglos, den Blick gesenkt.
Am Abend, im Arbeitssaal, zog er seine Ärmelschoner aus dem Pult, brachte seine Siebensachen in Ordnung, linierte sorgfältig sein Papier. Wir sahen, wie er gewissenhaft lernte, alle Vokabeln im Wörterbuch nachschlug und sich große Mühe gab. Dem guten Willen, den er an den Tag legte, hatte er es wohl zu verdanken, dass er nicht in die niedrigere Klasse abstieg; denn auch wenn er die Regeln leidlich beherrschte, fehlte ihm doch jede Eleganz im Ausdruck. Der Pfarrer seines Dorfes hatte ihm Grundkenntnisse in Latein beigebracht, da seine Eltern ihn aus Sparsamkeit erst möglichst spät auf die Schule schicken wollten.
Sein Vater, Monsieur Charles-Denis-Bartholomé Bovary, ehemaliger Hilfschirurg der Armee, um 1812 in eine Affäre bei Truppenaushebungen verstrickt und um dieselbe Zeit gezwungen, den Dienst zu quittieren, hatte sich damals seine persönlichen Vorzüge zunutze gemacht, um nebenbei eine Mitgift von sechzigtausend Franc einzustreichen, die sich in Gestalt der Tochter eines Wirk- und Strickwarenhändlers darbot, denn diese hatte sich in seine elegante Erscheinung verliebt. Ein stattlicher Mann, Angeber mit laut klirrenden Sporen, einem Backenbart, der in den Schnauzer überging, stets glitzernde Ringe an den Fingern und in auffällige Farben gekleidet, wirkte er wie ein kühner Recke mit der aufgeräumten Laune eines Handlungsreisenden. Nach der Heirat lebte er zwei oder drei Jahre vom Vermögen seiner Frau, dinierte gut, erhob sich spät, rauchte aus großen Porzellanpfeifen, ging abends erst nach dem Theater heim und besuchte regelmäßig Kaffeehäuser. Der Schwiegervater starb und hinterließ wenig; er war empört, stürzte sich ins Geschäft, verlor ein bisschen Geld und zog sich zurück aufs Land, das er bewirtschaften wollte. Da er von Ackerbau jedoch genauso wenig verstand wie von bedruckten Baumwollstoffen, seine Pferde ritt, anstatt sie zum Pflügen aufs Feld zu schicken, seinen Apfelwein flaschenweise trank, anstatt ihn fassweise zu verkaufen, das schönste Geflügel auf seinem Hof verspeiste und die Jagdstiefel mit dem Speck seiner Schweine einfettete, merkte er bald, dass es besser war, Schluss zu machen mit dem Spekulieren.
Für zweihundert Franc Miete jährlich fand er in einem Dorf, an der Grenze zwischen Pays de Cau und Picardie, eine Bleibe, halb Bauernhof, halb Gutshaus; und griesgrämig, von Reue geplagt, den Himmel verklagend, neidisch auf alle Welt, igelte er sich mit fünfundvierzig Jahren ein, angewidert von den Menschen, sagte er, und entschlossen, in Frieden zu leben.
Seine Frau war dereinst nach ihm verrückt gewesen; sie hatte ihn geliebt mit tausend Unterwürfigkeiten, die ihn noch stärker von ihr entfernt hatten. Früher einmal fröhlich, offenherzig und liebevoll, war sie mit zunehmendem Alter (so wie abgestandener Wein zu Essig) unverträglich geworden, zänkisch, nervös. Zuerst hatte sie viel gelitten, ohne zu klagen, wenn sie ihn allen Dorfschlampen hinterherlaufen sah und die zahllosen Spelunken ihn ihr abends zurückschickten, stumpf und stinkend vom Suff! Dann hatte ihr Stolz rebelliert. Von nun an hatte sie geschwiegen, ihre Wut heruntergeschluckt mit stummem Gleichmut, und den bewahrte sie bis zu seinem Tod. Sie war ständig unterwegs, geschäftig. Sie lief zu den Anwälten, zum Gerichtspräsidenten, wusste stets, wann ein Wechsel fällig war, erwirkte Aufschübe; und zu Hause bügelte sie, nähte, wusch, überwachte die Arbeiter, zahlte die Rechnungen, während Monsieur, der sich um nichts scherte, der immerzu in schmollender Trägheit dahindämmerte und bloß erwachte, um ihr etwas Unfreundliches zu sagen, rauchend vor dem Kaminfeuer saß und in die Asche spuckte.
Als sie ein Kind bekam, musste es zu einer Amme gegeben werden. Wieder bei ihnen zu Hause, wurde der Bengel verwöhnt wie ein Prinz. Seine Mutter fütterte ihn mit eingemachtem Obst, sein Vater ließ ihn barfuß laufen und sagte sogar, um den Philosophen zu spielen, er könne genausogut nackt bleiben wie Tierkinder. In Widerspruch zu den mütterlichen Neigungen hatte er ein männliches Kindheitsideal im Kopf, nach dem er seinen Sohn zu erziehen trachtete, er wollte ihn hart anfassen, mit spartanischer Strenge, um seine Konstitution zu kräftigen. Er schickte ihn ohne Feuer zu Bett, brachte ihm bei, Rum in großen Schlucken zu trinken und Prozessionen zu beschimpfen. Da der Kleine aber von Natur aus friedfertig war, schlugen seine Bemühungen fehl. Die Mutter schleppte ihn ständig mit sich herum; sie bastelte ihm Pappfiguren, erzählte ihm Geschichten, unterhielt sich mit ihm in endlosen Monologen voll melancholischer Scherze und plappernder Schmeicheleien. In der Einsamkeit ihres Lebens übertrug sie auf das Haupt dieses Kindes all ihre verflogenen, zu Bruch gegangenen Wünsche. Sie träumte von hohen Stellungen, sah ihn groß, schön, geistreich, gutbestallt, im Brücken- und Straßenbauwesen oder im Richteramt. Sie brachte ihm Lesen bei und sang mit ihm an einem alten Klavier sogar zwei oder drei kleine Liebeslieder. Doch Monsieur Bovary, der nichts übrig hatte für Literatur, sagte zu all dem, es sei die Mühe nicht wert! Würden sie jemals genug Geld haben, um ihm die staatlichen Schulen zu bezahlen, ein Amt zu kaufen oder ein Geschäft? Außerdem, mit Frechheit kommt ein Mann in der Welt immer nach oben. Madame Bovary biss sich auf die Lippen, und der Junge strolchte durchs Dorf.
Er lief den Ackersleuten hinterher und warf Erdklumpen nach den Raben, die davonflogen. Er aß Brombeeren an den Straßengräben, hütete mit einem langen Stock die Puter, half beim Heuwenden, rannte durch den Wald, spielte an Regentagen unterm Kirchenportal Himmel und Hölle und bettelte an hohen Festtagen, bis der Kirchdiener ihn die Glocken läuten ließ, so dass er sich mit dem ganzen Körper an das lange Seil hängen konnte und vom ihm hochgezogen wurde in seinem Schwung.
So wuchs er wie eine Eiche. Er hatte jetzt kräftige Hände, gesunde Farben.
Als er zwölf war, erreichte seine Mutter, dass er Unterricht bekam. Er wurde dem Pfarrer anvertraut. Aber die Stunden waren so kurz und unregelmäßig, dass sie kaum etwas nützten. Sie wurden in der Sakristei abgehalten, wann gerade Zeit war, im Stehen, flüchtig, zwischen Taufe und Begräbnis; oder der Pfarrer ließ seinen Schüler nach dem Angelus holen, wenn er nicht mehr aus dem Haus musste. Sie gingen hinauf in sein Zimmer, setzten sich: Mücken und Nachtfalter umflatterten die Kerze. Es war heiß, das Kind schlief ein; und der gute Mann döste vor sich hin, die Hände überm Bauch gefaltet, und schnarchte bald mit offenem Mund. Ein andermal, wenn der Herr Pfarrer auf dem Heimweg von einem Kranken in der Umgebung, dem er die Letzte Ölung gespendet hatte, Charles über die Felder streunen sah, dann rief er ihn zu sich, tadelte ihn eine Viertelstunde, nutzte die Gelegenheit und ließ ihn unter einem Baum Verben konjugieren. Der Regen unterbrach sie oder ein Bekannter, der vorüberkam. Ansonsten war er stets mit ihm zufrieden, sagte sogar, der junge Mann besitze ein gutes Gedächtnis.
So konnte es nicht weitergehen mit Charles. Madame wurde energisch. Weil er sich schämte oder weil er kapitulierte, gab Monsieur widerstandslos nach, und man wartete noch das eine Jahr, bis der Junge die Erstkommunion hinter sich hatte.
Nochmals vergingen sechs Monate; und im folgenden Jahr wurde Charles endgültig aufs Collège nach Rouen geschickt, wo sein Vater ihn persönlich gegen Ende Oktober hinbrachte, um die Zeit des Romanus-Marktes.
Heute wäre es keinem von uns mehr möglich, sich auch nur im geringsten an ihn zu erinnern. Er war ein Bursche mit ausgeglichenem Temperament, der in den Pausen spielte, im Arbeitssaal lernte, im Unterricht zuhörte, im Schlafsaal gut schlief, im Speisesaal gut aß. Seine Vertrauensperson am Ort war ein Eisenwarengrossist aus der Rue Ganterie, der ihn einmal im Monat abholte, sonntags, wenn sein Laden geschlossen war, ihn auf einen Spaziergang zum Hafen schickte, die Schiffe anschauen, und gegen sieben ins Collège zurückbrachte, noch vor dem Essen. Jeden Donnerstagabend schrieb er einen langen Brief an seine Mutter, mit roter Tinte und drei Siegeloblaten; dann sah er seine Geschichtshefte noch einmal durch oder las in einem alten Band des Anacharsis, der im Arbeitssaal herumlag. Bei den Spaziergängen redete er mit dem Diener, der vom Land kam wie er.
Durch beständigen Fleiß hielt er sich stets im Klassenmittel; einmal bekam er sogar ein erstes Accessit in Naturgeschichte. Doch am Ende der Tertia nahmen seine Eltern ihn vom Collège, damit er Medizin studiere, überzeugt, er könne es allein schaffen bis zum Bakkalaureat.
Seine Mutter mietete ihm ein Zimmer, im vierten Stock, über der Eau-de-Robec, bei einem Färber aus ihrer Bekanntschaft. Sie verhandelte Kost und Logis, besorgte Möbel, einen Tisch und zwei Stühle, ließ von zu Hause ein altes Bett aus Kirschbaumholz kommen und kaufte außerdem ein gusseisernes Öfchen, nebst dem Holzvorrat, der ihr armes Kind wärmen sollte. Am Ende der Woche fuhr sie weg, nach tausend Ermahnungen, sich anständig aufzuführen, denn jetzt war er sich selbst überlassen.
Das Verzeichnis der Vorlesungen, das er am Anschlagbrett las, machte ihn schwindlig: Vorlesung in Anatomie, Vorlesung in Pathologie, Vorlesung in Physiologie, Vorlesung in Pharmazie, Vorlesung in Chemie und dazu noch Botanik und Klinik und Therapeutik, ganz zu schweigen von Hygiene und Arzneimittelkunde, lauter Namen, deren Etymologien er nicht kannte und die vor ihm aufragten wie Tore zu Heiligtümern voll erhabener Finsternis.
Er begriff nichts; auch wenn er noch so aufmerksam zuhörte, er verstand kaum etwas. Obwohl er lernte, Hefte mit schönem Umschlag besaß, alle Vorlesungen besuchte, keine einzige Visite versäumte. Sein tägliches kleines Pensum erfüllte er wie ein Dressurpferd, das mit verbundenen Augen im Kreis läuft und nicht weiß, welche Arbeit es da verrichtet.
Um Ausgaben zu vermeiden, schickte ihm seine Mutter jede Woche mit dem Boten ein Stück Kalbsbraten aus dem Rohr, den er am Morgen aß, wenn er vom Hospital kam, und zum Aufwärmen stampfte er mit den Füßen gegen die Wand. Anschließend musste er in den Unterricht laufen, in den Hörsaal, ins Hospiz und hinterher durch all die Straßen wieder zurück. Abends, nach dem kärglichen Essen bei seinem Vermieter, ging er hinauf in sein Zimmer und setzte sich nochmal ans Lernen, in feuchten Kleidern, die vor dem glühenden Ofen an seinem Körper dampften.
An schönen Sommerabenden, wenn die lauen Straßen verlassen sind und Dienstmägde vor den Haustüren Federball spielen, öffnete er sein Fenster und lehnte sich hinaus. Der Fluss, der aus diesem Viertel von Rouen ein widerwärtiges kleines Venedig macht, strömte tief unter ihm, gelb, violett oder blau, zwischen seinen Brücken und seinen Rechen. Arbeiter hockten am Ufer und wuschen sich die Arme im Wasser. An Stangen, die oben aus den Speichern ragten, trockneten Stränge Baumwollgarn in der Luft. Gegenüber, jenseits der Dächer, erstreckte sich der weite klare Himmel, mit der untergehenden roten Sonne. Wie angenehm es dort sein musste! Wie kühl im Buchenhain! Und er blähte die Nüstern, um die ländlichen Wohlgerüche einzuatmen, die nicht bis zu ihm drangen.
Er magerte ab, wurde größer, und sein Gesicht bekam einen leidenden Ausdruck, der machte es fast interessant.
Ganz unabsichtlich, aus Nachlässigkeit, löste er sich mit der Zeit von all den guten Vorsätzen, die er gefasst hatte. Einmal versäumte er die Visite, am nächsten Tag die Vorlesung, und da er das Faulenzen genoss, ging er schließlich überhaupt nicht mehr hin.
Er gewöhnte sich an, im Wirtshaus zu sitzen, und spielte mit Leidenschaft Domino. Jeden Abend in einem schmutzigen öffentlichen Lokal zu verbringen und dort kleine, mit schwarzen Punkten bemalte Schafsknochen auf Marmortische zu knallen schien ihm ein kostbarer Beweis seiner Freiheit und steigerte seine Selbstachtung. Es war eine Art Einführung in die Welt, der Zugang zu verbotenen Freuden; und wenn er beim Eintreten die Hand auf den Türknauf legte, spürte er fast sinnliche Lust. Viele in ihm unterdrückte Dinge entfalteten sich nun; er lernte Couplets auswendig, die er bei Festgelagen sang, begeisterte sich für Béranger, konnte Punsch zubereiten und erlebte endlich die Liebe.
Dank dieser Vorarbeiten fiel er mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung zum Sanitätsbeamten. Am Abend desselben Tages erwartete man ihn zu Hause und wollte seinen Erfolg feiern!
Er machte sich zu Fuß auf den Weg und ging nur bis zum Dorfeingang, ließ seine Mutter holen, erzählte ihr alles. Sie fand Ausreden, wälzte die Schuld für sein Scheitern auf die ungerechten Prüfer und stärkte ihn ein wenig, indem sie versprach, die Sache in Ordnung zu bringen. Erst fünf Jahre später erfuhr Monsieur Bovary die Wahrheit; sie war alt, er nahm sie hin, denn er konnte sich auch gar nicht vorstellen, sein Fleisch und Blut sei ein Dummkopf.
Charles machte sich also wieder ans Lernen und bereitete ohne Unterlass seine Prüfungsfächer vor, indem er alle Fragen vorab auswendig lernte. Er bestand mit einer recht guten Note. So ein schöner Tag für seine Mutter! Man lud zu einem großen Essen.
Wo sollte er seine Kunst ausüben? In Tostes. Dort gab es nur einen alten Arzt. Lange schon wartete Madame Bovary auf seinen Tod, und der gute Mann war noch nicht abgetreten, da hatte Charles sich bereits auf der anderen Straßenseite niedergelassen, als Nachfolger.
Doch es war nicht genug, dass sie ihren Sohn großgezogen, ihm das medizinische Studium ermöglicht und Tostes als Wirkungsstätte entdeckt hatte: Er brauchte eine Frau. Sie fand ihm eine: die Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe, die fünfundvierzig Jahre zählte und Einkünfte von zwölfhundert Livre.
Obwohl hässlich, dürr wie ein Reisigbündel und voll knospender Pickel wie ein Frühlingsstrauch, fehlte es Madame Dubuc nicht an Bewerbern. Um ans Ziel zu gelangen, musste Madame Bovary alle anderen ausstechen, ja, sie durchkreuzte sogar äußerst geschickt die Intrigen eines Metzgers, den die Priesterschaft unterstützte.
Charles hatte von der Ehe den Beginn eines besseren Lebens erhofft, geglaubt, er werde freier sein und könne über sich und sein Geld verfügen. Doch seine Frau war Herr im Haus; in Gesellschaft durfte er dies sagen und jenes nicht, er musste freitags fasten, sich kleiden, wie sie es wollte, auf ihre Anordnung hin Patienten drängen, die nicht bezahlten. Sie öffnete seine Briefe, spionierte ihm hinterher und lauschte an der Trennwand, wenn er in seinem Arbeitszimmer Sprechstunde hielt und Frauen kamen.
Sie verlangte jeden Morgen ihre Schokolade, Rücksicht ohne Ende. Ständig jammerte sie über ihre Nerven, ihre Brust, ihre Gemütszustände. Das Geräusch von Schritten tat ihr weh; ging man fort, wurde die Einsamkeit ihr unerträglich; kehrte man zurück, war es doch nur, um sie sterben zu sehen. Abends, wenn Charles nach Hause kam, streckte sie ihre langen, mageren Arme unter den Laken hervor, schlang sie um seinen Hals, zwang ihn, sich auf den Bettrand zu setzen, und klagte ihr Leid: Er vernachlässigte sie, er liebte eine andere! Man hatte ihr ja vorausgesagt, dass sie unglücklich würde; und am Ende bat sie um irgendeinen Saft für die Gesundheit und ein bisschen mehr Liebe.
Anmerkungen
II.
Eines Nachts, gegen elf, wurden sie vom Hufschlag eines Pferdes geweckt, das genau vor ihrer Tür stehenblieb. Das Dienstmädchen öffnete die Dachluke und verhandelte eine Weile mit dem Mann, der unten auf der Straße wartete. Er kam den Arzt holen; er hatte einen Brief. Nastasie ging vor Kälte zitternd die Treppe hinunter und öffnete Schloss und Riegel, eins nach dem anderen. Der Mann ließ sein Pferd stehen, folgte dem Dienstmädchen und trat plötzlich hinter ihr ins Schlafzimmer. Aus seiner Wollmütze mit grauen Quasten zog er ein Schreiben hervor, das in ein Tuch gewickelt war, und überreichte es taktvoll Charles, der sich zum Lesen auf sein Kopfkissen stützte. Nastasie stand neben dem Bett und hielt das Licht. Madame hatte sich aus Schamhaftigkeit zur Wand gedreht und zeigte den Rücken.
Dieses Schreiben, versiegelt mit einem kleinen Siegel aus blauem Wachs, ersuchte Monsieur Bovary inständig, sofort auf das Gehöft Les Bertaux zu kommen, um ein gebrochenes Bein einzurichten. Nun sind es aber von Tostes nach Les Bertaux gut sechs Meilen, über Longueville und Saint-Victor. Die Nacht war tiefschwarz. Die junge Madame Bovary hatte Angst, ihrem Mann könnte etwas zustoßen. Also wurde beschlossen, der Stallknecht solle vorausreiten. Charles würde drei Stunden später aufbrechen, sobald der Mond am Himmel stand. Man würde ihm einen Jungen entgegenschicken, der ihn zum Gehöft führen und die Umzäunungen öffnen sollte.
Gegen vier Uhr morgens machte sich Charles, gut eingewickelt in seinen Mantel, auf nach Les Bertaux. Noch ganz benommen von der Wärme des Schlafes, ließ er sich wiegen im ruhigen Trab seines Tieres. Wenn es von allein stehenblieb vor den mit Dornbüschen umwachsenen Löchern, die man entlang der Ackerfurchen gräbt, schreckte Charles hoch, erinnerte sich schnell an das gebrochene Bein und versuchte sich alle Brüche, die er kannte, wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es hatte aufgehört zu regnen; langsam wurde es Tag, und auf den Zweigen der kahlen Apfelbäume saßen reglos Vögel und plusterten ihre kleinen Federn im kalten Morgenwind. Das flache Land erstreckte sich ins Unendliche, und die Baumgruppen rund um die Gehöfte bildeten, in großen Abständen, schwarzviolette Flecken auf dieser weiten grauen Fläche, die sich am Horizont in der Trübnis des Himmels verlor. Von Zeit zu Zeit öffnete Charles die Augen; weil aber sein Geist ermüdete und die Schläfrigkeit von allein zurückkam, verfiel er bald wieder in ein Dösen, wo jüngste Eindrücke verschmolzen mit Erinnerungen und er sich doppelt wahrnahm, als Student und als verheirateter Mann, in seinem Bett liegend wie vorhin, durch einen Saal mit Operierten schreitend wie einst. Der warme Geruch von Umschlägen vermischte sich in seinem Kopf mit dem herben Geruch des Taus; er hörte die Eisenringe an den Betten über ihre Stange rollen und seine Frau schlafen … Als er durch Vassonville kam, saß dort neben einem Graben ein Bürschchen im Gras.
»Sind Sie der Arzt?« fragte das Kind.
Und nachdem Charles geantwortet hatte, nahm es seine Holzpantinen in die Hand und lief voraus.
Unterwegs erfuhr der Sanitätsbeamte aus den Reden seines Führers, dass Monsieur Rouault ein sehr wohlhabender Landwirt sein musste. Er hatte sich am Vorabend das Bein gebrochen, als er von einem Nachbarn kam, wo sie Dreikönige gefeiert hatten. Seine Frau war seit zwei Jahren tot. Er hatte nur sein Fräulein bei sich, das ihm half, den Haushalt zu besorgen.
Die Radspuren wurden tiefer. Sie kamen nach Les Bertaux. Der kleine Kerl schlüpfte durch ein Loch in der Hecke, verschwand, tauchte dann hinten in einem Hof wieder auf und öffnete das Gatter. Das Pferd schlitterte auf dem nassen Gras; Charles zog den Kopf ein unter den Ästen. Die Wachhunde in ihrer Hütte bellten und zerrten an der Kette. Als er in Les Bertaux einritt, scheute sein Pferd und tat einen großen Sprung.
Es war ein stattliches Gehöft. In den Ställen sah man durch die offenen Türoberhälften schwere Ackergäule, die friedlich aus neuen Futterkrippen fraßen. Die Gebäude säumte ein breiter Misthaufen, Dampf stieg von ihm hoch, und zwischen den Hennen und Putern pickten fünf oder sechs Pfauen, ein Luxus in den Hühnerhöfen des Pays de Caux. Der Schafstall war lang, die Scheune war hoch, ihr Mauerwerk glatt wie die Hand. Unter dem Schuppendach standen zwei große Karren und vier Pflüge, nebst ihren Peitschen, ihren Kummeten, ihrem gesamten Zubehör, und die blauen Wolldecken verschmutzten im feinen, von den Speichern herabrieselnden Staub. Der Hof stieg leicht an, bepflanzt mit symmetrisch gruppierten Bäumen, und vom Tümpel her drang das fröhliche Geschnatter einer Gänseschar.
Eine junge Frau im blauen Merinokleid mit drei Volants trat vor die Haustür, um Monsieur Bovary zu empfangen, führte ihn in die Küche, wo ein kräftiges Feuer brannte. Das Frühstück des Gesindes brodelte ringsum in verschieden großen Töpfchen. Feuchte Kleidung trocknete im Inneren des Kamins. Das Schäufelchen, die Zangen und der Schnabel des Blasebalgs, alles riesengroß, glänzten wie blanker Stahl, und an den Wänden hing eine üppige Batterie von Kochgeschirr, in dem sich ungleichmäßig die helle Flamme des Kaminfeuers spiegelte, zusammen mit dem ersten Sonnenlicht, das durch die Fensterscheiben drang.
Charles ging hinauf in den ersten Stock, um nach dem Kranken zu sehen. Der lag im Bett, unter seinen Decken schwitzend, die Zipfelmütze weit von sich geworfen. Er war ein dicker kleiner Mann von fünfzig Jahren, mit weißer Haut, blauen Augen, einer Stirnglatze, und er trug Ohrringe. Neben ihm, auf einem Stuhl, stand eine große Karaffe mit Schnaps, von dem er sich immer wieder eingoss, zur Herzstärkung und Labung; doch sowie er den Arzt sah, verflog seine Aufregung, und anstatt zu fluchen, wie er das seit zwölf Stunden tat, begann er leise zu wimmern.
Der Bruch war einfach, ohne irgendwelche Komplikationen. Charles hätte sich keinen simpleren zu wünschen gewagt. Also rief er sich das Auftreten seiner Lehrmeister an den Betten Verletzter in Erinnerung, tröstete den Patienten mit allerlei guten Worten, chirurgischem Gekraule, das wirkt wie Öl beim Schmieren der Skalpelle. Da er Schienen brauchte, holte man aus dem Wagenschuppen einen Stapel Holzlatten. Charles suchte sich eine aus, schnitt sie in Stücke und glättete sie mit einem Glasscherben, während die Magd Laken in Streifen riss und Mademoiselle Emma sich mühte, kleine Polster zu nähen. Als sie ihre Nadelbüchse nicht sogleich fand, wurde ihr Vater ärgerlich; sie erwiderte nichts; doch beim Nähen stach sie sich in die Finger, steckte sie dann in den Mund und lutschte.
Charles überraschten ihre weißen Fingernägel. Sie waren glänzend, zart an den Spitzen, sorgfältiger gereinigt als die Elfenbeinfiguren aus Dieppe und mandelförmig geschnitten. Ihre Hand dagegen war unschön, vielleicht nicht hell genug und an den Knöcheln zu dürr; sie war auch zu lang, und an den Rändern fehlten ihr die weichen Rundungen. Schön an ihr waren die Augen; obwohl braun, wirkten sie schwarz wegen der Wimpern, und ihr offener Blick begegnete einem mit unschuldiger Kühnheit.
Als der Verband angelegt war, wurde der Arzt von Monsieur Rouault eingeladen, vor dem Heimweg noch einen Happen zu essen.
Charles ging hinunter in den großen Raum im Erdgeschoss. Zwei Gedecke mit silbernen Bechern waren auf einem kleinen Tisch vorbereitet, am Fußende eines großen Himmelbetts, umhüllt von Baumwollstoff mit aufgedruckten Figuren, die Türken vorstellten. In der Luft hing ein Geruch von Iris und feuchten Laken, er kam aus dem hohen Eichenschrank gegenüber dem Fenster. Auf dem Fußboden, in den Ecken, standen aneinandergereiht Säcke voller Getreide. Sie hatten nicht mehr hineingepasst in den angrenzenden Speicher, zu dem man über drei Steinstufen gelangte. Als Schmuck dieser Wohnung hing an einem Nagel in der Mitte der Wand, deren grüne Farbe unter dem Salpeter abblätterte, ein mit Bleistift gezeichneter Minervakopf im Goldrahmen, unter dem in altertümlichen Lettern geschrieben stand: »Meinem lieben Papa«.
Zunächst sprach man über den Kranken, dann über das Wetter, die strenge Kälte, die Wölfe, die nachts durch Feld und Flur strichen. Mademoiselle Rouault machte das Landleben keinen Spaß, vor allem jetzt, wo die Sorge um das Gehöft fast ganz auf ihr lastete. Da es kühl war in dem Raum, zitterte sie beim Essen, was ihre vollen Lippen ein wenig zur Geltung brachte, an denen sie, wann immer sie schwieg, aus Gewohnheit nagte.
Ihren Hals umschloss ein weißer Umlegekragen. Ihr schwarzes Haar in den zwei breiten Streifen, auf jeder Seite so glatt wie aus einem Guss, wurde in der Mitte des Kopfes von einer feinen Linie gescheitelt, die der Schädelwölbung folgte und noch ein Stück weiter lief; die Ohrläppchen sahen gerade noch hervor, dann war es im Nacken zu einem üppigen Knoten zusammengefasst, mit einer geschwungenen Welle an den Schläfen, die dem Landarzt hier zum ersten Mal in seinem Leben auffiel. Ihre Wangen waren zartrosa. Sie trug, wie ein Mann, zwischen zwei Knöpfe ihrer Bluse gesteckt, ein Lorgnon aus Schildpatt.
Als Charles sich oben von Vater Rouault verabschiedet hatte und vor dem Aufbruch noch einmal in den großen Raum trat, stand sie am Fenster, die Stirn gegen die Scheibe gedrückt, und blickte hinaus in den Garten, wo der Wind die Bohnenstangen umgelegt hatte. Sie drehte sich zu ihm.
»Suchen Sie etwas?« fragte sie.
»Meine Reitpeitsche, bitte«, antwortete er.
Und er begann überall zu stöbern, auf dem Bett, hinter den Türen, unter den Stühlen; sie war auf den Boden gefallen, zwischen Säcke und Mauer. Mademoiselle Emma hatte sie entdeckt; sie beugte sich über die Getreidesäcke. Charles wollte höflich sein, stürzte herbei, und als er in gleicher Absicht ebenfalls den Arm ausstreckte, spürte er, wie seine Brust den Rücken des jungen Mädchens streifte, das sich unter ihm bückte. Mit rotem Kopf richtete sie sich auf und blickte über die Schulter, in der Hand seinen Ochsenziemer.
Anstatt drei Tage darauf wieder nach Les Bertaux zu kommen, wie er versprochen hatte, erschien er bereits am nächsten Tag, dann regelmäßig zweimal pro Woche, die überraschenden Besuche nicht mitgerechnet, die er von Zeit zu Zeit machte, wie aus Versehen.
Übrigens ging alles gut; die Heilung verlief erwartungsgemäß, und als man nach sechsundvierzig Tagen sah, dass Vater Rouault auf seiner Masure ganz allein erste Schritte machte, begann man Monsieur Bovary für einen äußerst fähigen Mann zu halten. Vater Rouault sagte jedem, besser hätten ihn auch die vortrefflichsten Ärzte aus Yvetot oder sogar aus Rouen nicht kurieren können.
Charles fragte sich kein bisschen, warum er so gern nach Les Bertaux ritt. Hätte er nachgedacht, er würde seinen Eifer sicher auf den schwierigen Fall zurückgeführt haben oder vielleicht auf den Gewinn, den er sich erhoffte. Lag es aber wirklich an diesen Dingen, dass seine Besuche auf dem Gehöft unter den armseligen Beschäftigungen seines Lebens eine bezaubernde Ausnahme bildeten? An solchen Tagen erhob er sich früh, galoppierte davon, trieb sein Tier zur Eile, stieg schließlich ab, um sich im Gras die Füße zu reinigen, und streifte seine schwarzen Handschuhe über, bevor er einritt. Er mochte es, wenn er in den Hof kam, an seiner Schulter das Gatter spürte, das aufschwang, und er mochte den Hahn, der auf der Mauer krähte, die Burschen, die herbeiliefen. Er mochte Scheune und Pferdeställe; er mochte Vater Rouault, der ihm kräftig die Hand drückte und ihn seinen Retter nannte; er mochte Mademoiselle Emmas kleine Holzpantinen auf den gescheuerten Fliesen der Küche; die hohen Absätze machten sie etwas größer, und wenn sie vor ihm herging, schlugen die rasch auf und ab wippenden Sohlen mit hartem Klackern gegen das Leder der Stiefelchen.
Sie begleitete ihn stets bis zur ersten Stufe der Außentreppe. Wenn sein Pferd noch nicht bereitstand, wartete sie. Man hatte sich voneinander verabschiedet, redete nichts mehr; die frische Luft umfing sie, blies ihre flaumigen kleinen Nackenhaare durcheinander oder zerrte an den Schürzenbändern, die über ihren Hüften flatterten wie Fähnchen. Einmal, bei Tauwetter, nässelten die Baumrinden im Hof, der Schnee auf den Dächern der Gebäude schmolz. Sie stand in der Tür; sie ging ihren Sonnenschirm holen, öffnete ihn. Der Schirm aus taubenblauer Seide, den Sonnenstrahlen durchdrangen, warf ein bebendes Schillern auf die weiße Haut ihres Gesichts. Sie lächelte darunter in der lauen Wärme; und man hörte die Wassertropfen einen nach dem anderen auf das gespannte Moiré fallen.
In der ersten Zeit, da Charles Les Bertaux aufsuchte, erkundigte sich die junge Madame Bovary stets nach dem Kranken, und sie hatte in ihrem Ausgaben-Einnahmen-Buch für Monsieur Rouault sogar ein schönes leeres Blatt genommen. Als sie jedoch hörte, dass er eine Tochter hatte, betrieb sie Nachforschung; sie erfuhr, dass Mademoiselle Rouault im Kloster, bei den Ursulinen, zur Schule gegangen war und, wie man so sagt, eine gute Erziehung genossen hatte, dass sie sich demzufolge auf Tanzen, Geographie, Zeichnen, Stickerei und Klavierspiel verstand. Das war die Krönung!
»Deshalb«, sagte sie sich, »strahlt sein Gesicht, wenn er zu ihr reitet, und deshalb trägt er seine neue Weste, auch wenn er Gefahr läuft, sie bei Regen zu verderben? Oh! diese Frau! diese Frau! …«
Und instinktiv war sie ihr verhasst. Zunächst machte sie sich durch Anspielungen Luft, Charles verstand sie nicht; später durch beiläufige Sticheleien, die er aus Angst vor einem Donnerwetter überhörte; schließlich durch scharfe Anwürfe, auf die er nichts zu entgegnen wusste. – Warum ritt er immer wieder nach Les Bertaux, wo Monsieur Rouault doch geheilt war und diese Leute bisher nicht gezahlt hatten? Ja! weil dort eine Person war, jemand, der zu plaudern verstand, eine Aufschneiderin, ein Schöngeist. Das war es, was er liebte: er brauchte Stadtfräuleins! – Und sie fuhr fort:
»Die Tochter von Vater Rouault, ein Stadtfräulein! Du liebe Güte! der Großvater war Schafhirte, und einen Cousin haben die, der wäre beinahe vors Schwurgericht gekommen wegen eines hinterhältigen Schlags bei einem Streit. Da besteht wahrlich kein Grund, so vornehm zu tun oder sonntags im Seidenkleid zur Kirche zu gehen, wie eine Gräfin. Ein armer Mann übrigens, der ohne die Rapsernte vom letzten Jahr nicht gewusst hätte, wie er seine Rückstände zahlen soll!«
Zermürbt unterließ Charles seine Besuche in Les Bertaux. Héloïse hatte ihm den Schwur abgerungen, dass er nicht mehr hinreiten werde, die Hand auf dem Messbuch, nach vielen Tränen und Küssen, in einem großen Liebessturm. Er gehorchte also; die Kühnheit seines Begehrens wehrte sich jedoch gegen die Unterwürfigkeit seines Verhaltens, und durch eine Art von naiver Heuchelei meinte er, das Verbot, sie zu sehen, gebe ihm ein Recht, sie zu lieben. Und außerdem war die Witwe mager; sie war ein Raffzahn; sie trug zu jeder Jahreszeit einen kleinen schwarzen Shawl, dessen Zipfel ihr zwischen den Schulterblättern baumelte; ihr vertrockneter Körper steckte in zu kurzen futteralartigen Kleidern, unter denen ihre Knöchel hervorschauten, mitsamt den breiten Schuhschleifen, die sich über grauen Strümpfen ineinanderschlangen.
Charles’ Mutter kam hin und wieder zu Besuch; nach wenigen Tagen jedoch schien die Schwiegertochter sie an ihrer Klinge scharfzuwetzen; und wie zwei Messer traktierten sie ihn dann mit ihren Sticheleien und Tadeleien. Es war falsch, so viel zu essen! Warum immer gleich jeden Erstbesten auf ein Gläschen einladen? Wie eigensinnig von ihm, er wollte keine Flanellunterwäsche!
Zu Frühlingsbeginn geschah es, dass ein Notar aus Ingouville, Vermögensverwalter der Witwe Dubuc, bei schönster Flut die Segel hisste und alles Geld seiner Kanzlei mitnahm. Zwar besaß Héloïse, neben einem auf sechstausend Franc geschätzten Schiffsanteil, noch ihr Haus in der Rue Saint-François; von diesem ganzen Reichtum, mit dem man so auf die Pauke gehauen hatte, war allerdings nichts aufgetaucht in der gemeinsamen Wirtschaft als ein bisschen Mobiliar und altes Gelumpe. Die Sache verlangte nach Aufklärung. Das Haus in Dieppe war bis in die Fundamente zerfressen von Hypotheken; was sie bei dem Notar hinterlegt hatte, wusste Gott allein, und der Anteil an dem Kahn überstieg keine tausend Écu. Sie hatte gelogen, die gute Frau! In seiner Wut zertrümmerte Monsieur Bovary senior einen Stuhl auf dem Steinboden, beschuldigte seine Frau, sie habe den Sohn ins Unglück gestürzt, ihn mit dieser Schindmähre zusammengespannt, deren Zaumzeug nicht besser war als das Fell. Sie fuhren nach Tostes. Man sprach sich aus. Es kam zu heftigen Wortwechseln. Héloïse warf sich schluchzend in die Arme ihres Mannes, beschwor ihn, sie vor seinen Eltern zu schützen. Charles wollte sie verteidigen. Jene waren beleidigt und gingen.
Aber der Hieb hatte gesessen. Acht Tage später, als sie im Hof Wäsche aufhängte, spuckte sie plötzlich Blut, und tags darauf, während Charles ihr gerade den Rücken kehrte und die Gardine am Fenster zuzog, sagte sie: »Oh! mein Gott!«, tat einen Seufzer und verlor das Bewusstsein. Sie war tot! Wie verblüffend!
Als auf dem Friedhof alles vorbei war, ging Charles nach Hause. Unten war niemand; er stieg hinauf in den ersten Stock, ins Schlafzimmer, sah ihr Kleid, das noch am Fußende des Alkovens hing; da lehnte er sich gegen den Sekretär und blieb so stehen bis zum Abend, versunken in wehmütige Grübelei. Sie hatte ihn geliebt, alles in allem.
Anmerkungen
III.
Eines Morgens kam Vater Rouault und brachte Charles den Lohn für sein wiederhergestelltes Bein: fünfundsiebzig Franc in Vierzig-Sou-Münzen und eine Pute. Er hatte von seinem Unglück erfahren und tröstete ihn, so gut er konnte.
»Ich weiß, wie das ist!« sagte er und klopfte ihm auf die Schulter; »mir ging’s nicht anders als Ihnen! Als ich meine arme Verewigte verloren hab, lief ich raus auf die Felder, um allein zu sein; ich fiel am Fuß eines Baumes nieder, ich weinte, ich rief nach dem lieben Gott, ich sagte ihm dummes Zeug; ich wäre gern einer von den Maulwürfen gewesen, die ich an den Ästen sah und in deren Bäuchen die Maden wimmelten, na ja, verreckt halt. Und wenn ich dran dachte, dass andere im gleichen Augenblick bei ihren lieben kleinen Frauen waren, sie an sich drückten, drosch ich mit meinem Stock auf den Boden; ich war so gut wie verrückt, dass ich nichts mehr aß; der Gedanke, auch nur ins Kaffeehaus zu gehen, widerte mich an, ob Sie’s glauben oder nicht. Und dann, ganz langsam, ein Tag verscheuchte den anderen, ein Frühling folgte einem Winter und ein Herbst einem Sommer, dann wurd’s besser, Körnchen für Körnchen, Krümel für Krümel; dann ist’s weggegangen, ist verschwunden, ist runtergerutscht, will ich sagen, denn im Innersten bleibt immer was zurück, sozusagen … ein Stein, hier, auf der Brust! Aber das ist nun mal unser aller Los, drum darf man sich nicht zugrunde gehen lassen und, nur weil andre gestorben sind, auch sterben wollen … Reißen Sie sich zusammen, Monsieur Bovary; das geht vorüber! Besuchen Sie uns; meine Tochter denkt hin und wieder an Sie, müssen Sie wissen, und sie sagt auch, Sie hätten sie ganz vergessen. Bald ist Frühling; Sie dürfen in unserm Revier ein Karnickel schießen, das bringt Sie auf andre Gedanken.«
Charles folgte seinem Rat. Er ritt wieder nach Les Bertaux; er fand alles so wie gestern, das heißt, wie vor fünf Monaten. Die Birnbäume standen schon in Blüte, und der gute alte Rouault, nun wieder auf den Beinen, lief hin und her, was den Hof lebendiger machte.
Er hielt es für seine Pflicht, den Arzt mit größter Zuvorkommenheit zu behandeln wegen seiner kummervollen Lage, bat ihn, die Mütze auf dem Kopf zu lassen, sprach leise wie mit einem Kranken und tat sogar, als müsse er sich aufregen, weil man nicht eigens für ihn etwas zubereitet hatte, das ein bisschen leichter war als alles übrige, Schälchen mit Crème zum Beispiel oder gesottene Birnen. Er erzählte Geschichten. Charles ertappte sich beim Lachen; doch plötzlich überkam ihn die Erinnerung an seine Frau, und er wurde düster. Man brachte den Kaffee; er dachte nicht mehr an sie.
Er dachte immer seltener an sie, je mehr er sich ans Alleinsein gewöhnte. Die neuen Vorzüge der Unabhängigkeit machten ihm sein einsames Leben bald erträglicher. Er konnte jetzt essen, wann er wollte, kommen oder gehen, ohne sich zu rechtfertigen, und wenn er todmüde war, alle viere weit von sich gestreckt, auf seinem Bett liegen. Er verwöhnte sich also, hätschelte sich und nahm den Trost, den man ihm zusprach, gern entgegen. Andrerseits hatte der Tod seiner Frau ihm beruflich sehr genützt, denn einen Monat lang hatten alle ständig gesagt: »Der arme junge Mann! So ein Unglück!« Sein Name war bekannt geworden, seine Kundschaft gewachsen; und außerdem ritt er nach Les Bertaux, sooft er wollte. Er spürte eine ziellose Hoffnung, ein unbestimmtes Glück; er fand sein Gesicht einnehmender, wenn er sich den Backenbart bürstete vor dem Spiegel.
Eines Tages kam er gegen drei; alle waren auf den Feldern; er trat in die Küche, konnte Emma aber zunächst nirgendwo sehen; die Fensterläden waren geschlossen. Durch die Ritzen im Holz warf die Sonne auf den Steinboden lange, schmale Streifen, die sich an den Möbelkanten brachen und an der Decke zitterten. Fliegen krabbelten auf dem Tisch an den Gläsern hoch, aus denen getrunken worden war, und surrten, wenn sie in dem stehengebliebenen Cidre-Rest ertranken. Das im Kamin herabfallende Tageslicht ließ den Ruß auf der Rückwand samtig glänzen und die kalte Asche bläulich schimmern. Zwischen Fenster und Feuerstelle saß Emma und nähte; sie trug kein Fichu, auf ihren bloßen Schultern sah man kleine Schweißperlen.
Wie es auf dem Lande Brauch ist, bot sie ihm eine Erfrischung. Er lehnte ab, sie drängte und schlug ihm schließlich lachend vor, mit ihr ein Glas Likör zu trinken. Sie holte aus dem Schrank eine Flasche Curaçao, griff nach zwei kleinen Gläsern, füllte eines bis an den Rand, goss in das andere nur einen Tropfen, und nachdem sie angestoßen hatten, setzte sie es an den Mund. Da es fast leer war, lehnte sie sich zum Trinken zurück; den Kopf in den Nacken geworfen, die Lippen gerundet, den Hals angespannt, lachte sie, weil sie nichts spürte, während ihre Zungenspitze zwischen den kleinen Zähnen hervorkam und hurtig das Glas leckte.
Sie setzte sich und nahm ihr Nähzeug wieder auf, einen weißen Baumwollstrumpf, den sie stopfte; sie arbeitete vornübergebeugt; sie redete nicht, auch Charles schwieg. Die unter der Tür hereinströmende Luft wirbelte eine Staubflocke über die Fliesen; er schaute ihr beim Dahinkriechen zu, und er hörte nur das Pochen in seinem Kopf, verbunden mit dem Gegacker eines Huhns in der Ferne, das ein Ei legte irgendwo auf dem Hof. Emma erfrischte sich ab und zu die Wangen mit den Handflächen, die sie hinterher an den Eisenkugeln der großen Feuerböcke kühlte.
Sie klagte, seit Beginn der warmen Jahreszeit leide sie an Schwindelanfällen; sie fragte, ob Bäder im Meer hilfreich sein könnten; sie begann von der Klosterschule zu erzählen, Charles von seinem Collège, sie kamen ins Reden. Sie gingen hinauf in ihr Zimmer. Sie zeigte ihm ihre alten Notenhefte, die kleinen Bücher, die sie als Preis erhalten hatte, und die ganz unten in einem Schrank verblassenden Eichenlaubkränze. Sie sprach auch von ihrer Mutter, vom Friedhof und zeigte ihm sogar das Beet im Garten, wo sie Blumen pflückte, jeden ersten Freitag im Monat, um sie aufs Grab zu stellen. Aber der Gärtner, den sie hatten, verstand nichts davon; es gab nur Verdruss mit den Dienstboten! Sie hätte gern, und sei es auch nur für den Winter, in der Stadt gewohnt; obwohl die langen, schönen Tage das Landleben im Sommer vielleicht noch langweiliger machten; – und je nachdem, was sie sagte, war ihre Stimme klar, hell oder plötzlich von Wehmut verschleiert, voll schleppender Modulationen, die fast in Gemurmel endeten, wenn sie mit sich selber sprach, – mal fröhlich, mit großen naiven Augen, dann wieder mit halb geschlossenen Lidern, der Blick verschwommen vor Langeweile, die Gedanken abschweifend.
Am Abend auf dem Heimweg ging Charles die Sätze, die sie gesagt hatte, einen nach dem anderen durch und versuchte sich an alle zu erinnern, ihren Sinn zu vervollständigen, um sich den Teil ihrer Existenz auszumalen, den sie in einer Zeit gelebt hatte, als er sie noch nicht kannte. Doch nie vermochte er sie in Gedanken anders zu sehen, als er sie beim ersten Mal gesehen, oder so, wie er sie gerade erst zurückgelassen hatte. Dann fragte er sich, was aus ihr werden sollte, ob sie heiraten würde, und wen? ach ja! Vater Rouault war ziemlich reich, und sie! … so schön! Doch Emmas Gesicht erschien immer wieder vor seinen Augen, und etwas Monotones wie das Brummen eines Kreisels dröhnte ihm in den Ohren: »Und wenn du doch heiraten würdest! wenn du heiraten würdest!« In der Nacht schlief er nicht, seine Kehle war ausgedörrt, er hatte Durst; er stand auf, um aus seinem Wasserkrug zu trinken, und öffnete das Fenster; der Himmel war sternenübersät, ein lauer Wind wehte, in der Ferne bellten die Hunde. Er wandte den Kopf in Richtung Les Bertaux.
Charles überlegte, dass er ja nichts zu verlieren hatte, und nahm sich vor, um sie anzuhalten, sobald sich Gelegenheit böte; doch jedesmal, wenn sie sich bot, verschloss die Angst, keine richtigen Worte zu finden, ihm den Mund.
Vater Rouault hätte nichts dagegen gehabt, seine Tochter loszuwerden, die im Hause kaum von Nutzen war. Insgeheim entschuldigte er sie, fand, sie besitze zuviel Geist für den Ackerbau, ein vom Himmel verfluchtes Gewerbe, denn nie brachte es Millionäre hervor. Weit davon entfernt, ein Vermögen erworben zu haben, machte der gute Mann Jahr für Jahr Verluste; auch wenn er auf den Märkten glänzte, wo er Freude hatte an den Finessen des Gewerbes, lag ihm der Ackerbau im engeren Sinne, mit der Führung des Bauernhofs, weniger als irgendwem sonst. Er nahm die Hände nicht gern aus den Taschen und sparte nicht bei den Kosten für alles, was sein Leben betraf, denn er wollte gut essen, gut warm haben, gut liegen. Er mochte starken Cidre, blutige Lammkeulen, schaumig geschlagene Glorias. Er hielt Mahlzeit in der Küche, allein, vor dem Feuer, an einem kleinen Tisch, den man ihm fertig angerichtet hereintrug, wie im Theater.
Als er nun merkte, dass Charles in der Nähe seiner Tochter rote Wangen hatte, was bedeutete, dass er demnächst um ihre Hand anhalten würde, bebrütete er die ganze Sache im voraus. Er fand ihn zwar etwas schmächtig, und das war nun kein Schwiegersohn, wie er ihn sich gewünscht hätte; aber es hieß, er sei anständig, sparsam, sehr gebildet, und wahrscheinlich wäre er bei der Mitgift nicht allzu pedantisch. Und da Vater Rouault vor der Notwendigkeit stand, zweiundzwanzig Morgen von seinem Land zu verkaufen, da er dem Maurer viel schuldete, dem Sattler viel schuldete, da an der Presse der Spindelbaum ausgetauscht werden musste:
»Wenn er um sie anhält«, sagte er sich, »geb ich sie ihm.«
Um Michaeli kam Charles für drei Tage nach Les Bertaux. Der letzte Tag war verstrichen wie die beiden davor, mit Hinausschieben von einer Viertelstunde auf die andere. Vater Rouault begleitete ihn ein Stückchen; sie gingen durch einen Hohlweg, gleich würden sie Abschied nehmen; jetzt oder nie. Charles gab sich noch bis zum Ende der Hecke, und schließlich, als sie schon vorbei waren:
»Meister Rouault«, murmelte er, »ich möchte Ihnen etwas sagen.«
Sie blieben stehen. Charles schwieg.
»Raus mit der Sprache, ich weiß doch sowieso alles!« sagte Vater Rouault und lachte freundlich.
»Vater Rouault …, Vater Rouault …«, stotterte Charles.
»Mir soll’s recht sein«, fuhr der Landwirt fort. »Die Kleine ist gewiss meiner Meinung, aber fragen müssen wir sie schon. Machen Sie sich auf den Weg; ich geh wieder nach Hause. Wenn sie ja sagt, dass wir uns richtig verstehen, brauchen Sie nicht wiederkommen, wegen der Leute, und außerdem würde sie das allzusehr aufregen. Aber damit Sie nicht vor Ungeduld sterben, will ich den Fensterladen ganz weit aufstoßen, bis an die Mauer: Sie können ihn von hinten sehen, wenn Sie sich über die Hecke beugen.«
Und er machte sich davon.
Charles band sein Pferd an einen Baum. Er lief los und stellte sich auf den Weg; er wartete. Eine halbe Stunde verging, dann zählte er neunzehn Minuten auf seiner Uhr. Plötzlich rumpelte etwas an der Mauer; der Fensterladen war aufgesprungen, der Haken zitterte noch.
Am nächsten Morgen gegen neun war er auf dem Hof. Emma errötete, als er eintrat, und bemühte sich, ein wenig zu lachen, um ihre Verlegenheit zu überspielen. Vater Rouault umarmte seinen zukünftigen Schwiegersohn. Über Geldangelegenheiten zu reden wurde aufgeschoben; man hatte ja auch genügend Zeit vor sich, denn die Eheschließung konnte anstandshalber nicht vor Ablauf von Charles’ Trauerzeit stattfinden, also im Frühling des kommenden Jahres.
Der Winter verging also mit Warten. Mademoiselle Rouault kümmerte sich um ihre Aussteuer. Ein Teil wurde in Rouen bestellt, und sie schneiderte sich Nachthemden und Häubchen anhand von Modezeichnungen, die sie ausborgte. Bei den Besuchen, die Charles auf dem Hof machte, sprach man von den Hochzeitsvorbereitungen; man fragte sich, an welchem Ort das Diner abgehalten werden sollte; man grübelte über die Anzahl der Gänge, die nötig waren, und über die Art der Vorspeisen.
Emma ihrerseits hätte gern um Mitternacht geheiratet, im Fackelschein; doch Vater Rouault war dieser Einfall unbegreiflich. Es gab also eine Hochzeit, zu der dreiundvierzig Personen kamen, bei der man sechzehn Stunden tafelte, die am nächsten Tag weiterging und ein bisschen noch an den darauf folgenden.
Anmerkungen
IV.
Die Gäste kamen früh am Morgen, in Kutschen, einspännigen Karriolen, zweirädrigen Fuhrwerken mit Bänken, alten Kabrioletts ohne Verdeck, Möbelwagen mit Ledervorhängen, und die jungen Leute aus den nächstgelegenen Dörfern in Karren, auf denen sie in einer Reihe standen, sich an den Seitenwänden festhaltend, um nicht zu fallen, in flottem Trab und kräftig durchgerüttelt. Manche reisten aus zehn Meilen Entfernung an, aus Goderville, aus Normanville und aus Cany. Man hatte alle Verwandten aus beiden Familien eingeladen, man hatte sich mit verkrachten Freunden ausgesöhnt, man hatte an längst aus den Augen verlorene Bekannte geschrieben.
Hin und wieder hörte man hinter der Hecke einen Peitschenknall; kurz darauf öffnete sich das Gatter: eine Karriole fuhr herein. Sie galoppierte bis zur ersten Stufe der Außentreppe, hielt abrupt und entlud ihre Menschenfracht, die von allen Seiten herabstieg, sich die Knie rieb und die Arme streckte. Die Damen, mit Hauben, trugen Kleider nach städtischer Fasson, goldene Uhrketten, Pelerinen, deren überkreuzte Zipfel im Rockbund steckten, oder kleine, bunte Fichus, die im Rücken mit einer Nadel festgehalten wurden und den Nacken entblößten. Die Buben, ebenso gewandet wie ihre Papas, schienen sich in ihrer neuen Kleidung unwohl zu fühlen (viele trugen an diesem Tag sogar das erste Paar Stiefel ihres Lebens), und neben ihnen sah man, keinen Laut von sich gebend in dem weißen Erstkommunionskleid, das für den Anlass länger gemacht worden war, irgendein großes Mädchen von vierzehn oder sechzehn Jahren, sicher ihre Cousine oder ihre ältere Schwester, rotgesichtig, verstört, das Haar fettglänzend von Rosenpomade und in ständiger Angst, die Handschuhe könnten schmutzig werden. Da nicht genug Pferdeknechte zur Stelle waren, um alle Wagen auszuspannen, krempelten die Herren ihre Ärmel hoch und machten sich selbst ans Werk. Je nach gesellschaftlicher Stellung trugen sie Fräcke, Gehröcke, Jacken, Joppen: – gute Fräcke, die von der ganzen Hochachtung einer Familie umhegt und nur für Feierlichkeiten aus dem Schrank geholt wurden; Gehröcke mit großen, im Winde flatternden Schößen, zylinderförmigen Kragen, Taschen so breit wie Säcke; Jacken aus grobem Tuch, die gewöhnlich eine Mütze mit messingumrandetem Schirm begleiteten; sehr kurze Joppen, die im Rücken zwei so dicht wie ein Augenpaar nebeneinanderliegende Knöpfe besaßen und deren Schoßteile aussahen, als wären sie vom Beil des Zimmermanns aus einem einzigen Block herausgehauen. Andere wiederum (aber die mussten natürlich am untersten Tischende speisen) hatten Festtagskittel, also mit einem Kragen, der über die Schultern heruntergeschlagen war, mit feingefälteltem Rücken und sehr tief sitzender, im Bund geraffter Taille.
Und die Hemden wölbten sich über den Brustkörben wie Harnische! Alle waren frisch geschoren, die Ohren standen ab von den Köpfen, man war glattrasiert; manch einer, der vor Tagesanbruch aufgestanden war und beim Bartschaben nichts gesehen hatte, trug Schmarren schräg unter der Nase oder abgeschrammte Stellen an den Kinnbacken, groß wie Drei-Franc-Stücke, und diese hatten sich unterwegs an der frischen Luft entzündet und zierten nun mit rosa Flecken all diese dicken, weißen, strahlenden Gesichter.
Das Rathaus lag eine halbe Meile vom Hof, darum ging man zu Fuß und kehrte nach der kirchlichen Trauung auf die gleiche Weise heim. Der Festzug, anfangs geschlossen wie eine einzige bunte Schärpe, die in der Landschaft wehte, auf dem schmalen, sich zwischen grüner Saat dahinschlängelnden Pfad, wurde bald immer länger und zerfiel in verschiedene Gruppen, die plaudernd zurückblieben. Der Dorfmusikant marschierte vorneweg mit seiner Geige, deren Schnecke Bänder schmückten; dann kamen das Brautpaar, die Verwandten, die Freunde, wie es der Zufall wollte, und die Kinder trödelten hinterher und hatten ihren Spaß daran, die Glöckchen der Haferrispen abzureißen oder unbeobachtet miteinander herumzutollen. Emmas Kleid war zu lang und schleifte ein wenig nach; hin und wieder blieb sie stehen, um es anzuheben, und dann zupfte sie vorsichtig mit ihren behandschuhten Fingern die harten Gräser ab und die kleinen Stacheln der Disteln, während Charles mit leeren Händen wartete, bis sie fertig war. Vater Rouault, auf dem Kopf einen neuen Seidenhut und am schwarzen Frack Aufschläge, die seine Hände bis zu den Fingernägeln bedeckten, führte die alte Madame Bovary am Arm. Und Monsieur Bovary senior, der all diese Menschen im Grunde verachtete und darum lediglich in einem einreihigen Gehrock mit militärischem Schnitt gekommen war, bedachte eine junge blonde Bäuerin mit Kneipenschmeicheleien. Sie verbeugte sich, errötete, wusste nicht, was sie erwidern sollte. Die anderen Hochzeitsgäste redeten über ihre Geschäfte oder trieben hinterrücks Schabernack und brachten sich frühzeitig in Stimmung; und wenn man die Ohren spitzte, hörte man noch das Gefiedel des Dorfmusikanten, der auf freiem Feld immerzu spielte. Wenn er merkte, dass alle weit hinter ihm waren, blieb er stehen und verschnaufte, wachste seinen Bogen sorgfältig mit Kolophonium, damit die Saiten lauter kreischten, und dann setzte er sich wieder in Bewegung, hob und senkte abwechselnd den Hals seiner Geige, um sich selber den Takt zu schlagen. Das Gezeter des Instruments vertrieb schon von weitem die Vögelein.
Unter dem Dach des Wagenschuppens war die Tafel gedeckt. Darauf vier Rinderlenden, sechs Hühnerfrikassees, Kalbsgeschmortes, drei Lammkeulen und in der Mitte ein hübsches gebratenes Spanferkel, flankiert von vier Andouilles mit Sauerampfer. An den Ecken stand Schnaps in Karaffen. Der süße Cidre in Flaschen trieb rund um die Korken seinen zähen Schaum heraus, und schon vorher waren alle Gläser mit Wein gefüllt worden, bis an den Rand. Große Schüsseln mit gelber Crème, die beim kleinsten Ruck gegen den Tisch von ganz alleine wogte, trugen, auf die glatte Oberfläche gestreut, die Initialen der Frischvermählten in Nonpareille-Schnörkeln. Für Kuchen und Nougats hatte man einen Konditor aus Yvetot kommen lassen. Da er ein Neuling war in der Gegend, hatte er sich Mühe gegeben; und zum Nachtisch brachte er persönlich eine mehrstöckige Torte, die Jubelgeschrei auslöste. Den Unterbau bildete ein Viereck aus blauer Pappe, das einen Tempel darstellte mit Portiken, Kolonnaden und Statuetten aus Stuck ringsherum, in Nischen, übersät mit Sternen aus Goldpapier; auf der zweiten Etage stand ein Bergfried aus Biskuit, umgeben von winzigen Befestigungsanlagen aus kandierter Engelwurz, Mandeln, Rosinen, Orangenscheiben; und auf der obersten Fläche schließlich, einer grünen Wiese, wo es Felsen gab mit Marmeladeseen und Schiffen aus Haselnussschalen, war ein kleiner Liebesgott zu sehen, der sich auf einer Schokoladenschaukel wiegte, und ihre beiden Säulen endeten in zwei echten Rosenknospen, anstelle von Bällchen, an der Spitze.
Man aß bis zum Abend. Wenn man vom Sitzen müde war, ging man zum Spazieren hinaus auf die Höfe oder in die Scheune, eine Partie Bouchon spielen; dann kehrte man zurück an die Tafel. Gegen Ende schlief der eine oder andere ein und schnarchte. Beim Kaffee jedoch kamen alle wieder zu sich; nun wurden Lieder angestimmt, Kraftproben gemacht, man stemmte Gewichte, ging unter dem Daumen hindurch, suchte Karren auf den Schultern hochzuheben, machte derbe Witzchen, küsste die Damen. Am Abend, beim Aufbruch, passten die bis an die Nüstern mit Hafer vollgefutterten Pferde kaum noch in die Deichsel, sie schlugen aus, bäumten sich, das Zaumzeug riss, ihre Besitzer fluchten oder lachten; und die ganze Nacht sah man im Mondenschein auf den Straßen der Umgebung rasende Karriolen, die in gestrecktem Galopp dahinjagten, in den Wasserrinnen hüpften, über Kubikmeter Schotter sprangen, sich in den Böschungen verfingen, mit Frauen, die sich aus der Wagentür lehnten, um in die Zügel zu greifen.
Wer in Les Bertaux blieb, verbrachte die Nacht trinkend in der Küche. Die Kinder schliefen unter den Bänken.
Die Braut hatte ihren Vater gebeten, man möge sie verschonen mit den üblichen Späßen. Doch einer von ihren Cousins, ein Fischhändler (er hatte als Hochzeitsgeschenk sogar ein Seezungenpaar mitgebracht), wollte schon mit dem Mund Wasser durchs Schlüsselloch pusten, als Vater Rouault gerade noch rechtzeitig dazukam, um es zu verhindern, und ihm erklärte, die würdige Stellung seines Schwiegersohns verbiete solche Ungebührlichkeiten. Der Cousin ließ sich von diesen Gründen indes nur schwer überzeugen. Im stillen warf er Vater Rouault Hochnäsigkeit vor, und er setzte sich in eine Ecke zu vier oder fünf anderen Gästen, die bei Tisch zufällig mehrmals mindere Stücke vom Fleisch abgekriegt hatten, sich darum ebenfalls schlecht behandelt fühlten, über ihren Gastgeber tuschelten und in verhüllten Worten seinen Ruin herbeiwünschten.
Die alte Madame Bovary hatte den ganzen Tag lang den Mund nicht aufgemacht. Man hatte sie weder beim Kleid der Schwiegertochter um Rat gefragt noch bei der Speisenfolge; sie zog sich früh zurück. Anstatt es ihr gleichzutun, ließ ihr Mann Zigarren aus Saint-Victor kommen und rauchte bis zum Morgengrauen, dazu trank er Grogs mit Kirsch, eine der Versammlung unbekannte Mixtur, die ihm noch höheres Ansehen verschaffte.
Charles war kein geborener Possenreißer, während der Hochzeit hatte er nicht geglänzt. Er antwortete ziemlich ungeschickt auf Spott, Wortspiele, Zweideutigkeiten, Glückwünsche und schlüpfrige Reden, die man pflichtgemäß schon bei der Suppe auf ihn abschoss.
Am nächsten Tag hingegen wirkte er wie ausgewechselt. Ihn hätte man viel eher für die Jungfrau vom Vorabend halten können, während die Frischvermählte nichts erkennen ließ, was Rückschlüsse erlaubte. Auch den größten Schelmen fiel keine Bemerkung ein, und wenn sie vorbeikam, musterten alle sie mit maßloser Gespanntheit. Charles jedoch verbarg nichts. Er nannte sie meine Frau, duzte sie, erkundigte sich bei jedem nach ihr, suchte sie überall, und oft zog er sie hinaus auf die Höfe, wo man ihn von weitem sah, zwischen den Bäumen, wie er ihr den Arm um die Taille legte, halb über sie gebeugt weiterging und mit dem Kopf die Spitzenrüsche an ihrer Korsage zerknitterte.
Zwei Tage nach der Hochzeit verabschiedeten sich die Eheleute: Charles konnte wegen seiner Kranken nicht länger verweilen. Vater Rouault ließ sie in seiner Karriole nach Hause bringen und begleitete sie höchstpersönlich bis Vassonville. Hier umarmte er seine Tochter ein letztes Mal, stieg aus und machte sich wieder auf den Weg. Nachdem er zirka hundert Schritt gegangen war, blieb er stehen, und als er die entschwindende Karriole sah, deren Räder sich im Staube drehten, tat er einen tiefen Seufzer. Er dachte zurück an seine eigene Hochzeit, die frühere Zeit, die erste Schwangerschaft seiner Frau; auch er war sehr vergnügt gewesen an jenem Tag, da er sie von ihrem Vater mitgenommen hatte in sein Haus, als sie hinter ihm auf dem Pferd saß und mit ihm über den Schnee trabte; denn es war um die Weihnachtszeit und das Land war ganz weiß; sie hielt ihn mit einem Arm umfangen, am anderen hing ihr Korb; der Wind zerrte an den langen Spitzen ihres Kopfschmucks aus dem Pays de Caux, die hin und wieder seinen Mund berührten, und wenn er den Kopf drehte, sah er neben sich, auf seiner Schulter, ihr rosiges Gesichtchen, das still vor sich hin lächelte unter der breiten Goldborte der Haube. Um sich zu wärmen, steckte sie ihm von Zeit zu Zeit die Finger unter den Rock. Wie lange war das alles her! Ihr Sohn wäre jetzt schon dreißig Jahre alt! Nun blickte er hinter sich, er sah nichts auf der Straße. Er fühlte sich traurig wie ein Haus ohne Möbel; und da sich in seinem von Suff und Schlemmerei benebelten Hirn die zärtlichen Erinnerungen mit schwarzen Gedanken mischten, bekam er für eine Minute Lust, bei der Kirche vorbeizuschauen. Da er jedoch Angst hatte, ihr Anblick könnte ihn noch trauriger stimmen, lief er schnurstracks heim.
Monsieur und Madame Charles kamen gegen sechs nach Tostes. Die Nachbarn stellten sich ans Fenster, um die neue Frau ihres Arztes zu sehen.
Das alte Dienstmädchen erschien, begrüßte sie feierlich, entschuldigte sich, weil das Essen nicht fertig war, und bat Madame, sie möge doch einstweilen ihr Haus in Augenschein nehmen.
Anmerkungen