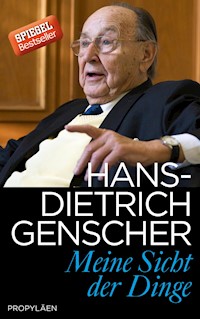16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hans-Dietrich Genscher und Christian Lindner im Gespräch: ein Brückenschlag zwischen den Generationen. Zwei Liberale sprechen über ihre Wege in die Politik, ihre Partei, Deutschland und Europa sowie über das, was sie beide antreibt: die Leidenschaft für die Freiheit. Als Christian Lindner 1979 geboren wurde, da war Hans-Dietrich Genscher Bundesvorsitzender der FDP und Außenminister in einer sozialliberalen Koalition. Heute schauen beide mit unterschiedlichen Perspektiven auf die gesellschaftlichen Herausforderungen - der eine als Elder Statesman, der andere in aktueller politischer Verantwortung. Ein politisches Buch, aber auch eine Auseinandersetzung und Verständigung zwischen den Generationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hans-Dietrich Genscher | Christian Lindner
Brückenschläge
Zwei Generationen, eine Leidenschaft
Hoffmann und Campe Verlag
Ein Wort vorab
»Wir müssen reden« – so beginnen Gespräche, wenn es in einer Beziehung schwierig wird. »Wir müssen reden« – so haben auch oft unsere Gespräche in den vergangenen Monaten begonnen. Weil unsere Partei, die FDP, in Beziehungsschwierigkeiten steckte – intern, aber auch extern, denn viele Bürgerinnen und Bürger zweifeln an der liberalen Partei.
Die Gründe dafür haben wir am Telefon, bei Mittagessen oder am Rande von Veranstaltungen immer wieder diskutiert. Dabei haben wir zurückgeschaut, vor allem aber haben wir den Blick nach vorn gerichtet: auf die Aufgaben, die Deutschland bewältigen muss – hierzulande, in Europa und in einer neuen Weltordnung. Bei diesen Gelegenheiten entstand die Idee, andere an unserem Austausch teilhaben zu lassen: durch dieses Buch.
Mancher behauptet, der Liberalismus habe sich zu Tode gesiegt. Das Thema des 21. Jahrhunderts sei nicht mehr die Freiheit, sondern die Begrenzung der Freiheiten. Wir setzen dem entgegen, dass die Übernahme von individueller und gemeinsamer Verantwortung in Freiheit das humanste Prinzip ist, menschliche Gesellschaften zu gestalten. Gerade in einer globalisierten Welt darf der Einzelne im Wirtschaftlichen, Gesellschaftlichen und Privaten nicht vergessen werden. Die Hinwendung zum Menschen und zu seinen Chancen auf ein gelingendes Leben, das ist die bleibende Aufgabe des Liberalismus. Er erkaltet eben nicht in technokratischen Operationen, sondern macht die realisierbaren Lebenschancen zu seinem Maßstab. In diesem Sinne soll dieses Buch ein Brückenschlag sein – hin zu den Bürgerinnen und Bürgern.
Unsere Gedanken erheben weder den Anspruch, ein Grundsatzprogramm zu sein, noch sollen sie als Handlungsanweisungen für unsere Partei verstanden werden. Im besten Fall ist dieser Gesprächsband der Anstoß zu einer Diskussion. In jedem Fall aber ist er eine Einladung, sich mit den Überzeugungen und Überlegungen zweier Freidemokraten aus zwei Generationen auseinanderzusetzen. Auch in diesem Sinne sind die folgenden Kapitel ein Brückenschlag – zwischen einem 85-Jährigen und einem 34-Jährigen, zwischen erlebter Nachkriegsgeschichte und gedachter Zukunft, zwischen Tradition und Erneuerung.
Die FDP hat alle Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland mitverantwortet und mitgestaltet – für die Soziale Marktwirtschaft, die Westintegration, die Europäische Einigung und die Ostpolitik zur Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas. Immer war unsere Partei dabei Anwalt neuen Denkens. Mehr als einmal haben die Liberalen für ihre Überzeugungen ihre politische Existenz aufs Spiel gesetzt. Diese Tradition, die der Ältere von uns beiden mitgeprägt hat, gibt der FDP das Selbstbewusstsein, auch vor den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft bestehen zu können.
Der Jüngere und seine Generation stehen nun vor historischen Wendepunkten, die weit über die deutschen Grenzen hinausreichen. Die Neudurchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft als Idee einer Verantwortungswirtschaft, faire Aufstiegschancen durch Bildung, die Fortentwicklung der Europäischen Union, die Wahrung der Bürgerrechte in einer digitalisierten Gesellschaft, die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen ohne autoritäre Gebote und die Mitwirkung an einer globalen Kooperationsordnung, die von allen als gerecht empfunden werden kann – über diese Themen sprechen wir, aus unterschiedlichen Perspektiven mit einer gemeinsamen Leidenschaft für die Freiheit. Sie ist unser Brückenschlag.
Hans-Dietrich Genscher im Februar 2013
Christian Lindner
»Wir sind beide Kinder unserer Zeit«
LINDNER
Der 8. Mai 1945 gilt als Stunde Null der späteren Bundesrepublik, Richard von Weizsäcker hat ihn in seiner berühmten Rede von 1985 einen »Tag der Befreiung« genannt. Wie haben Sie diesen Tag erlebt, wo waren Sie, was fühlten Sie?
GENSCHER
Für mich war bereits der 7. Mai 1945 meine Stunde Null. Ich war wenige Wochen zuvor erst achtzehn geworden, hatte aber schon mehr als zwei Jahre militärischen Dienst hinter mir, erst als Luftwaffenhelfer, später dann bei der Wehrmacht als Pionier. Ich gehörte zur Armee Wenck, einem General, der in der letzten Kriegsphase den Auftrag hatte, mit seinen Truppen Hitler in Berlin zu befreien. Doch er hielt sich nicht an diesen Befehl, sagte seinen Offizieren: »Ich werde nicht Zehntausende von jungen Soldaten, die mir anvertraut sind, in eine sinnlose Schlacht führen. Ich führe die Armee nach Westen und hoffe, dass wir in amerikanische Gefangenschaft kommen.«
LINDNER
Befreiung durch Gefangenschaft, harte Zukunftsaussichten für einen 18-Jährigen.
GENSCHER
Natürlich fragten wir damals, was nun werden wird. Wir wussten ja, dass der Krieg verloren war und dass er sehr bald zu Ende gehen würde. Meine Mutter hatte mich noch an meinem Geburtstag, am 21. März 1945, da wurde ich 18 Jahre alt, in der Kaserne in Wittenberg besucht. Als ich sie zum Bahnhof brachte, sagte ich zu ihr: »Ich vermute mal, dass wir uns jetzt eine ganze Weile nicht sehen werden. Wir werden jetzt zum Einsatz kommen. Aber ich habe im Gefühl« – damit wollte ich sie beruhigen –, »ich werde es überleben. Eigentlich geht es nur darum, in welche Gefangenschaft ich komme.«
Ja, und dann war es so weit. Die letzte Nacht, vom 6. auf den 7. Mai, übernachteten wir auf einem Gutshof in der Nähe der Elbe bei Tangermünde auf dem Ostufer. Auf diesem Gutshof wurde Bismarck geboren, und wir lagen nun dort in der Scheune. Wir wussten, dass wir am nächsten Tag wohl die Elbe nach Westen überschreiten würden. Seit Tagen schon zog die Armee über die Trümmer einer Brücke. Sie müssen sich vorstellen, wie lange das dauert, wenn achtzigtausend Mann über einen Holzsteg marschieren. Als wir da also abends im Stroh lagen, sagte ich: »Leute, wir werden das jetzt ja packen, wahrscheinlich, dann könnt ihr später euren Kindern und Enkeln sagen, die letzte Nacht des Krieges habt ihr bei Bismarck übernachtet. Ihr müsst ja nicht sagen, dass es in der Scheune war.«
Was wir nicht ahnten: Am nächsten Tag sollte uns noch ein schwerer Kampfeinsatz bevorstehen. Wir mussten den Brückenkopf verteidigen gegen die nachrückenden Russen, die uns diese Fluchtmöglichkeit abschneiden wollten. Wir befanden uns in einem kleinen Ort namens Wust; das ist der Ort, in dem der unglückliche Leutnant von Katte, der Erzieher Friedrichs des Großen, geboren worden war. Seine Familie stammte aus Wust, und er wurde dort auch nach der Hinrichtung in Küstrin beigesetzt.
LINDNER
Waren Sie selbst auch in die Kampfhandlungen verwickelt?
GENSCHER
Ja, sicher, ganz massiv. Das Schwierigste war, sich vom Gegner abzusetzen, ohne dass er es bemerkt. Wir hatten den Auftrag, mit unserem Bataillon den Ort Wust bis 15.30 Uhr am 7. Mai zu verteidigen. Am Ende waren wir nur noch zehn Mann. Dann wurden die Nächsten abgezogen, schließlich waren wir nur noch zu dritt …
LINDNER
Und Sie dabei?
GENSCHER
Ich war einer von den dreien. Am Westrand des Ortes, auf einer kleinen Anhöhe, schossen wir dann in alle Richtungen, um den Russen, die oben aus den Dachfenstern der Häuser rausguckten, vorzutäuschen, dass wir noch viele sind. So wollten wir Luft nach hinten schaffen. Dann wurde einer von uns letzten drei durch ein Explosivgeschoss verwundet, sein Arm hing herunter, sodass ich dem anderen sagte: »Zieh ihn zurück, ich halte die Stellung.« Da lag ich dann, allein, mit dem Gedanken, wenn ich jetzt einen Schuss ins Bein kriege, komme ich hier nicht mehr weg. Aber es ging gut. Ich kam tatsächlich bis an die Elbe. Dort wartete eine große Zahl von deutschen und amerikanischen Sanitätskraftwagen, Krankenschwestern, Sanitätern, Ärzten. »Verwundete rechts raus«, hieß es – und plötzlich war der Krieg von einer Minute auf die andere beendet.
LINDNER
Solche Erfahrungen vergisst man wohl nie.
GENSCHER
Ja, wenngleich das tiefgehendste Erlebnis da schon zwei, drei Wochen zurücklag. Ich war nachts allein auf dem Weg zum Gefechtsstand unseres Bataillons, der sich in einem kleinen Dorf befand. Eine durchgehende Frontlinie gab es schon nicht mehr. Beide Seiten tasteten sich vor allem nachts ab. Als ich im Dunkeln in einem Bauernhof stand und mich zu orientieren suchte, öffnete sich unmittelbar neben mir leise und behutsam die Hoftür neben dem großen Hoftor. Die Maschinenpistole hatte ich schussbereit. Da blickte ich auf eine Entfernung von ein, zwei Metern in das angsterfüllte Kindergesicht, das mit weit aufgerissenen Augen unter dem russischen Stahlhelm hervorblickte. Seine Kalaschnikow hatte er genauso schussbereit wie ich meine Maschinenpistole. Sein Entsetzen war wohl nicht geringer als das meine. Reglos standen wir uns gegenüber. Eine Sekunde oder vielleicht auch drei oder fünf. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber keiner von uns war in der Lage, auf den Menschen zu schießen, dem er Auge in Auge gegenüberstand. Es war der Zeitpunkt, da sich zwei junge Menschen, ein Russe und ein Deutscher, gegenseitig das Leben schenkten. Dann machte ich einen Sprung nach vorn und schlug die offen stehende Tür zurück und mit ihr mein Gegenüber. In diesem Moment schon erschienen über dem Hoftor vier, fünf russische Stahlhelme. Der russische Angriff hatte begonnen. Ich schlug Alarm und konnte im Dunkel der Nacht den Schüssen der in den Hof eindringenden Rotarmisten entgehen. Geblieben ist die Erinnerung an den jungen Russen, mit dem ich wenige Sekunden meines Lebens schicksalhaft verbunden war und den ich nun als meinen »Iwan« immer in meinem Bewusstsein haben würde, auch als ständige Mahnung.
LINDNER
Fühlten Sie sich besiegt oder befreit?
GENSCHER
Ich fühlte Dankbarkeit. Dankbarkeit, überlebt zu haben. Dankbarkeit, nicht in russische, sondern in amerikanische Gefangenschaft geraten zu sein. Dankbarkeit, dass Hitler-Deutschland nun vorbei war, insoweit auch befreit. Damals ahnte ich noch nicht, dass es schon wenige Tage später eine sowjetische Besatzungszone geben würde, für die galt: befreit ohne frei zu sein.
LINDNER
In diesem Moment hat für Sie schon ein neues Deutschland begonnen?
GENSCHER
Das haben wir so gespürt, ja. Als wir kurz zuvor südlich von Berlin nach Westen marschierten – immer nur nachts, weil die russischen Jagdbomber am Tage die Straßen beherrschten –, mussten wir plötzlich anhalten. Ein Motorradfahrer kam mit einer Meldung an unseren Kommandeur, das Bataillon – noch etwa 80 Mann – stand um ihn herum. Wir wurden informiert, dass Hitler tot war. Wenck teilte uns das nicht so schwülstig mit wie Dönitz es getan hatte, der vom Führer sprach, der mit der Waffe in der Hand bis zum letzten Atemzug kämpfend gestorben sei. Wencks Tagesbefehl lautete: »Soldaten der 12. Armee: Der Führer ist tot. Ab heute wird die Ehrenbezeigung wieder durch Anlegen der rechten Hand an die Kopfbedeckung erwiesen. Wenck, General der Panzertruppen.«
Man muss dazu wissen, dass nach dem Attentat vom 20. Juli die Wehrmacht mit dem Hitlergruß salutieren musste, was als Demütigung gedacht war. Jetzt werde wieder richtig gegrüßt, das war Wencks einzige Bemerkung zu Hitlers Tod. Das zeigte, was der Mann dachte. Mir hat das einen unglaublichen Vertrauensschub gegeben – einer wie er, der wird es schaffen, uns hier rauszuholen. Trotzdem, die Gefühle waren gemischt, was wird aus uns, was aus unserem Land? Schließlich wussten wir, dass in Deutschland Schreckliches geschehen war.
LINDNER
Richard von Weizsäcker hat in seiner Rede auch gesagt: Wer sich Augen und Ohren nicht zuhielt, wusste, »dass Deportationszüge rollen«. Wussten Sie das auch?
GENSCHER
Sie müssen sich vorstellen, Herr Lindner: Ich hatte damals das Wort Auschwitz noch nicht gehört, aber »Judenverfolgung« reichte ja auch. Es reichte, was wir gesehen hatten: Menschen, die mit einem Stern gebrandmarkt wurden. Menschen, die weggebracht wurden, weil sie Juden waren. Es reichte, was wir hörten: von den Zuständen an der russischen Front, zum Beispiel. Von den Gefangenenlagern, in denen in den ersten Kriegsjahren viele russische Kriegsgefangene verhungerten. Wir hatten selbst die russischen Kriegsgefangenen erlebt, die sich freiwillig zur Flak gemeldet hatten, um dem Hungertod zu entgehen. Was muss die Menschen dazu bewegt haben … Ich habe verstanden, dass so etwas Rachegefühle hervorrufen wird. Aber was würde das konkret bedeuten? Ich konnte mir sicher nicht vorstellen, dass es zu einer Teilung Deutschlands führen würde. Für mich war das ein Land.
Wir gehörten nicht zur Kategorie der Verantwortlichen im Dritten Reich, aber wir fühlten uns in der Verantwortung unseres Volkes stehend – im Guten, aber auch im Schlechten, in dem unendlich Schlechten. Und uns erfasste die Gewissheit, dass unser Land jetzt zur Rechenschaft gezogen werde, wie immer die ausfallen würde. Es gab für mich persönlich aber auch einen Moment großer Erleichterung, als ich durch einen Zufall erfuhr, dass Halle von den Amerikanern besetzt worden war …
LINDNER
Und nicht von den Russen …
GENSCHER
… in dem Moment wusste ich, meine Mutter war nicht dem ausgesetzt, was viele andere Frauen bei der Besetzung durch die Rote Armee erleiden mussten. Aber hatte sie die Kampfhandlungen überhaupt überlebt? Die Frage nach ihrem Schicksal ließ mich nicht los. Und eine andere Frage auch nicht: Ist es möglich, hier abzuhauen? Wir marschierten durch Tangermünde in die Gefangenschaft, rechts und links amerikanische Soldaten. Aber wenn sich eine Armee auflöst, herrscht auch totales Chaos. Das war eine Chance. Ein Kamerad, der neben mir lief und mit dem ich von Anfang an auf einer Stube gewesen war, fragte mich: »Du bist so nachdenklich, was geht dir durch den Kopf?«
»Ich habe gerade zwei Entscheidungen getroffen«, sagte ich.
»Und welche sind das?«
»Erstens: Ich haue hier so schnell wie möglich ab.«
Er antwortete: »Da komme ich mit. Und die zweite?«
»Ab sofort mache ich nur noch, was ich gerne mache.« Das hieß, ich will nicht mehr geschoben werden, Luftwaffenhelfer, Reichsarbeitsdienst, Wehrmachtssoldat – jetzt will ich tun, was ich will. Das habe ich weitgehend durchgehalten. Heute würde ich sagen, jetzt will ich für mich Verantwortung übernehmen. Das ist es ja, was den Liberalen ausmacht: Freiheit wollen, auch um selbstverantwortlich handeln zu können. Freiheit ohne Verantwortung bedeutet Zügellosigkeit. Das Bewusstsein, dass Freiheit und Verantwortung siamesische Zwillinge sind oder auch zwei Seiten derselben Sache, bedeutet die ständige Herausforderung zum verantwortlichen Handeln in Freiheit.
LINDNER
Nicht nur Befehle empfangen, sondern selbst über sein Leben bestimmen. War das vielleicht der Moment, in dem sie nicht nur zu einem selbstbestimmten, sondern auch zu einem politischen jungen Mann geworden sind?
GENSCHER
Nein, nicht bewusst, das wäre falsch. Gestatten Sie mir eine Rückblende in die Zeit, als ich ein kleiner Junge war und in das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Mein Großvater war für mich Vaterersatz, denn mein Vater starb, als ich neun Jahre alt war. Der Großvater war mit dem Dorfpfarrer verbunden und der gehörte zur Bekennenden Kirche. Auf dem Dorf hatte das eine große Bedeutung. Immer wieder wurde dieser Pfarrer von der Gestapo vernommen und manchmal auch für kürzere oder längere Zeit inhaftiert. Das ständige Bemühen meines Großvaters als verantwortlicher Laie in der Gemeinde um die Freilassung des Pfarrers hat auch meine Familie geprägt. An meinem ersten Schultag – nach Ostern 1933 – verlangte der Lehrer, der sich schnell umgestellt hatte: »Jetzt treten wir mal an wie die Hitler-Jugend!« Mit meinen sechs Jahren erwiderte ich: »Da kann ich nicht mitmachen, wir sind deutsch-national.« Woraufhin der Mitschüler neben mir rief: »Da kann ich auch nicht mitmachen, wir sind Kommune.« Der Vater war Kommunist.
Am Abend bekam mein Vater im Kegelclub vom Lehrer zu hören: »Deinen Sohn hast du aber schon ganz schön indoktriniert. Der hat sich heute geweigert, mitzumarschieren wie die Hitler-Jugend.« In der Nacht kam mein Vater vom Kegeln zurück, weckte mich und drückte mir einen »Kanaldeckel« in die Hand. Das war ein Fünfmarkstück, die nannte er so, es war die höchste Auszeichnung, die in der Familie verliehen werden konnte. Zu mir sagte er nur: »Hier haste einen Kanaldeckel für das, was du heute in der Schule zum Lehrer gesagt hast.«
So war mein Vater. Von meinem Großvater habe ich meine Verbundenheit zu Frankreich. Er hat dort Ende des 19. Jahrhunderts seinen Wehrdienst abgeleistet, im lothringischen Dietenhofen. Seitdem bewunderte er die französische Kultur und litt darunter, dass er als Ältester den Bauernhof übernehmen musste. Er hätte lieber studiert, musste aber mit dem »Einjährigen« von der Schule abgehen, weil der Urgroßvater festgelegt hatte: »Es ist bei uns Sitte, dass der Älteste den Hof übernimmt.«
Mein Großvater ist 1947 gestorben. Ich erinnere mich, dass ich ihn am 1. Januar 1946 auf dem Land besucht habe, um ihm zum neuen Jahr alles Gute zu wünschen. Ein sowjetischer Major – ein Studienrat für Germanistik in Leningrad, der sehr gut Deutsch sprach – war mit drei Mann bei meinem Großvater einquartiert worden. Als der Major es nicht hören konnte, sagte ich: »Hoffentlich hauen die bald ab!«
»Mein Junge, die bleiben fünfzig Jahre«, erwiderte mir mein Großvater.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte ich.
»Warte ab«, gab er zurück. Er hat fast recht behalten.
Ich denke manchmal, vielleicht sieht er, dass ich ein wenig dazu beigetragen habe, dass es nicht ganz fünfzig Jahre geworden sind.
LINDNER
Noch einmal zurück zu 1945: An den »Endsieg« haben Sie nicht geglaubt?
GENSCHER
Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus dem Jahr 1944. Damals hatte ich beim Arbeitsdienst einen Kameraden, dem wir den Spitznamen »Stalin« gegeben hatten wegen seines Bürstenschnitts. Er trug sein schwarzes Haar stoppelig kurz, so wie Stalin. Der Kamerad war meist sehr in sich gekehrt, an den Gesprächen beteiligte er sich kaum. Ich hatte immer Stubendienst mit ihm, und an einem Abend, als wir beim Essen saßen, erzählte ein Kamerad aus Berlin: »Ich habe heute einen Brief bekommen von meiner Mutter. Mein Vater hat sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet.« Das war, wie gesagt, im Oktober 1944.
»Ganz schön dumm«, entgegnete ich.
»Nein, nicht wie du denkst«, sagte er.
»Na, wie denn dann?«
Seine Antwort: »Mein Vater ist Rechtsanwalt, und er sollte als Pflichtverteidiger vor dem Volksgerichtshof auftreten. Da hat meine Mutter zu ihm gesagt, ein anständiger deutscher Rechtsanwalt tritt vor diesem Blutgericht nicht auf.«
Ich erwiderte daraufhin: »Dann ziehe ich vor deinen Eltern den Hut.«
Danach trug ich mit meinem »Stalin« die Schüsseln zur Küche, und da wandte er sich an mich: »Das hat mir gut gefallen, was du vorhin gesagt hast.«
»Bist du auch dagegen?« Das war ein Schlüsselwort – man sagte »dagegen« und konnte sich immer noch herausreden, wenn es ganz ernst wurde.
Er bekannte: »Ich bin Kommunist.«
»Ist das denn besser?«, fragte ich.
»Ja! Der Kommunismus ist die Zukunft. Ich will dir eines sagen: Wenn ich an die Front komme, ich laufe zu den Russen über. Bei ihnen ist die Zukunft.«
»Und woher weißt du das?«, frage ich.
»Von meinem Vater.«
»Und wieso?«
»Mein Vater war als kommunistischer Funktionär zur Ausbildung in den zwanziger Jahren in der Sowjetunion. Und du, was denkst du mit deinen bürgerlichen Vorurteilen?«, wollte er wissen.
»Die Zukunft? Ich stelle sie mir wie in England oder Amerika vor.«
»Ach, das ist alles von gestern«, hielt er mir entgegen, »der Kommunismus ist die Zukunft.«
Nur sieben Wochen verbrachten wir gemeinsam beim Arbeitsdienst, danach hörte ich nichts mehr von ihm. Eines Tages las ich, dass »mein« Stalin, der in Wirklichkeit Werner Jarowinzky hieß, Mitglied des Politbüros der SED geworden war. Er hat dann später den Ständigen Vertreter der BRD, Hans Otto Bräutigam, bei einem offiziellen Essen gefragt: »Sehen Sie den Herrn Genscher gelegentlich in Bonn?«
»Ja.«
»Bestellen Sie ihm mal schöne Grüße.«
Bräutigam: »Kennen Sie Herrn Genscher?«
»Ja, aus alten Zeiten.«
Bräutigam sprach mich dann darauf an und dachte, wir hätten zusammen studiert. Aber ich erwiderte ihm: »Das waren noch ältere Zeiten.« Jarowinzky war, wie er später einem Journalisten erzählte, unsere Begegnung genauso in Erinnerung geblieben wie mir. Ich hätte ihn gern nach der Wende wieder getroffen, aber er ist Anfang 1990 gestorben.
Aber Sie sehen, aus den zwei Jungen von 1944, die ihre eigene Vorstellung von der Zeit danach hatten, sind zwei Männer geworden, die – jeder für sich – ihrer Vorstellung treu geblieben sind.
LINDNER
Für uns heute ist das, was Sie in jungen Jahren erlebt haben, unvorstellbar. Getrennt von der Familie, Deutschland besetzt, die Zukunft nur eine vage Idee.
GENSCHER
Wir werden ja auch die Luftwaffenhelfer-Generation genannt. Mit 15 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen zu werden, das macht etwas mit einem. Die ersten Luftwaffenhelfer gehörten den Jahrgängen 1926 und 1927 an. Einberufen wurden wir am 15. Februar 1945 als Reaktion auf die verlorene Schlacht von Stalingrad. Wir mussten die Plätze der Soldaten besetzen, die bei der Flak im Landesinneren dienten und jetzt an die Front geschickt wurden, wo man eine neue 6. Armee aufstellte. In dieser Generation ging wie ein Lauffeuer herum, was sich anbahnte. Nach unserer Entlassung aus dem Reichsarbeitsdienst Anfang Dezember 1944 und vor der Einberufung zur Wehrmacht Anfang 1945 trafen wir uns – meine Klassenkameraden und ich – am Silvestermorgen 1944. Wir wussten alle, jetzt müssen wir ran. Wir hatten einen Einberufungsbefehl für den 6. Januar, und wir wussten, in diesem Jahr wird die Sache beendet. Darin waren wir uns einig, und so haben wir uns im Januar 1945 verabredet, wann man sich wo trifft.
Einer fragte: »Was denkt ihr denn, wer als Erstes zurückkommt?« Und dann entschieden wir uns für einen Namen. Tatsächlich war er der erste, der zurückkam – können Sie sich das vorstellen? Ich war der dritte, der kam, am 7. Juli 1945.
Uns alle beherrschte das Gefühl: »Wir müssen jetzt etwas Neues, etwas Besseres machen.« Was dieses Neue sein würde, wussten wir selbst nicht genau. Klar war nur, keine Diktatur mehr. Und dennoch mussten wir gleichzeitig erleben, wie eine neue Diktatur bereits immer deutlicher ihr Gesicht zeigte …
LINDNER
Die ersten Konturen der DDR.
GENSCHER
Damals war es die sowjetische Besatzungszone. Im Juni wurden dort die Parteien zugelassen – vier: die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Christdemokratische Union und die Liberaldemokratische Partei –, und schon wenige Wochen später wurde deutlich: Die Kommunisten wollten eine Zwangsvereinigung.
LINDNER
KPD und SPD wurden zur SED zusammengeschlossen.
GENSCHER
Ja, und das war dramatisch: Führende Sozialdemokraten gingen weg, weil sie damit nicht einverstanden waren, andere wurden verhaftet. Bald begann auch der Druck auf Missliebige in den anderen Parteien. Alles ging wieder von vorne los, wieder konnte man nicht sagen, was man wollte. Die Kritiker dieses Weges wurden als »faschistische Elemente« verunglimpft. Das waren sie natürlich nicht! Das hat politisiert.
LINDNER
Dagegen wollten Sie Opposition machen.
GENSCHER
Richtig. Und in der Lage imponierten gerade die Redner, die sich besonders kritisch gegen die Besatzung und die SED äußerten. Je härter jemand auftrat, desto begeisterter waren wir. Damit ging der Kampf um die Hochschulen los. In den Betrieben hatten sich Betriebsgruppen der Parteien gebildet, an den Universitäten Hochschulgruppen der Parteien. Dort, an den Hochschulen, war die Liberaldemokratische Partei fast überall die mit Abstand stärkste. Ich erinnere mich an ein großes Idol, Wolfgang Natonek an der Universität Leipzig, der als rassisch Verfolgter bei den Nazis schon Zwangsarbeit leisten musste. Als NS-Verfolgter gab ihm das nach dem Krieg zunächst mehr Freiraum, offen auszusprechen, was er dachte und wollte. Diese Auseinandersetzungen um die Hochschulen spielten eine enorme Rolle, mich politisierte das immer mehr, machte aus mir einen kämpferischen jungen Mann, einen Liberalen. Bei der ersten Kommunalwahl in Halle – Wahlen waren relativ frei in den großen Städten – erhielt die Liberaldemokratische Partei die meisten Stimmen.
LINDNER
In Ihrer Heimatstadt gab es offenbar auch ein entsprechend liberales Milieu.
GENSCHER
Ein sehr starkes! Die Sitzverteilung habe ich heute noch im Kopf, so sehr hat mich das Ergebnis beeindruckt: 29LDP, 27SED, 19CDU. Damals hatten allerdings auch die Sozialdemokraten, die von dem Vereinigungsgerede nicht überzeugt waren, sehr stark die Liberaldemokratische Partei gewählt.
LINDNER
Und der LPD sind Sie dann beigetreten.
GENSCHER
Das war das Ergebnis eines längeren Findungsprozesses. Die Kommunisten kamen für mich nicht infrage und die SPD, deren westdeutscher Vorsitzender Kurt Schumacher mir enorm imponierte, auch nicht, weil erkennbar war, dass es unter dem Druck der sowjetischen Besatzungsmacht zur Zwangsvereinigung zwischen SPD und KPD kommen würde. An den Christlichen Demokraten gefiel mir, dass sie die Konfessionen politisch zusammenführen wollten. Aber dann kam ich in eine Versammlung, in der ein Redner auftrat – ein unglaublich leidenschaftlicher Redner – und Folgendes formulierte: »Der Liberalismus ist die umfassendste Alternative zu jeder Form der Unfreiheit.« Da habe ich mir gedacht, das sind die richtigen Leute. Und so reifte mein Entschluss zugunsten der Liberalen Partei, deren Mitglied ich am 30. Januar 1946 wurde.
LINDNER
Wären für Sie auch, wenn es damals weiterhin eine SPD gegeben hätte, die Sozialdemokraten als politische Heimat möglich gewesen?
GENSCHER
Wahrscheinlich nicht. Auch von der CDU hielt mich am Ende ab, dass in einem Wahlaufruf stand, sie wollten den Christlichen Sozialismus. Sozialismus, ob nun christlicher oder anderer Art, kam für mich nicht infrage. Zwei Leute bei der SPD allerdings beeindruckten mich, der eine war Kurt Schumacher. Er kämpfte gegen die Zwangsvereinigung, sah sich als Gegenspieler zu Otto Grotewohl, dem ersten Ministerpräsidenten der DDR, der aus der SPD kam, und sprach über die SED von den »rotlackierten Faschisten«. Rotlackierte Faschisten …
LINDNER
Was für ein scharfes Wort …
GENSCHER
Das konnte nur einer so zuspitzen, der aus den Konzentrationslagern gekommen war. Dann begann in ganz Berlin der Kampf gegen die Zwangsvereinigung. Franz Neumann, ein richtiger Arbeiterführer, führte an der Spitze der SPD einen äußerst mutigen Kampf gegen die Zwangsvereinigung in Berlin, lange Zeit bestand die SPD im Ostsektor ja noch fort. Sie stellte einen Abgeordneten im Bundestag in Bonn, der in Ostberlin wohnte. Mit der S-Bahn fuhr er nach Westberlin und flog dann zur Bundestagssitzung.
LINDNER
Ist es Ihnen auch so ergangen wie manchen Ihrer Generation, dass Sie sich als missbraucht und verführt betrachteten?
GENSCHER
Nein, verführt nicht. Das familiäre Milieu bewahrte mich davor, und die Schule auch. Das ist mir sehr wichtig. Kurz bevor ich Luftwaffenhelfer wurde, mussten wir einen Aufsatz schreiben, fünf Stunden. Thema war ein Zitat aus Franz Grillparzers Der Traum ein Leben. Diese Worte habe ich nicht vergessen: »Eines nur ist Glück hienieden und des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust, und die Größe ist gefährlich, und der Ruhm ein leeres Spiel, was er gibt sind nicht’ge Schatten, was er nimmt, es ist so viel.« Eine Stunde kaute ich an meinem Federhalter. Dann kam der Durchbruch, und ich schrieb: Offenbar geht es Grillparzer um die inneren Werte und den Menschen, wie er ist. Jeder sei anders, aber es käme auf die inneren Werte an. Aber wenn das alles richtig sei, was Grillparzer schreibt, und ich sei der Meinung, das sei richtig, dann müsste ich mich fragen, warum bei uns alle Leute Uniformen tragen, wir seien ein uniformiertes Land. Anschließend zählte ich alle Uniformen auf.
Als der Lehrer die Arbeit zurückgab, bemerkte er – ich muss dazu sagen, der mochte mich auch sehr – Folgendes: »Ich habe das Gefühl, das Thema war doch ein bisschen zu schwierig.« Das heißt, es war kein vorgeschriebenes Thema, er hatte es selbst ausgesucht. »Im Grunde hat es nur einer verstanden: Genscher. Eigentlich hättest du eine Eins verdient, aber da du wie immer zwei Kommafehler gemacht hast, konnte ich dir nur eine Zwei plus geben.« Er hatte eine Komma-Macke. Danach gab er allen ihre Arbeiten zurück, nur mir nicht. »Wo ist denn meine Arbeit?«, wollte ich wissen. »Ach«, erwiderte er, »ich vergaß das zu erwähnen, bei der Korrektur ist mir das Tintenfass umgefallen, und da habe ich deine Arbeit weggeworfen.« Als die Stunde zu Ende war und ich nach draußen ging, legte er seinen Arm um meine Schulter: »Nicht wahr, mein Junge, jetzt gibt es auf dieser ganzen großen Welt nur zwei Menschen, nämlich dich und mich, die wissen, warum es besser war, dass ich deine Arbeit weggeworfen habe.«
Wissen Sie, wenn Sie so etwas erleben … – ich war richtig glücklich!
LINDNER
Da hatten Sie einen Verbündeten, aber Sie haben eben auch früh eine Erfahrung gemacht, die wir heute nicht mehr kennen – die einer großen Unfreiheit, wenn man mit der Interpretation eines Dichterworts schon ein Risiko eingeht.
GENSCHER
Ich sage Ihnen, ich fand die Reaktion von ihm einfach klasse! Ich habe es zu Hause gleich erzählt. Meine Mutter erwiderte daraufhin: »Ich habe dir doch immer schon gesagt, du musst ja nicht auch noch schreiben, was du denkst.«
LINDNER
Sie haben später Politik zum Beruf gemacht. Politiker zu werden – haben Sie sich das schon zu dieser Zeit nach dem Kriegsende vorgenommen?
GENSCHER
Ach, überhaupt nicht! Ich hatte ein ganz anderes Berufsziel: Rechtsanwalt, als ich 1952 nach Westdeutschland kam. In der DDR, wo ich mein Jurastudium begann, wäre ich ohnehin nie Politiker geworden. Anwalt wollte ich werden, um selbständig zu sein. Mir imponierte, Leuten helfen zu können!
LINDNER
Und wie wurde dann aus dem Anwalt ein Politiker?
GENSCHER
1946, wie gesagt, bin ich Mitglied der LDP geworden. Ich erinnere mich, dass sich damit sehr bald eine Enttäuschung verknüpfte, weil mir die Parteiführung in Berlin nicht hart genug erschien. Sie erwarten doch als junger Mann, dass die der SED mal offen sagen, was Sache ist. Das wagte zwar Kurt Schumacher, aber aus dem sicheren Westen heraus. Ja, und dann bekam ich um die Weihnachtszeit 46/47 die Lungentuberkulose, die mich zunächst vollkommen aus dem Verkehr zog. Ich lag im Krankenhaus, und eines Tages setzte sich der Chefarzt zu mir aufs Bett: »Meine Oberärzte sagen dir, du hast eine feuchte Rippenfellentzündung und Lungenentzündung. Das stimmt, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Du hast eine schwere beiderseitige Lungentuberkulose. Vier von fünf Lungenlappen sind befallen, und ich muss dir sagen, wir Ärzte können da gar nicht so viel machen. Mindestens 50 Prozent musst du selbst schaffen, du musst die Krankheit besiegen wollen.«
Und dann hielt er mir einen – ich würde heute sagen – Impulsvortrag. Nie dürfe ich eine Niederlage mit der Krankheit erklären. Der Beste müsse ich sein wollen im Studium. Ganz vorn müsse ich sein wollen, immer, auch bei den Weibern, sagte er – was meine Mutter unerhört fand, der ich das später erzählt habe. Die Worte dieses Arztes waren eine Stimulans, über die Krankheit hinaus. Nicht aufgeben – es ist zu packen! Damals hieß Tuberkulose, so wie ich sie hatte, vielleicht Tod, aber jedenfalls nie richtig arbeitsfähig. Also eine eigentlich total deprimierende Perspektive. Ich habe nach sechs Semestern das Referendarexamen abgelegt, verbrachte davon aber nur dreieinhalb Semester an der Uni. Im Krankenhaus habe ich weitergelernt. Politik stand da nicht mehr in der Mitte.
LINDNER
Wann kehrte sie in die Mitte zurück?
GENSCHER
Im Jahr 1946 habe ich meinen ersten Wahlkampf noch mitgemacht – Kommunalwahlen und Landtagswahl. Hinterher hielt ich mich völlig zurück und blieb einfach still. Man blieb in der Partei, um zu zeigen, dass man nicht in der SED sein wollte, aber die Partei bot für mich keine politische Identität mehr. Innerlich war ich auf einem anderen politischen Ufer angelangt, weil inzwischen ja ein Gegenmodell entstand. Über das Radio konnte man sich darüber gut informieren. In Westdeutschland konnten sie in ihren Zeitungen schreiben, was sie wollten. Immer wieder mal fuhren Freunde nach West-Berlin; sie lasen Zeitungen – offen wurde dort die schärfste Auseinandersetzung mit der SED geführt. Wie Reliquien wurden Zeitungen bei uns in der Universität weitergegeben und gelesen, bald auch der Spiegel. Möglicherweise war ich über die Entwicklungen in der Bundesrepublik besser informiert als manche politisch nicht interessierten Kommilitonen in Westdeutschland.
LINDNER
Die Bundesrepublik war also Ihr Staat, nicht die DDR. Und in diesen Staat, die gewählte politische Heimat, machten Sie sich dann auf.
GENSCHER
Zunächst nach West-Berlin und dann nach Bremen, um die Ausbildung als Referendar fortzusetzen und abzuschließen. Meine Mutter blieb zunächst noch in Halle. Ich ging am 20. August 1952 von dort weg. Ich kam am Anhalter Bahnhof in Berlin an. Besser gesagt, in seinen Trümmern. Der Bahnhof war Territorium der DDR. Wenn man zwei Stufen nach unten ging, stand man im englischen Sektor von Berlin. Als ich meinen Fuß von der letzten Stufe herunter auf den Erdboden setzte, wusste ich, jetzt bist du im Westen angekommen.
Nachdem ich in Bremen Fuß gefasst hatte und auch bei einem Anwalt arbeiten konnte, sodass ich also über eine gewisse materielle Grundlage verfügte, kam meine Mutter nach. Sie traf gerade in Bremen ein, als sie noch im Zug hörte: Stalin ist tot. Als sie mich sah, fragte sie mich zweifelnd: »Ja, hab ich denn was falsch gemacht, dass ich ausgerechnet jetzt weggegangen bin, wo er doch nun tot ist?«
LINDNER
Vielleicht wird es drüben besser …
GENSCHER
Ich habe ihr widersprochen: »Es war bestimmt richtig, dass du gekommen bist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da viel ändern wird.« Geändert hat sich auch nichts, aber natürlich war die Reaktion verständlich.
LINDNER
Kommen wir noch einmal zurück nach Bremen, denn dort wurden Sie in der FDP aktiv, sozusagen Ihr zweiter Schritt in die Politik.
GENSCHER
Und zwar sofort. Für mich war es die liberale Partei, die ich wirklich wollte. Also ging ich in Bremen zur Geschäftsstelle und erklärte denen, ich wolle meine Mitgliedschaft fortsetzen.
LINDNER
Und dann? Viele Ihrer Generation wandten sich damals enttäuscht oder verbittert ab von der Politik.
GENSCHER
Bei manchen Kommilitonen habe ich das erlebt. Aber die, die aus dem Osten kamen, waren doch stärker politisiert. Für das eigene Land etwas tun, sich mitverantwortlich fühlen, das war für viele ein Motiv. Auch ich empfand das schon 1945 so: Wir müssen jetzt etwas Neues machen, und zwar wir selber. Für mich kam als zweites politisches Motiv der Wunsch hinzu, die Vereinigung des geteilten Landes zu erreichen. Deshalb habe ich Leute vor allem danach beurteilt, wie sie zur Frage der deutschen Teilung standen. Ich war zum Beispiel zur Ausbildung bei der Staatsanwaltschaft; in Halle gab es nur noch einen Volljuristen als Staatsanwalt, alle anderen waren »Volksstaatsanwälte«. Ich erreichte es, dass ich zu ihm kam: Dr. Geissler, ehemals Oberbürgermeister von Gleiwitz, bis die Nazis kamen, ein Zentrums-Mann. »Mit Konrad Adenauer, Herr Genscher, müssen wir vorsichtig sein«, sagte er mir, »der hat mit uns im Osten nichts zu tun.«
Immerhin war Dr. Geissler CDU-Mitglied. Und er kannte Adenauer von der Zusammenkunft der Zentrumsoberbürgermeister im preußischen Staatsrat. Das machte mich hellhörig: Wenn der so über den eigenen Mann an der Spitze denkt, muss etwas dran sein, dachte ich. Später folgte die große Debatte über die Teilung und was zu tun sei. Ich kann mich noch an die Nacht erinnern, als Thomas Dehler und Gustav Heinemann mit Konrad Adenauer in der Vereinigungsfrage abrechneten. Am Radio zu Hause bin ich fast verrückt geworden. Ich hätte Dehler umarmen können!
LINDNER
Da wussten Sie, dass Sie in der richtigen Partei waren.
GENSCHER
Sie müssen sich vorstellen, die FDP in Bremen war eine recht moderne Partei. In der FDP gehörten die hanseatischen Liberalen zum liberalen Flügel, ich meine sowohl die Hamburger wie die Bremer. Mit den Baden-Württembergern und den Bayern zusammen bildeten sie das liberale Lager, auf der anderen Seite stand die FDP Nordrhein-Westfalen …
LINDNER
… die damals Züge einer nationalen Sammelbewegung hatte.
GENSCHER
Bürgermeister Spitta in Bremen, zum Beispiel, hatte drei Mal die Bremer Verfassung entworfen – einmal im Kaiserreich, einmal zu Beginn der Republik und dann im Auftrag der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war eine der Traditionsfiguren. Ich trat dort also der FDP und den Jungdemokraten bei und wurde rasch stellvertretender Landesvorsitzender der Jungdemokraten, aber das war es zunächst auch. Ein einziges Mal habe ich für die Bürgerschaft kandidiert – als Zählkandidat auf einem aussichtslosen Platz.
LINDNER
Auf den ersten Blick ist das eine gewisse Paradoxie – Halle und die Einheit bleiben Basis und politisches Ziel, die Chiffren, die man mit Ihnen verbindet. Gleichwohl sind Sie nicht bei den Nationalliberalen gelandet.
GENSCHER
Ganz eindeutig! Ich hatte das Gefühl, das Nationalliberale zementiert eher und verschließt Möglichkeiten, statt Wege zur Einheit zu öffnen.
In Bremen legte ich das zweite Staatsexamen ab, damals musste man noch ein halbes Jahr als Anwaltsassessor arbeiten, dann wurde ich als Rechtsanwalt zugelassen, zunächst arbeitete ich als angestellter Rechtsanwalt. Später fing ich mit einem Kollegen neu an. Der Landesgeschäftsführer, der mich im Herbst 1955 aufgenommen hatte, berichtete mir eines Tages, er habe eine Anfrage, wonach die Bonner Bundestagsfraktion einen Volljuristen als wissenschaftlichen Assistenten suche. »Wäre das was für Sie?« Zufällig hatte ich vorher einen großen Zeitungsartikel gelesen über die Arbeitsweise des amerikanischen Senats und wie so ein Senator ausgestattet war – also über das Hilfspersonal, das ihm zur Verfügung stand. Daher hatte ich eine Vorstellung von der mir angebotenen Arbeit und dachte, das macht einen ja nicht dümmer, das könnte ich zwei, drei Jahre probieren. Ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Die Fraktion bildete eine Kommission aus drei Leuten, die mich befragten, schließlich musste ich mich der Fraktion vorstellen, mit Thomas Dehler als Fraktionsvorsitzendem, bis die alte Marie-Elisabeth Lüders einfach entschied: »Der kommt aus Halle, den nehmen wir.« Damals ging das.
LINDNER
Ab da befanden Sie sich im Treibsand.
GENSCHER
Damit war ich dann mitten drin, ohne doch wirklich zu ahnen, dass Politik mein Beruf auf Lebenszeit werden würde.
LINDNER
Aber diese Entwicklung passt zu einem wie Ihnen, der stets der Erste und Beste sein will, wie es der Arzt dem Tuberkulose-Patienten empfahl. Ich muss immer noch an Ihre Bemerkung denken, dass Sie so beeindruckt waren von diesem Redner, der davon sprach, Liberalismus sei die umfassendste Alternative zu jeder Form der Unfreiheit …
GENSCHER
… verstehen Sie, das war ein Politikum. Denn das bedeutete, Alternative nicht nur zu den Nazis, sondern zu jeder Form der Unfreiheit, also auch gegen die Unfreiheit von damals in der sowjetischen Besatzungszone. Heute würden Zuhörer das völlig anders verstehen als in Halle am Ende des Jahres 1945. Da wusste jeder, der meint auch die jetzigen Herren.
LINDNER
Darauf will ich hinaus.
GENSCHER
Damals hieß es: Was ist des Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone Nachtgebet? Herr Gott, gib uns das fünfte Reich, das vierte ist dem dritten gleich. Das war ein tödlicher Spruch, aber traf natürlich voll in das Lebensgefühl der Menschen. Aber noch mal zurück ins Jahr 1956. Ich kam also nach Bonn, nicht um Berufspolitiker zu werden, sondern weil ich es spannend fand, im Gesetzgebungsapparat und dem politischen Apparat eines großen Parlaments mitwirken zu können. Das war es, was mich reizte. Ich dachte, das bringt dich weiter, und vieles wirst du auch als Anwalt brauchen können. Je tiefer ich eintauchte, desto mehr ergriff mich, womit ich mich da befasste. Plötzlich rückte ich auf den Stuhl des Bundesgeschäftsführers vor, als Karl-Hermann Flach wegging. Zuerst hieß es, das solle ich interimsweise machen, es werde noch jemand gesucht. Gefunden wurde tatsächlich Hans Friderichs, der später Bundeswirtschaftsminister wurde.
Ich fuhr mit Erich Mende – dem damaligen Partei- und Fraktionsvorsitzenden – zum Landeshauptausschuss Rheinland-Pfalz nach Mainz, das Parteigremium tagte, und dort hielt ein junger Mann eine flammende Rede. Spontan habe ich zu Erich Mende gesagt: »Den lasse ich kommen, der kann den Bundesgeschäftsführer machen.«
»Meinen Sie?«, erwiderte der vorsichtig. Und so kam Hans Friderichs, damals Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, zur FDP nach Bonn. Ich wollte eigentlich bald zurück nach Bremen, aber dann kam Willy Weyer und drängte, es würde jetzt höchste Zeit, ich müsste direkt in die Politik einsteigen. Ich spreche vom Jahr 1962, Adenauer war noch Kanzler, CDU/CSU und FDP waren Koalitionspartner. »Sie müssen beim nächsten Mal ins Parlament. Ich habe auch schon einen Wahlkreis: Wuppertal. Da kenne ich den Kreisvorsitzenden.« Bis dahin war ich noch nie in Wuppertal gewesen, als ich mich dort vorstellte beim Kreisvorstand, betrat ich also zum ersten Mal Wuppertaler Boden. So ging das damals zu in der Politik. Vieles war möglich, vieles war unkompliziert.
Heute, in Ihrer Zeit, ist das anders. Und Ihr Weg in die Politik ist wohl auch ein anderer gewesen. Wie also fing es bei Ihnen an, Herr Lindner?
»Ich wollte mich einmischen«
LINDNER
Angefangen hat es mit dem Gefühl, mich einmischen zu wollen. Ich war in der Schülervertretung und wollte mehr. Also habe ich mir die Parteien in meiner Heimatstadt Wermelskirchen angesehen. Bei der SPD tummelten sich meine Lehrer. Die Junge Union hat sich vor allem zum Biertrinken getroffen – Freunde hatte ich aber schon, dafür brauchte ich keine Partei. Die Grünen, soweit es sie gab, erschienen mir nicht unkonventionell und liberal, sondern eher spaßfrei und pessimistisch. Bei der FDP trafen sich der Forstwirt, der Handwerksmeister, die Friseurin, der pensionierte Lehrer, der Jurist – zupackende, offene Menschen, die Freude hatten an ihrem Beruf, aber sich damit nicht zufriedengegeben, sondern sich für ihre Stadt nach Feierabend engagiert haben. Ich fand, die Liberalen hatten das positivste Menschenbild von allen, weil sie jedem einzelnen Menschen etwas zutrauen und ihm damit auch vertrauen.
In dieser Zeit hat mein Vater ein Exemplar der Freiburger Thesen, die in den siebziger Jahren als Rowohlt-Bändchen erschienen waren, aus dem Regal gezogen und mir zu lesen gegeben. Er war übrigens kein Parteigänger, sondern nur interessierter Beobachter. Dieses Parteiprogramm hat mich gefesselt – ich denke an den Kernsatz: »Nicht nur auf Freiheiten und Rechte als bloß formale Garantien des Bürgers gegenüber dem Staat, sondern auf die soziale Chance in der alltäglichen Wirklichkeit der Gesellschaft kommt es an.« Ich glaube, bis heute handelt es sich um eines der besten Dokumente, um einen zeitgemäßen Liberalismus darzustellen. Insbesondere übrigens die Einleitung von Werner Maihofer.
GENSCHER