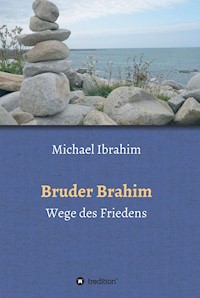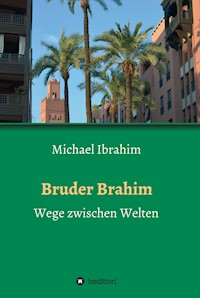
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Leben wird spannend durch Veränderungen! Wie fühlt es sich an, auszubrechen aus dem Alltagskokon? Wer sind wir eigentlich, jenseits aller Labels und Rollen, die die Gesellschaft uns gibt? Ein junger Mann sprengt seine Fesseln und wird zu einem Weltenbummler, verliebt sich und konvertiert dann ausgerechnet zu einer Religion, die mit Veränderungen die größten Probleme hat - dem Islam. Für viele Menschen ein Rätsel und ein Schreckgespenst, lebt er als Brahim den Islam, entwickelt aber seine eigene Praxis und denkt aufgrund seiner Lebenserfahrung offen über Veränderungen nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Meinen Elternund meinen Lehrernin Liebe und Dankbarkeit
Erstellt mit LATEX auf Ubuntu-Linux
Text und Korrektur: Michael Ibrahim
Lektorat: Regine Becker
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
https://tredition.de
1. Öffentliche Auflage, Juni 2018
ISBN-Nummern für dieses Buch
978-3-7439-3691-1 (Paperback)
978-3-7439-3692-8 (Hardcover)
978-3-7439-3693-5 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die öffentliche Ausgabe dieses Buches enthält geänderte Namen und teils gekürzte oder veränderte Handlungen, um das Privatleben der Personen zu schützen.
Der Autor hofft mit dem Buch zum Dialog über ein besseres Miteinander anzuregen und niemanden zu verletzen oder bloßzustellen.
Altersempfehlung: ab 16 Jahren
Bruder Brahim
- Wege zwischen Welten -
Ein biografischer Roman von Michael Ibrahim vollendet im Ramadan 2018
Anmerkung:
Die islamischen Segensfloskeln, die sogenannten Eulogien, verwende ich hier nicht so konsequent wie vielleicht gewünscht. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Eulogie nur durch eine Kombination aus drei hochgestellten Buchstaben dargestellt.
Die Muslime sprechen z.B. bei der Nennung des Propheten Mohammedsaw :
gesprochen: salla-llahu ‘alaihi wa salam, was bedeutet: „Gott segne ihn und schenke ihm Heil!”
Sprechen Sie die Segensfloskel im Stillen, wenn Sie ihn kennen, überlesen Sie ihn einfach, wenn er Ihnen nichts sagt.
Auf die Eulogie bei der Nennung eines Gottesnamen habe ich verzichtet, weil sie im Deutschen unüblich und befremdlich ist. Man möge sie gegebenenfalls im Stillen sprechen. Ich benutze im ersten Teil des Buches aus historischen Gründen auch den Begriff Göttliche Mutter, wie er in Indien üblich ist. Dies ist im Islam nicht üblich, aber ich habe mich trotzdem entschieden, es so zu schreiben, wie ich damals dachte. Der von den Christen verwendete Begriff Gottes Sohn entspricht ebenfalls nicht islamischen Denken.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Alte Wege verlassen
1.1 Das Ende einer heilen Welt
1.2 Wissenschaft statt Religion
1.3 Brasilien und die erste Liebe
1.4 Eine neue Liebe
1.5 Mystische Begegnungen
1.6 Die Welt steht Kopf
1.7 Krise bedeutet Wendung
1.8 Der Kleinstadt-Yogi
1.9 Auf ins nächste Abenteuer
1.10 You are the one
1.11 Alles wird anders
2 Eine neue Welt entdecken
2.1 Alles ist im Wandel
2.2 Unser Sommermärchen
2.3 Ankunft in Marokko
2.4 Wiedersehen in Tanger
2.5 Auf in die Königsstadt Fes
2.6 Rückkehr nach Europa
3 Tiefgründige Entscheidungen
3.1 Zurück in Deutschland
3.2 Die Einheit Gottes
3.3 Der Koran
3.4 Ramadan
3.5 Verlobung
3.6 Übertritt zum Islam
3.7 Unsere Heirat
4 Leben bedeutet Veränderung
4.1 Ein orientalisches Abenteuer
4.2 Ein brasilianisches Abenteuer
4.3 Das Ausland ruft
4.4 Wir werden eine Familie
5 Hilfe - wir sind Ausländer!
5.1 Ankunft in der neuen Welt
5.2 Paradies und Hölle in einem
5.3 Erste Lichtblicke
5.4 Eine mutige Reise
5.5 Unsere Argentinierin
5.6 Halbzeit und Heimreise
5.7 Das letzte Jahr bricht an
5.8 Unser letztes Jahr im Ausland
6 Neustart in Deutschland
6.1 Zurück in der Heimat
6.2 Wir werden sesshaft
6.3 Zuhause am Wald
6.4 Zuhause im Antialtas
6.5 Zuhause in der Wüste
6.6 Der Islam gehört zu Deutschland
7 Alte Konflikte
7.1 Alltagsprobleme
7.2 Extremismus
7.3 Globale Eskalation
7.4 Der schamanische Weg
7.5 Ein Weg in die Freiheit
7.6 Der Weg der Mäßigung
7.7 Blüte und Krise des Islam
8 Neue Wege gehen
8.1 Von guten und von schlechten Meistern
8.2 Die Eine-Welt-Familie
8.3 Der Islam für mich
8.4 Die Weitergabe des Islam
8.5 Schlusswort
Anhang
1 Am Anfang war
2 Mein Weltbild als Erwachsener
3 Meine Kommentare zum Koran
Es gibt dreierlei Arten von Geschöpfen. Als Erstes die Engel, die reine Vernunft sind. Ihre Nahrung besteht aus Anbetung,
Dienst und Gottesgedenken. Davon leben sie so, wie der Fisch im Wasser lebt. Ihr Gehorsam gegen Gott wird ihnen nicht als Verdienst angerechnet, da er ihrer Natur entspricht.
Die zweite Art sind die Tiere, die reine Begierde sind und nicht von der Vernunft gesteuert werden. Das Ausleben ihrer Begierden wird ihnen nicht als Sünde angerechnet, da auch sie nur ihrer Natur folgen.
Die dritte Art ist der Mensch, der zur Hälfte aus Begierde besteht. Er ist halb Engel, halb Tier. Seine beiden Hälften liegen ständig im Kampf miteinander. Folgt er ganz seiner Vernunft, wird er zu reinem Licht und übersteigt in seinem Rang sogar die Engel. Folgt er ganz seiner Begierde, wird er niedriger als ein Tier.
Wir wurden von Gott erschaffen, damit sich die Wahrheit in uns offenbaren kann. Wir sind dazu bestimmt, ein Spiegel für das Gesicht des Geliebten zu werden. Bemühten wir uns nicht darum, welchen Wert besäßen wir dann noch?
Rumi (1)
Assalamu aleikum
ist arabisch und man liest es von rechts nach links. Ausgesprochen wird es „assalamu aleikum“ und es bedeutet: „Der Friede sei mit euch!“ Dies wünsche ich uns allen wirklich von ganzem Herzen, denn was wir mehr als alles andere in dieser Welt brauchen ist Frieden, Offenheit und Toleranz.
Michael Ibrahim ist mein Name. Ich bin Muslim -aber kein Sunnit, kein Schiit, kein Alevit, sondern einfach nur ein Konvertit!
Wenn mich hier in Deutschland jemand fragt, welche Religion ich habe, und ich antworte, dass ich Muslim bin, kommt immer dieser Moment des Schweigens, der Betroffenheit. Dann mustert man mich still als käme ich vom Mars oder aus einem IS-Trainingscamp. Wenn du auch Muslim oder Muslima bist, weißt du sicherlich, wovon ich spreche. Allen anderen kann ich nur versichern: Es ist keine Übertreibung. Im ersten Moment ist das für jeden ein Schock! Man schaut mich an wie ein Alien und ich spüre die Unsicherheit meines Gegenübers, wie er oder sie mir wohl begegnen soll. Diese Ausgrenzung klappt übrigens auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft prima. Wenn ich erzähle, dass ich ab und zu nach Indien fahre und Yoga mache, hin und wieder eine Kirche besuche, Schriften der Sufis und der Ahmaddiyas und anderer Religionen lese und einige ihrer Ideen richtig gut finde, werde ich häufig ausgegrenzt. Das ist schade, zumal die meisten Muslime, die dies tun, die Quellen gar nicht gelesen haben und nur ein vorgefertigtes Urteil von anderen übernehmen. So ist es der mehrheitlich nichtmuslimischen deutschen Bevölkerung kaum zu verwehren, wenn sie die gleichen Vorbehalte und Vorurteile über Muslimen hegen.
Wenn heute einige Pegida-Demonstranten oder gar ein Heimaminister schreien: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland!“ oder krasser noch die Rechten skandieren „Muslime raus!“, dann trifft mich das sehr, denn es greift direkt meine Familie an. Ich weiß zwar, dass gemeint ist, dass der Islam keine Tradition in Deutschland hat und würde dies auch bejahen, aber es unterstützt alle die vom rechten Flügel, die mit anderen Kulturen generell nichts zu tun haben möchten.
Ich bin nun einmal ein Urdeutscher, nur eben vor mehr als 10 Jahren zum muslimischen Glauben konvertiert. Ich vollzog dies auf dem marokkanischen Konsulat in Frankfurt einige Monate vor der Hochzeit mit meiner Frau Fatima, die aus Marokko stammt. Bevor ich sie heiratete, hatte ich den Koran (2) ganz gelesen und mir viele Gedanken gemacht, was in meinem Leben nach der Heirat anders wäre. Da ich mich als weltoffen und multireligiös empfand und ich es wichtig fand, eine gemeinsame Religion in der Familie zu leben, wollte ich es wagen. Ehrlich gesagt, habe ich mir nie träumen lassen, dass ich mich für eine Muslima entscheiden könnte. Ich selbst hatte immer eher auf eine heiße Brasilianerin getippt, die katholisch oder säkular aufgewachsen ist. Aber die Wege des Göttlichen sind unergründlich. Der Beamte auf dem Konsulat brachte es, nachdem ich das islamische Glaubensbekenntnis, die Shahada, ausgesprochen hatte, in gebrochenem Deutsch auf den Punkt: “Herzlichen Glückwunsch! Jetzt sind Sie Muslim! Sie dürfen ab jetzt nicht mehr stehlen, betrügen, ehebrechen und kein Schweinefleisch mehr essen.“ „Wie bitte? Ist dies das Bild, das er von uns Christen hatte? Sind etwa nur Muslime gute Menschen?“, fragte ich mich. Er legte mir die Konvertierungsurkunde in arabischer Schrift vor, in der ich lediglich das Datum und meinen Namen entziffern konnte. Egal, jetzt oder nie! Ich setzte meine Unterschrift darunter: Michael Ibrahim -ich war so verliebt! Den Namen Ibrahim habe ich mir übrigens ausgesucht, weil Abraham – arabisch Ibrahim – der Stammvater aller drei Buchreligionen ist, sozusagen der Urvater des Judentums, Christentums und des Islam. Aber in Marokko und in der Moschee nennen mich alle einfach Bruder Brahim. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig die Kulturen voneinander wissen und wie wenig Berührungspunkte sie haben. Dieses Unwissen wird von einigen wenigen zur Stimmungsmache und zur Spaltung der Bevölkerung ausgenutzt - ein gemeinsames Übel zwischen unseren beiden Kulturen, was ich ausgesprochen schändlich finde.
Die Leute, die mich als Kind kannten, sagen oft: „Das ist doch der Sohn von Werner und Maria, der früher in dem Dorf da lebte, bevor er studieren ging! Du bist Muslim?! Aber doch ein ganz normaler, oder?!“ – Ich hoffe es! Jedenfalls bin ich keiner von den Extremisten, den Faschos, welche uns tagtäglich in den Medien gebetsmühlenartig als „die “ Muslime präsentiert werden und an die die Leute immer als erstes denken. Ich gehöre keiner islamischen Tradition an und sehe vieles, was gerade in der Welt passiert, mit genauso viel Sorgen wie die meisten Deutschen das wohl tun. Wenn ich meinen Gebetsteppich ausrolle und bete, frage ich mich oft, was im Leben eines Extremisten so anders gelaufen ist, als in meinem. Welche Lebenserfahrung haben diese Jungs gemacht und wie können sie den Islam so radikal interpretieren? Wie bringt man junge Männer dazu, sich für die Bewegung irgendeines selbsternannten Führers zu opfern?
Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es die gleichen Mechanismen sind, die auch im dritten Reich funktionierten und in allen Führersystemen angewandt werden - ich werde im letzten Kapitel darauf eingehen. Ich glaube, dass die beste Medizin gegen Extremismus und Faschismus reichhaltige kulturelle Erfahrungen und Begegnungen sind, die dann eine reife Persönlichkeit und letztendlich eine reifere und gerechtere Gesellschaft hervorbringen. Man muss immer ganz wach sein für diese direkte Erfahrung und mit gesundem Menschenverstand die festgefahrenen Strukturen reflektieren. Wenn man die Welt wirklich unvoreingenommen wahrnimmt, wird man entdecken, wie wundervoll sie ist in all ihrer Unvollkommenheit. Man wird sich schnell der Mystik zuwenden, also dem Kern der Religionen, und nicht bei Ritualen und Verboten stehenbleiben. Man muss alle religösen Dogmen sowie kindliche Vorstellungen von Gut und Böse allmählich hinter sich lassen, ganz auf Gott vertrauen und wirklich aus jeder Erfahrung des Lebens lernen, und sei sie noch so bitter. Letzteres habe ich erst nach und nach zu schätzen gelernt. Ich glaube, man nennt dies Schattenarbeit (3), die Versöhnung mit unserer dunklen Seite. Wir erreichen erst unser volles Potenzial, wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Der Islam hat ein sehr ausgeglichenes Menschenbild und negiert keinesfalls die dunkle Seite unseres Wesens.
Ich betrachte es als ein Gottesgeschenk, dass ich so viele Kulturen und Meister kennenlernen durfte und eine Fülle negativer wie positiver Erfahrungen sammeln konnte. Als mystische Strömungen im Islam gibt es z.B. die Sufiorden und die Derwische, zu denen ich leider nur kurz Kontakt hatte. Zwar gibt es immer wieder Stimmen auch von Muslimen, wie z.B. Murad Winfried Hofmann, der in seinem Werk (4) vor den Gefahren eines Abgleitens des reinen Islams in einen Pantheismus warnt und herausstellt, dass der Islam Mystik und Rationalität verbindet; dennoch habe ich das Gefühl, dass er die Tiefe der mystischen Erfahrungen nicht kennt. Bei den Sufis heißt es:
Wenn du das Meer erreichst, höre auf, von Flüssen zu sprechen!
Ich hatte noch vor meiner Konvertierung die Ehre, einen wahren Sufimeister, einen Sheik, kennenzulernen und den Dikr, das islamische Gottgedenken, ganz praktisch zu erleben. Dieser Sheik sprach wie ein Vater zu mir und gab mir den Mut, die Konvertierung zu wagen und die spirituelle Tiefe des Islam und seiner Mystik zu erfahren. Diese fand ich auch in den Versen des persischen Dichters und Mystikers Rumi (1), der im 13. Jahrhundert lebte. Seine Worte und seine Dichtung erscheinen mir bei all den primitiven Ausdrücken, die man heute tagtäglich in den Medien hört, wie ein Juwel der menschlichen Sprache und zeugen von echten spirituellen Erfahrungen. Den ersten Kontakt zur Mystik bekam ich jedoch schon Jahre zuvor durch die Lehrbriefe eines großen Yogi, Paramhamsa Yogananda, einem indischen Guru, der in die USA auswanderte und durch seine Autobiografie (5) weltweit bekannt geworden war. In meinen dunkelsten Stunden in Argentinien, als der Sheik nicht zugegen war, die Lehrbriefe vergessen und ich mir einen lebenden Meister wünschte, traf ich meinen jetzigen Meister und meine größte Inspiration - den noch lebenden indischen Guru Sri Sri Ravi Shankarji, dem ich mehrmals persönlich begegnen durfte und den ich in diesem Buch liebevoll Guruji nennen werde (6).
Die Mystik transzendiert alle Religionen und verbindet das, was für die meisten Menschen widersprüchlich und getrennt erscheint. Sie öffnet uns die Tore zur Tiefe unseres Seins. Fast alle Religionsstifter waren Mystiker und gleichzeitig auch Vorbilder und Führungspersönlichkeiten. Guruji betont immer:
Diejenigen, die sich von der inneren Wahrheit leiten lassen, fühlen sich als Mitglieder einer Weltfamilie, in der alle ihren Platz und ihre Aufgabe finden.
Genau das war nach meinem Verständnis auch die Haltung des Propheten Mohammedsaw , der das größte Vorbild der Muslime ist. Ohne Führung eines Meisters kann man den Pfad nicht finden. Deswegen folgen die meisten Muslime auch der Sunna, der Überlieferung und den Gewohnheiten des Propheten. Unter der Führung eines falschen Meisters entsteht jedoch eine Perversion dieser Idee der Einheit – so etwas wie ein totalitärer Gottesstaat, wie der sogenannte IS ihn verkörpert. Ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen, um zu zeigen, an welchen Stellen ich in gewisser Weise die göttliche Gnade spüren durfte, die mich den geraden Weg führte, weg von Extremismus und Gewalt, und an welchen Stellen ich meine eigene Erfahrung machen und meine eigene Wahrheit finden durfte.
Das alles habe ich natürlich zum Großteil meinen Eltern zu verdanken, denen ich dieses Buch widme. Sie hatten wohl auch am intensivsten die Folgen meines spirituellen Wegs zu spüren und die Abkehr vom Katholizismus war für sie sicher eine herbe Enttäuschung. Tiefe Dankbarkeit empfinde ich auch gegenüber allen meinen Lehrern und Meistern aus den verschiedensten Kulturen, die ich hier zitieren werde und für deren Führung und Weisheit ich mich bedanke. Außerdem möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die mit mir im Alltag oder an diversen langen Abenden Diskussionen über den Sinn des Lebens geführt haben und mit denen ich manchen magischen Moment erleben durfte, Momente der Fülle und der Einheit des Seins. Und nicht zuletzt danke ich meiner Frau, die mit ihrer so fremdartigen Kultur für mich eine echte Herausforderung, aber auch eine Bereicherung war und ist. Ich hoffe und bete, dass wir unseren spirituellen Weg der Gottessuche noch vertiefen und diese Erfahrungen an unsere Kinder weitergeben werden.
Doch um stabile Beziehungen zu haben und das Leben zu einem Fest werden zu lassen, müssen wir uns selbst erkennen und besser mit unseren eigenen Emotionen und Wünsche umgehen lernen. Hierzu waren für mich Meditation, Gebet sowie Yoga- und Aikido-Übungen hilfreich. Sie ermöglichten es auch, die Menschen um mich herum intensiver wahrzunehmen. Den Meistern genügt schon ein Blick in deine Augen und er weiß, wer du bist. Nun, diese Stufe habe ich noch nicht erreicht, aber an manchen Tagen kann ich schon sehr viel aus den Augen meiner Mitmenschen herauslesen. Folgt man dem spirituellen Pfad, so entwickelt man nach und nach sein volles menschliches Potenzial und man hilft anderen aus tiefster Überzeugung. Das ganze Universum scheint einen dann dabei zu unterstützen. Im Islam heißt es hierzu sinnbildlich:
Gehst du einen Schritt auf Gott zu, so geht er hundert Schritte auf dich zu!
Ein Beispiel hierzu: Vor zwei Jahren wollte ich mit meinem Schülern auf der Kursfahrt nach Malta geflüchtete Menschen treffen, am Weihnachtsgottesdienst vor einem Jahr haben ich bereits Geflüchtete getroffen. Dieses Jahr wir als Familie geflüchtete Familien unterstützen können und bei uns zu Gast gehabt. Wie schade ist es da, tagtäglich in den Medien zu sehen, wie man sich nur auf das Promille an Extremisten konzentriert, die mich genauso beunruhigen. Ich hoffe, dass die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin in den Geflüchteten hilfesuchende Menschen sieht und sich mit ihnen offen, aber durchaus auch kritisch beschäftigt.
Dieses Buch soll nicht nur bunt und lustig, sondern auch unbequem sein. Es ist für alle gedacht, die ein wenig aus ihrer Komfort-Zone heraus kriechen und neue Wege gehen wollen, unabhängig von Weltanschauung und Religion. Es richtet sich an alle Menschen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und das Gefühl haben, sie seien auf der Suche und würden gerne noch tiefer in das Geheimnis eintauchen. Es erzählt in wesentlichen Punkten meine persönliche Geschichte und gibt dir als Leser die Chance, die vielfältigen Begegnungen nachzuerleben, mit mir durch die verschiedenen Kulturen zu reisen und auch die Widersprüche zu erleben. Es hat mich Jahre gekostet, alle Geschichten und Gedanken kompakt zusammenzufassen. Ich erhebe nicht den Anspruch, alles vollständig und historisch korrekt wiederzugeben. Aus Respekt vor meinen Mitmenschen habe ich auf allzu intime Details verzichtet, nur Vornamen verwendet und einige davon auch geändert. In meiner Wahrnehmung sind wir alle Brüder und Schwestern und sollten gegenseitig aus unseren Erfahrungen lernen. Möge Gott uns alle segnen und mögen wir alle die Vielfalt des Lebens schätzen lernen, den eigenen Weg finden und glücklich werden. Dies bedeutet es für mich, ein spiritueller Mensch zu sein und somit Gott nahe zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich in vielen Momenten immer diese göttliche Führung gespürt habe und dem nahen Verderben entrinnen konnte. Das will wohl auch Sure 1 des Korans (2) ausdrücken, wenn es heißt „führe uns den geraden Weg“, denn alles, was nicht dem göttlichen Plan folgt, ist zum Scheitern verurteilt. Mögen wir alle diesen geraden Weg finden und ihn beschreiten, wohin auch immer er führen wird!
Feedback und Fragen bitte an: [email protected]
1 Alte Wege verlassen
1.1 Das Ende einer heilen Welt
„Wer bin ich?“ – das ist wohl die schwierigste Frage, die man sich stellen kann. Aber ich möchte genau mit dieser Frage anfangen. Als Kind war es irgendwie sehr einfach für mich, hierauf zu antworten. Ich wusste intuitiv, wer ich bin, und wo ich hingehöre und sogar, wo ich herkam. Irgendwo in meinem alten Tagebuch aus der Grundschulzeit liegt ein mit Bleistift verfasstes Zettelchen, auf welches ich als Drittklässler eine Geschichte über mich selbst geschrieben habe, die meine Mutter damals sehr erstaunte. Sie spielt im Himmel und handelt davon, dass ich Angst davor habe, in einem Körper geboren zu werden, der den Gesetzen der Zeit unterliegt, also irgendwann altert und stirbt. Ich erkannte mich also schon damals intuitiv als unsterbliche Seele und wusste, dass ich in einem sterblichen Körper stecke. Nun, ganz so hochgestochen habe ich es damals nicht ausgedrückt, aber man erkennt genau diesen Sinn. Im Anhang des Buches befindet sich auf Seite 319 der Originaltext. Viele Jahre später hielt ich plötzlich ein Buch in den Händen mit dem Titel „Ich komme aus der Sonne“ (7) von einem jungen Mann aus Argentinien, der Ähnliches ausdrückte. Nach ein paar Recherchen lernte ich aus dem Internet, dass man uns Indigo-Kinder nennt. Heute denke ich, dass dies nichts Besonderes ist und immer mehr Kinder, die jetzt geboren werden, schon diese Entwicklungsstufe erreicht haben, sich als unsterbliche Seele zu erkennen. Sie verstecken dies im Alltag aber meistens.
Geboren wurde ich Anfang der siebziger Jahre in einer katholischen Familie, die seit etwa 280 Jahren das gleiche Fleckchen Erde besiedelt und dort bis heute Ackerbau und Weinbau betreibt, in einem Dorf, welches noch vor wenigen Jahrzehnten zu hundert Prozent katholisch war. Somit war es für mich als Kind niemals eine Frage, welcher Religion und Weltanschauung ich folgen wollte. Ich wurde getauft, ging zur Kommunion und zur Firmung und spürte dabei trotz der zunehmenden Kritik von außen und den unzähligen Kirchenaustritten, dass mir meine Gemeinde eine Heimat bot, dass die Gottesdienste mir halfen, mich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen, dass die Beichte mir zwar schwer fiel, aber mich wahrhaftig erleichterte. Ich erinnere mich auch, dass der Empfang der Sakramente für mich oft mit tiefen spirituellen Empfindungen verbunden war.
Unser Pfarrer aus Kroatien legte viel Wert auf Jugendarbeit und fuhr sogar mit uns auf Jugendfreizeiten. Er war ein wahrhaftiger Diener des Herrn, ganz ohne falsche Absichten, wie sie so manche katholischen Priester in der Vergangenheit gezeigt hatten. Das überzeugte mich. Der Glaube, die Gemeinschaft, die Riten - das war für mich alles eins, eben der Katholizismus, meine Religion.
Ausländerkinder gab es praktisch keine oder sie fielen mir nicht auf. In der vierten Klasse sangen wir ein seltsames Lied, dass uns im Rahmen der Gesundheitserziehung beigebracht wurde. Es richtete sich aber eindeutig gegen Muslime, die viele mit den uns fremden türkischen Gastarbeitern gleichsetzten:
C-A-F-F-E-E1, trinkt nicht so viel Caffee! Nichts für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven macht dich schwach und krank, sei doch kein Muselmann, der das nicht lassen kann!
Natürlich habe ich damals nicht verstanden, dass es mit Gesundheitserziehung nur wenig zu tun hatte sondern zur kulturellen Abgrenzung diente. Es sollte ganz klar die Idee in uns verankert werden, dass wir die überlegene Kultur sind. Aber ein viel überzeugenderes Vorbild war meine Familie, besonders meine Mutter, die ihr Christsein mit aktivem Engagement in der Gemeinde und vielen guten Taten für ihre Mitmenschen zeigte. So engagierte ich mich nach der Kommunion für lange Zeit als Messdiener und pflegte die Gräber der verstorbenen Geistlichen, obwohl mein bester Freund schon nach einem Jahr der Kirche den Rücken zukehrte, weil man in der Gemeinde über seinen kranken Vater herzog. Meine Mutter bestärkte mich immer, dass der Dienst in der Kirche etwas Gutes sei und mich zu einem guten Menschen machen würde, der es sicher irgendwann einmal in der Himmel schaffen sollte. Solche Vorstellungen waren selbst für mich als Jugendlicher noch sehr konkret und motivierten mich, eine Ausbildung zum Lektor zu machen, ja ich konnte mir sogar vorstellen, irgendwann das Amt eines Diakons zu übernehmen. Meine Mutter war sehr stolz auf mich, denn sie hatte wohl alles richtig gemacht. Mein Vater war auch engagiert in der Gemeinde, aber in seiner Haltung eher offen und kritisch gegenüber jedem System mit Dogmen. Doch auch er unterstützte mein Engagement. Selbst nach Abschluss der Schule mit dem Abitur, wo viele Jugendliche aus meinem Jahrgang schon aus der Kirchengemeinde verschwunden oder sogar ganz aus der Kirche ausgetreten waren, ging mein Engagement weiter. Unzählige Male stand ich am Altar. Meine Spezialität waren Beerdigungen, bei denen es nebenher auch immer ein bisschen Taschengeld von den Angehörigen der Verstorbenen gab. Ich hätte die Totenlitanei mittlerweile schon allein halten können, aber damals war es gar nicht notwendig, denn es gab noch genug Seelsorger. Die Lieder, die in unserer Kirche immer gesungen wurden, konnte ich alle schon auswendig. Manchmal hielt ich mit meiner Mutter und anderen Katecheten zusammen Wortgottesdienste und Fürbittgebete.
Aber nicht nur in der Kirchengemeinde sondern auch im Kindergarten und in der Schule lief alles sehr gut. Ich fühlte mich dort sehr geliebt. Bereits als Winzling im Kindergarten drückte ich mich der Erzieherin oft in ihren großen Busen, was diese offensichtlich auch gerne zuließ. Ich spielte meist mit den Kindern aus der Nachbarschaft und hatte gegen Ende sogar eine erste Sandkastenfreundin namens Uta, mit der ich während der ganzen Grundschulzeit ein Herz und eine Seele war. Sie war gewissermaßen eine sehr junge Vertreterin der durch den Club of Rome (8) aufkeimenden Umweltbewegung, die schließlich die Grünen-Partei hervorbrachte. Durch sie habe ich sehr viele weibliche Gefühle und Verhaltensweisen in mein Wesen integriert und einen engen Bezug zur Natur und zum Umweltschutz gefunden. Untypisch für einen Jungen, spielte ich mit ihr oft draußen am Bach. Wir bestimmten Pflanzengattungen oder suchten nach verletzten Tieren, um diese dann zu pflegen. Obwohl sie ein hübsches Mädchen war und ich sie sehr mochte, hatte ich nie eine körperliche Beziehung zu ihr. Einmal habe ich sie aus lauter Über-schwänglichkeit geküsst, worauf sie mich bat, das in Zukunft zu unterlassen. Trotzdem blieben wir unzertrennliche Freunde.
In der Schule war ich im ersten Jahr nur am Träumen, anstatt Interesse fürs Lernen zu zeigen. Ich fand es so langweilig, die ganze Zeit im Klassenraum zu sitzen. Daran muss ich heute als Lehrer oft denken. In der Grundschule waren wir noch alle brav und liebten unsere Lehrerin sehr. Schlägereien auf dem Schulhof gab es in meiner Erinnerung keine. Wohl aber einen alten Nazi-Polizisten, der mir bei der Fahrradprüfung mal zeigen musste, dass er der Chef ist und sich mit seinen 100 Kilogramm auf meine Zehspitzen stellte, weil ich 2cm über die weiße Linie auf dem Boden übertrat. Immerhin ließ er mich trotzdem die Prüfung bestehen.
Als die Grundschulzeit vorbei war, fuhr ich mit dem Bus zwei Dörfer weiter und ging dort auf eine katholische Privatschule, wo mich meine Eltern angemeldet hatte. Tatsächlich musste man für eine erfolgreiche Anmeldung nachweisen können, dass man getauft ist und aktiv in einer Gemeinde engagiert ist. Um den großen Pott an öffentlichen Fördermitteln zu erhalten, nahm man aber auch eine gewisse Quote Ketzer auf, also evangelische und muslimische Kinder, aber meines Wissens keine Atheisten. An dieser Schule gefiel es mir sehr gut und ich schaffte es auf das Gymnasium, aber mit dem Einsetzen der Pubertät flogen nun öfters mal die Fetzen. Ich erinnere mich noch an viele massive Auseinandersetzungen mit den Lehrern, die wir nicht mochten. Diese waren teils so stark, dass zwei Lehrerinnen heulend aus der Klasse rannten. Auch Mobbing unter Schülern passierte fast täglich, nur nannte man es damals noch nicht so. In der 8. und 9. Klasse hatte ich wöchentlich blaue Flecken auf dem Oberarm, weil wir uns gegenseitig in der Pause prügelten. Einmal flog sogar mein geliebter Delsey-Koffer aus dem 3. Stockwerk des Gebäudes in den Schulteich, weil ich soeben einen frechen Spruch gegen einen Mitschüler losgelassen hatte. Es war schwer, sich seinen Platz zu erkämpfen und akzeptiert zu werden, denn die Hackordnung unter den Jungs war auch an einer katholische Schule streng.
Als ich als Zweitjüngster in die Oberstufe eintrat und immer noch mit Mobbing zu kämpfen hatte, entschloss ich mich kurzerhand Karate zu erlernen. Unser Meister war Sensei Udo, ein junger Sportlehrer, den wir sehr verehrten. Schon nach einem Jahr respektierten mich selbst die Mitschüler, die größer und stärker waren. Ich musste mich nicht einmal im Kampf gegen sie profilieren. Allein meine neue Ausstrahlung als geschulter Karateka genügte, um mir den nötigen Respekt zu verschaffen. So wurde ich sogar zum stellvertretenden Sprecher des Gymnasialzweigs gewählt. Manchmal wurde es auch echt peinlich. Mehrmals überschätzte ich meine neuen Fähigkeiten in Kämpfen und im Zerschlagen von Materialien derart, dass ich entweder nach Kontertechniken des Gegners meterweit durch den Raum flog oder beim Zerschlagen von Ziegelsteinen mehrfache Knochenbrüche erlitt. Einmal verließ ich nach einer Karate-Schulvorführung die Sporthalle mit einem aufgeschlitzen Fuß und zog eine lange Blutspur hinter mir her, ohne es zu merken. Als es mir dann auffiel, erregte ich sofort das Mitleid vieler junger Mütter und ihrer Töchter, was mir gar nicht so unangenehm war.
Obwohl ich eher eine pazifistische Grundhaltung hatte und kriegerische Handlungen ablehnte, wollte ich trotzdem etwas über den Krieg und seine Regeln lernen, über den mein Großvater Franz mir des Abends so oft Geschichten erzählt hatte. Ich entschloss mich, nicht zu verweigern und nach der Schulzeit zur Bundeswehr zu gehen. Hier lernte ich eine sehr wichtige Lektion, die vielen Jugendlichen heute schlichtweg fehlt: Sich durchbeißen! Als Winzerssohn war ich zwar schon die körperliche Arbeit im Freien gewohnt und hatte bereits einen stattlichen Körperbau, nun aber lernte ich auch unter schwierigen kriegsähnlichen Bedingungen durchzuhalten. Ich glaube, dass heute die Hälfte der Bevölkerung einen Krieg nicht überleben würde, weil sie körperlich und psychisch schlichtweg nicht in der Lage ist, derartige Belastungen durchzustehen. Das tägliche Leben als Soldat war besonders anfänglich sehr hart. Nach jedem Lichtblick folgte wieder eine tiefes Loch. Es fing damit an, dass man mich der Freiheit beraubte und mir zusammen mit einem Saarländer ein rosa Zimmer gab, worauf man uns als schwul brandmarkte. Beim Herumsitzen während des Wachdienstes nahm man mir meine mitgebrachten Mathebücher ab, in denen ich mich während der Nacht weiterlernen wollte, und ersetzte sie durch ebenfalls mitgebrachte Heftchen mit expliziten Nacktfotos. Weil ich ein Winzerssohn war, glaubten alle, dass ich auch viel Alkohol trinken würde, was aber gar nicht der Fall war. Ich schaffte es zum Weinhändler in unserer Einheit aufzusteigen. Doch dies hatte auch dunkle Seiten. Nun weckte man mich nachts, nur weil die alkoholhaltigen Getränke leer waren, und wenn ich nicht aufstehen wollte, wurde ich zeitweise geschlagen oder durch eine Hand unter der Decke sogar sexuell belästigt, bis ich den Spind öffnete und den von zu Hause mitgebrachten Wein herausgab. Aber allmählich verstand ich die Muster und wurde der heimliche Weinlieferant der ganzen Kompanie inklusive der Vorgesetzten und später sogar die Vertrauensperson der Einheit. So konnte ich schließlich nach der Grundausbildung nett mit dem Bataillonskommandeur ein Schwätzchen halten, während die anderen Jungs draußen im Dreck herumrobbten und sich gegenseitig beschimpften.
„Michael, wie gefällt es dir auf dem Klotzberg bei den Soldaten?“, fragte mich mein Onkel aus einem Nachbardorf ein paar Monate später. Ich klagte ihm mein Leid, dass dort alles so profan war und wenig intellektuell und ich meine erste tiefe Krise gerade hinter mir hatte, die folgenden Auslöser hatte: Wir waren mehrere Tage draußen im Biwak in simulierten Kampfhandlungen, während es ununterbrochen regnete. Ich verbrachte die Nächte meist in der Schützengrube und am Tage robbten oder rannten wir durch den Wald, mal mucksmäuschenstill und mal laut schreiend wie Rambo. Man bekam maximal zwei Stunden Schlaf pro Nacht. Ich fror und war gestresst vom rauen Ton der Vorgesetzten und dem Mobbing durch die Kameraden. Ich versuchte mich zurückzuziehen und sammelte Holz für ein kleines Feuer. Nach einem Dutzend missglückten Versuchen, das nasse Holz zu entzünden, rastete ich aus und schrie über den ganzen Truppenübungsplatz in die Nacht hinein: „Verdammte Scheiße!!! Ich habe die Schnauze voll! Spielt euren Scheißkrieg alleine! Ich gehe jetzt nach Hause!“ Wutentbrannt schmiss ich mein G3, die Braut des Soldaten, in den Dreck und rannte los. Natürlich wurde ich schon nach ein paar Metern von meinen Kameraden gestoppt. Bevor ich mich versah, stand mein Unteroffizier vor mir. „Soldaaaat!!! Stillgestanden! Soll ich Sie erschießen? Sie wollen wohl Fahnenflucht begehen? Ist das Ihr Plan?“ Ich schaute zu Boden und stammelte: „Nein, Herr Unteroffizier, ich bin einfach nur fertig. Ich friere, bin erkältet, habe kaum geschlafen und kann nicht mehr!“ Und prompt kam die Antwort, die mich überraschte: „Kanonier! Sie haben Glück, dass wir uns nicht wirklich im Krieg befinden und dies nur eine Übung ist. Sonst hätte ich Sie tatsächlich erschießen müssen, wenn Sie in Richtung Feind gelaufen wären. Ich befehle Ihnen in die Dackelgarage zu gehen und vier Stunden zu schlafen, dann reden wir weiter. Abtreten!“ Die Dackelgarage war das Zweimann-Gefechtszelt, von dem jeder Soldat eine halbe Plane in seiner Ausrüstung mit sich trug. Man knöpfte sie zusammen, hob eine 2m lange und 1,80m breite Grube aus und spannte die Plane darüber auf, so dass man gerade so darunter liegen konnte. Ich verkroch mich also und legte mich auf meine Isomatte in den schlammigen Waldboden und betete, dass ich das wohl alles ohne psychischen Schaden überstehen und hoffentlich niemals einen echten Krieg erleben würde.
Mein Gebet wurde erhört, denn nachdem ich diese Geschichte meinem Onkel erzählt hatte, fragte er mich, ob ich als Betreuer im katholischen Jugendzeltlager mitfahren wolle, wo er noch immer ehrenamtlich tätig war und wo ich wohl als Kind auch schon teilgenommen hatte. Das Tolle an dem Angebot war, dass man dafür Sonderurlaub bei der Bundeswehr beantragen konnte, weil man ja in der Jugendpflege arbeitete. Ich war begeistert. Kurze Zeit später händigte er mir einen gestempelten Brief des Pfarrers aus mit der Bitte, mich freizustellen, da das Lager in diesem Jahr sonst wohl nicht stattfinden könne. Ich war total euphorisiert als ich sonntagsabends mit dem Zug zurück nach Idar-Oberstein fuhr. Auf dem Fußweg hoch zur Klotzbergkaserne hoffte ich, dass mein Antrag angenommen würde, und malte mir aus, wie ich mich fühlen würde, wenn ich tatsächlich zwei Wochen frei bekäme. Doch zunächst wurde ich mit einem Schlag wieder in die bittere Realität zurück katapultiert, denn der Lauf zweier G3-Gewehre war auf mich gerichtet. Ich schluckte und fühlte mich wieder genauso ohnmächtig wie im Biwak kürzlich und wollte am liebsten wegrennen. „Halt, stehen bleiben!“ riefen die beiden Wachen der Kaserne. Ich stand sofort still. „Hey, was ist denn mit euch los? Ich bin doch ein Kamerad!“, schrie ich durch den Zaun. „Tut uns leid! Erhöhte Alarmstufe wegen der Milzbrandattacken letzte Woche und Warnung wegen möglicher terroristischer Anschläge! Truppenausweis zeigen, Klappe halten und nicht bewegen!“ Ich tat, wie mir befohlen, und wurde schließlich als clean befunden. Am nächsten Tag genehmigte mein Hauptfeldwebel tatsächlich mein Urlaubsgesuch - das war wie Weihnachten für mich! Ich hätte ihn umarmen können, aber so etwas tut ein Soldat nicht.
Diese zwei Wochen Sommerzeltlager waren für mich unglaublich wichtig. In alter Soldatenmanier schlief ich in meinem Zelt ohne Luftmatratze direkt auf dem Waldboden, diesmal ganz ohne Regen. Ich kam als Gruppenleiter mit meinen Spielen und Ideen gut bei den Jungs an. Die Mädchen himmelten mich an, weil ich durch das harte Leben bei der Bundeswehr eine sehr stattliche Figur hatte, sportlich und braungebrannt war. Zwei Mädchen fielen mir besonders auf. Sie hießen Andrea und Marina, hatten beide wunderschönes schwarzes langes Haar und sprachen kein Deutsch. Mein Onkel klärte mich auf, dass sie aus Brasilien seien und ihren Urlaub bei der Tante in Deutschland verbringen würden. Ich schien der Einzige zu sein, der ihr Englisch mit stark südamerikanischem Akzent verstand. Ich war also immer zur Stelle, wenn sie Probleme oder Fragen hatten, sei es nur aus Englisch zu erklären, dass das Seltsame auf ihrem Teller gebratene Blutwurst mit Sauerkraut ist oder sei es bei zwischenmenschlichen Problemen zu vermitteln. Die Tatsache, dass ich immer stärkere Gefühle besonders für Andrea hegte, verkomplizierte die Situation natürlich tagtäglich, so dass mein Onkel mich bat, bis zu Ende des Lagers Zurückhaltung zu üben. Am Ende des Lagers war ich sehr traurig bei dem Gedanken, die beiden nie wieder zu sehen. Beim traditionellen Abschlusstreffen auf der Dorfkerb überkam mich tiefe Traurigkeit, bei dem Gedanken, dass ich Andrea vielleicht niemals wiedersehen würde und ihr bisher nicht sagen konnte, wie sehr ich sie mag. Ich suchte sie den ganzen Abend in der sich amüsisierenden Menschenmenge aber fand sie erst in letzter Minute, kurz bevor ich zurück in die Kaserne fahren musste. Wir verabschiedeten uns tief bewegt und tauschten die Postadressen aus, um uns in Zukunft schreiben zu können. Ich ahnte damals nicht annähernd, wie sehr dieser Moment mein Leben verändern sollte. Das Erlebnis Zeltlager insgesamt war für mich so beglückend, dass ich ab jetzt jedes Jahr dabei war, auch ohne Andrea. Ich fand meine Erfüllung darin, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sowohl als Soldat, wie auch später als Student. In einem Jahr, als ich aufgrund meiner Erfahrung bereits Lagerleiter war, wäre der Abschlussgottesdienst beinahe ausgefallen, weil der Priester krank war und nicht kommen konnte. Kurzerhand übernahm ich seine Rolle. Alle Kinder, Betreuer und Eltern feierten inbrünstig mit mir Gottesdienst in einem großen weißen Zelt mitten im Grünen. Das war eine gute Erfahrung für mich und ich kam mir keineswegs als Betrüger vor, weil ich ja den kirchlichen Segen für dieses Amt nicht hatte.
Aber zurück zur Bundeswehrzeit: Mein Hauptfeldwebel genehmigte mir sogar im letzten Monat meines Dienstes, an der Soldatenwallfahrt nach Lourdes teilzunehmen. Auch das war für mich ein einzigartiges Erlebnis und hat mir gezeigt, dass es auch unter den Soldaten alle Typen von Persönlichkeiten gibt. Es reisten sogar Atheisten mit, die an der Grotte der hl. Bernadette beteten und das einzigartige Quellwasser tranken. Beim Kreuzweg trug ein Kamerad, der absolut ohne Religion aufgewachsen war, die Kranken über Kilometer und war gerührt von den Gebeten und der meditativen Stimmung. Mein Kumpel Andi und ich freundeten uns mit einem amerikanischen Priester an, mit dem wir viel über Religiöses und über das Leben diskutierten. Nach dem Abschlussgottesdienst in der unterirdischen Basilika, den wir zusammen mit 40.000 Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt feierten, sagte er zu uns: „You are good guys! At least one of you should become a priest!“ - Einer von uns sollte Priester werden! Aber wohl kein katholischer Priester, denn wir jagten doch beide ständig den Mädels hinterher! Selbst auf der Wallfahrt buhlten wir um die Gunst einer jungen Amerikanerin. Ich fühlte mich aber durchaus bestärkt, in meinem Ziel vielleicht einmal Diakon zu werden oder in irgendeiner Weise von der Existenz Gottes zu zeugen und die hier erlebte Spiritualität weitergeben zu dürfen. Mit dem feierlichen Lied Land of hope and Glory aus Pomp and Circumstance verließen wir Lourdes und so endete in gewisser Weise auch mein Soldatenleben glorreich, denn den Rest habe ich schlicht vergessen.
Zu Hause ging ich in Wochen danach wieder begeistert in die Messe und träumte von den vielen Begegnungen in Lourdes. Nach einigen Monaten jedoch verblassten diese Erfahrungen und ich langweilte mich wieder während der Gottesdienste. Als ich mir einestags unsere Kirchengebäude genauer anschaute, fielen mir die vielen Heiligenstatuen auf. Sie stellten für mich unerreichbare Vorbilder dar, eine Art Übermenschen, die mit einer ganz besonderen Mission auf diesen schönen Planeten gekommen sind, um der Menschheit Gutes zu tun. Außerdem störte ich mich immer mehr an dem großen gemalten Altarbild, welches ganz oben ein Dreieck mit dem alles sehenden Auge zeigte, darunter dann eine Szene in den Wolken, wo ein alter Mann mit einem Globus in der Hand dasaß und sich mit einem spärlich bekleideten jungen Mann, der ein Kreuz in den Armen trug, unterhielt. Darüber schwebte eine weiße Taube. So fragte ich eines Tages nach einem Sonntagsgottesdienst meinen Opa Franz, ob dieses Bild denn seinen Gottesvorstellungen entspräche: Der Vater, als alter Mann, der die Erde buchstäblich in der Hand hält, der Sohn, der wohl schon weiß, dass er gekreuzigt wird, und der heilige Geist in Form der Taube, die über den beiden schwebt. Ich fand das Bild sehr seltsam und sträubte mich innerlich dagegen. Außerdem fragte ich mich immer, ob Jesus, auch wenn er der Sohn Gottes sei, genauso Lust auf junge Frauen hatte wie ich in diesem Alter. Natürlich empfand ich derartige Fragen als ketzerisch und schmutzig und schämte mich gehörig dafür. Da hatte die katholische Erziehung ganze Arbeit geleistet. Meine Gedanken drehten sich im Kreis. In vielen theologischen Fragen kam ich keinen Schritt weiter, und den Auslegungen, die die Kirche mir anbot, konnte ich teilweise nicht zustimmen. Oft haben wir in der Familie diskutiert, ob Jesus nun wirklich Wunder vollbracht hatte oder ob das alles nur im übertragenen Sinne zu verstehen sei. Da sind auch öfters mal verbal die Fetzen geflogen im Austausch zwischen den Generationen und uns hat es so manchen Sonntag verhagelt.
1.2 Wissenschaft statt Religion
Als ich im Alter von 19 Jahren dann anfing, Physik an der Uni zu studieren, begann meine atheistische Phase. Das ist sehr bemerkenswert, denn die Wallfahrt nach Lourdes lag nicht lange zurück und mein Soldaten-Kumpel Andy studierte jetzt auch mit mir zusammen. Nach unserem Wiedersehen in der Einführungswoche und dem Kennenlernen der Studienkollegen stellte ich im anschließenden Mathe-Vorkurs fest, dass ich bei der Bundeswehr anstatt den Heften mit den nackten Mädchen doch wohl besser die Mathebücher gelesen hätte. Alle schienen schlauer zu sein als ich und konnten sich hervorragend konzentrieren. Mir gelang das überhaupt nicht mehr, weil ich keine Übung mehr darin hatte. Ich verzweifelte und wurde depressiv. Die ganze Situation eskalierte Woche für Woche bis ich am ersten Weihnachtstag im Haus meiner Eltern regungslos auf dem Wohnzimmerteppich lag und auf die Spitze des Tannenbaums blickte, die mir unerreichbar schien.
„Papa, ich glaube ich schaffe das Physik-Studium nicht. Ich kann schon froh sein, wenn ich später mal einen Job als Hausmeister bekommen werde!“, sagte ich zu meinem Vater. Der aber verstand, wie ich mich fühlte und redete mir die ganzen Weihnachtsferien gut zu. Irgendwann in den folgenden Monaten, nachdem ich mich bei einer alten Schulfreundin ausgeheult hatte, der es mit ihrem Medizinstudium genauso ging, platze dann der Knoten und mein Gehirn war wieder einsatzbereit. Nun hatte ich mein Selbstvertrauen zurück und war heiß, die Geheimnisse der Physik und der Mathematik zu erlernen. Selbst im Schlaf arbeitete mein Gehirn noch weiter an logischen Rätseln und einige Male bin ich in meiner Studentenbude schlafwandelnd zum Schreibtisch, weil ich dachte, die Weltformel endlich gefunden zu haben. Aber als ich dort ankam, wunderte ich mich immer, wie ich denn dort gerade hingekommen war. Weil ich mich nicht erinnerte, was ich da wollte, ging ich zurück in mein Bett.
Tagsüber frustrierte es mich immer noch, mit meinen Kumpels, von denen die meisten ein Einser-Abitur hatten, die Übungen zu machen. Diese waren bereits schon mit dem Lösen der Aufgaben beschäftigt, da hatte ich noch nicht einmal die Aufgabenstellung gelesen. Aber ich biss mich durch. Woche für Woche lernte ich viel dazu und steigerte meine kognitigen und logischen Fähigkeiten. Man züchtete mich zu einer rational logisch denkenden Superbrain heran und ich vernachlässigte unbewusst andere wichtige Bereich des Lebens, wie Religion und Partnerschaft. Die Professoren und ihre wissenschaftliche Lehre machten einen großen Eindruck auf mich. Die Bücher enthielten spannende neue Fakten und ich hatte das Gefühl, dass ich nur noch ein paar Jahre studieren müsse, dann würde die Religion für mich ohnehin überflüssig werden, also legte ich sie innerlich bereits ab.
Wenn ich am Wochenende zu Hause war, ging ich trotzdem noch in die Kirche, war bis zu meinem 25. Lebensjahr Messdiener und sogar noch eine Jahre länger Lektor. Alles andere wäre in meinem Dorf ja einem Rufmord gleichgekommen! Außerdem hätte ich viele in meiner Familie sehr unglücklich gemacht. Dass es später trotzdem so kommen würde und auch nicht zu vermeiden war, wusste ich damals noch nicht. Welch Ironie des Schicksals!
Doch auch diese Phase hatte viel Gutes: Ich stellte alle Dogmen in Frage und akzeptierte nur das, was für mich logisch, oder besser noch, direkt erfahrbar war, was also definitiv wahr sein musste. Die Mathematik gab mir neue Einblicke in das Konzept der Unendlichkeit. So viele ungelöste Problem gab es in der Mathematik, obwohl sich schon derart viele schlaue Menschen regelrecht die Köpfe zerbrochen hatten. Ich liebte z.B. die Fraktale Geometrie mit ihren bizarren Formen und besonders das überraschende Ergebnis des Chaos-Spiels(9), welches mich immer wieder verblüffte, weil aus all der Zufälligkeit nur aufgrund der Existenz einer festen Regel eine perfekte Ordnung entsteht. Ich sah darin das Wirken eines höheren Gesetzes, das ich aber nicht Gott nannte. Die Physik erhellte mir parallel dazu die Geheimnisse unseres Universums, so dass ich trotz aller Rationalität immer wieder in ehrfürchtiges Staunen versetzt wurde. Mir war damals noch nicht bewusst, dass dieses Staunen aus allem Zweifel heraus etwas ganz Wichtiges und Wunderbares war, nämlich das Tor zu einer echten Spiritualität. Es war der Anfang jener Suche nach Wahrheit, auf die sich jeder Mensch einmal begibt. Es ist nicht nur die Frage: „Wer bin ich?“ sondern auch: „Wo komme ich her? Was ist dieses Universum in dem wir leben? Hat das Ganze einen Sinn? Folgt es einem Plan?“
Leider erstickte der Alltag meinen Drang zur Sinnsuche. Nach vielen Jahren des Studiums war ich so geprägt vom analytischen Denken und der naturwissenschaftlichen Methodik, dass ich das Wahrnehmen und das Staunen nicht mehr zulassen wollte und jeden logischen Widerspruch im Alltag nur als Ärgernis sah. Probleme waren für mich ein Ansporn, noch kompliziertere Theorien zu entwickeln und für magische oder gar mystische Momente war kein Platz. In unserer verkopften westlichen Welt haben sich schon viele Menschen darin verloren, die gedanklich entworfene Karte mit der Welt selbst zu verwechseln. Sie glauben, wie ich damals, daran, dass es keinen Gott gibt und man stattdessen die Weltformel bald finden wird, mit der man alles ganz logisch und haarklein erklären kann. Dieses Extrem, die sogenannte deterministische Weltsicht, welche Blaise Pascal und Isaak Newton vertraten, ist aus heutiger Sicht klar durch die moderne Physik zu widerlegen. Die Chaostheorie allein macht dem Determinismus schon einen Strich durch die Rechnung, aber letztendlich ist es die Quantentheorie bzw. die Quanteninformationstheorie, die erklärt, dass jeder Determinismus auf der Ebene der Atome und Elementarteilchen völlig absurd ist. Hier gelten Wahrscheinlichkeitsgesetze wie z.B. in (10) und (11) dargelegt.
1.3 Brasilien und die erste Liebe
Nach etwa einem Jahr im Studium war ich bereits auf rational denken programmiert und überzeugt, alle Probleme des Lebens rational lösen zu können. Doch an Silvester, als ich gerade dabei war eine Feuerzangenbowle zuzubereiten und dabei fast den Partykeller abfackelte, verliebte ich mich etwas überraschend und absolut heftig in ein Mädchen von meiner Ex-Schule. Sie hieß Yassi und war gerade dabei, ihr Abitur abzulegen. Ich kannte sie flüchtig aus meinem Karateverein, in dem ich nun seit einigen Jahren leidenschaftlich trainierte. Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, denn wie gesagt, meine Welt an der Uni war geprägt durch die Gesetze der Logik, durch Experimente, Formeln, Rechnungen und Analysen - und nun das: Ich war einfach Hals über Kopf innerhalb kürzester Zeit verliebt und nichts war mir wichtiger.
Wir schrieben uns unzählige Briefe - Emails waren noch nicht für jedermann verfügbar, ganz zu schweigen von Messenger-Diensten! Über die Jahre wurden wir wirklich zu einem Paar, das alle bewunderten, denn wir gingen sehr respektvoll miteinander um und hatten nie ernsthaft Streit. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass wir am Freitag Mittag, wenn wir beide aus der Uni heimkamen, erst einmal Stressabbau betrieben. Wie schlüpften in den Karate-Gi und verprügelten uns gegenseitig mit unseren Boxhandschuhen. Danach genossen wir die Zweisamkeit, einmal in ihrem und einmal in meinem Zimmer. Das war für meine Mutter oft ein Problem, zumal das Mädchen nicht katholisch sondern protestantisch war. Aber neben all den kleineren und größeren Problemen erlebten wir sehr schöne Momente und spürten, dass uns diese Beziehung gut tat und uns weiter brachte. Zurückblickend muss ich sagen, dass das erste Mal, wenn man sich ganz und gar verliebt, ein sehr wichtiger Moment ist. Zum ersten Mal ist das eigene Ich nicht mehr so wichtig und man hat das Gefühl, dass einem die ganze Welt gehört. Auf natürliche Weise erfährt man also eine Erweiterung des Bewusstseins über den eigenen Körper hinaus. Man hat das Gefühl, schweben zu können, und man ist mit der ganzen Welt eins. Welch mystisches Erlebnis! Derartig starke Emotionen waren neu für mich. Ich versuchte mit aller Kraft, an meiner antrainierten Rationalität festzuhalten. Ich wollte stark sein, die Welt weiterhin exakt erfassen und mir alles logisch erklären können. Um diese Fesseln des rationalen Ego zu lösen, bedurfte es einer längeren Reise nach Brasilien, die ich kurz vor meinem Diplom machte.
Andrea und ich hatten uns tatsächlich seit Jahren geschrieben. Ich spürte immer noch ein starkes Gefühl der Liebe, die mich an sie band, aber nicht wie als Geliebte sondern als Geschwister. Heute wo ich dies schreibe, weiß ich, dass die Liebe uns Menschen zusammenführt, um uns gegenseitig zu helfen und unser volles Potenzial zu verwirklichen. Damals war ich natürlich im Zwiespalt, weil ich ja in einer Beziehung war und gleichzeitig fühlte, dass Andrea mir fehlte. In der Zeit, in der ich gerade die Thesen meiner Diplomarbeit niederschrieb, bekam ich wieder einmal meine Krise und wollte einfach nur weg. Andrea schrieb mir einen aufmunternden Brief und lud mich darin ein, sie und ihre Familie in Brasilien zu besuchen. Ich war nicht abgeneigt, aber meine Freundin und meine Familie waren noch sehr skeptisch. Ein paar Wochen später kam tatsächlich ihr Vater Jorge zu uns nach Hause und lud mich noch einmal persönlich ein. „Habt ihr denn auch schon fließendes Wasser und Fernsehen in Brasilien?“, fragte ihn mein Opa Franz ganz besorgt, als er erfuhr, dass ich auf einem anderen Kontinent in dem Schwellenland Brasilien für einige Zeit verweilen wollte. Jorge musste schmunzeln und erzählte, dass die Militärdiktatur seit 1985 überstanden sei und die wirtschaftliche Entwicklung gut voran gehe, und ja, man habe all dies in der Mittelschicht schon zur Verfügung. Er arbeitete im Agrarministerium unter Präsident Fernando Henrique Cardoso und hatte immer tolle Geschichten zu erzählen, vor allem über seine Begegnungen mit den Xavantes-Indianern im Amazonasgebiet, deren Stimme er über einige Jahre im Parlament sein durfte. So reiste ich im Dezember 1998 tatsächlich für drei Monate nach Brasilien. Für drei Monate konnte ich einen Blick in die neue Welt werfen und dabei auch eine neue Sprache erlernen, die ich in Grundzügen schon in VHS-Kursen angefangen hatte. Die Erlebnisse öffneten mich buchstäblich und ließen meine Persönlichkeit reifen. Ich wurde gelassener, tanzte gerne und war voll im Hier-und-Jetzt. Ich kam mir vor wie Alexander von Humboldt und habe ein ganzes Buch mit Berichten, Skizzen und portugiesischen Vokabeln gefüllt sowie mehrere Diafilme geschossen. Viele Vorträge habe ich vor Verwandten, Freunden und Schülerinnen und Schülern darüber schon gehalten. Vielleicht schreibe ich darüber eines Tages ein weiteres Buch, meine brasilianischen Freunde würden sich sehr freuen. Hier will ich nur einige exemplarische Momente herausgreifen, die mich besonders veränderten:
So war es oft nicht einfach, meiner Familie in Deutschland und meiner Freundin Yassi, die mitten in den Prüfungen am Ende ihres Semesters in Medizin war, verständlich zu berichten, was hier gerade mit mir passierte. Brasilianer und vor allem Brasilianerinnen sind sehr viel körperlicher und direkter als wir Deutschen es sind. So wurde ich ständig eingeladen, betätschelt, Mädchen gingen mit mir aus und tanzten mit mir. Eines Abends, es war kurz vor Weihnachten während eines Tanzes in der Kakadu-Bar, küsste mich eine Schulabsolventin, die gerade im Freudenrausch über ihren guten Abschluss war und mich schon den ganzen Abend beobachtet hatte. Ich hatte zuvor den Abend brav an der Bar neben der Tanzfläche verbracht und eine paar Caipis getrunken, als mich die Sehnsucht packte und ich mich plötzlich unglaublich einsam fühlte. Alle anderen waren eng umschlungen am Tanzen und amüsierten sich. Meine Freundin Yassi würde erst in mehr als zwei Monaten nachreisen und das alles hier erleben - die Schwüle der Nacht, die Magie der Musik, die Lebensfreude, das Fehlen von Berührungsängsten. Ich hatte beobachtet, dass jenes Mädchen mich die ganze Zeit von der Tanzfläche aus beobachtete und wohl mit mir tanzen wollte. Ich sprach mit Andrea, ob es hier üblich sei, einfach ein Mädchen zum Tanzen aufzuforden. Sie antworte: „Ja, klar! Sie wird sich freuen. Denk nicht so viel! Genieße den Abend und die Musik!“ Ich dachte: „Was soll schon passieren? Wir sind ja schließlich nicht alleine in einem Motelzimmer! Geh tanzen, Junge!“ Und so ging ich auf das Mädchen zu, welches mich mit einem „Oi, tudo bem?“ begrüßte. Wir tanzten miteinander und schon nach drei Liedern legte sie ihren Arm um meinen Hals und zog mich nach unten, zunächst nur, weil sie nah an mein Ohr wollte, um mich nach meinem Namen zu fragen. Ich verriet ihn ihr und fragte nach ihrem. Sie hauchte zurück, „Michael, you are my christmas present!“ Ab diesem Moment hatte sie die Kontrolle übernommen. Ich ließ mich sogar von ihr führen und während des nächsten ruhigen Liedes tanzten wir eng umschlungen und küssten uns dabei minutenlang. „Wow, da fühlt man sich machtlos!“ Mir ging alles Mögliche durch den Kopf von „Wahnsinn, ich fühl mich so lebendig und will mehr!“ bis „Oh, mein Gott, was macht dieses Mädchen mit mir? Meine Freundin wird mich umbringen!“ Doch der Zauber endete einge Stunden später, als meine Freunde mit mir zum nächtlichen Hamburgerfuttern aufbrachen und man würde all dem keinerlei Bedeutung mehr zumessen. Ich sah Carol in der nächsten Zeit auch nicht wieder, weil dann Weihnachten war und meine Rationalität endlich wieder einsetzte. An Weihnachtsfeiertagen habe ich lange mit Yassi telefoniert und ihr, naiv wie ich war, leider alles erzählt. Sie verstand die Welt nicht mehr und meine Motivation zu dieser Affäre, wenn man dies als eine solche bezeichnen konnte, schon gar nicht. Ich widerum verstand ihre Empörung nicht, weil hier bei jeder Gelegenheit Jungs und Mädchen miteinander spielten, tanzten, rumknutschten und in die Kiste sprangen. Ich hatte nur eine einzige Nacht nicht aufgepasst und schon standen fünf Jahre Liebe und Vertrauen auf der Kippe.
Doch das Leben in Brasilien ging weiter! Über Silvester fuhren wir mit zwölf anderen Freunden in zwei Autos nach Rio. Die Entfernung entspricht in der von Frankfurt nach Barcelona, also rund 1300 Kilometer. Andreas Freundin Renata hatte uns ein kleines Appartement in Ipanema für die Silvestertage überlassen, das nur ca. 50 Meter vom Strand lag. Der Wachmann sah uns in zwei vollbeladenen Autos kommen und fragte: „Wo wollt ihr denn hin?“ „Zu Renatas Appartement im dritten Stock wollen wir und 14 Tage Rio erleben!“, antworteten wir freudestrahlend. „Aber das sind doch alles nur Fünfzehn-Quadratmeter-Appartements!“, antwortete er verwundert. Wäre er Deutscher gewesen, hätte er uns wohl zum Teufel gejagt, aber er ließ uns passieren. Wir mussten alle erst einmal lachen, als wir die Appartementür öffneten, denn das Zimmer war tatsächlich winzig. Auch hier hätten Deutsche wohl möglich angefangen zu fluchen und zu schimpfen und wären dann abgezogen, auf der Suche nach einer besseren Bleibe. Aber Brasilianer können super improvisieren und finden immer eine Lösung. „Vamos dar um jeito!“, wie es dort heißt – „Lasst uns das Unmögliche möglich machen!“ Wir stapelten also die wenigen Möbel einschließlich der Couch übereinander und legten den Boden mit Luftmatratzen aus. Das Fenster hinter Klo und Dusche, die von der ursprünglichen Schlafecke nur durch einen Vorhang abgetrennt waren, musste offen bleiben, sonst war die Luft unerträglich. Überhaupt war es ein komisches Gefühl, nur hinter einem Vorhang aufs Klo zu gehen, wo man wusste, dass alle die Geräusche hörten. Die anderen waren schon damit beschäftigt, einen Plan zu machen, wann wer wo schlafen darf. Es gab zwei Schichten, eine von Mitternacht bis um vier Uhr und eine von vier bis acht Uhr, auf mehr als vier Stunden Schlaf im Appartement hatte man keinen Anspruch. Alle waren schließlich einverstanden und wir gingen zum Stand, wo wir einen traumhaften Sonnenuntergang über dem smaragdgrünen Meer von Ipanema erlebten.
Als es schließlich dunkel wurde, saß ich für einem Moment alleine am Meer und schaute versunken in die Wellen. Plötzlich kam Andrea und fragte mich, wie ich mich fühle und an was ich denken würde, so fern von zu Hause. Ich hatte schließlich zum ersten Mal einen anderen Kontinent betreten und war nun mit einer Horde wilder Brasilianer nach Rio gereist. Ich war etwas verwundert über die Frage, weil an meiner Uni in all den Jahren mich niemand so etwas gefragt hatte. „Ich denke gerade an die Uni und versuche mich an all die Formeln zu erinnern, mit denen man die Wasserwellen beschreiben kann!“ antwortete ich. Sichtlich entsetzt schaute sie mich an, schüttelte den Kopf und sagte: „Mente polluida!“, was wörtlich „verschmutzter Geist!“ bedeutet. Damit meinte sie wohl, dass ich nicht mehr in der Lage war, die Wirklichkeit an sich wahrzunehmen. Ich war immer am analysieren, studierte lieber die Karten anstatt über das Land zu stauen, das ich gerade bereiste. Aber so langsam kam ich dahinter, wie man loslässt.