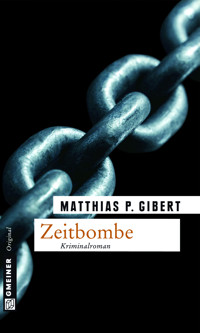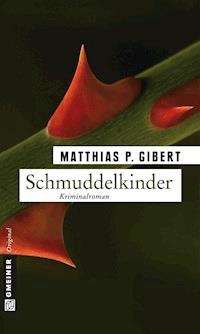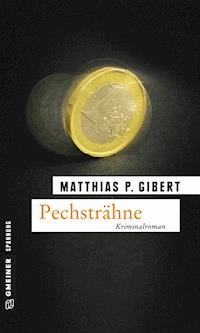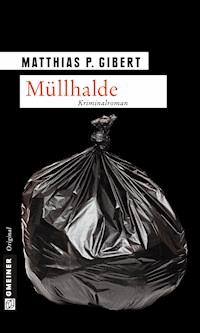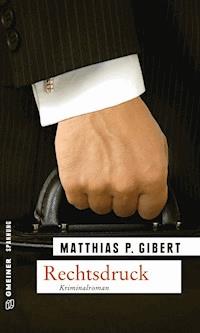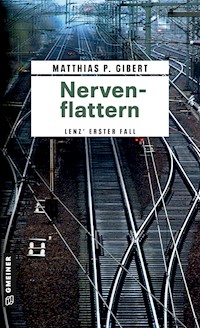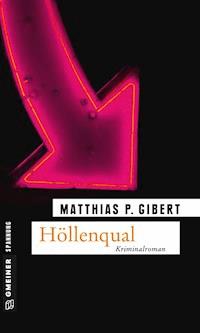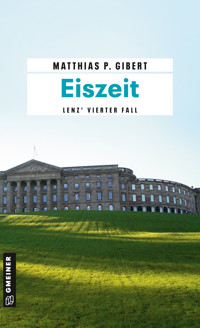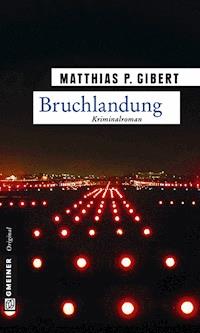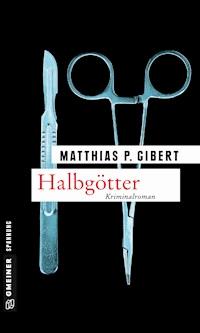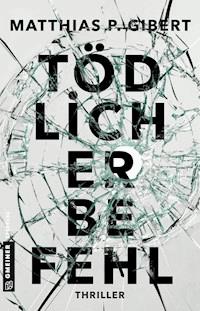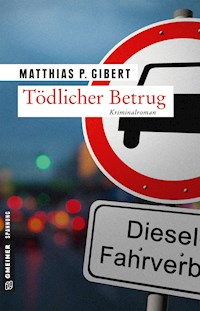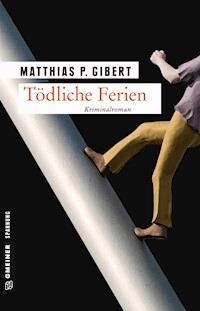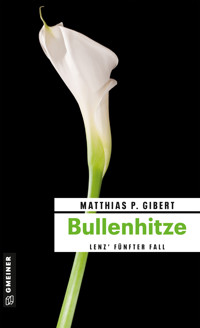
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Lenz und Hain
- Sprache: Deutsch
Günther Wohlrabe, Eigentümer des größten Bestattungsunternehmens der Region, stirbt nach einem Dinner in the Dark qualvoll. Was zunächst nach einem natürlichen Tod aussieht, entpuppt sich schon bald als raffiniert ausgeführter Mord: Wohlrabe wurde mit den hochgiftigen Samen der Rizinuspflanze getötet. Kurze Zeit später steht Hauptkommissar Paul Lenz von der Kripo Kassel vor einer zweiten Leiche: Der Bauunternehmer Werner Kronberger wurde tot in seinem Auto aufgefunden - mit laufendem Motor und einem Schlauch im Auspuff, der die Abgase in das Wageninnere leitete. Die Obduktion ergibt, dass er vor seinem Tod mit einem Elektroschocker betäubt wurde. Außerdem finden sich auch in seinem Körper Spuren von Rizinussamen. Und Lenz findet heraus, dass es zwischen den Toten eine weitere Gemeinsamkeit gibt: Beiden waren am Bau von Deutschlands größtem Krematorium im nahe gelegenen Hofgeismar beteiligt, einem höchst umstrittenen Projekt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias P. Gibert
Bullenhitze
Lenz’ fünfter Fall
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / Korrekturen: Daniela Hönig / Doreen Fröhlich, Sven Lang
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von fotolia.com / Weiße Calla Lilie © Linleo
ISBN 978-3-8392-3446-4
1
Das Klingeln des Telefons störte Horst Brandau zur absoluten Unzeit. Samstags nach 19 Uhr sollte man ihn nicht stören. Bei den meisten Männern übrigens sollte man um diese Zeit nicht anrufen; zumindest nicht bei denen, die kein Premiere-Abo haben. Sportschauzeit.
Der große, übergewichtige Mann wuchtete sich fluchend aus dem Sessel und trabte zum Sideboard, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden.
»Brandau«, stöhnte er genervt in den Hörer.
»Hallo, Herr Brandau, hier ist Liane Bötsch.«
Er musste einen Moment nachdenken, bevor er den Namen und die Stimme mit einem Gesicht in Verbindung gebracht hatte. Die Chefin seiner Frau.
»’n Abend, Frau Bötsch. Is’ gerade schlecht, wegen der Sportschau. Was gibt’s denn?«
Sie zögerte, ehe sie antwortete. »Es ist wegen Ihrer Frau. Können Sie mal ganz schnell herkommen?«
»Zu Ihnen, ins Geschäft?«
»Genau.«
Im Fernsehen wurde Lukas Podolski an der Strafraumgrenze brutal von den Füßen geholt, doch der Schiedsrichter wollte nichts gesehen haben und forderte ihn auf, weiterzuspielen.
Brandau trippelte von einem Bein aufs andere. »Wie gesagt, is’ im Moment gerade gar nicht gut. Sportschauzeit ist heilig, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Es wäre aber wichtig.« Sie holte tief Luft. »Wegen Ihrer Frau.«
Podolski handelte sich wegen Reklamierens eine gelbe Karte ein.
»Was ist denn mit meiner Frau?«
»Darüber möchte ich am Telefon nicht spechen. Kommen Sie einfach her, am besten sofort.«
Brandau hätte kotzen können. Köln gegen Bayern, und er sollte sich in die Menschenmassen des Samstagsgeschäftes stürzen. Scheiße aber auch.
»Ich komme, muss mir nur schnell was anziehen. Bin in fünf Minuten da.« Hoffentlich hat sie keinen Scheiß gebaut, dachte der Bauarbeiter, als er den Schlüssel ins Zündschloss seines alten VW-Golf steckte.
Aus den fünf Minuten wurden zehn, weil er dreimal um den Block fahren musste, bis er einen Parkplatz ergattert hatte. Vor der Tür des Schuhgeschäftes, in dem seine Frau stundenweise aushalf, erwartete ihn eine kleine Menschenansammlung, die durch die Schaufensterscheibe ins hell erleuchtete Innere glotzte. Ein paar Meter entfernt kreisten die blauen Lichter eines verlassenen Notarztwagens. Brandau wischte sich einige Schneeflocken von der Stirn, drängelte sich durch, schob die Glastür auf und betrat den nach Leder riechenden Laden.
Liane Bötsch stand mit dem Rücken zur Eingangstür im Durchgang zum Lager. Mit dem dezenten Signal der Klingel, das Brandau ausgelöst hatte, drehte sie sich um. Ihr Gesicht war rot und feucht, die Hände hielt sie vor den Mund gepresst.
»Es tut mir so leid …«, stammelte sie.
Brandau hatte keinen Schimmer, wovon die Frau sprach.
»Was ist denn hier los, Frau Bötsch? Is’ was passiert? Ich meine wegen dem Notarztwagen da draußen.«
Sie drehte sich um und fing leise an zu schluchzen.
Er sah irritiert an ihr vorbei in das kleine Lager. Dort blieb sein Blick an einem Paar dunkelblauer Schuhe hängen, die nach oben ragten und sich leicht hin und her bewegten. Es waren die gleichen, mit denen seine Frau einige Stunden zuvor zur Arbeit gegangen war. Auch die dunklen Strumpfhosen, die aus den Schuhen lugten und ein paar kräftige Frauenbeine umhüllten, kamen ihm bekannt vor. Er machte einen schnellen Schritt vorwärts und wollte den Raum betreten, wurde jedoch von einem in rot und neongelb gekleideten Rettungssanitäter gestoppt. Dahinter kniete ein weiterer Mann auf dem Boden, auf dessen Rücken in großen Buchstaben ARZT zu lesen war, und der sich hektisch auf und ab bewegte. Dabei presste er seine ineinander gefalteten Hände auf die nackte Brust einer Frau, die leblos, mit zerrissener Bluse und grau angelaufenem Gesicht, vor ihm lag. Horst Brandaus Frau. Aus ihrem Mund ragte ein schwarzer Plastikstopfen, der mit Heftpflaster um die Lippen herum verklebt war, und an dessen Ende ein durchsichtiger Schlauch hing. Über sie gebeugt stand ein weiterer Sanitäter mit einem Infusionsbeutel in der einen Hand. Mit der anderen versuchte er, die Anschlusskabel der Elektroden, die auf ihrer Brust angebracht waren, aus der Reichweite des Arztes zu halten. Hinter den Männern sah Brandau mehrere große, silberne Koffer, deren Klappen wie riesige Mäuler aufstanden. In einem davon war ein Gerät eingebaut, das einen leisen, dauerhaften Ton von sich gab. Überall lagen die Verpackungen der Utensilien herum, deren die Männer sich bedient hatten.
Der Bauarbeiter betrachtete ein paar Augenblicke lang die Szenerie, dann drehte er sich um und wankte einige Schritte zurück.
»Was ist denn mit ihr? Ist ihr nicht gut?«, fragte er Liane Bötsch, die mit zwei weiteren Mitarbeiterinnen vor einem Stiefelregal stand, besorgt.
»Ich glaube, es geht ihr gar nicht gut, Herr Brandau.«
Aus dem kleinen Lager drang ein unterdrücktes Stöhnen. Brandau und die Frauen drehten sich um und sahen, wie der Arzt sich erhob und die Gummihandschuhe von den Fingern streifte.
»Das war’s«, erklärte er dem Rettungssanitäter mit resignierter Geste. Damit warf er die Handschuhe neben sich auf den Boden und betrat den Verkaufsraum. Frau Bötsch weinte nun hemmungslos.
»Es tut mir leid«, begann der Mediziner, »aber es war nichts mehr zu machen. Sie ist tot.«
Brandau schien noch immer nicht zu verstehen, was sich eigentlich abspielte.
»Sie sind der Ehemann?«, fragte der Arzt Brandau, bekam jedoch keine Antwort. Deshalb nickte Frau Bötsch heftig mit dem Kopf. »Ja, das ist ihr Mann.«
Horst Brandau sah von links nach rechts in die Runde, warf einen Blick auf die bewegungslosen Füße einen Raum weiter, und in diesem Moment dämmerte ihm, was passiert sein musste. »Das kann doch gar nicht sein. Sie kann doch nicht gestorben sein.«
»Doch, Herr Brandau, so leid es mir für Sie tut, aber Ihre Frau ist tot«, erklärte der Notfallmediziner. Brandau hörte ihm nicht zu, zumindest schien es so, sondern ging langsam zurück ins Lager. Dort kniete er sich neben seine tote Frau, zog ihren noch immer teilweise entkleideten Körper zu sich und umschlang sie. Ihre schlaffen Arme schleiften dabei über den Boden.
Eine Zeit lang später später befand sich Brandau noch immer in der gleichen Stellung. Um ihn herum waren die Sanitäter damit beschäftigt, die Geräte zu verpacken, den Müll aufzusammeln und anschließend die Koffer nach draußen zu schleppen. Der Notarzt trat hinter ihn und legte ihm vorsichtig die Hand auf die Schulter.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie stören muss, Herr Brandau, aber wir müssen weiter. Und es sind noch ein paar Formalitäten zu klären, bevor wir fahren.«
Der große, dicke Mann ließ seine tote Frau sanft zu Boden gleiten, nickte und stand auf.
»Ich habe hier den vorläufigen Totenschein«, erklärte der Mediziner. »Die Daten habe ich dem Personalausweis entnommen, den die Geschäftsführerin in der Tasche Ihrer verstorbenen Frau gefunden hat.«
Brandau senkte den Kopf und betrachtete seine Frau. »Wie geht es jetzt weiter? Nehmen Sie sie mit?«
»Nein, das dürfen wir nicht. Ich habe schon den Allgemeinmediziner verständigt, dessen Adresse auf der Quittung für die Praxisgebühr steht; auch die hatte Ihre Frau glücklicherweise in der Tasche. Er müsste in ein paar Minuten hier sein. Wenn er die Leichenschau vorgenommen hat, stellt er den Totenschein aus, dann kann der Leichnam abtransportiert werden. Damit müssten Sie einen Bestatter beauftragen.«
Brandau fuhr sich mit seiner schwieligen Pranke durchs Haar. »Und wo bekomme ich den her, heute, am Samstag und um diese Uhrzeit?«
»Das ist ganz einfach. Nahezu alle Bestatter haben einen Notdienst, der rund um die Uhr erreichbar ist. Wenn Sie im Branchenbuch nachsehen und sich vielleicht noch einen der drei großen aussuchen, sollte es keine Probleme geben.«
»Wer sind denn die drei großen?«
Der Arzt nannte die Namen von drei Bestattungsunternehmen.
»Wohlrabe hab ich schon mal gehört«, erwiderte Brandau.
»Gut, dann nehmen Sie den doch. Soll ich die Geschäftsführerin bitten, ihn zu benachrichtigen?«
Wieder betrachtete der Bauarbeiter den Leichnam. »Ja, bitte.«
Kurz nachdem der Notarzt mit seinen Leuten den Laden verlassen hatte, betrat ein etwa 50-jähriger, schlanker Mann mit grauen Haaren und einem großen Aluminiumkoffer in der Hand den Schuhladen und stellte sich als Dr. Horstmann vor. Er begrüßte freundlich die Anwesenden und kondolierte Brandau. »Ich habe den Notarzt noch kurz draußen im Wagen gesehen, er hat mich über alles informiert.«
Dann ließ er sich die Tote zeigen, bat darum, alleingelassen zu werden, zog den Vorhang zum Lager zu und begann mit der Untersuchung. Unterdessen hatte Liane Bötsch den Laden geschlossen und die übrige Belegschaft nach Hause geschickt. Auch der Menschenauflauf vor der Tür hatte sich aufgelöst.
»Möchten Sie einen Kaffee, Herr Brandau?«, fragte sie leise.
»Nein danke, ich will nichts trinken«, gab er abwesend zurück, ohne den Blick von der Auslegeware auf dem Boden zu heben.
»Kann ich sonst etwas für Sie tun?«
»Nein, ich brauch nichts.« Sein Ausdruck hatte nun fast etwas Unwirsches.
»Dann gehe ich jetzt nach unten und mache den Tagesabschluss. Wenn etwas sein sollte, müssen Sie nur rufen, ja?«
Er nickte. Sie nahm die Schublade aus der Kasse, ließ einen Ausdruck folgen und verzog sich. Brandau starrte noch immer regungslos auf den Boden.
31 Jahre. So lange waren er und Hannelore bis zu diesem Samstag verheiratet. Während all dieser Jahre war der Umgang zwischen ihnen nie von den ganz großen Gefühlen geprägt gewesen. Nicht, dass seine Frau das nicht gewollt hätte, aber es war ganz einfach mit Horst Brandau nicht zu machen gewesen. Sie waren seit der Konfirmationszeit miteinander gegangen, hatten den ersten Kuss und die ersten schüchternen Annäherungsversuche gemeinsam erlebt und mit keinem anderen Menschen mehr ausprobiert. Den Heiratsantrag hatte er ihr nach einer schnellen Nummer auf dem Rücksitz seines alten Käfers gemacht, und ein Antrag im eigentlichen Sinn war es gar nicht. Eher hatte er ihr erklärt, wie es mit ihnen weitergehen würde.
In der ersten Zeit wollte er partout ein Kind, am liebsten natürlich einen Sohn, aber daraus wurde nichts. Und mit dem weiteren Verlauf der Ehe hatte er es zu schätzen gelernt, keine Kinder gezeugt zu haben. So vergingen die Jahre, und mit ihnen verflüchtigte sich jegliches Gefühl für den Partner. Hannelore und Horst Brandau lebten nebeneinander her, sprachen wenig miteinander und waren trotzdem auf ihre spezielle Art zufrieden mit ihrem Leben. Sie hatte immer stundenweise im Schuhladen ausgeholfen, seit sie vor vielen Jahren aus ihrem Heimatdorf nach Kassel gezogen waren, weil er einen Job bei einem großen Bauunternehmen bekommen hatte. Er arbeitete viel, machte Überstunden, so oft es ging, und vergnügte sich ein- oder zweimal im Monat in einem Puff mit immer der gleichen Rothaarigen, der zweiten Frau in seinem Leben. Hannelore wusste nichts davon, und wenn, hätte es ihr nichts ausgemacht, denn ihr Mann war ihr seit vielen Jahren gleichgültig. Oft hatte sie daran gedacht, sich scheiden zu lassen, doch vor der Alternative, dem Leben ohne Partner, hatte sie eine Heidenangst. Also war sie geblieben. Und nun lag sie tot im Lager eines Schuhladens, gestorben an einem schwachen Herzen, das vor mehr als zwei Jahren schon einen leichten Infarkt erlitten hatte, der allerdings unbemerkt geblieben war.
Es klopfte leise an der Scheibe. Brandau hob den Kopf und sah in die Gesichter von zwei Männern. Beide trugen schwarze, schlecht sitzende Anzüge, schwarze Mützen und billig wirkende Schuhe in eben dieser Farbe. Er wusste nicht, ob er öffnen sollte, doch diese Entscheidung wurde ihm von der die Treppe hochstürzenden Liane Bötsch abgenommen, die sofort auf die Eingangstür zuhielt.
»Die Bestattungsfirma«, murmelte sie dabei.
Eine knappe halbe Stunde später standen Brandau und Dr. Horstmann, der die Untersuchung beendet hatte, neben dem Eingang zum Lager, wo die beiden Mitarbeiter des Bestattungsinstituts damit beschäftigt waren, die Leiche in einen Sarg zu heben.
»Das mit dem Totenschein geht klar?«, wollte einer der beiden von dem Mediziner wissen.
»Ja, alles klar, Sie können sie mitnehmen«, erwiderte Dr. Horstmann.
»Hat sie leiden müssen, Herr Doktor?«, fragte der Witwer.
»Nein, das bestimmt nicht. Sie wussten ja sicher, dass es mit ihrem Herzen nicht zum Besten stand.«
»Ja, sie hat doch immer diese Medikamente nehmen müssen.«
»Und nun hat ihr Herz seinen Dienst versagt«, erklärte der Arzt.
»Einfach so?«
»Ja, das geht manchmal einfach so; so leid es mir auch für Sie tut. Immerhin war Ihre Gattin seit mehr als 15 Jahren meine Patientin.«
»Und es geht so schnell?«
»Das geht schnell, ja. Einerseits ist es gut, nicht leiden zu müssen, andererseits hat man als Hinterbliebener keine Möglichkeit zum Abschiednehmen. Aber ich kann Ihnen nochmal versichern, dass Ihre Frau wirklich nicht gelitten hat.«
»Wenigstens was«, erklärte Brandau emotionslos.
»Ich werde mich nun an den Schreibkram machen«, teilte der Mediziner mit. »Da ist leider immer eine ganze Menge zu tun.«
Damit griff er zu seinem Koffer, kramte einige A-4-Blätter und Umschläge daraus hervor und begann zu schreiben.
»Wo ist Ihre Frau geboren, Herr Brandau?«, war seine einzige Frage in den nächsten Minuten.
»In Schwalmstadt.«
Dann waren die Schreibarbeiten erledigt und der Mediziner händigte den Mitarbeitern des Bestattungsinstituts die Papiere aus.
»Ihre Rechnung kommt zu uns, Herr Doktor?«
»Ja, die schicke ich zu Ihrer Firma.«
»Dann laden wir sie jetzt ein und bringen sie weg.«
»Machen Sie das.«
Horstmann packte seinen Kram zusammen, ließ die Verschlüsse des Koffers zuschnappen und reichte Brandau die Hand zum Abschied.
»Auf Wiedersehen, Herr Brandau, und alles Gute für Sie. Wenn irgendetwas ist, können Sie mich gerne anrufen.«
2
Hauptkommissar Paul Lenz stieg in seinen neuen Wagen, ließ den Motor an, legte den ersten Gang ein, und rollte langsam vom Hof des Händlers. Mit einem breiten Grinsen sinnierte er darüber, dass er sich noch nie in seinem Leben ein fabrikneues Auto gekauft hatte. Und dass er bis vor ein paar Tagen auch nicht damit gerechnet hätte, es jemals zu tun. Während er den Kleinwagen durch den samstäglichen Verkehr steuerte, wuchs seine Freude über das bevorstehende Treffen mit Maria in Fritzlar mit jeder Motorumdrehung.
Seit mehr als drei Wochen hatte er seine große Liebe nicht gesehen. Zuerst war sie mit ihrem Mann, dem Kasseler Oberbürgermeister Erich Zeislinger, für zehn Tage in Amerika gewesen. Von dort war sie mit einer deftigen Erkältung zurückgekommen, die sie für mehr als eine Woche aus dem Verkehr gezogen hatte. Doch nun war sie soweit genesen, dass eines der heimlichen Treffen mit ihrem Geliebten in Fritzlar möglich war.
Lenz fuhr am Auestadion auf die Autobahn, schaltete wegen des einsetzenden Regens den Scheibenwischer ein, und drehte die Musik etwas lauter. Danach regulierte er den Tempomat auf die erlaubten 100 Stundenkilometer und lehnte sich genüsslich zurück. Als er an der Autobahntankstelle hinter Baunatal vorbeikam, sah er interessiert nach rechts. Von den Schäden, die während einer Verfolgungsjagd mit ein paar Schwerkriminellen vor etwa einem halben Jahr entstanden waren, war nichts mehr zu sehen. Das stark in Mitleidenschaft gezogene Gebäude war danach abgerissen und neu aufgebaut worden.
Zwischen Gudensberg und Fritzlar trat er für ein paar Sekunden das Gaspedal bis zum Boden durch und wunderte sich über die Kraft, die der kleine Dreizylinder freisetzte.
Dann hatte er sein Ziel erreicht. Er stellte den Wagen auf dem Parkplatz hinter der Fußgängerzone ab und machte sich auf den Weg zur Arztpraxis seines Freundes Christian, eines Psychiaters. Dort angekommen, legte er die Sektflasche ins Eisfach, schaltete die Kaffeemaschine ein, und schüttete die mitgebrachten Süßigkeiten in eine Schale, weil er wusste, dass Maria nur höchst ungern aus der Tüte aß.
Während er bei Musik aus dem Radio wartete, dachte er über den Fall nach, der ihn über Wochen beschäftigt, und den er glücklicherweise am Morgen gelöst hatte. Ein älterer Mann und seine Frau hatten eine wohlhabende Nachbarin beraubt und umgebracht. Von Anfang an standen die beiden unter Verdacht, doch zu beweisen war ihnen die Tat nicht gewesen. Bis sich am Vortag ein Juwelier meldete, dem sie ein Collier angeboten hatten, das er selbst dem Mordopfer vor Jahren angefertigt hatte. Nach einer langen Nacht des Leugnens war die Frau am Morgen mürbe geworden und hatte ein Geständnis abgelegt.
Der Hauptkommissar sah auf die Uhr über der Tür und danach auf seine Armbanduhr. Maria war seit mehr als einer halben Stunde überfällig. Das war nicht außergewöhnlich, weil sie sich häufig verspätete und ihre zeitlichen Planungen eher den Charakter einer unverbindlichen Ankündigung hatten. Doch bis dato war es ihr immer möglich gewesen, ihre Verspätung per Telefon mitzuteilen. Dass sie es heute nicht tat, irritierte Lenz.
Er wartete eine weitere halbe Stunde, bevor er zum Telefon griff und ihre Kurzwahlnummer drückte. Sofort ertönte der Ansagetext ihrer Mailbox. Lenz drückte, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, die rote Taste, goss sich eine Tasse Kaffee ein, und sah erneut auf die Uhr. Um 22.20 Uhr, also knapp zwei Stunden, nachdem er angekommen war, räumte er seine Sachen zusammen und verließ die Praxis. Bis dahin hatte er mehr als zwei Dutzend erfolglose Versuche unternommen, sie zu erreichen. Auch ihren Festnetzanschluss in Kassel hatte er vom Praxistelefon aus angerufen. Dort wurde ebenfalls nicht abgenommen.
Das Zucken der Blaulichter am wolkenverhangenen Himmel war kilometerweit zu sehen. In Lenz’ Hals bildete sich schlagartig ein Kloß, der ihm die Luft abzuschnüren drohte. Mit zitternden Fingern schaltete er einen Gang zurück, trat das Gaspedal voll durch und trieb den neuen Motor zur Höchstleistung. Immer wieder versuchte der Polizist sich einzureden, dass das alles nur eine unglückliche Duplizität sein müsse, obwohl er sich innerlich sicher war, dass es nicht stimmte.
Die abgesperrte Unfallstelle lag auf der Gegenspur der A 49, etwa auf Höhe der Autobahnbrücke über die L 3221 zwischen Gudensberg und Besse. Lenz erkannte im Gewirr der Blaulichter die total zerstörten Überreste eines vermutlich blauen Lieferwagens und eine durchgeschlagene Leitplanke, etwa 50 Meter davon entfernt. Er verließ die Autobahn, parkte unter der Brücke, sprang aus dem Wagen und rannte los. Was er kurz danach im Gegenlicht des Lichtmastes sah, der die Szenerie erhellte, trieb ihm die Tränen in die Augen.
Marias silbernes Cabriolet lag auf dem Dach, das Stoffverdeck hing in Fetzen zu allen Seiten heraus; die A-Säule war abgeknickt bis zum Lenkrad. Der Vorderwagen war um einen guten Meter gekürzt.
»Sie können hier nicht durch«, wurde der Hauptkommissar von einem jungen Streifenpolizisten freundlich, aber bestimmt gebremst.
»Ich bin ein Kollege«, flüsterte Lenz, ohne den Blick von dem Autowrack zu lösen.
»Das kann ja jeder …«, versuchte der blau gekleidete Mann einzuwenden, doch ein einziger, im diffusen Licht eher zu erahnender als zu erkennender Blick ließ ihn verstummen. »Schon gut«, erklärte er. »Gehen Sie durch.«
Im Näherkommen sah Lenz die aufgestemmte Fahrertür von Marias Wagen und die Blutspuren auf dem Fahrersitz und dem Lenkrad. Er zog seinen Dienstausweis aus der Jacke, ging auf den nächsten Polizisten zu und hielt ihm die Karte unter die Nase.
»Lenz, Kripo Kassel. Was ist hier passiert?«
»Üble Sache, Herr Kommissar. Der Fahrer des Transporters oben auf der Bahn hat beim Überholen die Kontrolle über seine Karre verloren, vermutlich wegen eines geplatzten Reifens. Dabei hat er das Auto da drüben nach rechts abgedrängt und durch die Leitplanke geschickt.«
Lenz schluckte deutlich sichtbar.
»Danach«, fuhr der Polizist fort, »hat er sich mehrfach überschlagen. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, waren nicht angeschnallt und wurden herausgeschleudert. Sie war sofort tot, er ist im Krankenwagen gestorben.«
Er deutete auf die Überreste von Marias Cabriolet.
»Die Frau, die in dem Wagen saß, ist ebenfalls tot, ich hab es vorhin über Funk gehört. Sie ist im Krankenhaus gestorben. Aber wenn man sich das Wrack so ansieht, ist es verwunderlich, dass sie es überhaupt bis dorthin geschafft hat, oder?«
Lenz wollte seinen Dienstausweis in die Jacke zurückschieben, verfehlte jedoch die Innentasche. Die kleine grüne Karte fiel auf den Boden. Sein uniformierter Kollege bückte sich, griff nach dem Dokument, und reichte es dem Kommissar.
»Danke«, murmelte Lenz abwesend.
»Wollen Sie rübergehen, sich ein wenig umsehen? Ihre Kollegen aus Homberg sind natürlich schon da.«
Ohne ihm zu antworten, drehte Lenz sich um, presste die Zähne aufeinander und hatte dabei das Gefühl, in einem sehr, sehr bösen Traum gelandet zu sein, aus dem er nicht aufwachen konnte. Während er langsam und verstört auf seinen Wagen zuging, liefen dicke Tränen über sein Gesicht.
Zwei Minuten später saß er wie ein Zombie hinter dem Lenkrad, wendete, und fuhr Richtung Gudensberg. Ohne Ziel rollte er durch den Ort, wurde vom Fernlicht eines entgegenkommenden Fahrzeugs geblendet, steuerte eine Bushaltestelle an, schaltete den Motor aus und ließ sich vornüber auf den Lenkradkranz fallen. Gedanken und Bilder rasten durch seinen Kopf, kamen, gingen, und ließen sich doch nicht fassen. Er sah vor seinem geistigen Auge Marias Lachen, und im gleichen Moment kippte das Bild. Nun tauchte ihr total zerstörter Wagen auf und die Worte des Streifenpolizisten jagten durch sein Gehirn. ›… ich hab es vorhin über Funk gehört. Sie ist im Krankenhaus gestorben.‹
Der Kommissar griff zum Telefon und drückte die Kurzwahltaste seines Freundes und Kollegen Uwe Wagner. Er musste mit jemandem sprechen. Musste jemandem, der von seinem Verhältnis zur Frau des Kasseler Oberbürgermeisters wusste, erzählen, was passiert war.
Als die Leitung stand, wurde er sofort zu Wagners Mobilbox weitergeleitet. Scheiße, dachte er, wenn ich dich wirklich mal brauche, und warf das Gerät auf den Beifahrersitz. Für einen Moment überlegte Lenz, zurück zum Unfallort zu fahren, verwarf die Idee jedoch. Dann klingelte sein Telefon. Er sah Uwe Wagners Namen aufleuchten.
»Hallo, Uwe«, meldete er sich knapp und mit zitternder Stimme.
»Hallo, Paul. Ich vermute, du weißt es bereits?«
Lenz schluckte. »Ja. Wir waren in Fritzlar verabredet. Sie ist nicht gekommen, und auf dem Rückweg bin ich praktisch dran vorbeigefahren. Woher weißt du es denn?«
»Der Kollege aus Homberg hat mich gerade angerufen. Er wollte nicht, dass ich es aus der Zeitung erfahre. Immerhin ist sie die Frau des OBs.« Er machte eine kurze Pause. »Wie geht es dir?«
Lenz holte tief Luft. »Wie soll es mir schon gehen? Ich habe vor zehn Minuten erfahren, dass die Frau, mit der ich gerne alt geworden wäre, tot ist.«
Nun schluckte Wagner deutlich hörbar.
»Sie ist gestorben?«, fragte er entsetzt.
»Ja, sie ist im Krankenhaus gestorben. Ein Streifenpolizist hat es mir gesagt.«
3
»Kommst du, Monika?« Günther Wohlrabe zog den Schal über, griff zu seinem Hut, nahm den Mantel seiner Frau vom Bügel und positionierte sich neben der Eingangstür.
»Ich hatte vergessen, meine Tasche umzuräumen«, erklärte sie charmant und bewegte sich beschwingt auf die ausgebreiteten Arme ihres Mannes zu.
»Dir geht es augenscheinlich besser«, kommentierte er ihren Auftritt.
»Viel besser, ja.«
»Keine Angst mehr?«
»Na ja, keine wäre zu viel gesagt. Ich lasse den Abend auf mich zukommen, und wenn es mir zu viel wird, gehe ich einfach mal raus.«
»Gut. Dann lass uns jetzt losfahren. Macht es dir etwas aus, wenn ich hinfahre und du zurück? Ich würde gerne den heutigen Abend ein wenig alkoholisiert ausklingen lassen.«
Die junge Frau griff nach dem Hals ihres Mannes, zog seinen Kopf zu sich herunter und küsste ihn auf den Mund. »Nein, ganz und gar nicht. Es wäre nur schön, wenn du morgen früh fit wärst, weil morgen Sternchentag ist.«
Er drängte sich näher an sie heran, küsste sie auf den Hals und fuhr mit der rechten Hand über ihren Busen. »Sollten wir nicht heute Abend und morgen früh …?«
Sie befreite sich von ihm und öffnete mit einer schnellen Bewegung die Haustür. »Lieber nicht, Günther. Heute Abend wäre Lust, morgen früh ist Fortpflanzung. Und wir wollen doch um jeden Preis verhindern, dass deine Spermien um sieben in der Früh nicht vollzählig einsatzbereit sind, oder?«
»Ich gebe mich geschlagen«, antwortete er ein klein wenig zu schnell, griff nach dem Schirm neben der Tür und folgte ihr.
Nach einer kurzen Fahrt durch die verregnete Stadt erreichten die beiden das Piccolo Mondo, ein italienisches Restaurant der gehobenen Klasse mit einem besonderen Angebot.
Wohlrabe half seiner Frau mit geöffnetem Schirm beim Aussteigen, führte sie über die Straße und betrat hinter ihr das modern eingerichtete, helle Lokal mit der offenen Kochstelle in der Mitte des Raumes. Dort waren mehrere Köche und ihre Helfer mit der Zubereitung von Speisen beschäftigt. Etwa die Hälfte der Tische war besetzt, meist von Pärchen. Der Bestattungsunternehmer und seine junge, gut aussehende Frau wurden von einem Kellner in Empfang genommen, der ihnen aus den Mänteln half.
»Wir hatten reserviert, für Wohlrabe.«
»Si, naturalmente«, erwiderte der junge Mann. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen«, setzte er mit italienischem Akzent hinzu. »Die anderen Gäste sind schon da.«
Er brachte die beiden zu einem seitlich stehenden, großen Holztisch, wo sechs Frauen und zwei Männer saßen, jeder mit einem Aperitif vor sich oder in der Hand.
»Bitte, nehmen Sie Platz. Möchten Sie einen alkoholischen oder einen alkoholfreien Aperitif?«
Wohlrabe orderte für sich einen mit, für seine Frau einen ohne Alkohol.
Nachdem die Getränke serviert waren, trat ein weiterer Kellner an den Tisch. Der Mann, offenbar ebenfalls Italiener, trug einen merkwürdigen Gurt um den Kopf, der von einem Kinnriemen gestützt wurde. Von der Stirn des Mannes ragte etwas nach vorne, das weder Wohlrabe noch seine Frau einordnen konnten.
»Buona sera, meine Damen und Herren«, begann er mit leichtem Akzent. »Mein Name ist Luca, und ich bin am heutigen Abend Ihr Kellner. Das heißt, dass Sie mich, obwohl ich Sie bediene, nicht zu Gesicht bekommen werden.«
Allgemeines Gelächter.
»Zunächst müssen wir leider das Bürokratische klären. Haben Sie alle die Reservierung dabei?«
Wohlrabe, die beiden anderen Männer und eine der Frauen schoben jeder ein Din-A4-Blatt über den Tisch. Luca, der Kellner, warf einen kurzen Blick auf die Papiere und machte dabei ein zufriedenes Gesicht.
»Allora, dann darf ich Sie über das weitere Vorgehen informieren. Zunächst ist es wichtig, dass jeder von Ihnen sein Mobiltelefon ausschaltet. Im Speisesaal ist jede Art von Licht unerwünscht, das gilt auch für fluoreszierende Uhren und sonstigen Schmuck.«
Einer der Männer griff sich an den linken Arm, löste das Lederband seiner Armbanduhr, und ließ sie in der Hosentasche verschwinden.
»Dann«, fuhr der Italiener fort, »muss ich Sie bitten, Ihren Platz unter keinen Umständen allein zu verlassen. Wenn Sie zur Toilette, in eine Rauchpause oder aus sonstigen Gründen den Raum verlassen möchten, stellen Sie bitte das Holzstück, das in der Mitte Ihres Tisches liegt, aufrecht. Ich weiß dann Bescheid, dass Sie einen Wunsch haben. Das gilt natürlich auch, wenn Sie ein weiteres Getränk möchten.«
Er lächelte die zehn Augenpaare an, die ihn aufmerksam fixierten. »Und scheuen Sie sich nicht, zu bestellen, was Sie möchten. Es ist alles im Preis inbegriffen.«
Er machte eine kurze Pause und wartete auf Fragen, doch es kamen keine.
»Es ist für uns überaus wichtig, dass Sie sich zu jeder Zeit Ihres Besuches bei uns wohl fühlen«, fuhr er fort. »Sollte irgendjemandem von Ihnen schlecht werden oder sich Beklemmung wegen der Dunkelheit einstellen, lassen Sie es mich bitte sofort wissen. Wir veranstalten heute Abend ein Dinner in the Dark und kein Überlebenstraining. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die allermeisten unserer vielen Gäste großen Spaß an diesem Event haben.«
Wieder sah er in die Runde, ob einer der Teilnehmer etwas anmerken wollte.
»Weiterhin haben Sie sicher mein etwas ulkig wirkendes Aussehen, speziell im Bereich meines Kopfes, bemerkt. Hierbei handelt es sich um die Halterung für das Nachtsichtgerät, das ich benutze, um im Speiseraum sehen zu können. Es ist nicht das Sehen, wie gewohnt, aber ich kann erkennen, wo Sie sitzen, und ob Sie etwas wünschen.«
Wieder sah er in die Runde.
»Haben Sie Fragen?«
Eine der Frauen, die schon gewartet hatten, als Wohlrabe und seine Frau das Lokal betraten, hob die Hand.
»Bitte, Signora.«
»Wir hatten ja bereits in der Reservierung angegeben, ob wir Fleisch, Fisch, vegetarisch oder asiatisch essen möchten. Erzählen Sie uns jetzt, was es im Einzelnen zu essen gibt?«
Der Kellner lächelte.
»Das tut mir leid, aber Sie erfahren erst im Anschluss an unser Dinner detailliert, was ich Ihnen serviert habe. Sie haben ja im Reservierungsfragebogen angegeben, wogegen Sie allergisch sind oder was Sie überhaupt nicht mögen; das haben wir bei der Menüzusammenstellung natürlich berücksichtigt. Aber ich bin sicher, Sie schmecken heraus, was sich jeweils auf Ihrem Teller befindet. Am besten vertrauen Sie einfach Ihrem Geschmackssinn.« Wieder lächelte er die zehn Teilnehmer des Dinner in the Dark an. »Und um den zu prüfen, schlage ich vor, jetzt zu beginnen.«
Nachdem er das Nachtsichtgerät eingeklinkt und startklar gemacht hatte, führte er jeweils zwei Personen durch eine Lichtschleuse in den absolut dunklen Raum, in dem das Essen stattfinden sollte. Günther Wohlrabe und seine Frau Monika waren zuletzt dran. An den Händen gefasst wie Schulkinder trotteten sie mit Trippelschritten hinter dem Kellner her ins Schwarze. Wohlrabe merkte an ihren feuchten Händen, dass seine Frau sich nicht wohl fühlte. Trotzdem ging sie tapfer weiter und ließ sich von Luca, dem Kellner mit dem unförmigen Nachtsichtgerät vor der Stirn, zu ihrem Tisch bringen.
Es verging eine Weile, bis sie saßen, denn ohne optische Orientierung dauerten die gewohnten Bewegungen und Abläufe deutlich länger. An den anderen Tischen unterhielten sich die Besucher leise miteinander, allein die vier Frauen, die gemeinsam essen wollten, lachten viel und mit erhöhter Lautstärke. Jeder der Anwesenden machte sich mit der Situation vertraut, tastete über den Tisch und war mehr oder weniger aufgeregt. Einzig Monika Wohlrabe machte Entspannungsübungen. Immer wieder spannte sie einzelne Muskelgruppen ihres schlanken, nahezu fettfreien Körpers an, atmete dazu tief ein, und löste die Anspannung während des Ausatmens.
Nun erschien Luca mit den Getränken für den ersten Tisch.
»Ich habe die Gläser oberhalb der Messer abgestellt«, erklärte er dem Paar, das sofort zu tasten begann. In rascher Folge bediente er die weiteren Tische, sodass nach kurzer Zeit alle mit Getränken versorgt waren. Danach brachte er die erste Vorspeise, den Salat. Wieder waren Wohlrabe und seine Frau die Letzten, die bedient wurden. Offenbar richtete sich die Reihenfolge nach dem Eintreffen.
Der Bestattungsunternehmer hatte das Fleisch-Menü gewählt, seine Frau die vegetarische Variante. Mit vorsichtigen Bewegungen, die Gabel in der rechten Hand, versuchten beide, sich einen groben Eindruck darüber zu verschaffen, was da auf ihrem Teller angerichtet war.
»Kommst du zurecht?«, fragte Wohlrabe leise.
»Na ja«, erwiderte seine Frau. »Als erstes habe ich mir ein großes Stück Brot in den Mund geschoben, danach zweimal die leere Gabel. Im Moment bin ich gerade dabei, mit Messer und Gabel für kleinere Stücke zu sorgen.«
»Mir ging es ganz ähnlich«, gab er in die Dunkelheit zurück und lachte dabei. »Auch ich hatte schon drei Leerfahrten mit der Gabel. Aber nun komme ich langsam zurande. Das, was ich bisher im Mund hatte, war köstlich.«
»Ja, bei mir auch. Ganz frisches Gemüse und knackige Salate mit einem herrlichen Dressing.«
»Hilft dir das Essen ein wenig über den Anflug von Panik hinweg?«, wollte er nach vorn gebeugt von ihr wissen.
»Du hast es gemerkt?«
Wohlrabe tastete nach ihrer Hand und streichelte darüber. »Natürlich, Monika. Wer, wenn nicht ich, kennt dich so gut?«
Sie legte das Messer auf den Tellerrand und erwiderte seinen Händedruck. »Das stimmt. Wer, wenn nicht du? Aber, um deine Frage zu beantworten, ja, das Essen hilft dabei, mich abzulenken. Ich habe allerdings die Augen permanent geschlossen, um nicht in die Dunkelheit sehen zu müssen.«
»Gute Idee. Lass es einfach so. Und wenn es tatsächlich nicht mehr gehen sollte, machen wir eben eine Pause.«
Seine Frau wollte etwas erwidern, wurde jedoch von einer der vier Frauen am Nachbartisch unterbrochen.
»Sie da, am Tisch gegenüber, Sie haben doch auch vegetarisch bestellt, oder? Was essen wir denn da gerade? Ist da Fenchel dabei?«
Monika Wohlrabe wusste nicht ganz genau, ob sie wirklich gemeint war, doch dann antwortete sie einfach in die Finsternis. »Ja, ich habe vegetarisch bestellt. Und nein, ich kann keinen Fenchel herausschmecken. Es könnte eher Mangold sein, was da so intensiv schmeckt.«
»Ah, Mangold. Den kenne ich gar nicht«, war die überraschende Reaktion.
Dieser Dialog war der Startschuss für einen ausgelassenen Diskurs über die Tische hinweg. Schlagartig wich die vornehme Zurückhaltung einem fröhlichen Abgleich der Eindrücke und Vermutungen, was denn alles in den servierten Salaten enthalten sein könnte. Und noch bevor Luca die Teller abgeräumt hatte, war nahezu jeder mit jedem per Du und wusste, woher er stammte.
Die vier Frauen am Nachbartisch kamen aus Göttingen und hatten sich gegenseitig mit den Einladungen zu diesem Event beschenkt. Das ältere Paar daneben kam aus Gotha und hatte die Karten für das Dinner von seinem Sohn überreicht bekommen. Nur die beiden auf der gegenüberliegenden Seite vom Tisch der Wohlrabes, ein junges Paar aus Westfalen, hielten sich etwas zurück. Die Frau blieb stumm wie der Fisch, den sie bestellt hatte, und auch ihr Gatte war nicht sehr gesprächig. Eher unwillig erzählte er, dass die Karten Teil eines Incentives in seiner Firma gewesen waren.
4
Lenz schaltete das Radio aus, lehnte sich zurück und streckte die Beine aus. Ruf an, dachte er. Ruf doch endlich an.
Uwe Wagner hatte ihm angeboten, mit dem Klinikum in Kassel zu telefonieren, um Genaueres über Marias tatsächlichen Zustand zu erfahren, und ihn sofort zurückzurufen. Nachdem sein Freund davon gesprochen hatte, dass Maria am Leben sein müsse, hatte Lenz für einen Augenblick befürchtet, verrückt zu werden. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen und war froh darüber gewesen, dass der Pressesprecher, der Gott und die Welt kannte, sich für ihn informieren wollte. Nun leuchtete das Display auf, und die Melodie erklang. Der Hauptkommissar riss das vibrierende Gerät vom Beifahrersitz, drückte hektisch die kleine, grüne Taste, und führte das Telefon ans Ohr.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!