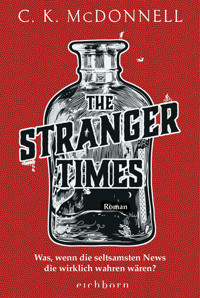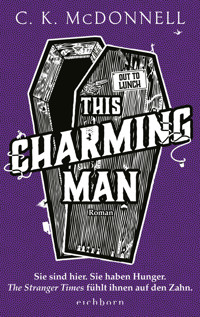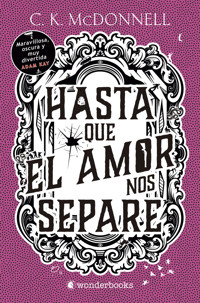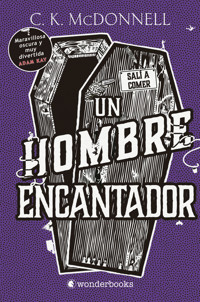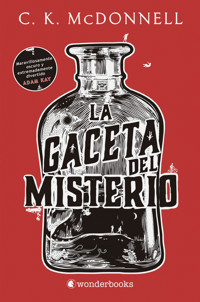9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dublin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Als ihn das erste Mal jemand umbringen wollte, war es ein Zufall. Das zweite Mal war volle Absicht.
Jetzt ist Paul Mulchrone auf der Flucht vor Leuten, die er nicht kennt und von denen er nicht weiß, warum sie ihn töten wollen. Seine einzigen Verbündeten sind eine Krankenpflegerin, die definitiv zu viele Krimis gelesen hat und Paul mit gefährlichem Halbwissen berät, und ein abtrünniger Kommissar mit einem ungesunden Hang zu Alkohol und roher Gewalt.
Gemeinsam müssen sie das berüchtigtste Verbrechen in der Geschichte Irlands lösen - ansonsten sind sie bald selbst nur noch Geschichte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumVORWORT DES AUTORSKAPITEL EINSKAPITEL ZWEIKAPITEL DREIKAPITEL VIERKAPITEL FÜNFKAPITEL SECHSKAPITEL SIEBENKAPITEL ACHTKAPITEL NEUNKAPITEL ZEHNKAPITEL ELFKAPITEL ZWÖLFKAPITEL DREIZEHNKAPITEL VIERZEHNKAPITEL FÜNFZEHNKAPITEL SECHZEHNKAPITEL SIEBZEHNKAPITEL ACHTZEHNKAPITEL NEUNZEHNKAPITEL ZWANZIGKAPITEL EINUNDZWANZIGKAPITEL ZWEIUNDZWANZIGKAPITEL DREIUNDZWANZIGKAPITEL VIERUNDZWANZIGKAPITEL FÜNFUNDZWANZIGKAPITEL SECHSUNDZWANZIGKAPITEL SIEBENUNDZWANZIGKAPITEL ACHTUNDZWANZIGKAPITEL NEUNUNDZWANZIGKAPITEL DREISSIGKAPITEL EINUNDREISSIGKAPITEL ZWEIUNDDREISSIGKAPITEL DREIUNDDREISSIGKAPITEL VIERUNDDREISSIGKAPITEL FÜNFUNDDREISSIGKAPITEL SECHSUNDDREISSIGKAPITEL SIEBENUNDDREISSIGKAPITEL ACHTUNDDREISSIGKAPITEL NEUNUNDDREISSIGKAPITEL VIERZIGKAPITEL EINUNDVIERZIGKAPITEL ZWEIUNDVIERZIGKAPITEL DREIUNDVIERZIGKAPITEL VIERUNDVIERZIGKAPITEL FÜNFUNDVIERZIGKAPITEL SECHSUNDVIERZIGKAPITEL SIEBENUNDVIERZIGKAPITEL ACHTUNDVIERZIGKAPITEL NEUNUNDVIERZIGKAPITEL FÜNFZIGKAPITEL EINUNDFÜNFZIGKAPITEL ZWEIUNDFÜNFZIGKAPITEL DREIUNDFÜNFZIGSt.-Katherine’s-Krankenhaus, vierter Stock, Neugeborenen-Station.St.-Katherine’s-Krankenhaus, dritter Stock, SicherheitsbereichSt.-Katherine’s-Krankenhaus, zweiter Stock.The Old Triangle, ein PubEPILOG 1EPILOG 2EPILOG 3EPILOG 4Über dieses Buch
Als ihn das erste Mal jemand umbringen wollte, war es ein Zufall. Das zweite Mal war volle Absicht.
Jetzt ist Paul Mulchrone auf der Flucht vor Leuten, die er nicht kennt und von denen er nicht weiß, warum sie ihn töten wollen. Seine einzigen Verbündeten sind eine Krankenpflegerin, die definitiv zu viele Krimis gelesen hat und Paul mit gefährlichem Halbwissen berät, und ein abtrünniger Kommissar mit einem ungesunden Hang zu Alkohol und roher Gewalt.
Gemeinsam müssen sie das berüchtigtste Verbrechen in der Geschichte Irlands lösen – ansonsten sind sie bald selbst nur noch Geschichte …
Über den Autor
C. K. McDonnell ist das Pseudonym von Caimh McDonnell, einem preisgekrönten irischen Stand-up-Comedian und Bestsellerautor der Dublin Trilogy. Bis heute hat er über 200.000 Bücher verkauft, davon allein im letzten Jahr über 110.000. Seine Bücher wurden als »eine der lustigsten Krimireihen, die Sie jemals gelesen haben« (The Express) und »ein brillanter humoristischer Thriller« (The Irish Post) bezeichnet. McDonnell lebt und schreibt in Manchester.
Übersetzung aus dem Englischen vonAndré Mumot
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der englischen Originalausgabe:
»A Man With One Those Faces«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by McFori Ink All
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Textredaktion: Sabine Biskup, Mainz
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Umschlagmotiv: © Berkah Visual/shutterstock,
Designer things/shutterstock, kensketch/shutterstock,
Save nature and wildlife/shutterstock, Victor Metelskiy/shutterstock,
Viktorija Reuta/shutterstock, Sanches11/shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4369-3
eichborn.de
VORWORT DES AUTORS
Liebe Leserinnen und Leser,
ich sollte zunächst einmal sagen, dass das Buch, das Sie gleich lesen werden, eigentlich gar nicht existieren dürfte. Auf Englisch nicht und schon gar nicht auf Deutsch. Denn als ich begonnen habe, es zu schreiben, wollte ich eigentlich nur eine Kurzgeschichte verfassen. Ehrlich gesagt lief dann alles völlig aus dem Ruder, und es wurde schließlich mein Debütroman, den ich 2016 kurzerhand im Eigenverlag herausgebracht habe.
Doch was noch wichtiger ist: Dieser Roman markiert das erste Auftauchen von Bunny McGarry, einer Figur, mit der ich wohl für den Rest meines Lebens verbunden sein werde. Eigentlich sollte er nur eine Nebenfigur in der Geschichte eines anderen Helden werden, aber nachdem er einmal aufgetaucht war, weigerte er sich, wieder zu verschwinden. Nicht bloß aus dem Roman, sondern auch aus meinem Kopf. Manchmal stelle ich fest, dass ich so denke wie er, und das kann, wie Sie bald herausfinden werden, einigermaßen verstörend sein.
Die Geschichte spielt in meiner Heimatstadt Dublin. Zwar lebe ich inzwischen in Manchester, kehre aber regelmäßig dorthin zurück, und die Bunny-McGarry-Reihe ist mein Weg, meiner Heimat zu gedenken und sie zu feiern.
Dieser erste Band enthält daher einige überaus irische Eigenheiten. Da wäre etwa die irische Polizei, die Garda Síochána, deren Beamte bei uns Gardaí oder Guards genannt werden. Die Bezeichnungen mögen andere sein, aber die Gardaí dürften sich nicht allzu sehr von den Polizisten unterscheiden, die Sie kennen. Vielleicht gehen sie bei ihrer Arbeit ein bisschen weniger formell vor, als Sie es von der deutschen Polizei gewohnt sind, aber, hey, sie haben damit durchaus Erfolg. Meistens.
Darüber hinaus wird immer wieder Hurling erwähnt, ein Spiel, das ganz sicher mit keinem vergleichbar ist, das Sie kennen. Es beinhaltet hölzerne Schläger, einen Lederball und gelegentliche kleinere Gewaltausbrüche. Es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt, und kein Beschreibungsversuch könnte ihm jemals gerecht werden. Die Tatsache, dass man die Spieler in meiner Jugend dazu zwingen musste, Helme zu tragen, sagt alles über diesen Sport. Sie zwingen! Der Ball fliegt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 145 Stundenkilometern. Die Robustheit der irischen Männlichkeit lässt sich nicht anzweifeln, ihr Irrsinn schon.
Ich hoffe, dass sich Ihnen all das vermittelt, nicht zuletzt, weil ich das Glück habe, dass der wunderbare André Mumot diesen Roman übersetzt hat. Allein für seine herausragende Übertragung von Bunnys überaus kreativem Fluchen verdient er alle zur Verfügung stehenden Preise. Und vermutlich sollten noch einige andere eigens für ihn ins Leben gerufen werden. Der arme Mann musste intensive Recherche und gewissenhafte Selbstbefragung auf sich nehmen, um die bestmögliche deutsche Annäherung an das häufig zum Einsatz kommende irische Schimpfwort gobshite zu finden: Arschgeige. Er ist mein Bunny-Botschafter, und ich hoffe, dies ist der Beginn einer langen Freundschaft zwischen dem schwergewichtigen Kraftpaket Bunny und Ihnen, den reizenden deutschsprachigen Leserinnen und Lesern.
Sláinte
C. K. McDonnell
Manchester, im März 2023
KAPITEL EINS
»Du erinnerst dich doch an Alan aus Clare, den Cousin von deinem Vater?«
»Ähm …?«
»Na sicher! Zwei Hunde, nur ein Auge, hat nie geheiratet – als du klein warst, kam er immer mal wieder bei uns vorbei.«
»Ach ja.«
»Tot! Ist an einem Herzinfarkt gestorben – möge er in Frieden ruhen. Hab ich letzte Woche in der Zeitung gelesen.«
Paul war nie aufgefallen, wie kalt sich die Hände alter Menschen bisweilen anfühlten. Als die gebrechlichen Finger der Frau nun seine Hand tätschelten, als wolle sie sich vergewissern, dass er wirklich da war, wurde ihm diese Tatsache sehr bewusst. Offen gestanden konnte er kaum noch an etwas anderes denken.
»Herzinfarkt in der Badewanne«, fuhr sie fort. »Ich glaube ja, das liegt an diesen ganzen neumodischen Badesalzen. Wie soll man heutzutage noch wissen, was die da alles reintun?«
Mit einem Nicken gab Paul ihr das Mindestmaß an Zustimmung, damit sie auf dem Pfad ihrer Gedanken ungebremst voranholpern konnte.
Hieß es nicht, dass Tote eiskalt waren? Als sie noch Kinder gewesen waren, hatte Barry Dodds ihm mal erzählt, wie er während der Totenwache für seinen Großvater dessen aufgebahrten Leichnam umgestoßen habe und dieser auf ihn gefallen sei. Laut Barry habe es sich angefühlt, als wäre er unter einem Dutzend tiefgefrorener Truthähne begraben worden. Allerdings hatte Barry auch behauptet, dass sich die Brüste einer Frau anfühlten, als würde man in ein Brathähnchen greifen. Jetzt, wo Paul darüber nachdachte: Der Junge musste von Geflügel ja vollkommen besessen gewesen sein.
»Dabei war er noch so jung. Er kann ja gerade mal …«
Margaret verstummte und starrte zur Decke, als versuchte sie, eine Rechnung anzustellen, für die ihr die nötigen Zahlen fehlten.
Waren Babys tatsächlich immer warm? Begann man sein Leben als winziges, heiß brodelndes Energie-Inferno und wurde dann immer kälter und kälter, bis man schließlich frostige Leichen-Temperatur erreichte? Wenn es um Babys ging, konnte Paul nur mutmaßen. Er war achtundzwanzig Jahre alt, aber im Arm gehalten hatte er bislang kein einziges.
Nicht zum ersten Mal machte die Platte in Margarets Kopf einen Sprung. »Ich habe mich auf der Nachbarstation mit einer Frau aus Dunboyne unterhalten. Sie behauptet, die Triaden hätten Dublin endgültig unter ihre Kontrolle gebracht.«
»Ach ja?«
»Es stand auch im Herald«, erklärte sie. »Scheinbar kann man vor lauter Chinesen keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist heutzutage. Man hat ja Angst, nachts noch vor die Tür zu gehen.«
»Ich habe gehört, dass die Chinesen auch immer Schwerter bei sich haben.«
»Wirklich?«
»Oh ja«, sagte er. »Die stehen wahnsinnig aufs Köpfeabschlagen und solche Sachen …«
Er war gerade dabei, die »Sachen« pantomimisch darzustellen, als er von einem strengen Räuspern unterbrochen wurde. Das war mal wieder typisch – fünfundvierzig Minuten lang nichts als Nicken und Hm-Sagen von seiner Seite, aber pünktlich zum Köpfeabschlagen kam Schwester Brigit, die Krankenpflegerin, zurück. Da stand sie nun, lehnte mit verschränkten Armen im Türrahmen und strafte ihn mit einem abschätzigen Blick.
»Na, wie kommt ihr beiden klar?«, fragte sie und betrat das Zimmer.
»Fantastisch«, sagte er. »Wir unterhalten uns blendend.«
»Das ist mein Gareth«, sagte Margaret und deutete auf Paul.
»Oh, ich weiß, Margaret. Natürlich. War er nicht auch dabei, als Sie zu uns gekommen sind?«
Ihr runzliges kleines Gesicht hellte sich auf vor Stolz. »Er ist Rechtsanwalt«, sagte sie strahlend. »Fliegt durch ganz Europa. Letzte Woche war er in Brüssel.«
»Ist das zu fassen.«
Margaret lehnte sich automatisch vor, damit Brigit ihre Kissen aufschütteln konnte.
»Ist es nicht schön, dass er sich die Zeit nimmt, seine alte Granny zu besuchen?«, sagte Brigit.
»Mutter«, korrigierte Paul.
»Ja, er ist mein …«
Durch den Nebel der sich auflösenden Erinnerung starrte die alte Frau Paul einen Augenblick fragend an. Beinahe glaubte er, ein unheilvolles Knacken zu hören, als würde das Eis, auf dem er stand, jeden Moment einbrechen.
Brigit war mit den Kissen fertig und klatschte in die Hände. Das Geräusch zog Margarets Aufmerksamkeit auf sich, und das Lächeln kehrte auf ihre Lippen zurück. Paul entspannte sich.
»Nächstes Mal«, sagte Brigit, »sollte er Sie tagsüber besuchen, dann können Sie draußen einen Spaziergang machen – jedenfalls, wenn Ihre Physio weiter so gut anschlägt.«
Sie schaute Paul erwartungsvoll an. Der Wink mit dem Zaunpfahl war derartig aufdringlich, dass er mit dem Gedanken spielte, ihn einfach verstreichen zu lassen.
»Ja, das wäre doch schön«, sagte er.
Er lächelte von seinem Stuhl neben dem Bett zu Brigit hinauf. Ihr üppiges Dekolleté rahmte ihren genervten Gesichtsausdruck wunderbar ein. Sie war eigentlich keine schlecht aussehende Frau; ein paar Jahre älter als er, braune, zu einem Bob geschnittene Haare, ansehnliche Figur. Reihenweise Männerherzen brachen ihretwegen wohl nicht, aber dass sie in der Schlange vor einem Fish-and-Chips-Laden ein gewisses Interesse wecken würde, stand außer Frage.
Sie sprach einen dieser Dialekte, die irgendwo auf dem Land gesprochen wurden. Wie die meisten Dubliner hatte sich Paul nie die Mühe gemacht, sie alle auseinanderzuhalten. Auch ihr Körperbau sagte laut und deutlich: Bauernhof. Sie war nicht dick oder muskulös, bloß kräftig genug, um klarzumachen, dass sie im Notfall auch den Zweikampf mit einer Kuh aufnehmen konnte.
»Allerdings ist es im Moment schrecklich verregnet«, sagte Margaret.
Er warf der alten Frau einen Blick zu und stellte fest, dass sie ihn erneut anstrahlte.
»Stimmt, Ma.« Er hob seine Stimme, um sicherzustellen, dass sie ihm zuhörte. »Es ist ganz wichtig, dass du mit deiner Physio weitermachst, damit wir dich wieder auf die Beine bekommen. Dann können wir auch wieder zusammen durch die Clubs ziehen.«
»Oh, Gareth, du bist unmöglich.« Sie grinste. »Den hier müssen Sie gut im Auge behalten, Schwester.«
»Ja, das Gefühl habe ich auch.«
Paul verabschiedete sich und gab Margaret einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Wieder: kalt, klamm. Eine weitere ungebetene Assoziation stellte sich ein. Als würde man an einem Schinken riechen, um festzustellen, ob er noch gut war. Die nächsten Tage würde er es wohl bei Käsetoast belassen.
Draußen im Korridor griff er gerade nach seinem Handy, als ihm mit einer zusammengerollten Ausgabe der Woman’s Weekly auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Nicht so fest, dass es wirklich wehgetan hätte, aber immer noch entschlossen genug für einen kurzen Schmerz.
»Wofür war das denn?«, fragte er.
»Dreimal darfst du raten.«
»Entspann dich mal. Die alten Damen lieben ein bisschen Klatsch und Tratsch.«
»Das sagst du so! Du musst sie ja auch anschließend nicht wieder beruhigen, wenn sie fest davon überzeugt sind, dass unsere chinesische Mitarbeiterin, die den medizinischen Abfall einsammelt, mit Drogen dealt.«
»Bist du denn sicher, dass sie das nicht tut?«
»Oh, glaub mir, ich habe das überprüft.«
»Tja.« Paul warf einen Blick auf die Uhr auf seinem Handy. »Ich würde sagen, das waren drei Stunden und sieben Minuten, wenn du mir also meinen Bescheid unterschreiben könntest …«
Brigit trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Du müsstest noch einen weiteren Fall übernehmen.«
»Drei Stunden und sieben Minuten«, wiederholte Paul und schaute Brigit an, als sei sie schwerhörig. »Plus die zwei Stunden und achtundfünfzig Minuten Besuchszeit, die ich am Montag absolviert habe – das macht sechs Stunden und fünf Minuten. Das heißt, fünf Minuten habt ihr eh schon gratis bekommen.«
Brigit schaute ihn verwirrt an. Paul sah, wie die Fragen, die sie stellen wollte, und der Gefallen, um den sie ihn bitten musste, um die Vorherrschaft kämpften. Der Gefallen gewann. Also ließ sie ihre Stimme etwas weicher werden. Offensichtlich war sie es nicht gewohnt, freundlich um etwas zu bitten.
»Es wird auch nicht lange dauern. Es geht um einen alten Mann, oben, in einem der Privatzimmer.«
»Ich würde ja sehr gerne behilflich sein«, log er, »aber ich muss meinen Bus kriegen.«
Was stimmte. Der Ford Cortina von Großtante Fidelma hatte zwar die Berliner Mauer, die Concorde und Nelson Mandela überlebt, vor vier Wochen auf der Überholspur der M50 aber schließlich doch noch seinen letzten Atemzug getan. Bislang hatte er nicht genug Geld beisammen, um ihn wieder fahrtüchtig zu machen. Tatsächlich hatte Paul sein gesamtes restliches Einkommen vom letzten Monat und die Hälfte seiner Notfallrücklagen aufgebraucht, nur um den Wagen überhaupt von dem Seitenstreifen herunterzubekommen, auf dem er den Geist aufgegeben hatte.
»Wohnst du immer noch da oben an der North Circular?«, fragte Brigit.
»Ja.«
Sie dachte kurz nach – offenbar wog sie Verschiedenes ab.
»Tu mir den Gefallen, dann setze ich dich anschließend zu Hause ab. Meine Schicht ist in einer Stunde zu Ende. Abgemacht?«
Tatsächlich klang das besser, als sich an der Bushaltestelle die Weichteile abzufrieren – außerdem kamen so noch 3 Euro 30 zur Wiederaufstockung seines Notgroschens hinzu.
»Na schön«, sagte er, »aber bitte nicht zudringlich werden. Ich weiß, wie ihr Krankenschwestern drauf seid.«
Sie verdrehte die Augen. »Ich versuche, mich zu beherrschen.«
Er deutete vielsagend auf seine Zigaretten – und sie holte aus ihrem scheinbar endlosen Vorrat missbilligender Gesichtsausdrücke einen weiteren hervor. Dann gab sie ihm mit einem Kopfnicken zu verstehen, dass er ihr folgen sollte.
Brigit öffnete schwungvoll die Notausgangstür, und Paul trat in die schneidende Novemberluft. Es war kalt genug, um Sehnsucht nach dem Mantel zu entwickeln, den er im Mitarbeiterraum zurückgelassen hatte, aber nicht kalt genug, um tatsächlich zurückzugehen und ihn zu holen. Überrascht bemerkte er, dass Brigit ihm folgte und sich neben ihn stellte, die Arme um ihren Oberkörper schlang und mit den Füßen scharrte, um sich warm zu halten.
»Heilige Scheiße«, sagte sie.
»Ist es nicht verrückt, dass man vor gar nicht so langer Zeit in Krankenhäusern noch rauchen durfte?«
»Ja«, seufzte sie. »Die gute alte Zeit – als die Leute einfach dran gestorben sind.«
Als er seine vorletzte Zigarette herauszog, fiel ihm auf, wie ihr Blick auf der Schachtel ruhte. Er hielt sie ihr hin.
»Das ist doch deine letzte.«
»Mach dir keine Gedanken, ich habe noch jede Menge.« Rein faktisch stimmte das. Er hatte vor sechs Monaten fünfundzwanzig Päckchen mit zwanzig Prozent Rabatt für achtzig Euro ergattert und sich so weit diszipliniert, jeden Tag nur eine von den billigen Imitats-Zigaretten zu rauchen. Er hatte auch überlegt, es ganz aufzugeben, aber dann hätte sie gewonnen. Er war noch nicht so weit, dies zuzulassen. Aber wenn er von den 3 Euro 30, die er für die Busfahrt sparte, die sechzehn Cent für Schwester Conroys Zigarette abzog, blieben ihm bei diesem Geschäft immer noch 3 Euro 14 übrig.
»Merci«, sagte Brigit, während sie die Hände um sein Feuerzeug legte und die Zigarette paffend zum Leben erweckte.
Sie nahmen beide einen Zug und betrachteten ihre Schatten, die sich über die gepflegten, von den antiseptischen Hospizlichtern halb beleuchteten Rasenflächen zogen.
»Darf ich dir eine Frage stellen?«
Er spürte, wie er innerlich zusammensank. Er wusste genau, was jetzt kam.
»Warum fragen die Leute das immer?«, entgegnete er. »Erstens – du hast damit bereits eine Frage gestellt, und zweitens: Noch nie hat jemand darauf ein Nein als Antwort akzeptiert.«
»Schon gut. Kein Grund, pampig zu werden. Ich wollte mich bloß ein bisschen unterhalten.«
Sie schnippte die Asche Richtung Gully und umarmte sich etwas fester. Sie nahmen beide noch einen Zug, im stummen Einverständnis, dass er ein Arschloch war.
Paul war es, der schließlich das Schweigen brach. »Ich habe halt ein Allerweltsgesicht.«
»Wie bitte?«, sagte sie.
»Das wolltest du mich doch fragen – wie ich mache, was ich mache.«
»Na ja, schon, aber …«
»Und jetzt«, unterbrach er sie, »wirst du sagen: Aber es muss doch noch mehr dabei sein als bloß …«
»Gedankenleser bist du auch?«
Er schaute sie an. »Okay, was wolltest du sagen?«
»Oh nein, Sherlock, du hast absolut recht. Ich wollte genau das sagen. Es kann nicht bloß daran liegen, dass du eine bestimmte Art von Gesicht hast – jeder Mensch hat ein Gesicht. An deinem ist nichts Besonderes. Nichts für ungut.«
»Bloß, weil du anschließend Nichts für ungut sagst, kommst du nicht mit jeder Beleidigung durch – das ist dir schon klar, oder?«
Obwohl sie natürlich recht hatte. Es war nichts Besonderes an seinem Gesicht – ganz im Gegenteil –, es war durch und durch gewöhnlich, genau wie alles andere an ihm. Ein Meter neunundsiebzig, blaue Augen, braunes Haar. Aber genau darum ging es ja: um seine absolute Gewöhnlichkeit. Er war in jeder Hinsicht unauffälliges Mittelmaß. Seine Gesichtszüge waren ein Meisterwerk himmelschreiender Nicht-Originalität, ein ästhetischer Tribut an den austauschbaren Durchschnitt. Gemeinsam aber bildeten sie ein Orchester, das alle Stimmungen und Ausdrücke perfekt nachspielen konnte.
»Aber«, sagte sie, »Margaret hat dich wirklich für ihren Enkel gehalten …«
»Sohn«, verbesserte sie Paul.
»Stimmt«, fuhr Brigit fort. »Während der alte Donal am anderen Ende des Flurs glaubt, du wärst der Sohn seines Nachbarn. Und Mrs. Jameson hält dich für …«
»In dem Fall bin ich mir selbst nicht ganz sicher«, warf Paul ein. »Ich würde vermuten, für ihren Butler.«
»Sie spricht mit uns allen, als wären wir ihre Dienstboten. Letzte Woche hat sie mich allen Ernstes gefragt, ob der Inhalt ihrer Bettpfanne mit dem von den anderen Patienten zusammengeschüttet wird. Die Frau glaubt wirklich, dass ihre Scheiße nicht stinkt.«
Paul musste lächeln, diese Beschreibung traf es tatsächlich ganz gut.
»Was ich eigentlich fragen wollte«, fuhr Brigit fort. »Warum tust du so, als wärst du all diese Menschen, die du nicht bist?«
Paul zuckte mit den Schultern. »Das macht es eben leichter.« Was stimmte. Es war nicht die ganze Wahrheit, nicht mal ansatzweise, aber die Wahrheit war es trotzdem. »Die Patienten, die ich im Auftrag vom Hospiz besuche, sind alt und verwirrt. Du siehst es doch selbst: Wenn die Angehörigen hierherkommen und ihre dementen Verwandten besuchen – wie ist das?«
»Nicht leicht«, gab Brigit zu. »Oft stehen sie einem geliebten Menschen gegenüber, der nicht weiß, wer sie sind. Das kann einem das Herz brechen. Mit der Zeit bekommen sie dann immer weniger Besuch, weil es für alle Beteiligten zu belastend ist.«
»Ganz genau. Aber die Patienten sind sich immer noch im Klaren darüber, dass sie eigentlich wissen sollten, wer der Besucher ist. Wenn ich also reinkomme und Hallo sage …«
»Dann tust du einfach so, als wärst du irgendwer?«
»Nein. Ich tue so, als wäre ich derjenige, für den sie mich halten.«
»Aber du bist doch gar nicht diese Person.«
»Ich weiß, aber es ist wirklich nicht besonders schwer. Wie geht es dem und dem? Gut. Hat sich bei Soundso der Hexenschuss verbessert? Hat er. Hauptsächlich sind die Leute einfach glücklich, irgendwas vor sich hin zu schwatzen. Eigentlich ist es genauso wie immer: Die meisten Menschen wollen viel erzählen, aber nicht unbedingt zuhören.«
Die Hospizleitung war mit dieser Vorgehensweise offiziell natürlich nicht einverstanden, drückte aber ein Auge zu. Die traurige Wahrheit lautete, dass es die Patienten glücklicher machte, wenn sie glaubten, noch einen Fuß in ihrem vergangenen Leben zu haben, und in seinen zynischeren Momenten dachte Paul, dass sie so auch für die Pflegekräfte leichter zu handhaben waren. Sein Dienst war darüber hinaus ehrenamtlich, und das machte ihn sehr viel preisgünstiger als die meisten Medikamente.
Paul nahm einen weiteren Zug von seiner Zigarette und genoss den nachgemachten Geschmack. Als er ausatmete und den Blick über den Rasen schweifen ließ, sah er, wie ein Fuchs sie beide beobachtete, während er ein halb aufgegessenes Sandwich aus dem Mülleimer vor dem Zeitungsstand zog. Er sah nicht aus wie ein ängstliches Tier, das sich bereit machte, jeden Augenblick davonzuhechten. Es war ein Dublin-Fuchs. Er schien zu sagen: Ich nehme mir das jetzt. Habt ihr irgendein Problem damit?
»Und«, sagte Brigit, »wie bist du zum Oma-Flüsterer geworden?«
Im Laufe der letzten Jahre hatte er verschiedene Bezeichnungen gehört für das, was er tat. Dies war ohne Zweifel die freundlichste.
»Vor ein paar Jahren war eine Frau, die … die früher auf mich aufgepasst hat …«, genauer musste er das Brigit nicht erläutern, fand er, »… krank und lag im St. Katherine’s Hospital. Sie war auf einer dieser Stationen, die … na ja, die man nur noch mit den Füßen voran verlässt.«
Brigit nickte.
»Ich hab sie ziemlich oft besucht. Und auf dieser Station gab es noch eine andere Frau – Alzheimer im letzten Stadium, unter anderem –, und die hat mich für ihren Bruder gehalten. Man wusste, dass er nicht aus Amerika zu Besuch kommen würde, und sie hatte ihm noch einiges zu sagen, also …«
»… hast du deine Show abgezogen.«
»Das ist keine Show!«
Sie zuckte zusammen, als sie in seiner Stimme so etwas wie echte Empörung wahrnahm, und streckte in einer versöhnlichen Geste die Hände aus. »Tut mir leid.«
»Man bat mich zu helfen. Also habe ich das getan.«
»Und dann ist dir dein Ruf durchs ganze Land vorausgeeilt …«
»So in etwa.«
Genau genommen war es ganz und gar nicht so gewesen, aber auf die genauen Einzelheiten wollte er jetzt nicht eingehen. Er musste seine sechs Stunden gemeinnütziger Arbeit pro Woche ableisten, und die Oberschwester von der Station im St. Katherine’s hatte aus Dankbarkeit einige Anrufe für ihn getätigt. Patientenbesuche hatten den großen Vorteil, dass sie nicht unter freiem Himmel stattfanden, und schwer heben musste man dabei auch nicht.
Paul warf einen kurzen Blick auf Brigit. Sie blickte in den bewölkten Himmel und schien im Stillen eine ganze Liste von Fragen durchzugehen. Sie gehörte eindeutig zu den Frauen, die immer noch eine Nachfrage hatten.
»Was soll dann diese Sache mit den Bescheinigungen?«, fragte sie schließlich. »Bist du auf Bewährung draußen und musst Wohltätigkeitsarbeit leisten, oder was?«
»Nein!« Paul war selbst erschrocken, wie feindselig er sich anhörte. »Ich bin niemals mit dem Gesetz in Konflikt geraten.« Okay, das war eine Lüge. »Ich habe einfach eine soziale Ader.«
»Aber seit wann müssen sich Leute mit sozialer Ader eine Bescheinigung unterschreiben lassen, dass sie sechs Stunden pro Woche gearbeitet haben?«
In Ermangelung einer Antwort schnippte Paul den Stummel seiner Zigarette in den Gully und zog sein Handy aus der Gesäßtasche.
»Wir legen jetzt besser mal einen Zahn zu, wenn ich noch einen Besuch für dich machen soll.«
»Ja, okay«, sagte Brigit. Sie ließ ihre Zigarette ebenfalls fallen und zerdrückte sie unter ihrem Schuh. Offenbar war es ihr unangenehm, ihm zu nahegetreten zu sein, und sie strich sich verlegen die Haare hinters Ohr.
Paul warf einen Blick auf die andere Straßenseite. Der Fuchs schnüffelte an dem Sandwich, das er ausgegraben hatte. Statt es zu fressen, entschied er sich, darauf zu urinieren. Eine ziemlich vernichtende kulinarische Kritik.
KAPITEL ZWEI
»Hast du mir zugehört?«
»Natürlich habe ich dir zugehört.«
Er hatte ihr nicht zugehört.
Gut, anfangs, als sie ihm erklärt hatte, wie genau der Gefallen aussehen sollte, um den sie ihn bat, hatte Paul ihr noch zugehört, aber dann hatte er angefangen, über Desinfektionsmittel nachzudenken. Warum roch es in Krankenhäusern so stark danach? Genau genommen stank es regelrecht nach dem Zeug. Auf den Fluren kam er an so vielen Leuten vorbei, die Tränen in den Augen hatten, und nie konnte man sagen, ob Grandpa gerade das Zeitliche gesegnet hatte oder die Ausdünstungen ihnen schlicht die Augäpfel verätzten.
Brigit blieb derartig unvermittelt vor einem der Privatzimmer stehen, dass ihre Plastiksohlen auf dem Fliesenboden ein leises Quietschen erzeugten.
»Also.« Paul deutete lässig auf die Tür. »Hier liegt sie?«
»Er!«, entgegnete sie. »Hier liegt er.«
»Klar. Wollte nur mal überprüfen, ob du auch aufpasst.«
»Ach, halt die Klappe«, sagte sie. »Also, noch mal zusammengefasst für alle, die gerade überhaupt nicht zugehört haben: Dieser Gentleman ist vor drei Wochen bei uns eingeliefert worden und hat seitdem keinen einzigen Besuch erhalten.«
»Wen erwartet er denn? Familie? Freunde?«
»Keine Ahnung, aber er fragt drei- bis viermal pro Tag, ob schon jemand da war.«
»Okay«, sagte er. »Und frisch doch bitte noch mal mein Gedächtnis auf. Sein Name lautet wie?«
Sie verdrehte die Augen. »Martin Brown. Er steht die meiste Zeit unter Medikamenten, aber auch in seinen lichteren Momenten ist er nicht grad der goldigste Sonnenschein. Erst gestern hat er eine der Pflegeschülerinnen zum Weinen gebracht.«
»Na, fantastisch«, sagte Paul. »Das wird ja ein Fest.«
Brigit legte eine Hand auf seinen Arm und senkte die Stimme. »Okay, er ist ohne Zweifel eine fürchterliche Kratzbürste, aber er wird nicht mehr lange bei uns sein. Der Krebs hat ihn voll erwischt. Soviel ich weiß, hat er drei Jahre lang jeden ärztlichen Rat und jede Behandlung ausgeschlagen, und nun ist er aus Amerika nach Hause zurückgekommen, um hier zu sterben. Er ist ganz allein und versucht, sich mit dem Unabwendbaren abzufinden. Also, na ja, Sie wissen schon …«
Paul holte tief Luft, schmeckte das Desinfektionsmittel hinten in der Kehle und atmete es seufzend wieder aus. »Okay. Dann wollen wir mal.«
Sie klopfte an die Tür und öffnete sie rasch. Schon von draußen konnte Paul hören, wie über ein Sauerstoffgerät eingeatmet wurde, gefolgt von einer tiefen, heiseren Stimme.
»Verdammte Scheiße, nennen Sie das …«, ein Nach-Luft-Schnappen, »… anklopfen? Was, wenn ich hier gerade an mir …«
»Dann hätte ich Ihnen eins übergebraten. Das bringen sie uns in der Ausbildung bei.«
»Gottverdammte … F…« Paul hörte einige weitere aufgebrachte Atemzüge.
»Na, na, Mr. Brown«, sagte Brigit. »Sie wollen doch Ihren Atem nicht verschwenden, nur um zu beweisen, dass die Epoche des guten Benehmens endgültig vorbei ist. Sie haben Besuch.«
Langsam trat Paul ein. Der Raum war genau so, wie er es mittlerweile von einem modernen Krankenhauszimmer erwartete – sauber, ordentlich, seelenlos. Es gab einen Fernseher, der gegenüber vom Bett oben an der Wand angebracht war und ohne Ton die Wiederholung einer Sitcom zeigte, die schon bei der Erstausstrahlung niemand gemocht hatte. Den einzigen Versuch einer Dekoration stellte ein Bild der Jungfrau Maria dar. Die Lippen hatte sie gespitzt und den Kopf zur Seite geneigt, als höre sie gerade mit aufrichtigster Sorge zu. Jesus mochte für die Sünden der Menschen gestorben sein, doch am Ende war es immer seine Ma, die bereit war, sich ihre Ausreden anzuhören.
Die Beleuchtung war spärlich, aber Paul musste kein Arzt sein, um zu erkennen, dass die schwächliche Gestalt, die halb aufgerichtet im Bett saß, nicht mehr lange auf dieser Welt sein würde. Martin Brown sah aus wie ein bulliger Mann, aus dem man die Luft herausgelassen hatte. Sein Fleisch hing bleich und lose an ihm herab, als trüge sein Skelett einen Anzug aus Haut, der ihm einige Nummern zu groß war. Verschiedene Kabel und Schläuche führten zu den Maschinen, die ihn umgaben, um seine Schmerzen zu erleichtern beziehungsweise sein Leiden zu verlängern. Es war schwer zu sagen, wie alt Brown war. Er hatte den Punkt erreicht, an dem die Zeit nicht mehr in Geburtstagen gemessen wird, sondern in Tagen, vielleicht nur noch Stunden. Seine ausgemergelte Hand presste eine Sauerstoffmaske auf sein Gesicht. Er funkelte Paul böse an, während er mühsam Atemluft inhalierte. Auf der ganzen Welt gab es nicht genügend Desinfektionsmittel, um den Gestank des Todes aus diesem Raum zu vertreiben.
Brigit räumte das Tablett mit dem nicht angerührten Essen ab, das auf dem Tisch vor ihm stand.
»Raus mit Ihnen.« Brown sprach in einem heiseren Flüstern.
Paul wollte sich schon auf dem Absatz umdrehen, als ihm bewusst wurde, dass diese Aufforderung nicht ihm gegolten hatte.
Brigit schaute zwischen den beiden hin und her. »Na schön – dann lasse ich euch Jungs mal allein. Ich bin mir sicher, ihr habt euch viel zu erzählen.« Sie klappte das Tischchen zusammen und verstaute es neben dem Bett, bevor sie das Tablett zur Tür trug. Bevor sie hinausging, warf sie Paul noch einen Blick zu, der nach einem sarkastischen »Viel Spaß« aussah.
Paul beobachtete, wie sich die Tür schloss. Eine verregnete Bushaltestelle kam ihm nun gar nicht mehr so schlimm vor. Dieser Mann sorgte dafür, dass es ihm eiskalt den Rücken runterlief. Paul hatte schon viele Menschen getroffen, die kurz vor ihrem Ende standen, aber so hatte es sich noch nie angefühlt. Er wusste nicht, wieso, aber dies war anders.
Einen langen Augenblick starrten sie einander an. Er versuchte, Brown die Zeit zu geben, für sie beide zu entscheiden, wer Paul sein würde. Er fragte sich schon, ob der Mann überhaupt noch etwas sagen würde. Vielleicht war er bereits tot? War es möglich, dass jemand starb, ohne sich zu bewegen – während seine Augen immer noch offen standen und ihn weiter böse anstarrten? War das Leben derart binär? Konnte der Schalter einfach still und heimlich auf Aus gestellt werden?
Brown sog einen abgehackten Atemstoß ein und hielt sich wieder die Maske vors Gesicht. Er war noch nicht tot.
Paul preschte zuerst vor. »Also, wie geht’s …«
»Ich wusste, dass du kommen würdest«, unterbrach ihn Brown. Er sagte es mit einer Endgültigkeit, als wäre Paul die unvermeidliche Steuerrechnung in der Post.
»Ich wollte nur mal sehen, wie es so läuft.«
»Ach, ganz fabelhaft. Scheiße, verdammte.« Er gestikulierte mit der freien Hand in Richtung des Stuhls, der neben dem Bett stand. Es war schwer, zwischen dem Röcheln und Knurren Browns Akzent zuzuordnen, aber irgendwo fand sich da zweifelsohne eine Spur Dubliner Innenstadt, vermischt mit dem näselnden Tonfall von jemandem, der einige Zeit auf der anderen Seite des Atlantiks verbracht hatte.
Paul ging zu ihm und setzte sich. Er machte keine Anstalten, Brown zu berühren. Dieser Mann war eindeutig nicht der Typ fürs Händchenhalten.
»Und, wie ist denn das Essen hier?«, versuchte es Paul.
»Glaubst du an den Himmel?«
Ah, okay – es würde also eine dieser Unterhaltungen werden. Nicht eine von Pauls Favoriten, aber zumindest hatte er damit wieder das Gefühl, zu wissen, wo er stand. Er warf einen Blick hinauf zur Maria an der Wand, deren ruhig zur Seite geneigter Kopf zu fragen schien: »Ich bin auch gespannt: Glaubst du daran?«
Er griff auf seine Standardantwort zurück, die für alle gleichermaßen funktionierte: für jene, die einem sofort mit Gott kamen, genauso wie für die Atheisten. »Ich persönlich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in dem wir unsere alten Freunde wiedersehen und …«
Browns Blick bohrte sich in seinen. »Soll das eine Drohung sein?«
»Nein, ich …« Der kurze Moment, in dem Paul geglaubt hatte, er habe das Gespräch im Griff, entglitt ihm wieder.
»Wenn es den Himmel gibt, gibt es auch eine Hölle und …« Ein schnappender Atemzug. »Ich weiß, wo es dann für mich hingeht. Ein paar Meter tief runter, unter dem Felsen …«
Ein Zitteranfall fuhr durch Browns Körper. Er krümmte sich zusammen und keuchte in seine Maske. Paul überlegte, ob er eine Schwester rufen sollte, aber eine leichte Veränderung in Browns Gesichtsausdruck sorgte dafür, dass ihm die Worte in der Kehle stecken blieben. Der verrückte alte Bastard lachte, auch wenn sein Gelächter rasch in einen Hustenanfall überging. Mit seiner rechten Hand zog Brown die Sauerstoffmaske ein Stück von seinen Lippen fort, während er sich mit dem Taschentuch in seiner linken den Mund abtupfte. Als er es wieder wegnahm, bemerkte Paul einen Blutfleck darauf. Rasch wich er dem Anblick aus und starrte lieber wieder in die großen braunen Augen der Jungfrau Maria. Woher wussten die Leute eigentlich, dass sie braun gewesen waren? In jedem Krankenhauszimmer, in dem er bislang gesessen hatte, hing ein Bild von ihr an der Wand, und auf jedem einzelnen hatte sie diese großen braunen Rehaugen. Wurden sie in der Bibel erwähnt? Vielleicht gleich nach der Stelle, an der erklärt wurde, dass Jesus weiß gewesen war – überraschenderweise für einen Mann aus dem Mittleren Osten.
Paul hielt deshalb so eifrig Augenkontakt mit der heiligen Lady voller Gnaden, weil er kein Blut sehen konnte, nicht das von anderen Leuten und schon gar nicht sein eigenes. Normalerweise war das kein Problem. Es erstaunte ihn, wie lange man sich in einer modernen medizinischen Einrichtung aufhalten konnte, ohne tatsächlich Blut zu Gesicht zu bekommen. Es war wie Öl in einem hochmodernen Auto: Man sah es erst, wenn irgendwas richtig schlecht lief.
Brown tupfte seine Lippen erneut ab und wedelte dann mit dem Tuch vor seinem Gesicht herum, als wollte er eine Fliege verscheuchen. Dann warf er Paul einen ungehaltenen Blick zu. Er fuchtelte noch mal mit dem Taschentuch herum, diesmal noch dringlicher. Verlegen zuckte Paul zusammen, als ihm klar wurde, dass er damit das Glas Wasser auf dem Nachttisch meinte. Er streckte die Hand aus und reichte es ihm.
Als der Sturm vorbei war, löste Brown seine Lippen von dem Strohhalm im Glas, und Paul stellte das Wasser vorsichtig auf den Nachttisch zurück. Als er sich umdrehte, hatte Brown seinen Kopf leicht schief gelegt und schenkte ihm einen anerkennenden Blick.
»Du bist ihm wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Und von deinem Onkel hast du auch was abbekommen …«
Paul wusste nicht, was er erwidern sollte, nicht zuletzt wegen der Art, wie Brown dies sagte. Es klang wie ein Kompliment.
Brown schaute zur Decke hinauf, als starre er in die weiteste Ferne, während sich ein langes Schweigen zwischen ihnen ausbreitete. Erschüttert stellte Paul fest, dass sich eine einzelne Träne ihren Weg über die Falten des abgehärmten Gesichtes bahnte. »Ich schwöre bei Gott, ich habe nicht gewusst … was er … ich habe das nicht gewusst.«
Zwei Sekunden später klang Brown beinahe schwatzhaft. »Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du noch ein kleiner Hosenscheißer.« Er schaute zu Boden, wobei seine sowieso schon schwache Stimme weiter absackte. »Ich habe mein kleines Mädchen dreißig Jahre lang nicht gesehen …«
Brown starrte zu dem Fernseher in der Ecke hinüber, aber offenbar nicht, weil er sich das Programm anschauen wollte.
»Würdest du das denn gern?«, wagte sich Paul vor.
Der Blick, den Brown ihm zuschoss, ließ keinen Zweifel: Das hätte er lieber nicht sagen sollen.
»Sie will nichts mit mir zu tun haben … Ich meine … Sie weiß nichts …« Er nahm einen weiteren Atemzug aus der Maske. »Lass sie in Ruhe.«
Während er mehr von der kostbaren Luft einsog, schaute er Paul auf eine Weise an, auf die sich kein Reim machen ließ. Traurigkeit, Trotz, Wut – es ging da zu vieles vor sich, was Paul nicht auseinanderdividieren konnte.
»Weißt du, wenn du dich deinem Ende näherst, ist es nicht die …«, Brown hielt inne, »… Überraschung, die dich fertigmacht, sondern die Scheißvorhersehbarkeit. Du bist Gerrys Sohn. Du wirst tun, was du kannst, um wie er zu werden, ob dir das bewusst ist oder nicht. Deshalb wirst du mir auch nicht glauben, wenn ich dir sage, dass ich nichts verraten habe. Du wirst sie benutzen … so sind wir eben.« Wieder schaute er Paul an, und seine Stimme senkte sich zu einem Flüstern. »Du … siehst wirklich genauso aus wie dein Onkel.«
Das hier war weit genug gegangen. Für wen auch immer dieser Typ Paul hielt, es handelte sich offenbar nicht um jemanden, den er sehen wollte.
»Also, ich glaube, hier liegt doch ein Missverständnis vor, ich denke, ich werde mal lieber …«
Als Paul aufstand, um zu gehen, schoss Browns Hand mit überraschender Geschwindigkeit vor und packte ihn am Handgelenk.
»Nein, nicht … bitte.« Jetzt lag ein Jammern in seiner Stimme. »Für einen alten Freund deines Vaters.«
Paul schaute zur Tür hinüber und zögerte. Vielleicht wäre ein Beruhigungsmittel angebracht – damit die gequälte Seele dieses Mannes Ruhe bekam vor dem, was ihm derartig zusetzte. Irgendwann musste er ein ziemlich einschüchternder Zeitgenosse gewesen sein, aber das war lange her. Nun war er nur noch eine traurige, leere Hülle, die von der Last seines Gewissens erdrückt wurde.
Brown begann wieder zu husten. Er führte die linke Hand mit dem Taschentuch zurück an seine Lippen, und sein Blick wanderte flehentlich zu dem Wasserglas hinüber. Paul griff danach und setzte sich auf die Bettkante.
Als Paul ihm das Wasser reichte, senkte Brown seine linke Hand und schob sie unter die Bettdecke.
»Danke.«
Er nahm den Strohhalm zwischen die Lippen und begann, langsam zu trinken. Paul sah aus dem Augenwinkel, dass er unter der Decke herumfummelte, wollte aber einen weiteren Blick auf das blutige Taschentuch vermeiden. Also bemühte er sich, Brown direkt in die Augen zu schauen. Trotzdem bemerkte er, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmte.
Plötzlich schoss Browns Hand vor und krallte sich in Pauls Kehle. Er ließ das Wasserglas fallen, das vom Bettrand abprallte, bevor es auf dem Boden zerbarst. Paul griff instinktiv nach Browns Arm und versuchte, ihn fortzureißen. Die Augen des alten Mannes funkelten wild, und plötzlich schien er über eine völlig wahnsinnige, verzweifelte Kraft zu verfügen. Kaum bemerkte Paul, dass sich Browns linke Hand am Rande seines Gesichtsfeldes in die Höhe schwang. Es musste ein atavistischer Überlebensinstinkt sein, der ihn dazu brachte, sich im letzten Augenblick abzuwenden, sodass die herabfahrende Hand seinen Kopf knapp verfehlte und stattdessen auf seine rechte Schulter niederging. Er spürte einen stechenden Schmerz, gefolgt von einer unerklärlichen Feuchte, die sich über seinen Arm ausdehnte.
In seiner Verwirrung und Wut begriff Paul nicht wirklich, was geschehen war. Er versuchte, aufzustehen und von seinem Angreifer loszukommen, aber mit dem linken Fuß rutschte er auf dem nassen Boden aus. Brown glitt an Pauls Kehle herab, krallte sich dafür an seinem Shirt fest. Pauls Schwung zog Brown aus dem Bett, sodass er direkt auf ihm landete. Dabei riss er verschiedene Maschinen mit sich, denen der Zusammenstoß mit der Schwerkraft und der Raserei eines Wahnsinnigen schlecht bekam.
Die gnädige Lockerung von Browns schraubstockartigem Griff an Pauls Kehle war nur von kurzer Dauer. Zwar bestand der alte Mann nur noch aus Haut und Knochen, war aber noch schwer genug, um schmerzhaft die Luft aus Pauls Lungen zu pressen, als er auf ihm landete.
Es entstand ein Moment seltsamer Ruhe, als beide Männer kurz um Atem rangen. Sie keuchten wie zwei Fische, die an Deck eines Bootes ihrem Schicksal überlassen wurden. Paul hörte ein unangenehmes Rasseln in seinem Hals und ein Klicken bei jedem angestrengten Atemzug.
Brown erholte sich als Erster. Er wuchtete seinen Körper herum, als würde er eine völlig wahnsinnige Version von Twister spielen, und führte sein Gesicht millimeternah an Pauls heran. Browns blutbefleckter Mund schäumte unter wild stierenden Augen. Sein Atem stank faulig, als würde das, was in seinen Innereien verrottete, in ihm hochkochen. Paul lag wie hypnotisiert da – wohl, weil sein Geist beschlossen hatte, dass das alles zu viel war, und nur noch darauf wartete, dass die Realität wieder zur Vernunft kam.
»Du … hast … mir … alles … genommen!« Der Atem des alten Mannes fuhr wie ein fauler Wind über Pauls Gesicht.
Dann bäumte Brown sich über ihm auf.
Pauls Arme waren wie festgenagelt. Er versuchte, sie freizubekommen, als Brown die linke Hand über seinem Kopf in die Höhe riss. Paul registrierte ein Aufblitzen, und er zuckte zurück, als die Hand des Alten wieder herabfuhr.
Auf halbem Weg nach unten krampfte Browns Arm zusammen, und was auch immer er in der Hand hielt, löste sich aus der Umklammerung und schlitterte über den Boden. Wutentbrannt wandte sich Brown um und bemerkte, was ihn zurückhielt. In animalischer Frustration zog er an seinem Venenkatheter und heulte laut auf. Das Ergebnis war, dass er mit dem Kopf voran erneut auf Paul hinabstürzte, sodass sie wieder Gesicht an Gesicht aufeinanderlagen.
Brown stieß ein krächzendes Wahnsinnsgelächter aus, das sich rasch in würgendes Husten verwandelte. Etwas Heißes und Feuchtes landete auf Pauls Gesicht. Nun konnte er nur noch den verzerrten Mund über sich sehen und das Blut, das zwischen unebenen, gelben Grabsteinzähnen herabtropfte.
Dann ertönte das Geräusch der aufgerissenen Tür, ein Schrei und weiterer Tumult.
Die Hände unsichtbarer Engel griffen nach Brown und zogen ihn fort. Paul sah nur noch, wie das Totenmaskengesicht des Mannes ihn irre geifernd angrinste. Paul wandte den Kopf ab. Erst jetzt bemerkte er, dass Blut sein Hemd um die Schulter herum rot färbte und …
Dann verlor er das Bewusstsein.
Er konnte eben kein Blut sehen. Nicht das von anderen Leuten und schon gar nicht sein eigenes.
KAPITEL DREI
»Eigentlich sind Sie ein echter Glückspilz!«
Er strahlte Paul mit einem warmen, entwaffnenden Lächeln an, das in den meisten Situationen überaus liebenswert gewirkt hätte. In diesem Augenblick aber fiel es Paul sehr schwer, ihm nicht mit voller Wucht eine reinzuhauen.
»Ach ja?«, fragte er. »Ich dachte nämlich, man hätte mir ein Messer in die Schulter gerammt. Hat man mir kein Messer in die Schulter gerammt?« Er beschloss, sich mit Sarkasmus zu begnügen. Schließlich hatte er heute bereits eine gewalttätige Auseinandersetzung hinter sich, und eine weitere traute er sich einfach nicht zu. Außerdem schien der Arzt aufrichtig zu sein, wenn auch ein wenig irre. Paul hatte durchaus erwartet, dass ihm in den frühen Morgenstunden in der Notaufnahme Unerwartetes begegnen würde, aber so viel Euphorie von einem professionellen Mediziner irritierte ihn dann doch. Vor allem da sie von jemandem kam, der ihm soeben erklärt hatte, dass seine rechte Schulter sieben frische Stiche aufwies. Sie war dick bandagiert, und der ganze Arm lag zur Entlastung in einer Schlinge.
Soweit Paul sich das Ganze zusammenreimen konnte, war er mit einem Krankenwagen vom St.-Kilda’s-Hospiz zur Notaufnahme des St.-Katherine’s-Hospital gefahren worden. Er nahm auch an, dass man ihm irgendwann im Laufe der Ereignisse etwas gegen die Schmerzen verabreicht hatte, denn er war ziemlich weggetreten gewesen.
Dr. Sinha war siebenundzwanzig und stammte aus Indien. Er verfügte über eine Urkunde, die ihm den Abschluss des dortigen Medizinstudiums bescheinigte sowie die Tatsache, dass er Drittbester seines Jahrgangs gewesen war. Danach hatte er die klinischen Prüfungen in Irland gleich beim ersten Mal bestanden, und zwar mit Auszeichnung. Er war hierhergekommen, weil er gehört hatte, dass die Iren so freundlich wären. Außerdem war er an einer internationalen Schule unterrichtet worden, was erklärte, warum er ein deutlich besseres Englisch sprach als jeder andere in diesem Gebäude.
Dass Paul über diese Dinge so gut Bescheid wusste, lag daran, dass er mitangehört hatte, wie Dr. Sinha all das drei Mal dem betrunkenen Ehemann der Frau erklärt hatte, die mit gebrochenem Bein am anderen Ende des Krankenzimmers lag.
Der treusorgende Gatte war Anwalt und hatte eine beträchtliche Zeitspanne mit dem Versuch verbracht, die zerschmetterte Gliedmaße seiner Frau wegzuargumentieren. Anscheinend hatten sie einen Skiurlaub gebucht, und das »passte nun gar nicht« zu der Diagnose, sie habe ein gebrochenes Bein. Mit der ganzen Geduld, die den Hindus in Ermangelung von katholischen Heiligen eigen ist, hatte Dr. Sinha vollstes Verständnis dafür gezeigt, dass der treusorgende Gatte auf eine zweite Meinung bestand. Er saß nun neben dem Bett seiner Frau und wartete darauf, dass der »richtige Arzt« auftauchte. Hoffentlich würde es jemand sein, mit dem er zusammen zur Schule gegangen war, damit sie irgendeinen geheimen Handschlag ausführen und aus dem Bruch in null Komma nichts eine leichte Schürfwunde machen konnten.
Nachdem er beobachtet hatte, mit wie viel Würde Dr. Sinha dem Ehemann aus der Hölle entgegengetreten war, hätte Paul ihn eigentlich mögen müssen. Die positive Einschätzung seiner Lage durch den braven Doktor machte es ihm allerdings ziemlich schwer.
»Ja, ein Glückspilz«, wiederholte Dr. Sinha. »Das obere Schulterblatt bietet nämlich optimale Voraussetzungen für Stichverletzungen. Wenn die Klinge die Rotationssehne verfehlt, was sie, wie ich Ihnen gerne mitteile, in Ihrem Fall getan hat, besteht nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Schadens.«
»Oh … gut.«
»Sehr gut sogar. Sie sollten sich an dieser Stelle allerdings keine Schussverletzung zuziehen. Das wäre wiederum äußerst unglücklich. In diesem Bereich verlaufen nämlich eine große Arterie und wichtige Nerven, die den Arm kontrollieren, ganz zu schweigen von einem Gelenk, das kein Chirurg der Welt neu aufbauen kann. Das wären dann wirklich schlechte Nachrichten.«
»Danke für den Tipp«, sagte Paul. »Nur damit ich Bescheid weiß: Wo wäre denn eine gute Stelle für eine Schussverletzung?« Er hatte immer noch nicht verinnerlicht, dass Dr. Sinha sich im Sarkasmus nicht zuhause fühlte.
»Gluteus maximus – gar keine Frage. Ob Schusswunde oder Stichwunde – wenn Sie die Wahl haben, entscheiden Sie sich immer für den Hintern.«
Offenbar war der Doktor nur mit Schusswechseln vertraut, die in höflicher gegenseitiger Abstimmung stattfanden.
»Also, wenn ich Hintern sage, meine ich natürlich die Backen und nicht den …«
»Super«, unterbrach ihn Paul. »Ich glaube, das habe ich so weit verstanden.«
Sinhas gute Laune schien einen Dämpfer zu erfahren, und Paul plagte augenblicklich ein schlechtes Gewissen – als hätte er einen fröhlich hechelnden Hundewelpen aus dem Weg getreten.
»Entschuldigung«, sagte Dr. Sinha. »Manchmal geht es bei medizinischen Fachfragen mit mir durch. Und das führt zu einer unangebrachten Art, mit den Patienten zu kommunizieren.«
»Das würde ich so nicht sagen.«
»Nun, es wurde schon so gesagt«, erwiderte Dr. Sinha. »Ich zitiere aus der Beurteilung, die ich am Ende meiner Probezeit bekommen habe.« Dann fügte er mit verletztem Stolz hinzu: »Offenbar habe ich zu viel Freude an meiner Arbeit.«
Paul warf erneut einen Blick zum treusorgenden Gatten hinüber. »Geben Sie sich ein bisschen Zeit. Ich bin sicher, das vergeht.«
»Eigentlich wollte ich Sie nach etwas anderem fragen.« Dr. Sinha löste das Klemmbrett vom Fußende des Bettes. »Ich bin ein wenig verwirrt. Hier steht, dass Ihr Angreifer …«, er hielt inne, um aus dem Krankenblatt vorzulesen, »… Ihnen Blut ins Gesicht gehustet hat?«
»Ja … ähm.« Bei der Erinnerung daran, wie Browns geistesgestörte Totenmaske ihn angegeifert hatte, drehte sich Paul der Magen um.
»War der Mann verwundet?«
»Nein!« Paul fühlte sich von der Frage angegriffen. »Ich habe nichts …«, stammelte er. »Ich habe mich lediglich verteidigt.«
»Okay, ich verstehe.« Dr. Sinhas Gesichtsausdruck ließ deutlich erkennen, dass er es keineswegs verstand.
»Soweit ich weiß, befindet er sich im letzten Lungenkrebs-Stadium«, fügte Paul erklärend hinzu.
»Und er hat Ihnen ein Messer in die Schulter gerammt?«
»Ja.«
»Warum hat er …«
So langsam fiel Dr. Sinha ihm wirklich auf die Nerven. »Das müssen Sie schon ihn fragen.«
»Oh … okay«, sagte der Arzt. »Es ist bloß … hier steht nämlich, dass er … verstorben ist.«
»Oh …«
»Akuter Herzinfarkt, heißt es hier.«
Paul wusste nicht, was er davon halten sollte. In diesem Augenblick wollte er einfach überhaupt nichts davon halten. Er hatte noch nicht einmal annähernd genug Zeit gehabt, sich selbst zu bedauern, und nun erwartete man schon, dass er auf solch eine Information reagierte.
Dr. Sinha warf ihm einen merkwürdigen, leutseligen Blick zu. Paul merkte, dass der junge Mediziner eine Gelegenheit witterte, seine Patientenkommunikation zu trainieren. Dr. Sinha legte den Kopf schief und ging so unbewusst in den vollen Jungfrau-Maria-Modus.
»Dann muss er gestorben sein, nachdem …«
»Ja, er war nämlich davor und währenddessen eindeutig am Leben.«
»Haben Sie ihn gut gekannt?«
»Nein«, erwiderte Paul. »Ich hatte ihn gerade erst kennengelernt.«
Dr. Sinhas Gesicht hellte sich auf. »Oh, na dann ist es ja gar nicht so schlimm, oder?«
»Nicht?«
»Ich meine, mir persönlich wäre es deutlich lieber, wenn ein Fremder versuchen würde, mich umzubringen, als jemand, den ich gut kenne.«
»Stimmt wohl.« So konnte man die Sache durchaus sehen.
»Die gute Nachricht: St. Kildas hat uns ein aktuelles Blutbild von Mr. Brown zugeschickt, und soweit wir das sehen, hatte er nichts Ansteckendes. Kein Aids, Hepatitis, Ebola …«
»Fantastisch.«
»Sie sind also komplett in Ordnung …«
»Abgesehen von der Stichwunde.«
»Ach, ha, ha. Entschuldigen Sie.« Er sagte tatsächlich ha, ha, und das auf eine Weise, die Paul überaus nervtötend fand. »Wir beide haben ein wirklich schwieriges Gespräch führen müssen, und jetzt sehen Sie uns an: Wir machen schon Scherze! Das ist doch wunderbar gelaufen.« Wieder strahlte er übers ganze Gesicht. »Was mich zu dem nächsten Punkt bringt, um den wir uns kümmern müssen. Es scheint ein Problem mit dem Notfallkontakt gegeben zu haben, den Sie uns bei Ihrer Einlieferung genannt haben.«
»Ach ja?«
»Das passiert andauernd in dieser Situation. Überall hetzen die Leute um einen herum …«
»Außerdem hatte man mich fast erstochen.«
»Außerdem hatte man Sie fast erstochen. Wir haben die Nummer angerufen, die Sie uns gegeben haben, aber anscheinend handelt es sich um einen chinesischen Lieferdienst namens The Oriental Palace.«
»Das ist nicht bloß ein Lieferdienst. Sie haben erst vor Kurzem einen Gästeraum mit besonders authentischem Ambiente eingerichtet.«
Mrs. Wu wäre stolz auf ihn gewesen. Seit beinahe drei Monaten sagte sie jedes Mal, wenn sie ans Telefon ging: »Hallo, The Oriental Palace – seit Neuestem mit einem Gästeraum mit besonders authentischem Ambiente.« Irgendjemand musste ihr gesagt haben, dass ihr neu eingerichtetes Restaurant über ein besonders authentisches Ambiente verfügte. Und wenn sie auch vielleicht nicht wirklich wusste, was damit gemeint war – daraus würde sie verdammt noch mal Kapital schlagen.
»Ich verstehe«, sagte Dr. Sinha. »Arbeitet ein Verwandter von Ihnen im Oriental Palace?«
»Nein, nicht wirklich.« Oder eigentlich gar nicht. »Fragen Sie nach Mickey.«
»Okay. Mickey wer?«
Das hatte Paul befürchtet. Wer wusste schon den Nachnamen seines Lieferdienstfahrers? Klar, Mickey war dann und wann auch mal reingekommen und hatte eine mitgeraucht oder an einem mauen Dienstag ein lebensbedrohlich billiges osteuropäisches Bier mitgetrunken. Einmal war er sogar länger geblieben und hatte die Hälfte von Roxanne auf DVD mitgeschaut, aber nach seinem Nachnamen zu fragen kam Paul doch arg persönlich vor. Mickey hatte ihm erzählt, dass er nicht aus China stammte und wie wahnsinnig es ihn machte, wenn die Leute es ihm einfach unterstellten. Leider hatte Paul vergessen, woher Mickey tatsächlich kam. Das war also ein weiteres Minenfeld. »Bloß Mickey.«
»Also keine Verwandten, die wir für Sie anrufen sollen?«
»Nein. Keine.«
Dr. Sinha machte dies offensichtlich verlegen. »Nun, als jemand, der aus einer sehr großen Familie stammt, darf ich vielleicht sagen, dass ich Sie beneide. Ich muss die Hälfte meines Gehalts für Geburtstagskarten ausgeben.«
»Muss schwer sein.«
»Ist es!« Dr. Sinha schien der Themenwechsel neuen Auftrieb zu geben. »Sieben Geschwister und, als ich das letzte Mal durchgezählt habe, sechsundzwanzig Neffen und Nichten. Plop – schon wieder ein Baby. Plop, plop – Zwillinge. Das hört einfach nicht auf.«
»Wow.«
»Also, dann notiere ich hier: Patient hat keine Familie?«
»Jep.«
»Wie sieht es aus mit einer Partnerin oder einem Partner?«
»Nein.«
»Okay, wunderbar. Sie sind also vollkommen allein«, sagte Dr. Sinha. »Ich meine, abgesehen von Mickey?«
»Ja.«
»Hervorragend.«
»Sie geben einem auf jeden Fall das Gefühl, dass es so ist.«
Dr. Sinha blätterte die Seite auf dem Klemmbrett um. »Nun, ich denke, das wäre alles. Es sei denn, Sie hätten noch irgendwelche Fragen an mich?«
»Nein«, sagte Paul.
Ein lauter, Aufmerksamkeit erheischender Huster vom treusorgenden Gatten schallte durch das Krankenzimmer. Seine zweite Meinung war immer noch nicht aufgetaucht.
»Überhaupt gar keine Fragen?«, erwiderte Dr. Sinha mit einem leichten Flehen in den Augen.
Paul fühlte sich verpflichtet. »Wann kann ich hier raus?« Nach kurzem Nachdenken wurde ihm klar, dass er die Antwort darauf tatsächlich wissen wollte. Er begann, eine starke Antipathie gegen Krankenhäuser zu entwickeln.
»Wir werden Sie morgen noch einmal durchchecken, und vorausgesetzt, alles ist in Ordnung, können Sie in ein paar Tagen nach Hause.« Er zögerte. »Aber … Sie möchten mit der Polizei sprechen.«
»Nicht wirklich«, sagte Paul. Er wollte es nicht – wozu sollte es auch gut sein? Ja, man hatte auf ihn eingestochen, aber der Täter stand für die Polizei nicht mehr zur Verfügung. Es sei denn, sie wollte ein Ouija-Brett hinzuziehen.
Dr. Sinha sah verlegen aus. »Entschuldigen Sie, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Englisch ist nicht meine Muttersprache. Die Polizei möchte mit Ihnen sprechen.«
Paul wurde flau im Magen. Die ganze Sache mit der Stichwunde hatte ihn vom Gesamtbild abgelenkt. Er hatte ein Zimmer betreten, und fünf Minuten später war ein Typ gestorben – und zwar nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihm, bei der sich der Mann genötigt gefühlt hatte, auf ihn einzustechen. Paul erkannte, dass das nicht gut aussah. Je mehr er darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher war es, dass dies jemals auch nur annähernd gut aussehen könnte. Er durfte keinen Ärger mit der Polizei bekommen, das verstieß gegen das zweite Gebot. Sie hatte das sehr klargemacht.
Er schaute hinaus zum Gang der Station und erblickte die Reflektoren einer Uniformweste, die hinter Schwingtüren aufblitzten.
»Steht da draußen ein Polizist?«, fragte er.
»Ja«, erwiderte Dr. Sinha. »Und ganz unter uns: Ich und meine Kollegen sind sehr froh über seine Anwesenheit. Vorhin hat er uns freundlicherweise dabei geholfen, einen Mann zu beruhigen, der ein bisschen zu viel Methamphetamin genommen hat.«
Paul fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und rieb sich den Nacken – eine Angewohnheit in Stresssituationen. »Oh Gott, oh Gott, oh Gott«, sagte er, »das sieht böse aus.«
Dr. Sinha tätschelte ihm beruhigend die Hand. »Entspannen Sie sich, Mr. Mulchrone, ich bin mir sicher, es wird alles gut werden.«
»Ja«, sagte Paul, »das legt der bisherige Verlauf dieser Nacht ja zweifellos nahe.«
KAPITEL VIER
Paul wusste genau, wo er nicht war.
Er war nicht in der Kanzlei von Greevy & Co Solicitors, auch wenn Shane Greevy ihm gegenüber hinter dem Schreibtisch saß und aus einem großen Buch mit Ledereinband vorlas. Greevy sah aus wie immer – er war ein hagerer Mann in seinen Vierzigern, mit beginnender Glatze, und trug sein ewiges Lächeln zur Schau, ohne dabei jemals glücklich auszusehen. Der Mann grinste so, wie ein Mindestlohn-Arbeitnehmer sich für die Feiertage schick anzog: als hätte ihn ein Memo aus der Chefetage dazu gezwungen. Genau genommen konnte dies auch gar nicht die Kanzlei von Greevy & Co Solicitors sein. Paul bemerkte, dass sein Unterbewusstsein die Einrichtung einem Mahagoni- und Lederpolster-Upgrade unterzogen und sogar eine beeindruckende Standuhr in der Ecke hinzugefügt hatte. In Wirklichkeit bestand die Kanzlei nämlich bloß aus zwei ranzigen Räumen in Phibsboro, direkt über einem Sofa-Laden, der nach einem drei Jahre dauernden Ausverkauf vor Kurzem endlich doch noch geschlossen worden war.
Dieser Traum war einer von zwei Träumen, an die sich Paul jedes Mal erinnern konnte, weil ihn beide mit großer Häufigkeit heimsuchten. Dies hier war der, den er in der Regel bevorzugte. Offenbar war es ungewöhnlich, sich bewusst zu sein, dass man träumte, leider hieß das aber nicht, dass er sich selbst auch wecken konnte. Es schien ihm nichts anderes übrigzubleiben, als beinahe jede Nacht wie festgewachsen miterleben zu müssen, wie sich das Ganze immer wieder von vorne abspielte.
Greevy schaute aus dem Buch mit Ledereinband auf und räusperte sich scharf. Offenkundig war er nicht glücklich darüber, dass man ihm keine vollständige Aufmerksamkeit zollte. Das war noch so eine Sache: das Buch. Fidelmas echtes Testament hatte lediglich aus einigen banalen DIN-A4-Ausdrucken bestanden.
Greevy las weiter vor: »… meinen Besitz jeglicher Art, wo auch immer situiert, einschließlich meines Hauses in Richmond Gardens, meine Ersparnisse und Geldanlagen vermache ich dem Tierheim für bedürftige Esel in Donegal.«
In diesem Augenblick stieß der rechts hinter Greevy sitzende Esel sein übliches, bedrohliches Knurren aus. Paul war sich ziemlich sicher, dass Esel in Wirklichkeit nicht knurrten, aber er würde den Teufel tun und seine Alpträume auf ihren Realitätsgehalt prüfen.
»Unabhängig von dieser Regelung hinterlasse ich für meinen Großneffen Paul Mulchrone folgende Verfügung.«
Paul schaute zu seiner Großtante Fidelma hinüber, die wie immer rittlings auf dem Esel saß. Ganz gleich, was er sagte oder tat, sie öffnete nie den Mund. Sie zeigte immer nur dieselbe missbilligende Miene, als wollte sie sagen: »Was stinkt hier eigentlich so?«
Zweimal waren sie einander im wahren Leben begegnet, und beide Male hatte sie nicht mit ihm gesprochen. Beim ersten Mal war er ein sechsjähriger Junge gewesen, der sich hinter seiner Mutter verkrochen hatte. Damals war er durch und durch konzentriert gewesen auf die Aufgabe, die man ihm übertragen hatte: sich um den großen, blauen Koffer zu kümmern. Fidelma und seine Ma stritten miteinander, bevor seine Großtante ihnen die Tür vor der Nase zuknallte. Paul verstand das nicht. Er weinte und beschwerte sich über die Kälte, bis die Tränen seiner Mutter seine eigenen stoppten. Das zweite und letzte Mal, dass er Fidelma getroffen hatte, war, als er gerade zwölf Jahre alt geworden war. Sein Geburtstag war am Tag vor der Beerdigung seiner Ma gewesen, deshalb hatte auch niemand daran gedacht. In dem Raum, in den man ihn brachte, hing ein großes Gemälde eines Baumes. Paul starrte es an, währen Fidelma ihn neuerlich ignorierte und zwei verwirrten und zunehmend wütenden Sozialarbeitern einen Vortrag über das bedauerliche Benehmen »der Jugend« hielt. Dann stürmte sie hinaus. Der Mann vom Sozialamt riss die Tür auf, um ihr einen rüden Ausdruck hinterherzubrüllen, und danach sah Paul sie nie wieder.
»Ihm soll Wohnrecht in meinem Haus in Richmond Gardens und eine Zahlung von fünfhundert Euro im Monat zukommen, von der er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dies ist nur eine vorübergehende Maßnahme, solange er sich um eine vernünftige Anstellung bemüht, was angesichts seiner dürftigen Ausgangslage im Leben naturgemäß eine Herausforderung darstellen dürfte.«
Und da waren sie, die fünf Wörter, die ihn mittlerweile vollständig definierten: »seine dürftige Ausgangslage im Leben«. Es waren jene fünf Wörter, die ihn so außer sich gebracht hatten, dass er zu dem Entschluss gekommen war, ihre ganze Planung ad absurdum zu führen. Statt nach einem Job zu suchen, würde er für immer von fünfhundert Euro im Monat leben. Scheiß auf sie! Und scheiß auf die Esel!
»Hierbei gelten folgende Einschränkungen. Erstens: Er darf auf keinerlei andere Hilfsleistungen vom Staat, von Hilfsorganisationen oder anderen Quellen zurückgreifen. Zweitens: Die monatliche Zahlung endet unverzüglich, sollte er in irgendwelchen Ärger mit der Polizei verwickelt werden.«
In diesem Augenblick begann der weitere Bewohner des Traumes zu johlen und auf seinem Platz hinter Greevys rechter Schulter auf und ab zu hüpfen. Es war Martin Brown. Immer noch in seinem Krankenhaushemd, tropfte das Blut aus seinem geöffneten, heulenden Mund. Er hämmerte auf eine alte Schreibmaschine ein, als würde er sich Notizen machen. Was das sollte, war Paul schleierhaft. Browns Anwesenheit in diesem Traum stellte eine neue und unwillkommene Ergänzung dar. Paul versuchte, Blickkontakt mit dem Esel aufzunehmen, denn selbst im Traum drehte ihm der Anblick des vielen Blutes den Magen um. Aber da es ihm gar nicht gefiel, nicht beachtet zu werden, sprang Brown aus seinem Stuhl und humpelte gebückt wie ein Schimpanse um den Schreibtisch. Schon im nächsten Augenblick legten sich seine knöchernen Hände um Pauls Hals. Er versuchte, sich loszueisen, aber die alten Finger waren irrsinnig stark. Greevy las derweilen weiter vor.
»Drittens: Um seine moralische Natur zu verbessern, wird von ihm verlangt, dass er sechs Stunden gemeinnütziger Arbeit pro Woche verrichtet, was von Mr. Greevy bestätigt werden soll.«
Paul schrie auf, als er spürte, wie sich Browns Zähne in seine rechte Schulter gruben. Während er versuchte, sich freizukämpfen, leierte Greevys Stimme weiter ihren Text herunter. Browns Hände zogen ihn langsam auf den Stuhl zurück, und Paul schaute zu Fidelmas unentwegt abschätzigem Blick hinauf.
Dann spürte er, wie eine Hand sanft seine linke Schulter schüttelte, und hörte, leiser und weiter entfernt, eine andere Stimme.
»Paul? Paul? Geht’s dir gut?«
Er drehte sich um und sah, dass Brigit Conroy auf ihn herabblickte. Ihr Gesicht war ein Inbegriff der Sorge. Das war auch neu.
Und dann wurde der Griff der Knochenhände um seinen Hals fester, seine Kehle wurde enger, und er schrie.
Paul schreckte aus dem Schlaf, schnappte nach Luft und blickte in Brigits besorgtes Gesicht.
Lichtstreifen und Desinfektionsmittel-Geruch. Ein gestärktes Laken an seiner Haut, zu fest unter die Matratze geklemmt, sodass sein Körper gefangen war. Er wusste, wo er sich befand. Im Krankenhaus. Er ließ den Kopf zurück aufs Kissen sinken, während das rhythmische Herzklopfen in seinen Ohren langsam leiser wurde. Nun, da ihm das Wo seiner Lage wieder bewusst war, folgten zügig das Wer, Wann und insbesondere das Warum. Er atmete einige Male tief durch.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Brigit.
Da seine Sinne wieder erwacht waren, sah Paul sich auch in der Lage, Brigit zu zeigen, wie er sich tatsächlich fühlte – er war stinkwütend.
»Oh, super, danke der Nachfrage«, sagte er.
»Es tut mir leid, dass …« Ihre Stimme verlor sich.
»Was tut dir leid? Dass du dafür gesorgt hast, dass ich abgestochen wurde? Ach was, mach dir bloß keine Gedanken. Ich hatte für den Abend eh keine Pläne, und die haben mir hier massenhaft kostenlose Drogen verabreicht. Ich führe das reinste Popstar-Leben!«
Sie setzte an, etwas zu sagen, aber er war noch nicht mal annähernd fertig. Er hatte dieses Gespräch in seinem Kopf Dutzende Male durchgespielt, und auf seinem inneren Teleprompter war noch jede Menge Text, der unbedingt rauswollte.