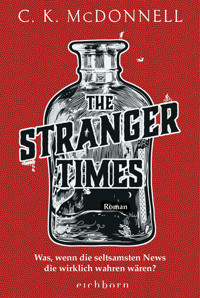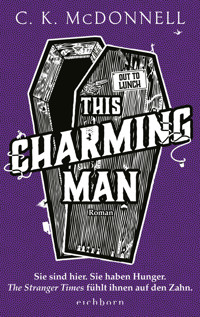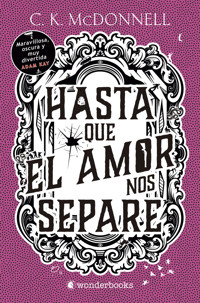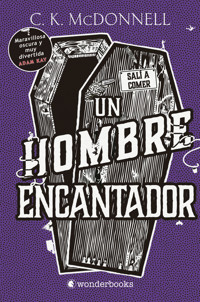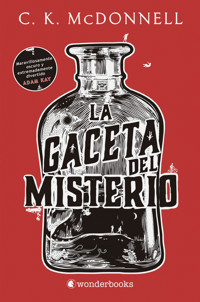14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Stranger Times
- Sprache: Deutsch
Ehen sind schon in den besten Zeiten schwierig, vor allem, wenn einer der beiden tot ist.
Vincent Banecroft, der jähzornige Chef der STRANGER TIMES, hat den Tod seiner Frau nie akzeptiert ... trotz recht eindeutiger Beweise für das Gegenteil. Nun scheint es, als ob er doch Recht behalten könnte: Wie weit wird er gehen, um sie zu retten?
Banecroft ist abgelenkt und damit kommt der Rücktritt von Hannah Willis als stellvertretende Chefredakteurin äußerst ungelegen. Ist es eine gute Idee, sich ausgerechnet jetzt in das schicke New-Age-Zentrum einer Promi-Sekte zu flüchten?
Und dann verschwindet auch noch ein ehemaliger Kolumnist der Zeitung - besonders beeindruckend, da er nie existiert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Epilog 1
Epilog 2
Kostenloser Bonus
Danksagungen
Der Regen
Über den Autor
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Über das Buch
Ehen sind schon in den besten Zeiten schwierig, vor allem, wenn einer der beiden tot ist.
Vincent Banecroft, der jähzornige Chef der Stranger Times, hat den Tod seiner Frau nie akzeptiert ... trotz recht eindeutiger Beweise für das Gegenteil. Nun scheint es, als ob er doch Recht behalten könnte: Wie weit wird er gehen, um sie zu retten?
Banecroft ist abgelenkt und damit kommt der Rücktritt von Hannah Willis als stellvertretende Chefredakteurin äußerst ungelegen. Ist es eine gute Idee, sich ausgerechnet jetzt in das schicke New-Age-Zentrum einer Promi-Sekte zu flüchten?
Und dann verschwindet auch noch ein ehemaliger Kolumnist der Zeitung – besonders beeindruckend, da er nie existiert hat.
C. K. McDonnell
Nach dem Tod fängt das Leben erst richtig an? The Stranger Times ermittelt
Roman
Übersetzung aus dem Englischen von André Mumot
Kapitel 1
Tristram Bleekers Kopf schaltete vollständig ab. Aus nächster Nähe in die Mündung einer Waffe zu schauen hat bisweilen diese Wirkung. Sein Mund war trocken, seine Handflächen schweißnass. Und er stellte fest, dass er unfähig war, auch nur einen einzigen zusammenhängenden Gedanken zu entwickeln.
Er kannte sich in diesem Bereich nicht besonders gut aus, aber dies war eindeutig keine normale Waffe. Anstatt des typischen, geraden Laufes öffnete sich die Mündung wie der Trichter einer Posaune. Gebannt hielt Tristram den Blick auf diese Öffnung gerichtet, als könne er in der finsteren Tiefe den Funken ausmachen, der das spektakuläre Ende seines bislang so unspektakulären Lebens einläuten würde. Es war, als schaue er einem äußerst reizbaren Drachen ins Nasenloch, der ihn mit einem einzigen Atemstoß in brutzelndes Grillfleisch verwandeln konnte.
»Muss ich meine Frage wiederholen?« Die Stimme am anderen Ende der Waffe klang seltsam müde, als wäre Tristram mindestens die zehnte Person, auf die ihr Besitzer an diesem Tag zielte, und als würde ihn das alles nur noch anöden.
Tristrams Lippen bewegten sich, aber er brachte kein einziges Wort heraus.
Hinter der Waffe wurde unzufrieden mit der Zunge geschnalzt. »Das läuft gar nicht gut.«
In der Tat. Es hieß ja immer, dass einem unter solchen Umständen das ganze Leben vorm inneren Auge ablief, aber bei Tristram war das anders. Es waren vielmehr die ersten zehn Minuten dieses Vorstellungsgespräches, die er immer wieder durchspielte, in dem verzweifelten Versuch, nachzuvollziehen, wie es zu dieser beunruhigenden Eskalation gekommen war. An irgendeinem Punkt musste er irgendetwas furchtbar falsch gemacht haben. Eigentlich hatte Tristram ein glückliches Händchen bei Vorstellungsgesprächen – da waren sich alle einig. Er war sympathisch, wohlartikuliert und ein Meister der kurzen, prägnanten Antworten. Man hatte ihn zwar gewarnt, heute mit allem rechnen zu müssen, aber bis vor wenigen Minuten hatte er noch geglaubt, sämtlichen Stolperfallen geschickt ausgewichen zu sein. Nur um im nächsten Augenblick festzustellen, dass er in die Mündung dieser seltsamen Waffe starrte.
»Die Frage lautete«, sagte die Stimme, die zunehmend ungehalten klang, »wie gut kommen Sie mit Stresssituationen klar?«
»Ich … ich …«, stotterte Tristram.
»Schon gut. Ich denke, das genügt als Antwort.«
Tristram glaubte, zu hören, wie sich hinter ihm eine Tür öffnete. Es folgte das Nach-Luft-Schnappen einer Frau. »Vincent!«
»Ich bin hier beschäftigt, Grace!«
»Das sehe ich. Legen Sie augenblicklich diese entsetzliche Waffe weg!«
Nach einer gefühlt sehr langen Zeit wandte sich das Maul des Drachens ab und wurde durch das Gesicht eines Mannes ersetzt. Es sah aus, als habe es eine Dusche, eine Rasur, eine vernünftige Mahlzeit und etwa einen Monat Schlaf dringend nötig. Und es gehörte zu der Person, die auf Tristram gezielt hatte: Vincent Banecroft, Chefredakteur der Stranger Times und frühere Fleet-Street-Legende.
Nach der Waffe war der Anblick von Banecrofts Gesicht nur eine minimale Verbesserung. Seine Augen lagen tief eingesunken in dunklen Höhlen. Einen Moment lang schloss er seine Lider, und Tristram fragte sich, ob er jetzt auch noch einschlafen würde, aber dann wurden sie auch schon wieder aufgerissen. Als wahrer Meister des Multitaskings legte Banecroft die Waffe neben sich ab, grinste hämisch über den Tisch und zündete sich eine Zigarette an.
Grace, die freundliche, mütterliche schwarze Frau, die am Empfang gesessen hatte, tauchte hinter Banecrofts Schulter auf. In ihren Händen hielt sie ein Tablett, auf dem zwei Tassen und ein Teller mit Keksen standen.
»Verzeihen Sie, Tristram. Mr. Banecroft ist manchmal ein wenig zu …«
»… einfühlsam«, beendete Banecroft den Satz.
Grace runzelte die Stirn. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das Wort war, nach dem ich gesucht habe.«
»Hätte es aber sein sollen.« Banecroft hielt zwei Bögen Papier in die Höhe, die Tristram sofort wiederkannte. Es war sein Lebenslauf. »Unser Mr. Bleeker hier, der sich für die Position des stellvertretenden Chefredakteurs dieser Publikation bewirbt, hat einen erstklassigen Journalismus-Abschluss an der Universität von Leeds vorzuweisen, gefolgt von sieben Jahren Berufserfahrung bei verschiedenen überregionalen Tageszeitungen und weitaus fachspezifischeren Magazinen. Sein Traum ist es, hier zu arbeiten, weil er sich schon sein Leben lang für das Übernatürliche interessiert. Sein Portfolio ist, offen gesagt, herausragend. Und seine Referenzen werfen ein derart gutes Licht auf ihn, dass man bei der Lektüre eine Schutzbrille aufsetzen muss, um keinen dauerhaften Schaden an der Netzhaut davonzutragen.«
»Ich weiß«, sagte Grace. Dann fügte sie durch zusammengebissene Zähne hinzu: »Er ist perfekt für den Job.«
»Ganz genau!« Banecroft ließ Tristrams Lebenslauf in den Papierkorb neben seinem Schreibtisch fallen und schnippte lässig etwas Zigarettenasche hinterher. »Mein Punkt ist: Wenn etwas wie eine Ente aussieht, wie eine Ente watschelt und wie eine Ente quakt, muss ich mich doch ernsthaft fragen, warum sich ausgerechnet dieses Geschöpf für die Position des brotliebenden Wasservogels bewirbt, die wir so dringend besetzen müssen.«
Grace verzog kurz das Gesicht, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein. Das ist mir zu hoch.«
Tristram räusperte sich und stellte überrascht fest, dass er die Fähigkeit zu sprechen wiedererlangt hatte. »Ich glaube, Mr. Banecroft versucht damit zu sagen, dass ich für die Position überqualifiziert bin.«
»Nein, ich versuche gar nichts zu sagen. Ich sage, dass Sie vollkommen qualifiziert sind für die Position. Zu vollkommen. Und jetzt ziehen Sie Leine, bevor ich die Beherrschung verliere. Und lassen Sie Ihre Hintermänner wissen, dass ich beim nächsten Mal nicht so wohlgesinnt darauf reagieren werde, wenn sie so etwas noch einmal probieren. Und apropos …«
Banecroft nahm die Flasche irischen Whiskeys zur Hand, die auf seinem Schreibtisch stand, und schenkte sich eine bescheidene Menge in sein Glas. Dann goss er weiter, bis er eine unbescheidene Menge erreicht hatte, und dann noch weiter Richtung Todeswunsch.
»Offenbar liegt hier ein Missverständnis vor.« Tristram versuchte, jovial zu klingen. »Niemand hat mich geschickt.«
»Schön.« Banecroft tätschelte seine Waffe. »Also, ich zähle bis zehn. Erst dann werde ich Sie erschießen. Und sollte sich nach Ablauf einer Woche niemand nach Ihnen erkundigt haben, werde ich mich in aller Demut bei Ihrem Leichnam entschuldigen.«
»Vincent!«, rief Grace aus. »Sie sind unvernünftig. Selbst für Ihre Verhältnisse – und das will wirklich was heißen.«
»Vier«, verkündete Banecroft.
»Okay«, sagte Tristram. »Ich verstehe. Sie testen mich.«
»Nein. Fünf.«
Tristram schaffte es nicht, die Panik in seiner Stimme zu verbergen. »Was ist denn mit eins bis drei passiert?«
»Ich habe lediglich gesagt, bis wohin ich zähle. Ich habe nicht gesagt, wo ich mit dem Zählen anfange. Sechs.«
Tristram schaute zu Grace auf. »Er nimmt mich auf den Arm, oder?«
Die Frau zuckte mit den Schultern, wobei aus einer der Tassen ein großer Schluck Tee schwappte. »Der Herr sei mein Zeuge, ich kann Ihnen das nicht versprechen.«
»Sieben.«
Tristram kam auf die Füße. »Ihr seid ja völlig verrückt!«
Banecroft griff nach seiner Waffe. »Was uns nicht tötet, macht uns hart, aber unser Mr. Chekhov hier wird Sie schneller selig machen, als unsere Büroleiterin die erste Strophe von Saving Grace anstimmen kann. Acht.«
»Ich werde Sie bei der Polizei anzeigen.«
Banecroft hob die Waffe und schaute zu Grace auf. »Saving … Grace? Kapiert? Das fand ich ziemlich clever.«
»War es nicht«, sagte Grace.
»Sie wissen einfach ein gutes Wortspiel nicht zu schätzen. Das ist Ihr Problem. Neun.«
Tristram machte auf dem Absatz kehrt und rannte auf den nächsten Ausgang zu. Unterwegs stolperte er noch über einen der vielen Bücherstapel auf dem Boden und krachte kopfüber ins Nebenzimmer. In seiner Eile verließ er den Raum durch eine andere Tür als die, durch die er eingetreten war, und so fand er sich ausgestreckt auf dem abgewetzten Teppich eines Großraumbüros wieder.
Drei Personen saßen hinter Schreibtischen und tranken aus Teetassen: ein untersetzter Herr im dreiteiligen Karo-Anzug, ein ostasiatischer Mann, der ein Jo-Jo auf und ab hüpfen ließ, und ein schwarzes Teenager-Mädchen mit lilafarbenen Haaren, das nicht mal von seinem Handy aufschaute.
Tristram deutete hinter sich auf Banecrofts Büro. »Dieser Mann ist ein Ungeheuer.«
Als Erwiderung auf seine Worte erntete er allgemeines, nonchalantes Kopfnicken. Dann wandte sich der untersetzte Herr im dreiteiligen Anzug an seine Kollegen: »Ich muss sagen, diese neuen Kekse sind wirklich ein bisschen trocken.«
Kapitel 2
Grace schlug in ihrem Notizblock eine unbeschriebene Seite auf, während Banecroft sich auf den Stuhl fallen ließ, den er bei solchen Konferenzen üblicherweise besetzte. Wenn es so weiterging, dachte sie, und sie noch mehr Mitarbeiter verloren, könnte er gleich in seinem Büro bleiben, und sie würden einfach zu ihm gehen. Dann müsste er wenigstens nicht mehr schlecht gelaunt in den Bullenstall gestampft kommen.
»Also gut«, begann Banecroft. »Dann legen wir mal los mit unserer Parade der Unfähigkeit, was? Grace – Sie haben das Wort.«
Sie las vor, was sie aufschrieb. »Wöchentliche Redaktionskonferenz. Anwesend – die Mitarbeiter der Stranger Times.«
»Die übrig gebliebenen«, murmelte Ox vor sich hin, während er noch immer sein Jo-Jo hüpfen ließ.
»Was war das?«, blaffte Banecroft.
»Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir die übrig gebliebenen Mitarbeiter sind. Seit wir Hannah verloren haben.«
»Verloren? Wir haben sie nicht verloren«, entgegnete Banecroft. »Sie ist uns ja nicht versehentlich in die Sofaritze gerutscht. Sie hat uns im Stich gelassen und ist auf allen vieren zu dem untreuen Phallus zurückgekrochen, von dem sie sich eigentlich scheiden lassen wollte.«
»Aber warum?«, fragte Reggie und rückte seine Weste zurecht.
Banecroft warf entrüstet die Hände in die Höhe. »Das haben wir doch in den letzten drei Wochen mehrfach besprochen. Sie hat mich lediglich über ihren Kündigungswunsch in Kenntnis gesetzt, und dann hat sie gekündigt. Ihr scheint alle Schwierigkeiten damit zu haben, diese beiden simplen Tatsachen zu begreifen.«
»Aber was haben Sie zu ihr gesagt?«, fragte Stella.
»Inwiefern ist das relevant?«
Sie schob sich ihre lilafarbenen Haare aus den Augen. »Weil Sie dazu neigen, wirklich schreckliche Dinge zu sagen, Boss. So wie andere Menschen zum Atmen neigen.«
Banecroft warf dem jungen Mädchen einen durchdringenden Blick zu. »Und doch scheint man mich hier als den entspannten, kuscheligen Chef wahrzunehmen, der sich unerklärlicherweise von einer Journalistin in Ausbildung bei einer Konferenz beschimpfen lässt, ohne dass diese befürchten muss, ihren Job zu verlieren.«
»Sie können mich nicht feuern. Sie haben sowieso schon zu wenig Angestellte. Außerdem stehe ich auf der Liste für den Job als Ihre Stellvertreterin an zweiter Stelle.«
»Moment mal.« Ox deutete erst auf sich, dann auf Reggie. »Wer von uns beiden soll denn deiner Meinung nach in der Hierarchie hinter dir stehen?«
»Ihr beide«, unterbrach Banecroft mit einem Achselzucken. »Auf Platz eins steht natürlich Grace.«
Die Vorstellung löste bei Grace sofort eine leichte Übelkeit aus. »Wagen Sie es ja nicht«, warnte sie. »Vielleicht sollten Sie Hannah einfach anrufen und sich bei ihr entschuldigen?«
»Wofür?«
»Für alles«, sagte Stella.
»Wofür nicht?«, warf Ox ein.
»Dafür, dass Sie Sie sind«, schloss Reggie.
»Na schön.« Banecroft beugte sich vor. »Eins nach dem anderen. Erstens schlittert ihr hier ganz dicht an der Meuterei entlang. Zweitens: Wie es der Zufall will, habe ich bereits versucht, Hannah anzurufen. Nicht – das möchte ich betonen – um mich zu entschuldigen, sondern nur, um zu sehen, ob die Frau wieder zur Vernunft gekommen ist. Ihr Handy schaltet aber permanent auf Anrufbeantworter.« Er wandte seinen Blick von einem zum anderen. »Hatte einer von euch das Glück, sie an den Apparat zu bekommen?«
Die verbliebenen Mitarbeiter vermieden es, ihn anzusehen. Grace hatte mehrere Male pro Tag versucht, Hannah telefonisch zu erreichen, als Reaktion aber nur ein einziges Wort erhalten. Am ersten Morgen ihrer Abwesenheit hatte Hannah ihr ein schlichtes »Sorry« per SMS geschickt. Grace wusste, dass auch die anderen keinen Erfolg gehabt hatten.
Banecroft verschränkte die Arme und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Das dachte ich mir. Ihr könnt alle gern weiter so tun, als wäre das meine Schuld, aber die Realität sieht anders aus: Sie hat uns im Stich gelassen!«
Niemand hatte irgendetwas dazu zu sagen.
Seit Hannahs schockierender Kündigung war die Moral in der Redaktion ins Bodenlose gesunken. Sie hatte nur wenige Monate hier gearbeitet und war doch zu dem Kitt geworden, der sie alle zusammenhielt. In den folgenden Wochen hatte sich die Wolke der Depression, die über diesem Ort hing, in allerlei kleinen Zankereien und verletzenden Bemerkungen manifestiert. Reggie hatte sogar eine Meinungsverschiedenheit mit Manny gehabt, dem permanent entspannten Rastafari, der im Erdgeschoss für die Druckerei zuständig war. Sich mit Manny zu streiten war, als versuche man, eine Wolke zu verprügeln.
Alle hatten das Gefühl, eine Freundin verloren zu haben. Schlimmer noch war die unausgesprochene Erkenntnis, dass die Person, die sie für eine gute Freundin gehalten hatten, dies offenbar nie gewesen war. Wahre Freunde stehen nicht einfach auf und machen sich für immer aus dem Staub.
»Also«, sagte Banecroft, »wenn wir jetzt mit unseren kleinen Wutanfällen fertig sind – wir hätten da eine Zeitung herauszubringen.«
»Um dies zu tun«, entgegnete Grace, »brauchen wir aber wirklich dringend einen stellvertretenden Chefredakteur.«
»Eine Woche können wir uns noch durchhangeln, bis ein geeigneter Kandidat auftaucht.«
»Ach ja? In der Ausgabe von letzter Woche gab es zweimal die Seite sieben.«
»Und«, fügte Reggie hinzu, »ein Kreuzworträtsel, das man nicht lösen konnte, weil die Lösungen zum Rätsel von vor drei Wochen gehörten.«
»Ja«, stimmte Grace zu. Wegen dieser Panne wurde sie mit wütenden Anrufen geradezu bombardiert. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass die Leute Kreuzworträtsel derartig ernst nahmen. Theoretisch hatte es sogar eine Morddrohung gegeben. »Theoretisch« weil die Überschneidung derjenigen, die Kreuzworträtsel vervollständigten, und derjenigen, die Gebäude mittels Bomben in die Luft sprengten, gleich null war. Das behauptete jedenfalls Ox. Falls er sich doch irrte, war die Menschheit eindeutig dem Untergang geweiht. »Ganz zu schweigen von der Story über den Geist von Mr. Adam Wallace, der regelmäßig den Lap-Dance-Club in Chinatown besucht und dort die Tänzerinnen unsittlich berührt haben soll.«
»Ah«, sagte Ox. »Jetzt verstehe ich. Dieser alte Knacker, der heute Morgen bei uns vor der Tür stand …«
»War der überaus lebendige Mr. Wallace«, bestätigte Stella. »Begleitet von seiner lieben Gattin, die ziemlich sauer zu sein schien.«
»Ich gebe zu«, sagte Reggie, »dass meine Informationen in diesem Fall mangelhaft waren. Okay, die Berichte über seinen Tod sind vielleicht übertrieben. Soweit ich weiß, treffen die über sein Verhalten aber absolut zu.«
»Trotzdem – nicht gerade paranormal, oder?«
Reggie sah verletzt aus. »Das sagt der Richtige. Ich beherrsche wenigstens die Rechtschreibung. Du hast einen halbseitigen Artikel über ein nicht identifiziertes Flutobjekt über Bolton abgegeben.«
»Das ist ja wohl nicht mal annähernd so schlimm wie …« Ox hielt inne und schaute zum Kopfende des Tisches hinüber. Banecroft war das Kinn auf die Brust gesackt, die Augen hatte er geschlossen.
Vieles machte Grace im Augenblick Sorgen, aber dies irritierte sie am meisten. Vincent Banecroft war nie das gewesen, was man landläufig gesund nennen würde, aber in den letzten Wochen war es mit ihm wirklich steil bergab gegangen. Dass er mitten im Gespräch einschlief, war eine neuer, alarmierender Trend. Auch seine geistesabwesende Lustlosigkeit beunruhigte sie. Von Vincent Banecroft zu behaupten, er sei noch reizbarer als sonst, war, als würde man dem Ozean ankreiden, nasser geworden zu sein, aber es traf zu. Er war es wirklich. Seine Wut war oft ungerechtfertigt gewesen, aber man hatte doch immer einen tieferen Grund dahinter erkannt. Nun aber schien sie immer wieder völlig aus dem Nichts aufzutauchen.
Davon abgesehen machte sich seine Krise auch in der Zeitung selbst bemerkbar. Der »alte Banecroft«, wie sie ihn nun im Stillen oft nannte, hätte nie zugelassen, dass derartig viele Patzer passierten. Es war, als wäre er nur noch halb anwesend. Als spule er nur seine Pflichten ab.
Grace schaute sich um und sah, dass sich ihre Sorgen auch in den Gesichtern der Kollegen spiegelten. Dann aber brach Banecroft die Spannung, indem er laut einen fahren ließ. Dies schien ihn zu wecken, und seine Augen blitzten unvermittelt auf.
»Also«, sagte er, wie aus der Pistole geschossen, »wenn ihr alle soweit fertig seid, würde ich euch gern daran erinnern, dass euer Job nicht darin besteht, auf die Fehler der anderen hinzuweisen. Als Chefredakteur ist dies mein Job und mein besonderes Privileg.«
Stella verschränkte mürrisch die Arme. »Und es ist die Aufgabe des stellvertretenden Chefredakteurs, dafür zu sorgen, dass diese Fehler gar nicht erst passieren. Deshalb brauchen wir ja einen.«
»Und wir werden auch einen bekommen. Schlussendlich.«
»Ich dachte, es würde diese Frau werden, die die vielen Schals getragen und nach Patschuliöl gerochen hat.«
»Wir hatten eine fundamentale Meinungsverschiedenheit.«
»Kaum zu fassen!«, murmelte Reggie, was ihm einen besonders feindseligen Blick von Banecroft einbrachte.
»Die Frau glaubte nicht an doppelte Buchstaben.«
»Wie bitte?«
»Bestes Beispiel – sie glaubte nicht daran, dass das Wort Bitte zwei ts enthalten sollte. Meinte, das wäre unökonomisch. Schlecht für die Umwelt.«
Letztere Aussage wurde mit verwirrten Mienen rund um den Tisch beantwortet.
»Ich verstehe n…«, begann Stella.
»Und nicht nur das«, fuhr Banecroft fort, während er seine in Schlappen steckenden Füße auf den Tisch legte, mit seinem Stuhl nach hinten kippelte und nur noch mit den Oberschenkeln die Balance hielt. »Sie glaubte auch, Großbuchstaben seien elitär und Interpunktion würde die Gesellschaft spalten.«
Ein langer Augenblick der Stille folgte, während alle sich vorzustellen versuchten, wie solche Regeln praktisch umsetzbar wären. Schließlich war es Ox, der das Schweigen brach. »Selbst für unsere Verhältnisse ist das befremdlich.«
Stella hob die Hand. »Was ist denn mit diesem netten alten Herrn, der letzte Woche hier war? Langer weißer Bart. Sah aus wie der Weihnachtsmann.«
Banecroft wandte sich an Grace und hob eine Braue. »Möchten Sie sich diesbezüglich äußern?«
Grace bekreuzigte sich. »Er meinte, er könne an Vollmondtagen nicht arbeiten, weil er da …«, ihr Gesicht verzog sich angewidert, »… Blutopfer bringen müsse.« Dann bekreuzigte sie sich noch einmal.
»Sehr wahr«, sagte Banecroft. »Sah aus wie Santa Claus und liebte doch den Satan.«
»Aber …« Stella kam ins Stocken. »Er hatte Lederschoner an den Ellbogen.« Niedergeschlagen wiederholte sie: »Lederschoner!«
»Und der Typ von heute Morgen?«, fragte Ox.
Banecroft schaute ihn ausdruckslos an.
»Das wissen Sie nicht mehr – ernsthaft?«, fragte Ox ungläubig. »Der kam direkt aus Ihrem Büro geflogen – das ist noch keine zwanzig Minuten her. Hat behauptet, Sie hätten damit gedroht, ihn zu erschießen.«
»Ach, der. Ja, der war zu gut, um wahr zu sein.«
Ox schaute die anderen mit geweiteten Augen an, bevor er sich wieder Banecroft zuwandte. »Was soll das denn bedeuten, bitte?«
»Eindeutig ein trojanisches Pferd, das uns von unseren Feinden ins Haus geschickt wurde. Ein allzu durchschaubarer Versuch, unsere Publikation zu vernichten.«
»Wenn die wüssten«, entfuhr es Ox. »Dafür brauchen wir nun wirklich keine Hilfe.«
Reggie rutschte auf seinem Platz hin und her und rückte seine Weste zurecht. »Meinen Sie nicht, dass das vielleicht ein klein wenig paranoid sein könnte?«
Banecroft gähnte, bevor er seine Antwort gab. »Sind Sie zufällig die letzten paar Monate hier gewesen? Man kann nicht paranoid sein, wenn es dokumentierte Beweise dafür gibt, dass es irgendwer auf uns abgesehen hat, und zwar im wortwörtlichen Sinne. Da drüben ist immer noch das Loch im Putz von dem Werwolf-Angriff. Und ich bin ja wohl kaum der Einzige, der jedes Mal, wenn er sich aufs Klo setzt, an die versteckte Kamera denken muss, die von dieser Irren-Sekte im neuen Badezimmer installiert wurde.«
»Mag ja sein«, gab Grace zu. »Oder finden Sie vielleicht bei jedem Bewerber ein Haar in der Suppe, weil keiner von ihnen Hannah ist?«
»Ja, das ist es. Sie haben mich durchschaut. Ich bin verliebt in die Frau, mit der ich ständig in den Haaren gelegen habe.«
»Ich entnehme dem sarkastischen Tonfall dieser Äußerung«, erwiderte sie, »dass Sie in Ihrem Leben keine einzige romantische Filmkomödie gesehen haben.«
»Habt ihr eigentlich alle mit dem Rastafari Haschkekse gegessen, oder was ist hier los? Also, wenn es euch davon abhält, hier rumzugackern wie ein gehässiger Hühnerhaufen – ich bin das Problem mit dem stellvertretenden Chefredakteur bereits angegangen.«
Grace ließ ihre Augenbrauen die Stirn hinaufschnellen. »Ach ja?«
»Ja. Ich werde Stanley Roker bitten, auf ein kleines Gespräch vorbeizuschauen.«
»Stanley?«, wiederholte Stella. »Der Typ, den Sie die schlimmste Sorte von schmierigem Boulevard-Parasiten genannt haben? Der Typ?«
»Ja.«
»Stanley ist ganz in Ordnung«, sagte Ox leise.
»Ich habe nichts anderes behauptet«, erwiderte Stella. »Aber er …« Sie nickte in Banecrofts Richtung. »Er hat gesagt, er würde ihm nicht weiter trauen, als er ihn werfen kann.«
»Wir müssen ihn weder mögen noch ihm vertrauen«, sagte Banecroft. »Sie alle haben meine bisherige Stellvertreterin gemocht und ihr vertraut. Und nun sehen Sie, was uns das eingebracht hat. Stanley Roker ist so manches, und vieles davon ist abstoßend, aber er ist auch eine Person mit umfassender journalistischer Erfahrung. Er mag im Laufe der Jahre einiges an stinkendem Müll produziert haben, aber es war immer orthographisch korrekter und sorgfältig recherchierter Müll. Also, wir müssen jetzt wirklich mal vorankommen.«
»Allerdings.«
Die Belegschaft drehte sich geschlossen um und schaute zur Ecke des Raumes hinüber, aus der die Stimme gekommen war. Banecroft tat dies derartig schwungvoll, dass er mit dem Stuhl nach hinten kippte und auf dem Boden landete. Dabei machte sich eine seiner Schlappen selbstständig, flog von seinem Fuß und traf ihn direkt am Kopf.
Sofort rappelte er sich auf und schloss sich seinen Kollegen an. Mit geöffnetem Mund starrten sie zu der Frau hinüber, die am anderen Ende des Raumes hinter einem Schreibtisch saß und seelenruhig eine Satsuma schälte. Sie war rundlich, etwa sechzig Jahre alt und trug eine Wachsjacke sowie eine Deerstalker-Jagdmütze. Ihr Gesicht war herzförmig, die Wangen gerötet, und sie sah aus, als würde sie weitaus lieber mit einem Rudel Collies auf ihrem Landsitz herumwandern als in einem Redaktionsbüro in Manchester sitzen. Zur Begrüßung schenkte sie ihnen ein gut gelauntes Lächeln.
»Wer zur Hölle sind Sie?«, fragte Banecroft.
»Elizabeth Cavendish die Dritte, aber bitte nennen Sie mich Betty.«
Für Grace klang sie wie eine dieser demonstrativ bodenständigen Adligen, die hin und wieder im Fernsehen zu sehen waren. Denen jede Menge Land gehörte, die aber mit größter Freude bereit waren, einer Kuh die Hand in den Hintern zu schieben, sobald sich die Situation ergab.
»Wie lange sitzen Sie da schon?«
»Lange genug.«
»Und was noch wichtiger ist: Wie um alles in der Welt sind Sie hier hereingekommen, ohne dass jemand von uns Sie gesehen hat?«
Sie zuckte mit den Schultern, schob sich eine Satsuma-Spalte in den Mund und kaute vor ihrer Antwort kurz darauf herum. »Die Welt ist sehr gut darin, Frauen ab einem gewissen Alter zu ignorieren – vor allem in Hollywood. Wenn man nicht zufällig Meryl Streep oder Helen Mirren ist, sitzt man nur noch in der Gegend rum und hofft, dass irgendwer vielleicht mal irgendwann eine Großmutter braucht. Und mit der Geschlechter-Disparität bei den Nachrichtensprechern will ich lieber gar nicht erst anfangen.«
»Was?«, sagte Banecroft.
»Soll ich mir einfach einen freien Tisch aussuchen?«, fragte Betty und ließ ihre Hand durch den Raum fahren. »Oder gibt es hier ein bestimmtes System?«
»Was?«, wiederholte Banecroft, der inzwischen wie ein Mann wirkte, der kurz davor war, den Verstand zu verlieren. Vorausgesetzt, dass er bis dahin herausfand, was es bedeutete, bei Verstand zu sein.
»Verzeihung«, sagte Betty. »Da ist es wohl wieder mal ein bisschen mit mir durchgegangen, was? Ich habe die Neigung, vor mich hin zu schwatzen. Ich muss mich entschuldigen. Betty, das Plappermäulchen. So haben mich die Mädchen in der Schule immer genannt. Kinder können so grausam sein, nicht wahr? Ein Mädchen – Dorothy Wilkins – hat mal einen Kaugummi auf meinen Stuhl geklebt. Schauderhaftes kleines Geschöpf. Frage mich, wo sie jetzt wohl steckt. Ist wahrscheinlich mit einem Minister verheiratet. Das sind immer die schlimmsten. Aber wie auch immer. Ich muss mich bei dem Boulevard-Freund, den Sie eben erwähnten und der in der Tat schrecklich klingt, entschuldigen, aber, ja: Ich bin Ihre neue stellvertretende Chefredakteurin.«
»Nur über meine Leiche«, schnaufte Banecroft.
Betty rümpfte die Nase. »Nun, das würde den Geruch vermutlich auch nicht mehr verschlimmern.«
»Nur dass ich das richtig verstehe – Sie glauben, der beste Weg, sich für den Job zu bewerben, bestünde darin, sich ins Gebäude zu schleichen, in ein Meeting zu schmuggeln, zu dem Sie nicht eingeladen waren, und mich zu beleidigen?«
Betty sah aufrichtig verblüfft aus. »Habe ich Sie beleidigt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie im Laufe dieses Meetings jeden der Anwesenden beleidigt haben, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich oder einer der anderen Sie beleidigt hätte.« Sie steckte sich eine weitere Satsuma-Spalte in den Mund und kaute nachdenklich darauf herum. »Wie überraschend dünnhäutig Sie sind!«
»Lassen Sie mich Ihnen etwas Zeit sparen. Sie haben Ihr Bewerbungsgespräch eindeutig und zu einhundert Prozent vergeigt. Wollen Sie nun so gut sein und aus eigenem Antrieb dieses Gebäude verlassen, oder soll ich Mr. Chekhov dazu benutzen, Ihnen den Ausgang zu zeigen? Das ist der Name meiner …«
»Blunderbuss«, beendete Betty den Satz. »Ja, ich weiß. Sehr geistreich. Das wird aber nicht nötig sein. Ich gehe nirgendwohin, da ich fürchte, dass Sie etwas ganz Entscheidendes missverstanden haben. Ich bewerbe mich nicht um die Position der stellvertretenden Chefredakteurin; man hat sie mir bereits gegeben.« Aus einer ihrer Jackentaschen zog sie einen Brief hervor und hielt ihn in die Höhe. »Ich habe hier ein Schreiben von Mrs. Harnforth, der Besitzerin dieser Zeitung, in dem all das erklärt wird. Eine Kopie ist soeben per E-Mail verschickt worden an …« Betty deutete mit dem Finger auf die Büroleiterin. »Grace, nicht wahr?«
Grace nickte.
»Hallo. Reizend, Sie kennenzulernen. Ich habe nur Gutes über Sie gehört.«
»Unmöglich«, sagte Banecroft.
»Wie bitte?«, entgegnete Grace eingeschnappt.
»Nicht Sie.« Banecroft winkte unwirsch ab und richtete seine Aufmerksamkeit auf Betty. »Sie können nicht die stellvertretende Chefredakteurin sein, da ich, und nur ich allein, die Berechtigung habe, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen.«
Betty stopfte sich ein weiteres Stück Satsuma in den Mund. »Vollkommen inkorrekt.«
»Es steht in meinem Vertrag.«
»Sie haben keinen Vertrag.«
»Ich habe einen mündlichen Vertrag.«
Betty hob eine Braue und schaute sich im Raum um. »Oje. Haben Sie irgendwelche Zeugen für diesen Vertrag – denn Mrs. Harnforth erinnert sich ganz entschieden nicht daran.«
»Es war ein implizierter Vertrag.«
Dies brachte Banecroft ein beidseitiges Brauenheben ein. »Lassen wir diesen Satz doch einfach mal eine Minute lang wirken, ja?«
Banecroft stampfte mit dem Fuß auf. »Schön! Ich kündige.«
Betty nickte. »Selbstverständlich sind wir sehr traurig, Sie zu verlieren, aber die Zeitung dankt Ihnen für Ihren Dienst. Also, eins muss man wirklich anerkennen: Was sind wir doch für ein dynamisches und flexibles Unternehmen! Ich meine, ich bin gerade mal fünf Minuten hier und wurde schon befördert. Offenbar werden einem hier auch als Frau keine Steine in den Weg gelegt. Wie erfrischend. Die Sechs-Uhr-Nachrichten könnten sich einiges bei uns abschauen.« Sie beförderte die beiden letzten Satsuma-Spalten in ihren Mund, kaute ausdauernd darauf herum und schluckte sie herunter. Anschließend gönnte sie dem Raum ein wohlwollendes Lächeln.
Grace schaute ihre Kollegen an und dann wieder Banecroft. Die Ader auf seiner Stirn pochte. Sie verspürte das dringende Bedürfnis, aus seinem näheren Umfeld zu verschwinden und alle zerbrechlichen Möbelstücke mitzunehmen.
Betty rieb sich die Hände. »Ich sehe, Sie sind immer noch hier. Sollen wir davon ausgehen, dass Ihre Kündigung lediglich ein Scherz war, der nicht gezündet hat?«
Banecroft sprach durch zusammengebissene Zähne. »Ich wünsche, augenblicklich mit Mrs. Harnforth zu sprechen.«
Betty stand auf. »Ich fürchte, das ist unmöglich. Aber da ich als ihre Vertreterin hier bin, nehme ich Ihr Anliegen mit großer Freude entgegen.« Sie gestikulierte in Richtung von Banecrofts Bürotür.
Die beiden verschränkten eine unangenehm lange Zeit die Blicke. Jede vorbeitreibende Eisscholle, die unglücklicherweise zwischen sie geraten wäre, hätte sich sofort in Dampf aufgelöst. Betty hielt währenddessen an ihrem Lächeln fest. Und schließlich machte Banecroft einen Schritt auf sein Büro zu.
»Entzückend.« Betty klang äußerst gut gelaunt. »Und sehen Sie es positiv – ich bin ein großer Fan von Interpunktion.«
CANCEL CULTURE? GEIST FLIEGT RAUS!
In einem weltweit einzigartigen Vorgang hat der Geist von Arnold Franklin – lange Zeit eng verbunden mit dem Frog-and-Trumpet-Pub in Stoke-on Trent – behauptet, gecancelt worden zu sein. Mittels eines Mediums hat Mr. Franklin Folgendes verlauten lassen: »Ich spuke seit siebenundvierzig Jahren in diesem Pub, seit meinem Herzinfarkt bei der Open-Mike-Nacht, als ich meine Gags vorgetragen habe. Ich war bei den Besitzern immer sehr beliebt. Dann taucht plötzlich diese neue Wirtin auf – eine Frau, wenn Sie wissen, was ich meine. Und ehe ich mich versehe, hat sie auch schon einen Exorzisten bestellt.«
Mabel Clarke, der der Pub bereits seit fünfzehn Jahren gehört, hat sich auf Anfrage folgendermaßen zur Sachlage geäußert: »Um ganz ehrlich zu sein, es wurde langsam öde. Er imitiert lustige Stimmen – das behauptet er jedenfalls. Ich finde das aber bloß rassistisch. Außerdem lassen sie sich so schlecht auseinanderhalten, dass man nur sehr schwer von mehreren Stimmen sprechen kann. Die meiste Zeit verbringt er auf dem Damenklo, und wir mussten aufhören, Mistelzweige aufzuhängen, weil er wirklich ein sehr aufdringlicher Poltergeist ist. Und dann die Witze! Wenn ich noch einmal den mit den zwei Nonnen und dem Stück Seife hören muss, kriege ich einen Schreikrampf. Obwohl der immerhin nicht beleidigend war. Und dann beschwert er sich immer wieder, dass er ja angeblich nichts mehr sagen darf. Die Wahrheit ist: Er hat einfach nichts Neues zu sagen. Es sind immer dieselben vier Witze, wieder und wieder. Er behauptet, er würde sich gleichermaßen über alle Bevölkerungsgruppen lustig machen, aber wir haben alle früheren Besitzer gefragt. Abgesehen von den Nonnen, heißt alle Bevölkerungsgruppen bei ihm lediglich: Frauen, Schwarze und einäugige Zwerge.«
Kapitel 3
Die Landschaft rauschte verschwommen und unbeachtet vorüber, während Hannah gedankenverloren aus dem Fenster des Minivans blickte. Mit schmerzlichem Bedauern wurde ihr bewusst, dass sie montagmorgens um diese Zeit eigentlich in der wöchentlichen Redaktionskonferenz saß und versuchte, Ideen für die aktuelle Ausgabe zu retten, nachdem Banecroft sein übliches Zerstörungswerk abgeschlossen hatte.
Sie blinzelte einige Male. Darüber durfte sie jetzt nicht nachdenken. Was auch immer davon zu halten war: Sie hatte ihre Entscheidung getroffen.
Vor siebzehn Tagen, an einem Freitagabend, hatte sie die Arbeit verlassen und war nach Hause aufgebrochen – nach einer anstrengenden Woche, in der sie wieder einmal eine druckfertige Stranger Times auf die Beine gestellt hatten. Als sie schließlich in ihrer Wohnung ankam, hatte sich bereits alles verändert. Schon am folgenden Tag kündigte sie.
Vergangene Woche hatte sie eine Einladung ihres Beinahe-Ex-Manns Karl zum Abendessen angenommen. Bis vor etwa einem Monat hatte er andauernd Kontakt zu ihr gesucht. Natürlich nur, weil sie sich in allerletzter Minute entschlossen hatte, doch noch einen Teil des Geldes haben zu wollen, das ihr aufgrund ihrer Scheidungsregelung zustand. Das war eine Kursänderung, aber ihr war klargeworden, dass ihr Verzicht den Eindruck erwecken könnte, Karl habe es verdient, alles für sich zu behalten.
Noch wichtiger: Ihr war eingefallen, dass es verschiedene wohltätige Zwecke gab, die sie mit dem Geld unterstützen konnte. Es war ein schöner Gedanke, dass aus all den Jahren, die sie diesem schlechten Scherz einer Ehe gewidmet hatte, doch noch etwas Gutes entstehen konnte. Außerdem musste sie zugeben, dass sie tief in ihrem Inneren eine hämische Freude darüber empfand, wie sehr Karl sich darüber ärgerte.
Er war nicht immer so gewesen, aber schon vor ihrer Trennung hatte sie es verstört zur Kenntnis nehmen müssen: Karl hatte sich selbst eingeredet, sich im Schweiße seines Angesichts von ganz unten zum Selfmademan hinaufgearbeitet zu haben. Als hätten eine Privatschulbildung und eine üppige Erbschaft bei seinem Erfolg nicht die geringste Rolle gespielt. Es war alles Spiegelfechterei, ebenso wie ihre Steuererklärungen. Sie zeigten deutlich, welch lächerliche Anstrengungen Karl unternommen hatte, um ja nichts zahlen zu müssen, was einer halbwegs vernünftigen Besteuerung gleichkam. Hannah hatte die Unterlagen zum ersten Mal im Rahmen ihrer Scheidungsverhandlungen gesehen, und je öfter sie daran zurückdachte, desto mehr schämte sie sich. Nicht nur war sie mit jemandem verheiratet gewesen, der sich so verhielt, sie war auch derartig ignorant gewesen, es nicht einmal zu bemerken. In ihrer Dummheit hatte sie angenommen, dass seine ständigen Klagen, irgendwelche Sozialschmarotzer würden von ihren Steuergeldern leben, bedeuteten, dass sie auch tatsächlich Steuern zahlten.
Sie hatte kein Interesse daran, sich mit Karl zu treffen. Schließlich wusste sie genau, dass er keinen Trick auslassen würde, um sie davon zu überzeugen, »sein« Geld nicht einfach zu verschenken. Deshalb war es eine große Erleichterung, als er keine Nachrichten mehr schickte. Beinahe einen Monat hörte sie nichts von ihm. Als er sich dann doch wieder meldete, tat er etwas Unerwartetes. Er entschuldigte sich. Karl entschuldigte sich nie. Bislang war Hannah davon überzeugt gewesen, dass er nicht einmal wusste, was eine Entschuldigung war. Noch erstaunlicher: Es war eine richtige Entschuldigung.
Entschuldigungen entwickelten sich zusehends zu einer ausgestorbenen Kunstform, da das Konzept andauernd ad absurdum geführt wurde. Da war die »Es tut mir leid, wenn sich jemand verletzt gefühlt hat«-Entschuldigung, die »Es tut mir leid, dass jemand glaubt, ich hätte gesagt, was ich gar nicht gesagt habe«-Entschuldigung und ihr beinahe eineiiger Zwilling, die »Es tut mir leid, dass du missverstanden hast, was ich gesagt habe«-Entschuldigung. Hinzu kamen zahlreiche Variationen, aber sie alle liefen darauf hinaus, dass es der betreffenden Person keineswegs leidtat.
Karl aber hatte es tatsächlich leidgetan, und zwar nicht nur die Sache mit dem Geld. Alles hatte ihm leidgetan. Er hatte sie gefragt, ob sie ein letztes Mal mit ihm zu Abend essen wolle – um ihre Ehe wenigstens in gutem Einvernehmen abzuschließen. Hannah war nicht dumm – nicht mehr. Der Mann war immer ein hervorragender Lügner gewesen, aber irgendetwas fühlte sich diesmal anders an. Außerdem war in den wenigen Wochen absoluter Funkstille so viel passiert. Also ging sie mit ihm essen.
Bei der Vorspeise drückte er sein Bedauern über sein abscheuliches Verhalten während ihrer Ehe aus. Er schämte sich für den Mann, der er gewesen war, und dafür, wie er sie behandelt hatte.
Während des Hauptganges erklärte er, dass er ein neuer Mensch geworden sei, nachdem er ein Erholungszentrum des Pinter-Instituts besucht hatte. Gegründet hatte es der ehemalige Hollywood-Star Winona Pinter, eine Schauspielerin, die inzwischen im Esoterik-Business ihr eigenes Imperium aufgebaut hatte. Pinter war in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen aufgetaucht – allerdings nicht wegen ihrer Schauspielerei. Die großen Medien gaben immer wieder ihre neuesten Quatschprodukte genüsslich der Lächerlichkeit preis – seien es Kerzen mit Weltallduft oder Yoga-Studios für Haustiere. Damit aber taten sie zugleich alles, um ihren Namen im Umlauf zu halten.
Hinzu kamen Winona Pinters erfolgreiche Nahrungsmittel und Bücher, gefolgt von Onlinekursen und schließlich – für die Auserwählten, die sich sehr, sehr glücklich schätzen konnten: die Erholungsinstitute. Sie waren sehr exklusiv, oder um es in einfache Worte zu packen: obszön teuer. So teuer, dass, zum Leidwesen der Presse, niemand wirklich wusste, wie teuer. Bevor man in einer dieser Einrichtungen als Gast akzeptiert wurde, musste man sich einem ausgiebigen Prüfungsprozess unterziehen. Und auch wenn das Institut es abstritt, wurde der Zugang nur solchen Personen gewährt, für die Geld keine Rolle spielte – oder die zumindest so taten.
In Wahrheit hatte Hannah das gesamte Abendessen ziemlich verstörend gefunden. Ja, es war nur ein Abend gewesen, aber er hatte genügt, um ihr eines zu zeigen: Karl war nicht mehr Karl. Im Laufe ihrer Ehe hatte Hannah irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen, dass die Augen ihres Ehemanns unentwegt den Raum durchstreiften. Schließlich hatte sie sich sogar gefragt, ob er es selbst überhaupt merkte. Daher war es auch so seltsam, dass er keinerlei Interesse am tief ausgeschnittenen Top der Kellnerin zeigte und auch nicht an den anderen Gästen, die durchs Restaurant gingen. Wenn sie es in ihrer Ehe gewagt hatte, sein Verhalten zur Sprache zu bringen, hatte er ihr stets versichert, sie bilde sich das alles bloß ein. Im Rückblick wurde ihr klar, dass sie sich viel zu bereitwillig damit hatte abspeisen lassen, statt für sich selbst einzustehen.
Bei der neuen Version von Karl waren die unsteten Augen kein Problem mehr. Während dieses einen Abendessens hielt er mehr Blickkontakt mit ihr als während ihrer gesamten Ehe. Und damit nicht genug: Dabei gestand er auch noch ein, dass er ein Narzisst sei, der Selbstbestätigung in bedeutungslosem Sex gesucht hatte, statt sich selbst und die Menschen, die er wirklich liebte, angemessen wertzuschätzen. Hannah hatte fest damit gerechnet, dass Karl betteln, schmeicheln und sie manipulieren würde – wie so oft –, aber dies war entweder ungeschönte Wahrhaftigkeit, oder er hatte in seinen schauspielerischen Fähigkeiten eine Tiefe erlangt, um die ihn selbst Winona Pinter beneidet hätte.
Vor dem Dessert entschuldigte sie sich, um die Damentoilette aufzusuchen. Ohne es recht zu wollen, blieb sie hinter einigen Monstera-Topfpflanzen stehen und beobachtete den »neuen« Karl ungläubig aus der Ferne. Er saß da, wartete geduldig auf ihre Rückkehr und hielt den Blick auf den Tisch vor sich gerichtet. Er unternahm nicht einmal den Versuch, mit der Kellnerin zu flirten – was für ihn früher so selbstverständlich gewesen wäre wie der nächste Atemzug.
Beim Kaffee stellte er die Idee in den Raum, dass sie es vielleicht, nur vielleicht, noch einmal miteinander probieren könnten. Hannah war äußerst zurückhaltend. Woraufhin Karl vorschlug, sie solle sich doch ein wenig Zeit nehmen und in Ruhe darüber nachdenken, was sie vom Rest ihres Lebens erwartete. Vielleicht konnte ja auch sie den Aufenthalt in einem Pinter-Institut in Erwägung ziehen? Dort ihre Gedanken ordnen.
Und hier war sie nun.
Sie schreckte aus ihren Überlegungen auf, als der Minivan scharf rechts von der Straße bog und vor einem großen Metalltor zum Stehen kam. Hohe Elektrozäune säumten die Begrenzung des Anwesens, auf denen gut lesbare Schilder darüber informierten, wie wenig Spaß es machen würde, einen Schlag im Hochspannungsbereich zu bekommen. Nach einigen Sekunden öffnete sich das Tor. Rechter Hand, hinter den dicht geschlossenen Reihen von Koniferen, die die Straße von beiden Seiten einfassten, sah Hannah die Gebirgszüge der Pennines aufragen. Das Pinter-Institut legte großen Wert auf Privatsphäre, weshalb es von mehreren Quadratkilometern Wald dicht umschlossen war. Fotografieren konnte man es nur aus der Luft.
Dieses Anwesen hatte man das Pinter Institute HQ genannt, nicht zuletzt, um es effektiv von seiner Vergangenheit zu lösen. Hannah hatte vergangene Nacht ein paar Stunden damit verbracht, sich in die Geschichte dieses Ortes einzulesen, schon deshalb, weil hier alle so versessen darauf waren, den früheren Namen bloß nicht zu erwähnen: Ranford House.
Die Ranfords hatten ihren Reichtum auf die denkbar altmodischste Weise erworben: durch Eroberungen. Die Familie hatte seit jeher hohe Ränge in der britischen Armee innegehabt, noch bevor diese überhaupt so benannt worden war. Und wann immer einer der ihren in kriegerischer Absicht in irgendeine Weltgegend entsandt wurde, schickten sie umgehend den nächsten Bruder in der Erbfolge hinterher. Der erkundigte sich dann vor Ort, ob es irgendjemandem besonders viel ausmachte, wenn er das kleine Fleckchen Land übernehmen würde, das niemand – zumindest niemand Wichtiges – zu nutzen schien. So verschafften sich die Ranfords Besitz in jedem neuen Land, das sich das britische Empire einverleibte – Plantagen in Amerika, Minen in Afrika, Zugstrecken in Indien; sie verfügten über große Vermögenswerte überall auf der Welt. Das Ranford-System funktionierte, auch wenn es den Verlust des ein oder anderen Sohnes mit sich brachte, entweder an irgendeiner Front oder durch die Hände eines Einheimischen, der sich als schlechter Verlierer erwies.
Erpicht darauf, ihren immensen Reichtum sichtbar zu machen, hatten die Ranfords am Fuße der Pennines also Ranford House erbaut. Nicht zuletzt, um hier ihrer allgemein bekannten Liebe zur Natur zu frönen – was im Wesentlichen bedeutete, alle Bewohner dieser Natur entweder zu erschießen oder sie mit Hunden zu Tode zu hetzen.
Schenkte man Wikipedia Glauben, hatte dieser Ort von Anfang an eine äußerst problembehaftete Geschichte. Noch während das Anwesen errichtet wurde, kamen mehrere Bauarbeiter bei Unglücksfällen ums Leben, was den Ruf begründete, das Haus sei verflucht. Als es fertiggestellt war und eines der gewaltigsten Herrenhäuser in ganz England abgab, schien die Familie Ranford es auch nur selten zu bewohnen. Lord Albert Ranford verlor seine junge Frau 1896 im Kindbett. Der Säugling überlebte – und war sein einziger Nachkomme: William. Es wird berichtet, der Kummer habe den Herrn des Hauses derartig erfüllt, dass er seinen Sohn größtenteils ignorierte.
William wiederum fiel früh als seltsam auf, und nicht auf die Weise, die typisch ist für einen Großteil der Aristokratie. In Eton legte er ein Benehmen an den Tag, das »eines Gentlemans nicht würdig« war, und wurde daraufhin von der Schule verwiesen – ein beispielloser Vorgang. Seine späteren Jahre als Playboy wurden nur kurz von der Familientradition des Kriegsführens unterbrochen. Dabei erwies sich seine Leitung eines Bataillons im Ersten Weltkrieg als katastrophal. Ein Bericht, den ein vorgesetzter Offizier von der Front nach Hause schickte, enthielt den vernichtenden Satz: »Niemals bin ich einem Mann begegnet, der weniger Achtung vor menschlichem Leben gehabt hätte als William Ranford.«
Doch während die militärische Laufbahn des jüngeren Ranford jede Menge Tod und Zerstörung über andere brachte, kam er selbst unversehrt nach Hause zurück und ging dazu über, seinem Vater auf neue Weise Schande zu machen. Die beiden waren einander den Großteil von Williams erwachsenem Leben entfremdet. Irgendwann mussten sie ihre Differenzen jedoch beigelegt haben, denn der Vater kam vorzeitig bei einem bizarren Jagdunglück ums Leben, und es gab Berichte, er sei in den Armen seines weinenden Sohnes gestorben. Dieser wurde umgehend zum neuen Lord Ranford.
Das Pech der Familie setzte sich fort, als William zwei Jahre später beim Sturz von einem Pferd verkrüppelt wurde. Nach seinem Unfall sah sein Leben weitaus düsterer aus. William wurde geradezu besessen von der Idee, die Kontrolle über seine gelähmten Beine zurückzuerlangen, wofür ihm jedes Mittel recht war. Als die Medizin ihm nicht mehr helfen konnte, wandte er sich anderen Wegen zu.
Von diesem Punkt an waren Details nur noch skizzenhaft bekannt und stammten eher aus Gerüchten als aus Tatsachenberichten. Ein junges Mädchen starb in Ranford House, und ihre Familie erhielt eine größere Geldsumme, womit die Angelegenheit aus der Öffentlichkeit verschwand. Doch bald schon erzählte man sich, im Haus würden seltsame Dinge geschehen und ungewöhnliche Personen ein und aus gehen. Eine große Zahl der Dienstboten, die den Ranfords seit Generationen gedient hatten, kündigte und wurde von Außenstehenden ersetzt. Dann brach der Zweite Weltkrieg aus.
Natürlich war William Ranford nicht das einzige Mitglied der britischen Aristokratie, das sich als flammender Bewunderer von Hitler erwies. Die meisten seiner Zeitgenossen schafften es jedoch, zurückzurudern, sobald der Krieg erklärt worden war. Ranford aber war viel zu reich, um wegen seiner politischen Haltung eine Internierung oder Ähnliches zu fürchten, und er war viel zu störrisch, um sich der gängigen Meinung anzuschließen. 1942 wurde er von einem seiner Angestellten denunziert, was dazu führte, dass man entdeckte, was die Presse seinerzeit als seinen »geheimen Hort« betitelte.
Überzeugt davon, dass der Sieg der Nazis unvermeidlich wäre, hatte Ranford auf seinem Anwesen eine riesige Menge an Vorräten angehäuft. Er hatte vor, sie Hitler zum Geschenk zu machen und damit die deutsche Kriegsmaschinerie zu unterstützen, wenn sie an der englischen Küste gelandet war. Die Entdeckung sorgte für einen Sturm der Empörung, worauf Ranford in die Schweiz flüchtete und den Rest seines Lebens im Exil verbrachte. Ranford House wurde beschlagnahmt, und nachdem es als Hospital für verwundete Soldaten gedient hatte, wurde für eine kurze Zeit eine Privatschule in seinen Mauern untergebracht. Das Gebäude ging durch verschiedene Hände, bevor es mehrere Jahre leer stand und schließlich von seinen derzeitigen Besitzern übernommen wurde.
Als sie den Wald, der direkt an die Straße grenzte, hinter sich ließen und Hannah die ganze viktorianische Monumentalität von Ranford House zu Gesicht bekam, blieb ihr die Luft weg. Eingerahmt von den dahinter aufragenden Bergen, war es viel zu groß, als dass irgendjemand wirklich darin wohnen konnte, und erbaut war es aus jenen dicken Granitsteinen, die ein volles Artillerie-Trommelfeuer abhalten konnten. Wasserspeier saßen auf den Zinnen und wehrten den Efeu ab, während sie fratzenschneidend auf die Welt herabblickten. Die gigantischen Rasenflächen, die das Gebäude umgaben, wurden von reich verzierten Brunnen durchbrochen – vermutlich, um den Pfauen und den anderen Ziervögeln, die hier herumstolzierten, Sitzgelegenheiten zu verschaffen.
Der Minivan steuerte auf das Ende der langen Einfahrt zu, wo ein Dutzend Mitarbeiter des Pinter-Instituts auf beiden Seiten der großen Eingangstreppe aufgereiht waren. Sie trugen schwarze Oberteile und weiße Hosen oder Röcke – bereit, die neuesten Erholungsbedürftigen zu begrüßen. Kaum hatte das Fahrzeug angehalten, wurde die Beifahrertür aufgeschoben.
Ein Mann, der aussah wie eine lebensgroße Ken-Puppe, trat heran und beugte ihr den Kopf entgegen. »Hallo, Mrs. Drinkwater. Ich bin Anton, Ihr persönlicher Erlebniskoordinator.«
Hannah wollte ihn sofort korrigieren, hielt sich jedoch zurück. Ihr Mädchenname lautete Willis, aber bedachte man, warum sie hier war, schien Drinkwater durchaus angemessen. Auch wenn es sich komisch anfühlte.
Sie ließ ihren Blick über die aufgereihten Angestellten und ihre starren Mienen wandern. Hannah war noch nie von einem Begrüßungskomitee empfangen worden. Es war ein ziemlich irritierendes Erlebnis – wie eine Szene aus Downton Abbey. Sie war sich nicht sicher, ob sie allen die Hand geben oder sie vollständig ignorieren oder sich vorstellen oder verbeugen sollte oder …
Ihre plötzliche Überforderung mit der unerwarteten Situation nahm sie derartig in Beschlag, dass sie bei allen Anwesenden schließlich doch noch einen nachhaltigen Eindruck hinterließ, wenn auch gänzlich unbeabsichtigt. Als sie aus dem Auto stieg, blieb sie mit dem Hacken ihres Schuhes hängen und landete mit dem Gesicht voran auf dem Kiesweg.
Ein hervorragender Start.
Kapitel 4
Stanley Roker fühlte sich gar nicht wohl.
Erstens saß er seit Stunden zusammengekrümmt in seinem Van und musste immer wieder einzelne Teile seines Körpers ausstrecken, damit sie ihm nicht einschliefen. Nach seinem Sturz aus großer Höhe, heraufbeschworen von einem magisch begabten Bastard mit viergeteiltem Gesicht, der ihn immer noch in seinen Albträumen heimsuchte, hatte sich sein Knöchel einigermaßen erholt. Er tat aber immer noch verdammt weh, wenn er ihn zu sehr oder zu wenig belastete. Seine Physio hatte er leider nicht durchgezogen.
Da es sich um einen der sonnigeren Augusttage handelte, war es im Van unangenehm heiß, was noch dadurch verschlimmert wurde, dass er wegen seiner Allergien das Fenster nicht herunterkurbeln durfte. Und dann war da noch die Tatsache, dass er einige »Verdauungsbeeinträchtigungen« durchmachte – hauptsächlich in Form von Sodbrennen. Seit einer Stunde überlegte er, ob er nicht eine Art Feldtoilette in seinem Wagen installieren sollte. Die leere Eisteeflasche, so unschätzbar wertvoll sie derzeit auch war, konnte eben nicht jede Eventualität abdecken.
All diese Umstände waren mögliche Ursachen dafür, dass Stanley sich derart unwohl fühlte. Aber auch wenn er sich vom Gegenteil zu überzeugen versuchte – sie waren nicht die wahre Ursache seiner finsteren Stimmung. Nein. Stanley Roker fühlte sich gar nicht wohl, weil er tat, was er gerade tat. Ziemlich ungünstig, da es genau das war, was Stanley Roker am besten konnte.
Er hatte sich in seinem Sitz zusammengekauert, damit der Fahrer des silbernen BMW auf der anderen Straßenseite ihn nicht sah, wenn er wieder aus dem Haus kam. Derzeit parkte der Wagen vor den Büros einer Produktionsfirma, die einem echten Star gehörte – einer festen Größe des Samstagabend-Fernsehens. Jemandem, den man sofort erkannte. Selbst wenn man nie eine seiner Shows gesehen hatte, kam man um seinen Werbespot nicht herum. Er, seine berühmte Frau und seine drei entzückenden Kinder gaben darin das indirekte Versprechen, dass alle englischen Familien ebenso attraktiv und unfassbar glücklich werden könnten wie Mr. und Mrs. Superstar. Sie mussten dafür lediglich in einem bestimmten Supermarkt einkaufen.
Stanley überwachte die Büroräume, weil er aus zuverlässiger Quelle wusste, dass sich besagter Fernsehstar irgendwann im Laufe des Vormittags für ein paar Stündchen davonstehlen und mit einem Mann treffen würde, mit dem er seit mehreren Jahren eine Affäre hatte.
Natürlich waren die Zeiten lang vorbei, in denen es eine große Sensation gewesen wäre, jemanden als schwul zu outen. Aber die Leute wollten es immer noch wissen – natürlich –, und was in diesem Fall hinzukam: Einer verheirateten Frau wurde übel mitgespielt. Ein Mann verletzte die heiligen Schwüre der Institution Ehe. Das Schwulsein spielte da eigentlich gar keine Rolle. Na gut, natürlich tat es das. Entscheidend war, dass jeder aber so tun konnte, als wäre es nicht so.
Für Stanley Roker war dies der Idealfall einer Granaten-Story, was so viel bedeutete wie: Er würde am Ende richtig viel Kohle einsacken. Die brauchte er dringend, schließlich schuldete er Leuten, die ziemlich krass drauf waren, eine ziemlich krasse Summe Geld. Bei einem Gangster mit übernatürlichen Fähigkeiten in der Kreide zu stehen bedeutete, sich endgültig von erholsamem Schlaf zu verabschieden. Seine Träume waren wirklich nicht mehr von dieser Welt.
Unbewusst strich er mit der Hand über die Tätowierung auf seiner rechten Schulter, die keine wirkliche Tätowierung war. Der Geldregen von diesem Job würde seine Schuld bei Ferry begleichen. Und dann bliebe immer noch genug übrig, um endlich das Übernachten im Van zu beenden. Dass Stanley Roker ausgerechnet in diesem Augenblick seine erste wirkliche Gewissenskrise durchlebte, war also in jeder Hinsicht unangebracht.
Die schicksalsträchtige Nacht, die sein Leben für immer verändert hatte, lag nur wenige Monate zurück. Stanley war ein Opfer – und er konnte von Glück sagen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Trotzdem war er tief im Inneren davon überzeugt, dass ihm nach wie vor eine Strafe blühte – wegen all der schrecklichen Dinge, die er im Lauf der Jahre getan hatte. Karma war ein Arschloch. Derzeit dachte er viel darüber nach, ob es bereits zu spät war, seine Seele zu retten. Aber sich diesen Zweifeln hinzugeben, während er gerade tat, was er tat, ergab keine besonders glückliche Kombination.
Sein akutes Unwohlsein wurde von einem kurzen Schock abgelöst, als sich die Beifahrertür seines Vans öffnete. Eine schlanke, etwa sechzigjährige Frau in einem burgunderroten Mantel stieg ein und nahm neben ihm Platz. Ihr Haar war koboldhaft kurz geschnitten und leicht rosa gefärbt, was an ihr durchaus elegant wirkte.
»Was zum …?«
»Hallo, Stanley.«
»Wer zur Hölle sind Sie?«
Sie streckte ihm eine sorgsam manikürte Hand entgegen. »Alicia Harnforth, hocherfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Aber da ich die Besitzerin der Stranger Times bin, haben Sie ja bereits für mich gearbeitet.«
»Nein, habe ich nicht.«
Sie hob eine Braue. »Na, kommen Sie, Stanley.« Sie griff in die Innenseite ihres maßgeschneiderten Blazers und zog mit spitzen Fingern einen Zeitungsausschnitt hervor. »Was ist mit diesem Erlebnisbericht? Der Autor wurde überfallen. Dann hat ihm eine freundliche Krankenschwester Hilfe angeboten und ihn mit in ihre Wohnung genommen, da er nicht ins Krankenhaus wollte. Worauf sie sich verwandelte, und zwar in ein … was war es noch?« Sie faltete den Artikel auseinander und überflog den Text. »Ach ja – in ein beängstigendes, arachnoides Dämonenwesen, das es darauf abgesehen hatte, sein Opfer in mehr als nur einer Weise zu verschlingen. Sehr dramatisch. Das haben Sie nicht geschrieben?«
»Es wurde anonym veröffentlicht«, erwiderte Stanley schwach.
»Als Leserzusendung«, bestätigte Mrs. Harnforth und steckte den Artikel zurück in ihren Blazer. »Übrigens herzlichen Dank für Ihre Hilfe in der misslichen Lage, in der wir vor ein paar Monaten gesteckt haben. Ich weiß das zu schätzen.«
»Ja, ja, schon gut. Was haben Sie hier zu suchen? Nein, streichen Sie das – woher wussten Sie, dass ich hier bin? Und wo wir schon dabei sind – die Tür war verriegelt. Wie haben Sie sie aufgekriegt?«
»So viele Fragen. Um wenigstens einige davon zu beantworten …« Lässig drehte sie den Zeigefinger ihrer linken Hand. Darauf erhoben sich die Sandwich-Verpackungen, Süßigkeitentüten und Softdrink-Dosen, zusammen mit dem weiteren Müll, der im Fußraum vor dem Beifahrersitz eine dicke Schicht bildete, in die Luft. All das schwebte munter in die leere Donut-Schachtel, die neben Stanley lag, worauf sich behutsam der Deckel schloss. »Na bitte«, sagte sie. »Schon besser.« Sie schaute sich im Van um und schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Was nicht heißen soll, dass dieser Wagen keine ordentliche Säuberung gebrauchen könnte. Oder vielleicht wäre es einfacher, ihn anzustecken und die Versicherungssumme zu kassieren.«
Fest entschlossen, unbeeindruckt zu erscheinen, verschränkte Stanley die Arme. »Sind Sie hergekommen, um mir Ihre Reinigungsdienste anzubieten?«
»Nein, ich bin aus zwei Gründen hierhergekommen. Erstens, um Ihnen zu helfen. Und zweitens, um Sie zu bitten, mir zu helfen.«
Stanley nickte. »Ich verstehe. Ein bisschen Quidproquo, was?«
»Genau genommen – nein«, sagte Mrs. Harnforth. »Ich weiß, Sie wollen unbedingt dieses Wesen aufspüren, das Sie angegriffen hat, um Ihrer Frau zu beweisen, dass Ihre Schilderung der Ereignisse der Wahrheit entspricht. Diesbezüglich kann ich Ihnen verraten, dass die gesuchte Kreatur als Balarig bezeichnet wird. Wie Sie ja am eigenen Leib erfahren haben, handelt es sich um eine schauderhafte Bestie, die sich im Wesentlichen wie eine Schwarze Witwe verhält. Wenn Ihre Frau also nicht unangekündigt hereingeplatzt wäre, dann, seien Sie versichert, wären Sie einen der entsetzlichsten Tode gestorben, die man sich vorstellen kann. Leider sind Balarigs Meister der Tarnung. Aber die gute Nachricht lautet: Es könnte einen Weg geben, dieses besondere Exemplar aufzuspüren.« Sie griff in die andere Innentasche ihres Blazers und holte eine Visitenkarte hervor. »Dies ist die Nummer eines Gentlemans namens Jackie Rodriguez.«
»Hier steht, er wäre Maler und Innenausstatter?«
»Das ist er«, bestätigte sie. »Von durchschnittlicher Begabung. Aber er ist auch der beste Dämonenaufspürer, dem ich je begegnet bin.«
»Und lassen Sie mich raten – er hilft mir nur, wenn ich Ihnen helfe.«
Mrs. Harnforth schüttelte den Kopf. »Nein. Er wird Ihnen in jedem Fall helfen, weil ich ihn bereits darum gebeten habe. Sie sind wirklich ein schrecklich misstrauischer Mensch, Stanley.«
»Kann mir nicht erklären, warum.« Noch einmal musterte er die Karte und begegnete dann ihrem Blick. »Also, wobei brauchen Sie meine Hilfe?«
»Ich befinde mich in der ungewohnten Lage, eine Ermittlung durchführen zu müssen. Ich meine, in gewisser Weise habe ich schon viele Ermittlungen durchgeführt, aber keine wie diese. Ich würde gerne auf Ihre ganz spezielle Expertise zurückgreifen.«
»Und was für eine Expertise soll das sein?«
»Ich benötige jemanden, der bereit ist, das Gesetz zu umgehen, um etwas herauszufinden. Jemanden mit der ausgereiften Fähigkeit, Schwachpunkte des Gegners zu identifizieren und sich diese zunutze zu machen. Kurz gesagt: Sie müssen lediglich ganz Sie selbst sein, Stanley.«
Er seufzte. »Um ehrlich zu sein, habe ich es gehörig satt, ich selbst zu sein.«
»Nun, dann habe ich gute Neuigkeiten für Sie – Sie werden das tun, was Sie seit langer Zeit tun, aber diesmal werden Sie auf der Seite der Guten stehen.«
»Zahlt die gute Seite denn auch gut?«
Mrs. Harnforths Gelächter war leise und melodisch. »Kommt darauf an, wie Sie das definieren. Ich will Sie ja nicht drängen, aber ich fürchte, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, und Sie werden auf der Stelle aktiv werden müssen.«
Stanley klopfte mit der Visitenkarte gegen sein Knie.
»Stanley?«
»Ich denke nach.«
»Dessen bin ich sicher«, sagte Mrs. Harnforth. »Aber das meinte ich nicht.« Sie deutete auf den Mann, der auf der anderen Straßenseite das Bürogebäude verließ. »Ich bin nicht gerade die emsigste Fernsehzuschauerin der Welt, aber ist das nicht Wie-heißt-er-noch von dieser Sendung?«
Stanley schaute zu dem Mann auf, der in den BMW stieg, dann wieder auf die Visitenkarte in seiner Hand. »Das … geht Sie nichts an.«
Kapitel 5
Banecroft hatte Betty erst vor wenigen Minuten kennengelernt, aber es gab bereits eine umfangreiche Liste mit Dingen, die ihn erheblich an ihr störten. Erst einmal war sie unangekündigt in seiner Konferenz aufgetaucht und dann auch noch buchstäblich aus dem Nichts.
Das ärgerte ihn sehr. Dass ihn dies dazu gebracht hatte, sich vor seiner Belegschaft auf den Hintern zu legen, ärgerte ihn noch mehr. Dann hatte sie ihm auch noch widersprochen, seine Autorität infrage gestellt und schließlich seinen Bluff über den Vertrag auffliegen lassen. Und dabei hatte sie eine japanische Zitrusfrucht gegessen und weder ihm noch einem der anderen auch nur eine einzige Spalte angeboten. Banecroft konnte schlechte Manieren nicht ertragen. Zumindest nicht bei anderen Leuten.
Und als wäre all das nicht schlimm genug, hatte sie sich auch noch als Elizabeth Cavendish die Dritte vorgestellt. Banecroft hatte noch nie jemanden getroffen, von dem die Welt zwei weitere Ausgaben benötigt hätte. Ja, auch Reggie spielte sich als Reginald Fairfax der Dritte auf. Bei ihm war es jedoch offensichtlich, dass er einen falschen Namen angenommen hatte, um sein früheres Leben hinter sich zu lassen. Also ließ Banecroft es ihm durchgehen. Vermutlich gab es nicht mal einen Reginald Fairfax, geschweige denn drei.
Er gewährte Betty den Vortritt in sein Büro, und sie schaffte es, zu seinem Schreibtisch zu kommen und Mr. Chekhov zu ergreifen, noch bevor er die Tür hinter sich schließen konnte. Er fügte seiner Liste hinzu, dass sie ärgerlich schnell war.
»Bitte fassen Sie nichts an, von dem Sie keine Ahnung haben.«
»Was für eine schreckliche Regel«, sagte Betty und nahm Mr. Checkhov von allen Seiten sorgfältig in Augenschein. »Wie soll man etwas verstehen lernen, wenn man es nicht anfassen darf?«
»Das ist eine wertvolle Waffe.«
»Oh, das weiß ich«, erwiderte sie. »Es ist eine Balander Blunderbuss. Großartiges Stück Waffenschmiedekunst. Deshalb ist es auch so eine Schande, dass sie sich in so einem schlechten Zustand befindet.«
Er riss ihr die Feuerwaffe aus den Händen. »Wollen Sie mich mit aller Gewalt wütend machen?«
Sie hielt in gespielter Verteidigungshaltung eine Hand in die Höhe und nahm auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz. »Ich wüsste nicht, wieso das nötig sein sollte. Wütend zu sein ist doch offenbar Ihr natürlicher Zustand.«
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Banecroft. »Ich habe ein überaus sonniges Gemüt. Es ist nur schon lange nichts Gutes mehr passiert, das es aktiviert hätte.«
»Ach je, ach je. Dann wollen wir da doch gleich mal Abhilfe schaffen.« Betty zog eine braune Papiertüte aus einer der Taschen ihrer Wachsjacke und streckte sie ihm entgegen. »Hätte der Herr vielleicht Lust auf ein Fruchtgummi?«
»Nein.«
Sie rüttelte die Tüte verheißungsvoll. »Sind Sie sicher? Noch nie habe ich jemanden wütend gesehen, während er ein Gummibärchen genossen hat. Das ist schlicht und einfach unmöglich.«
»Danke, aber ich bleibe lieber wütend.«
Betty hob die Brauen. »Eine interessante Aussage, finden Sie nicht? Es würde sich lohnen, darüber mal in Ruhe nachzudenken.«
»Ach du lieber Gott!« Banecroft setzte sich hin und legte die Blunderbuss – außer Bettys Reichweite – hinter sich auf den Boden. »Ersparen Sie uns Ihre laienhafte Psychoanalyse.«
Sie zog die Tüte zurück und steckte ihre eigene Hand hinein. »Schön. Ganz wie Sie wollen.« Sie fischte ein orangefarbenes Gummibärchen heraus und steckte es sich in den Mund.
»Wie es aussieht, wird hier nichts mehr so laufen, wie ich es will. Und ich soll mich wohl noch dafür bedanken, dass Sie meine Konferenz torpediert und versucht haben, mich vor meinen Angestellten zu erniedrigen.«
Betty führte eine Hand zum Mund und stopfte etwas hinein. »Das war gewiss nicht meine Absicht. Wie auch immer: Wenn Sie darauf setzen, dass die Leute auf Ihre trotzige Halbgott-Rolle reinfallen und vor Ihnen in die Knie gehen, sollten Sie damit rechnen, dass das hin und wieder nach hinten losgeht. Ich fürchte, manche von uns lassen sich eben nicht so schnell einschüchtern.«