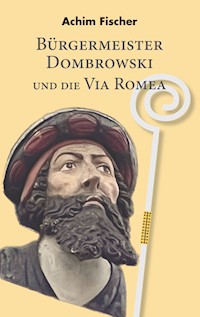
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Via Romea soll als neuer Pilgerweg ins Leben gerufen werden und von Stade im Norden nach Rom führen. Bürgermeister Dombrowski erhofft sich dadurch eine Belebung seines Städtchens, denn der Weg wird durch seine Stadt führen. Er brennt für das Projekt und ist Feuer und Flamme. Eine Gründungsversammlung wird einberufen und bald darauf begibt man sich auf den Weg nach Italien. Eine große Anzahl von Empfängen mit ausgiebigen Schlemmereien erwartet die Wanderer. Viele Bürgermeister und vor allem die schöne Bürgermeisterin bieten unvergessliche Erlebnisse. Aber es kommt anders als geplant. Zwei Muslime begleiten die Pilger-Wanderer und sorgen zunächst für Verwirrungen. Das Ansinnen der beiden, sich dem Koran zuzuwenden wird abgelehnt. Zum Schluss jedoch machen sie Bürgermeister Dombrowski einen Vorschlag, den er nicht ablehnen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Felix Dombrowski, Bürgermeister einer fränkischen Kleinstadt, hat Sorgen, große Sorgen. Es ist der Strukturwandel, der ihn bedrückt, bzw. der ausbleibende Strukturwandel, denn seine Stadt droht zu veröden. Die Geschäfte schließen nach und nach und ziehen zu den Einkaufszentren in der Peripherie.
Da erfährt er von dem Plan, einen neuen Pilgerweg ins Leben zu rufen: die Via Romea. Der Weg führt von Stade im Norden bis nach Rom und direkt durch seine Stadt. Vor seinem geistigen Auge sieht er schon Pilgerscharen, die die Stadt überschwemmen und in den Gasthäusern nach Herberge und Verpflegung verlangen. Mit Elan stürzt er sich auf die Organisation, ruft alle betroffenen Bürgermeister zusammen und gründet mit der italienischen Sektion einen Verein. Bald darauf schnürt er seine Wanderschuhe und begibt sich in Italien auf den Weg, wo die Pilger von der Bevölkerung als „santi pellegrini“ euphorisch gefeiert werden.
Doch die Dinge entwickeln sich anders als geplant, nicht zuletzt wegen der beiden Muslime, Farid und Walid, die sich dem Pilgertrupp angeschlossen haben. Nachdem Bürgermeister Dombrowski ihren ersten Vorschlag vehement abgelehnt hat, unterbreiten sie am Ende einen spektakulären Plan, mit dem sich alles ändern würde…
Autor
Achim Fischer
Layout, Satz, Gestaltung
Konrad Grimm, Ochsenfurt
Der auf dem Umschlag abgebildete Kopf
befindet sich am Rathaus Ochsenfurt
Inhalt
Bürgermeister Felix Dombrowski
Der Brief
Der Besuch
Auf der Via Romea
Die schöne Bürgermeisterin
Der Sängerkrieg
Gleichstand
Bagno di Romagna
Gleiches Recht
Sonnenkraft
Danksagung
I
BÜRGERMEISTER FELIX DOMBROWSKI
Man versetze sich einmal in die Lage eines Bürgermeisters. Man stelle sich vor, man stehe einer Gemeinde vor, einer Gemeinde oder lieber einer Stadt, einer Stadt überschaubaren Ausmaßes von, sagen wir, von zwölftausend Seelen, einer Stadt wie zum Beispiel Ochsenfurt am unterfränkischen Main.
Der Begriff Seele ist hier nicht versehentlich genannt, sondern bewusst anstelle von Einwohnern gewählt, um sogleich anzudeuten, hier walte ein Bürgermeister im Rathaus, dem die Geschicke seiner Bürger zu Herzen gehen und der für sie starkes Mitgefühl empfindet. Er weiß um die Sorgen und Nöte seiner Mitbürger, weiß durch jahrelange Erfahrungen und Anwesenheit auf den örtlichen Markt-, Wein-, Pfarr- und Feuerwehrfesten, die ohne Zahl sind, weiß durch die unzähligen Stadtrats- und Ausschusssitzungen, die regelmäßig erst spät in den Wirtshäusern ein Ende finden, weiß von den auf sich genommenen Jubiläen, Ehrungen und Geburtstagsfeiern, deren Zahl Legion ist, weiß also, dass seine Ochsenfurter in allererster Linie Seelen sind. Und erst in zweiter Linie Einwohner. Die Einwohner sind Sache des Einwohnermeldeamtes, dort werden sie sortiert, katalogisiert und statistisch aufbereitet. Der Bürgermeister aber ist um ihr Wohlsein besorgt, um ihr Wohlbefinden in allen Belangen, was seiner tiefsten inneren Überzeugung entspricht. Er sieht in ihnen, insbesondere wenn er die Augen ein wenig verengt und zu dem Butzenglas der Fenster in seinem Arbeitszimmer hin blinzelt, vorrangig Seelen, die seiner Fürsorge im umfassenden Sinn bedürfen. Zudem sind Wahlen grundsätzlich eher mit Seelen, denn mit Einwohnern zu gewinnen, was ebenfalls seiner tiefsten inneren Überzeugung entspricht.
Es ist Bürgermeister Felix Dombrowski, der da in seinem Ohrensessel sitzt und über die Aussichten und Perspektiven seiner Stadt brütet. Er sieht dunkle Wolken aufziehen, die keineswegs erst am fernen Horizont auftauchen, sondern sich schon seit längerem vorangearbeitet haben und drohen, die Stadt zu verdüstern. Er zupft sich am Ohrläppchen, wischt sich über die Nase und versinkt in tiefes Grübeln. Die Züge seines Gesichtes sind von bemerkenswerter Zeitlosigkeit, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, sein Konterfei fände passend einen Platz in jeder mittelalterlichen Portraitgalerie. Allenfalls die Frisur zeigt die Nähe zur heutigen Zeit an, denn die vollen grauen Haare sind exakt gescheitelt und sorgfältig geschnitten. Ein grauer Bart umkränzt Kinn und Wangen und verleiht ihm in all seiner Ratlosigkeit, die ihn gerade heimsucht, etwas Ehrfurchtgebietendes. Der Schädel wirkt breit und kräftig und jederzeit willig zum Trotz, den aufzubieten sein Träger in der Lage ist, wenn Widrigkeiten sein Wohlwollen kreuzen. Der breite Nasenrücken verrät eben diese Entschlossenheit zur Durchsetzung seines Willens, während hingegen die hellen Augen es vermögen, in Verständnis, ja selbst Güte dreinzublicken, was so manchen Gesprächspartner unmittelbar für ihn einnimmt.
Eine gewisse Majestät liegt in seinem Wesen. Einmal, bei einem der Rosenmontagsumzüge durch die Stadt, hatte man ihn als König ausstaffiert, mit einer Krone, einem Zepter und einem purpurnen Mantel versehen und auf einem der Umzugswagen auf einen Thron gesetzt. Der Jubel des Faschingsvolkes bei seinem Erscheinen kannte dabei keine Grenzen. Wohl denkbar, dass sich anfänglich in die ausbrechende Begeisterung ein im Ulk gegründeter Überschwang mischte, doch erkennbar wurde vielmehr die aufrichtige Bereitschaft und der Wunsch des Volkes, seinem König zu huldigen, der seinerseits die Huldigungen mit gemessenen Gesten wie selbstverständlich entgegennahm. Die Szene des königlichen Bürgermeisters im Beifallsturm und Getöse der Menge hatte sich aus der Stimmung des Faschingsumzuges ganz und gar herausgelöst, sich verwandelt und ihre eigene Wirksamkeit geschaffen.
Der Strukturwandel ist es, der ihm zu schaffen macht. Die Stadt hat mit dem allgegenwärtigen Strukturwandel zu kämpfen. Großstadtmenschen haben kein Verständnis für die Maße und Verhältnisse der Kleinstadt. Sie meinen, sie bräuchten nur daherzukommen, sich auf den Marktplatz zu stellen und sich überlegen lächelnd umzuschauen, bräuchten sich über die hohe Mauer vor der Kirche und das Straßenpflaster lustig zu machen. Ja, das meinen sie. Dabei bedurfte es immenser Anstrengungen, die sich über mehr als anderthalb Jahrzehnte hinzogen, um die Modernisierung des Marktplatzes in Einheit mit dem Ensemble des Kirchplatzes in die Wege zu leiten und zu einem guten Ende zu bringen. Die Experten der Planungsbüros gaben sich über all die Jahre im Rathaus die Klinke in die Hand und legten Gestaltungsvorschlag um Gestaltungsvorschlag vor, bis man sich aus dem Dickicht der Konzepte eines Tages rettete, indem man einer Kombination aus den drei überzeugendsten den Zuschlag erteilte. Ein Befreiungsschlag, der in seiner Entschlossenheit und Wucht an die Zerschlagung des gordischen Knotens mahnte! Die Frage der Finanzierung blieb die gesamte Zeit über eine Gleichung mit vielen Unbekannten, denn Freistaat, Bezirk, Kreis und nicht zuletzt die Stadt kämpften erbittert um ihre jeweiligen Anteile an den Kosten der Generalsanierung der „Wohnstube“ der Stadt, wie es hieß. Aber auch in dieser schwierigen Frage der Kostenverteilung konnte eines Tages Einigung erreicht werden, und die Baumaßnahmen nahmen ihren Anfang. Der Platz rund um die Stadtpfarrkirche St. Michael, 1276 erstmals urkundlich erwähnt, wurde aufgebrochen. Das Ergebnis war das, was Fachleute vorausgesagt hatten, nämlich dass in geringer Bodentiefe eine ganze Reihe von Skeletten zum Vorschein kam. Der Platz um die Kirche war eben der Kirchhof, der in vergangenen Zeiten üblicherweise als letzte Ruhestätte galt. Erst nach den großen Pestilenzen und Seuchen verlegte man den Friedhof in den Außenbereich. Die ausgegrabenen Knochen wurden von Staub und Erde gesäubert, mit nummerierten Banderolen versehen und archiviert. Man überließ sie dem Beinhaus in der neben der St. Michaelskirche gelegenen Friedhofskapelle St. Kilian. Der Kirchplatz wurde neu gepflastert. Die große Freitreppe, die von der Hauptstraße zur Kirche hinaufführte, musste weichen, und man errichtete statt ihrer, aus statischen Gründen, wie es hieß, denn die Kirche drohte in ihrer Gesamtheit abzurutschen, eine imposante Mauer, die sich über die gesamte Front hinzieht. Das Katzenkopfpflaster auf den Hauptstraßen der Innenstadt hatte ebenfalls ausgedient. Die Stadt erhielt eine neue Pflasterung, die keinem Stöckelschuh mehr zum Hindernis werden konnte und nicht nur Inline- und Skateboardfahrern eine geschmeidig glatte Fahrbahn bot. Da konnte man sie wieder gelegentlich hören, die lästerlichen Stimmen aus der Großstadt, die in hochmütigem Gestus meinten, der ausführende Architekt habe sich wohl von seinem Wohnort Stuttgart-Degerloch inspirieren lassen und die dortigen Einkaufspassagen für die Pflasterung zum Vorbild genommen. Nein und abermals nein! Die Bewohner der Stadt haben mit der Renovierung ihren Frieden geschlossen und sind einverstanden mit dem Erreichten. Erst kürzlich hat die Stadt einen städtebaulichen Preis erhalten, ein Umstand, den damals bei der Sanierung niemand jemals für möglich gehalten hatte.
Der Strukturwandel ist es, der Bürgermeister Dombrowski zu schaffen macht, der Strukturwandel in seiner ganzen Erbarmungslosigkeit. Er zupft sich am Ohrläppchen, wischt sich über die Nase und fingert aus der untersten Schublade seines Schreibtisches das Exemplar eines Flugblattes hervor, das vor etlichen Jahren in Umlauf kam, als es darum ging, ein Theater in der Stadt in dem leerstehenden Flockenwerk zu gründen. Ein Theater sollte in der Stadt aufleben, und zwei in der Region bekannte Theaterleute waren angetreten, die Leitung des Projekts zu übernehmen. Ein Projekt, das die Fantasie Purzelbäume schlagen ließ. Dies hätte eine Blutzufuhr ohnegleichen für den Kreislauf der Stadt bedeutet. Das Flugblatt stellte mit Donnerstimme die Fragen an die Bürgerinnen und Bürger:
Was wollt ihr im Flockenwerk haben?
Wollt ihr einen Drogeriemarkt?
– Nein, denn wir haben deren drei in der Stadt…
Wollt ihr einen weiteren Lebensmittelmarkt?
– Nein, denn wir haben schon deren fünf…
Wollt ihr ein Autohaus?
– Nein, wir haben Autohäuser in Fülle…
Wollt ihr eine Metzgerei?
– Nein, denn wir haben die besten im Überfluss…
Wollt ihr eine Bäckerei?
– Nein, wir haben einen Reichtum an ihnen ohnegleichen…
Wollt ihr ein Theater?
– Wollen wir, ja, ein Theater wollen wir!
So sah das noch vor einigen Jahren aus. Ein Theater hatten sie gewollt… Und jetzt? Bürgermeister Dombrowski hat einen Abscheu davor, sich mit Versäumnissen zu beschäftigen, insbesondere dann, wenn man ihn mit ihnen in Verbindung brächte. Ein Theater! Ein richtiges Theater! Was hätte das für den Nimbus der Stadt bedeuten können! Abend für Abend wäre das Publikum herbeigeströmt, hätte sich in die Gastronomien ergossen… aber die von der anderen Partei… und auch seine eigenen… Er zupft sich am Ohrläppchen, wischt sich über die Nase und wählt die Verbindungstaste zu seiner Sekretärin im Vorzimmer.
„Sei so gut…“
Mehr braucht er nicht zu sagen. Nach einigen Minuten erscheint die Sekretärin mit einem Tablett, auf dem sie den Schoppen Silvaner, dessen Glas vor Kälte beschlagen ist, zusammen mit einem Schälchen Erdnüsse hereinträgt. Der Bürgermeister dankt mit einem Kopfnicken und einem aufmunternden Blick, der wohl eher seiner eigenen Gemütsverfassung gilt als der seiner Sekretärin.
Aller Verschönerung und Modernisierung der Innenstadt zum Trotz ließ sich der Strukturwandel nicht aufhalten. Die drei Drogeriemärkte verschwanden nach und nach aus der Innenstadt, und ihr Sortiment fand sich in den neu erbauten Lebensmittel-Centern am Rand der Stadt wieder. „Alles unter einem Dach“ hieß der Slogan. Spiel- und Schreibwarenläden gaben ihre zentrale Geschäftslage auf und verlagerten sie in die Einkaufspassage, gleichermaßen am Stadtrand gelegen. Zwei Metzgereien stellten ihren Betrieb ein, weil sie nicht mithalten konnten mit den raumgreifenden Fleischtheken der neuen Center, hinter denen ein ganzer Schwarm gleich kostümierter Verkäuferinnen die Kundschaft bediente. Der Blumenladen zog ab und eröffnete auf dreifacher Geschäftsfläche ebenfalls in der Passage. Und mit dem Ausscheiden des letzten Tante-Emma-Ladens in der Hauptstraße war kein Pfund Mehl oder Päckchen Butter oder Bündel Karotten mehr für die Bewohner der Innenstadt fußläufig zu erhalten. Von nun an benötigte man ein Auto, um seine Einkäufe zu erledigen. Sogar die Ärzte folgten dem Trend. Sie schlossen ihre Praxen und eröffneten sie in dem nigelnagelneuen Ärztehaus jenseits der Bundesstraße. Die Innenstadt war auf dem Weg zu veröden. Da saß der Bürgermeister, von Tag zu Tag betrübter werdend, in seinem großen Ohrensessel und stellte sich die Frage, was zu tun sei. Einzig die Gasthäuser hielten stand, sah man von einer Ausnahme ab, die schmerzlich genug war, dem Weinhaus „Zum fröhlichen Mann“, und versagten sich dem Sog in die Peripherie. Nun, er, Bürgermeister Felix Dombrowski, tat jedenfalls sein Bestes, um diese beliebten Orte der Geselligkeit am Leben zu erhalten, was ihm jedermann zugutehalten musste.
Er lächelt ein wenig leidig und leert mit einem Seufzer den Rest aus seinem Glas, um es danach energisch auf dem Tablett abzustellen. Er blinzelt in Richtung der Butzenscheiben und fragt sich zum wiederholten Mal, wie der Strukturwandel aufzuhalten sei, oder wenn er schon nicht aufzuhalten sei, wann denn dann die neue Struktur, die doch der Wandel bereithalten sollte, sich einstellen wolle, um sich zu erkennen zu geben. Und wie er so zu den Butzenscheiben hin blinzelt, scheint es ihm, als ob er ein Glimmen in seinem Inneren wahrnehme, das, nach all seiner Erfahrung, in der Regel sich zu einem Einfall auswächst, wenn nicht gar zu einer rettenden Idee. Er spürt in sich hinein und nimmt wahr, wie das Glimmen langsam an Stärke und Leuchtkraft gewinnt.
Es steht eindeutig in Verbindung mit dem Vortrag, den er des anderen Tages in der Stadtbibliothek besucht hatte. Ein hageres, von Wind und Wetter gegerbtes Rentnerpaar war als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen und ließ seine Erlebnisse und Erfahrungen in einem Diavortrag lebendig werden. Man hatte viel Wissenswertes erfahren können und auch Amüsantes, und eine vielköpfige Zuhörerschaft nahm den Vortrag begierig auf, denn Pilgern auf dem Jakobsweg von der französischen Grenze bis nach Santiago de Compostela genießt hohes Ansehen.
Nun ist Bürgermeister Felix Dombrowski nicht auf der Milchsuppe daher geschwommen, wie man immer wieder zu hören bekommt. Wenn jemand in den Vielfältigkeiten dieser Welt, insbesondere in den geographischen und kulturellen, Bescheid weiß, dann ist er es. Den Jakobsweg kennt er natürlich, keine Frage, wenn er ihn auch nicht zu Fuß erkundet, sondern ihn mit dem Wohnwagen auf einer dreiwöchigen Tour immer wieder gekreuzt hat. Und er ist zu jeder Stunde des Tages und des ausgedehnten Abends bereit, über die ikonographische Ausgestaltung der Westfassade der Kathedrale von Compostela zu berichten, der Fassade mit ihren Darstellungen, die von den Offenbarungen des Johannes künden… wahlweise über… nun, je nach Belieben…





























