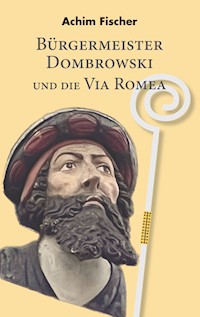Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frieders letztes Lachen In den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts verfasste Siegfried von Vegesack (1888-1974) seine großartige Triologie "Die Baltische Tragödie", die das Schicksal der Baltendeutschen sowie deren versinkende Kultur und Gesellschaft schildert. Was ist davon nach neunzig Jahren übriggeblieben, was ist davon noch zu spüren bei der nachgeborenen Generation? Ist die Tragödie ausgeheilt und zur Normalität übergegangen? Welcher Einfluss wirkt nach? Achim Fischer, 1944 als Sohn baltischer Eltern in Posen geboren, erzählt in vier Geschichten, wie das "Baltische" eher beiläufig - geradezu nebensächlich - doch immens lebendig in dieser Generation präsent ist und weiterhin wirkt. Melancholie und der typisch baltische Witz gehen hier eine berührende Verbindung ein. Brüche werden sichtbar, zuweilen Gräben, aber tiefenwirksamer Humor verbindet die Erzählungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Frieders letztes Lachen
In den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts verfasste Siegfried von Vegesack (1888-1974) seine großartige Triologie „Die Baltische Tragödie“, die das Schicksal der Baltendeutschen sowie deren versinkende Kultur und Gesellschaft schildert.
Was ist davon nach neunzig Jahren übriggeblieben, was ist davon noch zu spüren bei der nachgeborenen Generation? Ist die Tragödie ausgeheilt und in die Normalität übergegangen? Welcher Einfluss wirkt nach?
Achim Fischer, 1944 als Sohn baltischer Eltern in Posen geboren, erzählt in vier Geschichten, wie das „Baltische“ eher beiläufig - geradezu nebensächlich - doch immens lebendig in dieser Generation präsent ist und weiterhin wirkt. Melancholie und der typische baltische Witz gehen hier eine berührende Verbindung ein. Brüche werden sichtbar, zuweilen Gräben, aber tiefenwirksamer Humor verbindet die Erzählungen.
Achim Fischer, (1944) in Posen geboren, aufgewachsen in Potsdam und München; studierte Pädagogik, Politologie und Publizistik in Bochum und Berlin. Er lebt in Würzburg.
Kontakt: [email protected]
Das Cover zeigt eine Grafik von Konrad Grimm nach einem Foto von Klaus Berger. Der Kopf stellt Frieder von Krusenstjern (1943-2022) dar.
Inhalt
Einfluss
Dahme
Balten
Warthegau
Ama
Achim
Ama
Flucht I
München
Dahme
Kessel
Weitere Kessel
Erscheinung
Umzug
Flucht II
Frieders Pfingstwiese
Geburtstagsrede
Frieders letztes Lachen
Dank
EINFLUSS
Dahme
Am 28. Juli 2021 trafen wir in Dahme ein. Julia und ich hatten ein paar Tage in Zichtow bei Kyritz an der Knatter in Brandenburg bei Freunden verbracht und waren anschließend nach Dahme gefahren. Wir fuhren direkt zum Hotel, wobei das Hotel eine Eigentümlichkeit aufweist, die uns beim ersten Ansehen zögern ließ. Das Hotel, Hotel am Schlosspark, wie es sich nennt, ist in einem Krankenhaus untergebracht. Es nimmt den rechten Teil des Erdgeschosses ein, im weitaus größten Teil des Gebäudes hingegen, das sich in mehreren flachen Karrees ausstreckt, befinden sich die Kranken und Genesenden. Ein Altersheim ist ebenfalls einquartiert und heißt „Residenz am Schlosspark“. Vor dem Eingang hielten sich Patienten in Bademänteln oder auch nur im Pyjama auf, einige bandagiert, und rauchten und unterhielten sich. Andere hielten ihre Tropfgestänge fest und schoben sich vorsichtig über das Pflaster. Auf dem Weg zur Rezeption wich man Rollstuhlfahrern aus, und Krankenschwestern huschten vorbei. Ich dachte schon, es wäre das Krankenhaus, in dem ich beinah ein Jahr verbracht hatte, aber das war ein Irrtum, wie ich später erfuhr. Dieses Krankenhaus war neu, und meines war das alte Krankenhaus, zu dem der Redakteur uns erst am nächsten Tag führte und das inzwischen ein Seniorenheim ist.
An der Rezeption begrüßte uns eine blonde Frau derart freundlich, dass ich sie gleich fragte, ob sie wisse, seit wann dieses Krankenhaus bestünde. Aber sie wüsste es nicht, sagte sie, sie würde erst seit fünf Jahren hier arbeiten. Sie nahm unsere Anmeldungen entgegen, und als sie mein Geburtsdatum las, sah sie mich überrascht an.
„Oh, Sie haben morgen Geburtstag“, rief sie und strahlte, als ob sie selbst Geburtstag hätte und streckte ihre Hand aus, die sie sogleich wieder zurücknahm, „nein, da will ich Ihnen erst morgen gratulieren. Man soll nicht vorher gratulieren, das bringt kein Glück, nein, nein.“ Sie schüttelte freudig den Kopf. In der Tat gratulierte sie mir am nächsten Tag voller Herzlichkeit und auf dem Frühstückstisch stand eine zierliche Vase mit drei kurzstieligen Rosen.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, machten wir uns auf, das Städtchen zu erkunden.
Die Dahme ist ein 95 km langer Fluss, der bei Berlin in die Spree mündet und den Fontane auf seinen Wanderungen in der Mark Brandenburg auch „wendische Spree“ nennt. Obwohl nicht von übermäßiger Länge und obwohl lediglich ein Nebenfluss der Spree gibt sie einem Landkreis ihren Namen, dem Landkreis Dahme-Spreewald.
Richtig, den halben Namen, aber das ist für so ein Flüsschen auch schon viel.
Die Quelle der Dahme entspringt ein wenig südöstlich von der Kleinstadt gleichen Namens, Dahme/Mark. Die Stadt Dahme/Mark nun ihrerseits liegt keineswegs, wie zu erwarten, im Landkreis Dahme–Spreewald, sondern im Landkreis Teltow-Fläming, eher abgelegen im südlichen Zipfel.
Der Redakteur des „Fläminger Boten“, der mich zu meinem 77. Geburtstag interviewte, meinte, er komme selten nach Dahme, die Stadt läge irgendwie im Abseits und es gebe von dort wenig zu berichten. Die Geschichte jetzt mit mir sei eine Ausnahme, sagte er. So äußerte er sich.
Ganz verstanden habe ich den Redakteur nicht, denn es gab zumindest früher ein Gymnasium, heute ist es die Gesamtschule „Otto Unverdorben“, genannt nach dem Entdecker des Anilins. Und dann jede Menge Seniorenheime. Selbst der Redakteur hat über deren Häufung gestaunt, als er mit uns zum alten Krankenhaus fuhr. Er muss tatsächlich längere Zeit nicht in der Stadt gewesen sein, denn ein Seniorenheim schüttelt man ja nicht einfach mal so aus dem Ärmel und stellt es hin. Das braucht seine Zeit. Er hätte gut und gerne einen Artikel schreiben können über die ungewöhnliche Häufung von Altersheimen in Dahme, zumal die alten Herrschaften von irgendwo herkommen müssen. Gewiss nicht nur aus Dahme. Da ergäben sich Fragen über Fragen. Alte Menschen schüttelt man ebenso wenig aus dem Ärmel wie die dazugehörigen Heime oder Residenzen.
Und das Krankenhaus, das zum Teil als Hotel dient, was selten genug ist. Und das Ruinenschloss mit der angestrahlten Fassade und dem weitläufigen Park, in dem kulturelle Veranstaltungen und Feiern stattfinden. Und das Kino, in dem man während der Filmvorführung essen kann. Das Heimatmuseum am Töpfermarkt war früher die Oberschule, in der mein Großvater Oskar noch mit 72 Jahren einige Jahre Russisch unterrichtet hat. Die historische Altstadt, umschlossen von der „Eisernen Mauer“, der Stadtmauer aus Eisen- und Feldsteinen, im 13. Jahrhundert errichtet und bis heute fast vollständig erhalten. Die Kirche St. Marien aus dem 13. Jahrhundert. Der prächtige Rathausbau im Stil der Neorenaissance aus roten Backsteinen. Das Schwimmbad. Die Bäckerei auf der Hauptstraße. Als ich die Tür öffnete und eintrat, um ein Hörnchen zu kaufen, traf es mich mit Wucht. Wusste ich, dass ich hier schon gewesen war? Ich konnte mich nicht erinnern und dennoch erkannte ich die Bäckerei. Diese wannenartigen, porzellanenen Auslagen unter der Theke, in denen Reste von Kuchen lagen, und die wenigen Brotlaibe in den Wandregalen.
Den ehrwürdigen Ratskeller im Rathaus, in dem Onkel Juns uns einen Kakao spendiert hatte, gibt es nicht mehr, schade. Onkel Juns war der Bruder meiner Mutter und wurde von den Russen gleich nach dem Krieg im Nachbardorf als Bürgermeister eingesetzt, weil er Russisch konnte. Alle Balten dieser Generationen sprachen Russisch. Aber als die Russen dahinterkamen, dass Onkel Juns Nazi gewesen war, kräftig bei der SA mitgemischt hatte, verlor er den Posten. Er muss wohl kein besonders schlimmer Nazi gewesen sein, denn sie nahmen ihm nur sein Amt und sperrten ihn nicht ein. Erst einige Jahre später wollten sie ihn holen, doch Onkel Juns setzte sich in den Westen ab. Als mein Bruder und ich unsere Eltern fragten, weshalb Onkel Juns in den Westen gegangen sei, sagten sie, er hätte einem Russen einen Kinnhaken verpasst. Wir reckten die Fäuste in die Höhe und stießen einen Jubelschrei aus. Das war in Weimar 1949.
Aber dafür gab es noch den sogenannten Kornspeicher, in dem dereinst an die zweitausend napoleonische Soldaten gefangen gehalten wurden. Steht so im Stadtführer. Das ist eine erstaunliche Menge. Ich traf auf einen Mann vor dem Kornspeicher, der mir erzählte, zwanzigtausend napoleonische Soldaten seien es gewesen, die dort eingesperrt waren. Zwanzigtausend in einem Haus! Nach zweihundert Jahren kann man schon mal die Zahl ohne Scheu verzehnfachen. Der Mann sagte auch ohne erkennbaren Zusammenhang, nach dem Krieg wäre der erste Kämmerer der Stadt mit der Kasse getürmt, und Jude sei er gewesen. Ist auch schon über siebzig Jahre her.
Im Übrigen ist das Stadtwappen von Dahme allerliebst. Auf den Zinnen eines der Stadttürme, ebenfalls aus rotem Backstein, steht eine Dame in blauem Kleid und grüßt mit einem verhaltenen Lächeln und einem Palmzweig in der Hand. Sie hat offensichtlich das Gemäuer mit Hilfe einer Leiter erklommen, denn diese lehnt gut sichtbar an der Mauer. Dennoch hat der Name der Stadt nichts mit einer Dame zu tun, sondern leitet sich von dem sorbischen Wort Damna ab.
Am nächsten Morgen, an meinem Geburtstag, an dem Tag, an dem die Vase mit den kurzstieligen Rosen auf dem Frühstückstisch stand und die Dame von der Rezeption mir gratuliert hatte, erschien um elf Uhr der Redakteur des „Fläminger Boten“ im Hotel. Er kam mit einem dicken Allrad SUV an. Wahrscheinlich sind hier die Straßen im Winter schwer passierbar. Er gratulierte mir ebenfalls. Julia hatte im Vorfeld die Zeitung angeschrieben und auf meine Geschichte hingewiesen und angekündigt, dass ich an meinem siebenundsiebzigsten Geburtstag nach dreiundsiebzig Jahren das erste Mal wieder nach Dahme käme. Das reichte an Aufmerksamkeitswert eben so gerade aus, um einen Redakteur loszuschicken. Er war sehr freundlich und stellte seine Fragen, eine nach der anderen, und ich beantwortete sie und erzählte meine Geschichte in groben Zügen.
Er ließ uns aber wissen, dass der „Fläminger Bote“ ebenso wie die anderen Blätter mit der Sommerflaute zu kämpfen habe und man deshalb allerlei Beiträge aufnehme, die zu anderen Jahreszeiten kaum Interesse erweckt hätten. Nichts für ungut, fügte er hinzu, das sollten wir nicht persönlich nehmen. Das Zeitungsgewerbe sei ein hartes Geschäft. Aber nun sei er da, und wir fuhren gemeinsam zum alten Krankenhaus.
Ich will nicht sagen, ich hätte es gleich erkannt, aber irgendwie habe ich es schon erkannt. Die Fassaden waren frisch gestrichen und alles schien vor kurzem renoviert worden zu sein, sah tipp-topp aus, wie neu, und die Grünanlagen waren sehr gepflegt. Aber die Gestalt des Gebäudes erinnerte mich an Vergangenes, an längst Vergangenes, an etwas unendlich lange Vergangenes. Das alte Krankenhaus wird jetzt als Seniorenheim genutzt.
Wir machten noch Fotos, also der Redakteur machte einige Fotos von mir vor dem Krankenhaus, und Julia machte zwei Fotos von dem Redakteur und mir vor dem Krankenhaus. Wir fuhren danach noch zu dem Haus in der Luckauer Chaussee 3, und auch dort machte der Redakteur Fotos. Ein Foto von Julia und mir mit dem Haus im Hintergrund erschien zusammen mit dem Artikel, der einige Tage danach im „Fläminger Boten“ zu lesen war. Es war ein guter Artikel.
Gegen Abend machten wir uns erneut auf den Weg. In Dahme sind die Wege kurz, und so nahm es nicht viel Zeit in Anspruch, bis wir zu Katzschke’s Restaurant gelangten, das eine ansprechende Speisekarte und einen Biergarten hat. Zudem konnten wir von dort beinahe einen Blick auf das Haus in der Luckauer Chaussee werfen, der nur von einigen Bäumen verstellt war. Zu dem Haus, das ich dreiundsiebzig Jahre nicht gesehen hatte, schien ich Wiedersehensfreude entwickelt zu haben. Im Biergarten setzte man uns an einen Tisch, der an einen anderen angrenzte, an dem ein Paar vor riesigen Schnitzeln mit Pommes und Salat saß. Beide Motorradfahrer, er gegen Ende dreißig, Anfang vierzig, sie etwas jünger, machten einen angenehmen Eindruck. Sie kamen aus Tübingen, wie die Schilder an den abgestellten Maschinen zeigten. Ihre Helme hatten sie auf die Stühle neben sich gelegt. Wir wünschten ihnen guten Appetit, sie bedankten sich. Wir tauschten einige Sätze aus und kamen ins Gespräch. Man ist doch neugierig, was die jeweilig anderen in dieses abgelegene Städtchen verschlagen hat, wobei es bei dem Tübinger Paar auf der Hand lag. Sie befanden sich auf einer Motorradtour durch Brandenburg, und dabei vermeidet man Autobahnen und ausgebaute Schnellstraßen und wählt seinen Weg über kurvige Landstraßen und durch wenig bekannte Gegenden. Und heute waren sie in Dahme.
Als es an uns war, Auskunft zu geben, wurde ich unsicher, weil ich nicht wusste, wie ich beginnen sollte und was ich überhaupt erzählen wollte.
„Ich bin vor über siebzig Jahren das letzte Mal in Dahme gewesen…“, begann ich zögernd.
Die junge Frau sah mich aus wachen Augen an, zog die Brauen hoch. Ungläubigkeit sprach aus ihrem Gesicht. „Vor über siebzig Jahren…“, wiederholte sie zweifelnd und schüttelte kaum merklich den Kopf.
„Ich war hier im Krankenhaus… beinahe ein Jahr… auf Grund eines Unfalls... und da drüben haben wir gewohnt. Wir sind vor sechsundsiebzig Jahren nach Dahme gekommen…“
Die junge Frau wurde noch skeptischer, und der Mann wiederholte jetzt ungläubig „sechsundsiebzig…“
„Es hat mit dem Krieg zu tun“, sagte Julia.
„Na ja Krieg“, sagte ich, „nicht direkt mit dem Krieg…“
„Als Folge des Krieges, doch sicher.“
Ich stoppte. Ich hätte jetzt sagen können, dass heute mein siebenundsiebzigster Geburtstag sei und wir extra nach Dahme gekommen sind, um hier den Beginn meines zweiten Lebens zu feiern, aber das kam mir nicht über die Lippen. Ich spürte die Skepsis der beiden, die mich hinderte, weiterzureden. Ich hätte sie womöglich mit der Tatsache, dass heute mein Geburtstag sei, in Verlegenheit gebracht… vielleicht hätten sie auch daran gezweifelt und hätten einfach nur „na dann alles Gute“ hervorgepresst. Ich hätte also die ganze Geschichte erzählen müssen. Und sie hätten dann lange zuhören müssen.
Ich habe es nicht getan. Ich sagte nichts mehr, und sie fragten auch nicht weiter nach.
Im Nachhinein hat mir das leidgetan. Ich hätte den beiden einfach die Geschichte erzählen sollen. In Kurzform natürlich, so wie ich sie dem Redakteur erzählt habe, vielleicht noch etwas kürzer. Ja gewiss, noch kürzer, aber ich hätte erzählen müssen. Irgendwann hätten sie mir geglaubt.
Ich hole das jetzt nach. Ich erzähle die ganze Geschichte, ausführlich, und vielleicht lesen die beiden Motoradfahrer aus Tübingen sie irgendwann zufällig, und auch der Redakteur erführe dann alles, wenn er sie lesen würde.
Balten
Mein Name ist Marie-Luise Weinrich und ich bin am 10. August 1884 in Menkendorf in Russland geboren. In Wahrheit liegt Menkendorf nicht in Russland. Obwohl es ohne Zweifel Teil des russischen Reichs ist, gehört es dennoch nicht zu ihm, nicht im wesenhaften Sinn, will ich sagen. Wir sind keine Russen, wir sind russische Staatsbürger, aber keine Russen. Wir sind Deutsche, wir sind Balten und waren seit jeher auf unsere Autonomie bedacht, unsere Eigenständigkeit im Hinblick auf Russland. Man muss jedoch einräumen, die Zaren haben unseren Anspruch beinah durchweg anerkannt, denn sie wussten natürlich warum. Selbstverständlich nehme ich die widrigen Zeiten der Russifizierung aus, denn damals haben sie uns ordentlich gezwiebelt, aber schließlich musste der Zar einlenken, und Nikolaus II verkündete im Toleranzedikt von 1905 die Glaubensfreiheit. In den Schulen wurde wieder Deutsch als Unterrichtssprache gestattet. Irmgard Erdenthal, die Frau Pastorin, war außer sich vor Freude, als die Nachricht im Mai 1905 das Pastorat erreichte, und rief lauthals: „Glaubensfreiheit, Muttersprache… Ich kann es gar nicht fassen. Wir fangen wieder an zu leben. Frei, frei und nicht mehr bloß geduldet. Der Herr ist groß und mächtig und lenkt die Herzen wie Wasserbäche, wie es im Psalm heißt.“
Nu ja, wir betrachten Livland als unsere Heimat. Livland und nicht Russland, obwohl Menkendorf auf der kurländischen Seite der Düna liegt, sagt Papa immer, wir seien Balten und stammen aus Livland, wahrscheinlich, weil er aus Riga stammt. Südwestlich von uns liegt Kurland, jenseits der Düna, umfasst von der Ostsee und dem Rigaschen Meerbusen, gleichermaßen eines der russischen Ostseegouvernements, die seit der dritten polnischen Teilung 1795 vom deutsch-baltischen Adel autonom verwaltet werden. Nördlich grenzt an Livland die dritte baltische Ostseeprovinz, das Gouvernement Estland, das vom Finnischen Meerbusen und Russland eingeschlossen wird.
Gut Menkendorf liegt am mächtigen Dünastrom, und unser Land führt direkt an das Hochufer der Düna heran, was man so Hochufer nennt, und was dagegen bei uns nur eine geringe Höhe aufweist. Dort ist ein reizender Platz, zwei weiß gestrichene Holzbänke laden zum Verweilen ein, von denen aus man eine herrliche Aussicht auf den Strom hat, der gerade hier einen großen Bogen beschreibt. An dieser Stelle mündet zudem der Nebenfluss Dubna, so dass man den Eindruck eines ausgedehnten Sees hat. Die gegenüberliegenden Ufer säumen dunkle Wälder, die sich in die Ferne erstrecken, soweit das Auge reicht. Allerdings sind sie nicht selten von Dunst und Nebel verhangen. Man blickt dann in eine sich ständig verändernde, verschwommene Wallung von grauen, quirlenden Schwaden. Scheint aber die Sonne, so glitzert und funkelt das bewegte Wasser, und man muss seine Augen beschatten, um nicht ständig gegen das Licht zu blinzeln.
Ich sitze zu gerne auf den Rosshaarkissen, die die weißen Bänke polstern, eingehüllt in Decken und schaue auf die Düna. Ich habe das seit jeher getan, um dabei meinen Gedanken nachzuhängen und tue es auch jetzt noch, was nicht ohne weiteres und anstandslos jedermann einleuchten wird. Doch man sollte alles nicht zu materialiter nehmen, das führt zu nichts. Ich bin am 13. Juni 1952 in Potsdam verstorben. Es ließ sich nicht umgehen. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Zustand. Bis dahin war es eine tüchtige Strecke Leben. Meine weiße Bank am Steilufer der Düna besuche ich immer noch, nur dass ich keine Kissen mehr benötige und auch keine wärmenden Decken. Ich muss auch nicht meine Augen bei Sonnenschein beschatten, um nicht gegen das Licht zu blinzeln. Ich komme so zurecht. Ach, liebe Zeit, die Bänke bestehen nicht mehr, sie sind schon lang vermodert, wie sollen sie auch überdauert haben. Ebenso wenig existiert das Gut, wie denn auch. An seinem Platz steht ein Erholungsheim für Mütter, die jetzt von der Stelle aus über den Dünastrom ihre Blicke schweifen lassen, während sie sich erholen. Aber, wie ich sagte, ich komme auch so zurecht.
Einen Kilometer entfernt ist eine Fähre, dort Pram genannt, die uns mit der Eisenbahnstation im Städtchen Lievenhof, lettisch Livania, verbindet, von wo aus wir Riga erreichen können. Wenn das Eis gefroren ist, wird der Weg mit Tannenbäumchen abgesteckt, und man fährt mit dem Schlitten hinüber, was nicht jederzeit glatt verläuft, kann man sich denken. Einmal sind meine Eltern beinah ertrunken, als sie gegen einen Stein fuhren, um den herum das Eis noch schwach war und sie einbrachen. Sie kamen mit einem tüchtigen Schrecken davon, aber der Stein wurde von uns allen forthin mit Schaudern angesehen.
Wenn nun im Frühling der Eisgang zu erwarten ist, bedeutet das für uns ein großes Ereignis. Die ersten Anzeichen mit Beginn des einsetzenden Tauwetters sind gewaltige Entladungen, die gezackte Risse in die Eisdecke treiben, vergleichbar in der Form mit den in den Himmel geschleuderten Blitzen. Als ob sich die Düna nach dem langen Schlaf im Winter unter dem Eispanzer recken würde und dieser ihrem Druck nicht länger standhalten könne. Ein Bersten ist die Folge, das sich mit scharfem, schallendem Peitschenknalle bemerkbar macht, und glucksende Wasser dringen allerorts aus den Ritzen hervor. In manchen Jahren wachen wir mitten in der Nacht auf und werden von dem Getöse aus dem Schlaf gerissen. Der Eisgang hat begonnen. Wir lächeln zufrieden und schlafen wieder ein. In den nächsten Tagen finden wir uns in unsere Pelze gehüllt auf den Bänken ein und genießen das gewaltige Schauspiel der Eisschmelze, bei der die Düna ihren Eispanzer abwirft. Wir sehen zu, wie die großen Schollen brechen und sich davonmachen. Wenn sie schließlich an uns vorüberjagen oder sich auftürmen und aufs Ufer kriechen, kichern wir bei dem Gedanken, im Sommer an gleicher Stelle zu baden. Danach sind wir für ein paar Tage von der Welt abgeschnitten, Zeitungen und Briefe können nicht geholt werden. Bald darauf gibt es in der Regel immer Hochwasser, manchmal sogar Überschwemmungen, dann kann man keinen Schritt aus dem Haus machen. Ein Boot vermittelt den Verkehr mit den Ställen. Das Haus und die Ställe sind so angelegt, dass Wasser nie eingedrungen ist.
Sobald das Eis verschwunden, das Hochwasser abgeebbt ist und der Strom seine normale Fließgeschwindigkeit aufgenommen hat, erscheinen die ersten Flöße aus Russland. Wir haben schon nach ihnen Ausschau gehalten und jubeln, sobald sie in Sicht kommen. Der Winter ist endgültig vorbei. Die Flöße kommen. Die Flöße sind mit liederlich gefügten Hüttchen versehen und von Russen bemannt, welche ‚Druschken‘ heißen, wahrscheinlich abgeleitet von dem Wort ‚Druschok‘, was ‚Freundchen‘ bedeutet und dem Auftreten dieser Leute ganz gut entspricht. ‚Druschok‘ weist viele Bedeutungen auf, aber die deutsche Entsprechung ‚Freundchen‘ trifft es schon. Durch Zufall habe ich erfahren, dass es im heutigen Russland unter diesem Namen eine Hundehilfe gibt, eine Firma oder etwas in der Art, sie nennt sich Hundehilfe, die dreibeinige Hunde vermittelt. Man sagt, man habe die Hunde schon dreibeinig an Straßen und Eisenbahnschienen aufgegriffen und suche nun eine mitleidige Seele, die gegen ein rundes Sümmchen den humpelnden Geschöpfen ein Zuhause böte. Sie annoncieren auch in Deutschland wegen der Hunde. Nu ja, wollen wir hoffen.
Die Druschken landen mit ihren Flößen oft bei uns, und das ist dann ein hübsches Bild, wenn am Abend auf den am Ufer liegenden Flößen Feuerchen brennen, um das Abendessen zu kochen. Man sieht den Feuerschein, hört die Stimmen, und nicht selten spielt jemand Harmonika, und ein allgemeiner Gesang hebt an. Zuweilen hören wir wunderbare Stimmen zu uns hinaufsteigen, denen wir in der Dunkelheit, auf den Bänken warm eingepackt, mit Hingabe lauschen. An anderen Abenden, wenn zu viel Wodka im Spiel war, endet alles in einem schluchzenden Gegröle. Dann verschwinden wir rasch ins Haus. Sie suchen uns auch gelegentlich auf, um etwas zu erbitten, und meistens erhalten sie das Gewünschte, wenn es um Mehl oder Kartoffeln oder um ein Stück Butter oder Ähnliches geht. Bringen sie Pelze zum Tausch oder gesalzene Strömlinge, die Ostseeheringe, erhalten sie Hühner oder Schinken als Gegenwert.
Seltener kommen Strusen durch, das sind große Boote, die schon in der Hansezeit auf der Düna und in Schweden zum Transport genutzt wurden. Sie sind mit einem hochgiebligen Dach aus Matten gedeckt, angefüllt mit Korn oder Butter und mit einer Lehmschicht abgedichtet, um die Ladung vor Feuchtigkeit zu schützen. Gesteuert wird die Struse durch zwei große Riemen und erreicht eine Länge bis zu zwanzig Metern. In Riga werden sie auseinandergenommen und verkauft. Auf diesen Strusen werden manchmal kleine Bären mitgeführt, die ebenfalls zum Verkauf gedacht sind. Auf dem Jahrmarkt, wo sie mit einem schief aufgesetzten Fez zu bewundern sind, oder für den Zwingergraben eines Schlosses, in dem sie zur Belustigung des Publikums umhertapsen und nach zugeworfenen Bissen schnappen. Das ist dann eine Freude für uns Kinder, und wir staunen recht, wenn wir die drolligen, pelzigen Geschöpfe auf dem Deck einer Struse ausmachen.
Ein Wahrzeichen von Menkendorf war das alte Ehepaar Kristop und Kristopine. Man hatte sie mit dem Gut übernommen, und wenn man Kristop fragte, was er sei, hat er geantwortet: „Mensch für alles.“ Nun, zuletzt konnte er seines hohen Alters wegen nur noch das Holz zerkleinern und in die Küche tragen. Seine Frau war noch älter als er, so an die hundert Jahre. Sie erinnerte sich, in ihrer Jugend Franzosen der napoleonischen Armee, zwei Mann, durchkommen gesehen zu haben. Sie sah wohl schrecklich aus, wie eine Hexe, und ich hatte große Angst vor ihr, obwohl sie nicht mal mit mir gesprochen hat. Ich habe überhaupt als Kind immer Angst vor alten Weibern gehabt.
In Römersdorf war es Papa mit der Landwirtschaft ausgezeichnet gegangen. Er konnte so viel zurücklegen, dass er sich ein eigenes kleines Gut kaufen konnte. Menkendorf, an der Grenze von Kurland und Livland gelegen, war ein Rittergut. Wir haben Dokumente, laut denen ein Ritter Otto Menke mit diesem Land für seine Verdienste im Kampf im 13. Jahrhundert vom Ritterorden belehnt worden war. Das recht heruntergekommene, kleine Gut hat oft seinen Besitzer gewechselt. Als Papa das Gut übernahm, wurden irgendwelche Zölle geändert und dadurch der Handel mit Korn gefährdet. Außerdem trafen