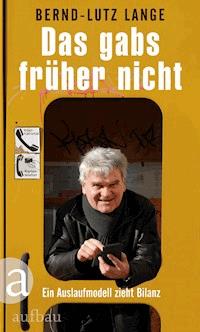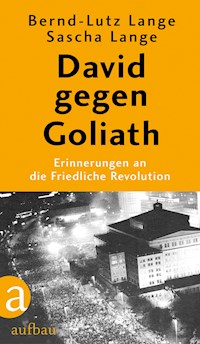15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernd-Lutz Lange nimmt uns mit ins Café Continental – und zugleich mit auf eine literarische Reise durch die letzten 60 Jahre, mit leisem Humor, einem Schuss Satire und einem Hauch Melancholie.
Das »Café Continental« ist der große Treffpunkt dieser Stadt. Jung und Alt kommen hier zusammen, Einheimische und Fremde, Eilige und Leute, die den halben Tag am Kaffeehaus-Tisch verbringen. Für Richard Dumont, eben noch Student, tut sich eine ganze Welt auf. Mit den Freunden am Malerstammtisch diskutiert er leidenschaftlich über die wechselnden politischen Großwetterlagen, über geheimste Neuigkeiten und allerprivateste Liebesangelegenheiten. Der Pianist Ferdinand Barnowsky nimmt ihn mit auf eine Reise in die goldenen Jahre des Berliner Kabaretts der zwanziger Jahre, ins Romanische Café und zur Premiere der Dreigroschenoper.
Über die Jahre lernt er immer neue interessante Leute kennen und erfährt ihre staunenswerten Familiengeschichten. Und immer wieder kommen jüdische Schicksale in der Stadt zur Sprache.
Auch an den Nachbartischen erlauscht Richard Dumont allerhand Aufregendes, so Heiteres wie Skurriles, so Tragisches wie Komisches.
Bernd-Lutz Lange hat in diesem Kaffeehaus einen literarischen Ort gefunden, mit dem er in Geschichten eigentlich die Geschichte dieses Landes ab Mitte der sechziger Jahre bis heute erzählt – und nicht zuletzt vielleicht auch die eigene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Das »Café Continental« ist der große Treffpunkt dieser Stadt. Jung und Alt kommen hier zusammen, Einheimische und Fremde, Eilige und Leute, die den halben Tag am Kaffeehaus-Tisch verbringen. Für Richard Dumont, eben noch Student, tut sich eine ganze Welt auf. Mit den Freunden am Malerstammtisch diskutiert er leidenschaftlich über die wechselnden politischen Großwetterlagen, über geheimste Neuigkeiten und allerprivateste Liebesangelegenheiten. Der Pianist Ferdinand Barnowsky nimmt ihn mit auf eine Reise in die goldenen Jahre des Berliner Kabaretts der zwanziger Jahre, ins Romanische Café und zur Premiere der Dreigroschenoper.
Über die Jahre lernt er immer neue interessante Leute kennen und erfährt ihre staunenswerten Familiengeschichten. Und immer wieder kommen jüdische Schicksale in der Stadt zur Sprache.
Auch an den Nachbartischen erlauscht Richard Dumont allerhand Aufregendes, so Heiteres wie Skurriles, so Tragisches wie Komisches.
Bernd-Lutz Lange hat in diesem Kaffeehaus einen literarischen Ort gefunden, mit dem er in Geschichten eigentlich die Geschichte dieses Landes ab Mitte der sechziger Jahre bis heute erzählt – und nicht zuletzt vielleicht auch die eigene.
Über Bernd-Lutz Lange
Bernd-Lutz Lange wurde 1944 in Ebersbach/Sachsen geboren und wuchs in Zwickau auf. Nach einer Lehre als Gärtner und Buchhändler studierte er an der Fachschule für Buchhändler in Leipzig. 1966 war er Gründungsmitglied des Kabaretts »academixer«, von 1988 bis 2004 trat er im Duo mit Gunter Böhnke auf, bis 2014 mit der Sängerin und Kabarettistin Katrin Weber. Am 9. Oktober 1989 war er Mitverfasser des Aufrufs der »Leipziger Sechs« zur Gewaltlosigkeit und zum Dialog. Seit 1990 veröffentlichte er zahlreiche überaus erfolgreiche Bücher, Hörbücher und DVDs. Von Bernd-Lutz Lange erschien im Aufbau Verlag zuletzt: »Freie Spitzen. Politische Witze und Erinnerungen aus den Jahren des Ostblocks« (2021), »David gegen Goliath. Erinnerungen an die Friedliche Revolution« (mit Sascha Lange, 2019), »Das gabs früher nicht. Ein Auslaufmodell zieht Bilanz« (2016).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Bernd-Lutz Lange
Café Continental
Geschichten und Plaudereien an Marmortischen
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Zur Einstimmung
Zur Einstimmung 2
Der Malerstammtisch
Prag
Das Original
Vom Nachbartisch
Das Spiel
Das Original 2
Willy
Madeleine
Der Malerstammtisch 2
Vom Nachbartisch 2
Der Sozialismus siegt
Prag 2
Poldi, der Schnorrer
Vom Nachbartisch 3
Das Original 3
Im Bus
Der Malerstammtisch 3
Das Geheimnis
Das besondere Pärchen
Das Original 4
Unerwarteter Rückblick
Das Café im Jahr 1989 und danach
Blick zurück
Der Schatz
Das Original 5
Vom Nachbartisch 4
Protest
Der traurige Mann
Vom Nachbartisch 5
Das Original 6
Der Malerstammtisch 4
Vom Nachbartisch 6
Alles anders
Alles anders 2
Der Conférencier
Das Original 7
Nachkriegszeit
Falco, der Besorger
Der Erdenwurm
Der Malerstammtisch 5
Schlechtes Wetter
Der Insider
Die Geschichte der Vera Weiß
Vom Nachbartisch 7
Der Malerstammtisch 6
Vom Nachbartisch 8
Jacques
Vom Nachbartisch 9
Der Malerstammtisch 7
Und wie sieht es heute an jenem Platz aus?
Zur Ausstimmung
DANK
Verwendete Literatur
Impressum
Für Stefanie
Die Zeit steht still.
Wir sind es, die vergehen.
Mascha Kaléko
Zur Einstimmung
In meinem Kabarettleben habe ich so manche Rolle gespielt. Ich war ein Stadtführer, der dem Publikum als Reisegruppe im DDR-Leipzig die Macken der Messestadt als positive Errungenschaften verkaufte, ein Lehrer, der dem phantasiebegabten Schüler Paschke die Phantasie austreiben wollte, der Dirigent eines Europa-Orchesters, der mit den Misstönen der Vertreter verschiedener Länder zu kämpfen hatte. Ich war der Kumpel am Tresen, der schon Anfang der neunziger Jahre leicht besäuselt versuchte, seinem Partner die Gefährlichkeit von Viren zu schildern und und und …
Mit dem Kabarett habe ich im Jahr meines 70. Geburtstags aufgehört. Die Zeit seitdem nutze ich zum Bücherschreiben, und in meinen Lesungen sitzen viele Menschen, die mich von der Brettlbühne kennen.
Nun bin ich in einem Alter, in dem das große Aufräumen angesagt ist. Also habe ich mich auch über meine Mappen hergemacht. Kleine und große Zettel gelesen, Notizen aus Gesprächen mit interessanten Leuten, da ein schöner Satz, dort eine Idee für eine Geschichte, ein Stück erfundener Dialog, eine Anekdote, Beobachtungen verschiedenster Art …
Was macht man damit?
Wenn ich nach dreimaligem Lesen keine Idee hatte, fütterte ich damit den Papierkorb (der Pegel darin stieg …).
Und was geschieht mit den anderen Notizen?
Ich musste einen Spielort erfinden und brauchte nicht lange zu überlegen … Als Liebhaber alter Kaffeehäuser (die man in Deutschland schon mit der Lupe suchen muss) verlegte ich die Geschichten und Plaudereien an Marmortische.
Im Café trifft man sich mit Leuten, lernt welche kennen und hört nebenher, was am Nachbartisch gesprochen wird.
Um welche Zeit geht es?
Ab den sechziger Jahren in der DDR über den Herbst 1989 bis ins heutige Deutschland.
Was ist erlebt, was erfunden?
Das wird nicht offengelegt. Nur so viel: Oft verbirgt sich hinter dem Unwahrscheinlichen gerade die Realität. Erlebtes triumphiert gern über das Erfundene.
In welcher Stadt spielt das?
Irgendeine Großstadt im Osten.
Das Café Continental gibt es nicht, die Akteure auch nicht, aber sie sind mitunter vom realen Leben inspiriert. Die einzigen authentischen Namen im Buch sind die jener Künstler aus den zwanziger Jahren, von denen erzählt wird.
Nun brauche ich noch jemand, der permanent Gast in diesem Kaffeehaus ist. Also eine Figur wie im Kabarett, die jene Rolle spielt. Das ist ein zunächst junger Mann, etwa ein Meter achtzig, von schlanker Gestalt (keine Kunst in dem Alter), dunkles Haar. Ein Haarschnitt, der an französische Filmschauspieler in den sechziger Jahren erinnert, auch die Art, sich zu kleiden. Er trägt nicht nur im Winter einen Schal, sondern besitzt auch ein schmales Exemplar für die anderen Jahreszeiten. Den Pullover hängt er mitunter lässig über die Schulter. Dann baumeln die Ärmel über dem Hemd, oder er hat sie über der Brust zusammengeknotet. Kurzum: Es würde mich nicht wundern, wenn er Alain, Jacques oder Jean heißen würde.
Und Sie werden beim Lesen Zeuge, wie dieser junge Mann allmählich älter wird und wie sich parallel dazu seine Stadt und das Land, in dem er lebt, auf nicht vorstellbare Weise verändert.
Und damit verabschiede ich mich und übergebe an den Erzähler, der sich Ihnen selbst vorstellen wird.
Zur Einstimmung 2
Es war gewünscht, dass ich mich Ihnen kurz vorstelle.
In der provinziellen und biederen DDR hatte mein Name doch einen gewissen exotischen und weltmännischen Klang: Ich heiße Richard Dumont.
Klingt nicht schlecht, was?
Dies habe ich väterlicherseits meinen hugenottischen Vorfahren zu verdanken.
Mitunter passierte es mir irgendwo, dass jemand meinen Familiennamen genau so aussprach, wie er geschrieben stand. Meist in einem etwas unsicher fragenden und zögernden Gestus?
»Du … mont?«
Ich leistete mir dann gern den Scherz: »Nein, Du, ich nicht mont, ich »Dümong«!
Dies brachte mir stets eine verunsicherte Reaktion desjenigen ein.
Meine Lehrer zeigten natürlich, dass sie wussten, wie man meinen Namen ausspricht, und so gab es in unserer Klasse neben Böhm, Lorenz, Körner, Harzer oder Härtel, eben auch den Jugendfreund »Dümong«.
»Freundschaft!«
Nur dem Staatsbürgerkundelehrer klang mein Name vermutlich einfach zu kapitalistisch, denn er rief mich nur mit »Richard« auf.
Nach einigen Französisch-Stunden sagten meine Freunde allerdings nicht mehr Richard, sondern nannten mich »Rieschahr«. Wenn ich mich irgendwo verspätete, dann hieß es nur: »Wo ist denn unser Franzose?«
Passte mir etwas in der Schule oder sonst wo nicht, meinte ich mitunter: »Na, wenn es wieder mal andersrum kommt, dann zieh ich mich in mein Weingut in der Provence zurück.«
Nach dem Abitur klappte es bei mir zunächst nicht mit dem Studium. Mein Traum war, Malerei und Grafik an einer Kunsthochschule zu studieren. Die Mappe für die Bewerbung, die ich abgab, war wohl etwas zu dünn, und das Gremium empfahl mir, es in zwei, drei Jahren noch einmal zu versuchen. So lernte ich zunächst Dekorateur. Kurze Zeit darauf benannte man den Beruf in Gebrauchswerber um.
Und was machte ich?
Ich dekorierte Schaufenster.
Ich lernte in meiner Lehre schon einiges, was mir – so meine Hoffnung – später einmal zugutekommen würde. Vor allem aber lernte ich in dem Warenhaus hübsche Kolleginnen kennen. Ich war der einzige männliche Gebrauchswerber und fühlte mich unter den Mädchen in ihren kurzen weißen Kitteln ausgesprochen wohl. Wir verstanden uns prächtig, und ich bin gern zur Arbeit gegangen.
Nachdem ich nach der Lehre noch ein Jahr gearbeitet hatte, gab ich eine dicke Mappe ab, und siehe da – ich wurde an der Kunsthochschule angenommen! Welch Freude!
Als ich in den sechziger Jahren in diese Stadt kam, begann logischerweise ein völlig neues Kapitel in meinem Leben. Schon bei meinem ersten Bummel durch den Ort geriet ich von einer Gasse auf jenen etwas versteckten Platz mit dem Brunnen, sah die vier Platanen, die ihn flankierten, und dahinter drei Häuser, ein architektonisches Trio Harmonie.
Mir schien, als würde ich nach langer Zeit an meinen Lieblingsort zurückkehren.
Alles, was mich besonders interessierte, das fand ich in diesen Gebäuden.
In dem kleineren Jugendstilhaus zur Linken las ich an der Fassade im Erdgeschoss über den beiden Schaufenstern zu meiner großen Freude in geschwungener Schrift »Buch- und Kunstantiquariat Walter Weidenfeld«.
Diese Schrift, das sah der Liebhaber gleich, hatte der Architekt seinerzeit um 1900 noch abgesegnet. Die stimmte und fügte sich ins Konzert der Fassadenornamente ein. Und im Gegensatz zur renovierungsbedürftigen Front des Hauses sah man den Buchstaben an, dass sie schon in den vergangenen Jahren eine Erneuerungskur hinter sich hatten. Vielleicht auch ein trotziges Zeichen des Inhabers in sozialistischen Zeiten: Uns gibt’s noch!
Und warum war meine Freude bei dieser Entdeckung so groß?
Ganz einfach: Weil das Stöbern in Antiquariaten zu meiner Lieblingsbeschäftigung zählt.
Jedes Antiquariat ist für mich eine romantische Insel, in der ich als Bücher-Robinson aufregende Entdeckungen machen kann.
Auf der rechten Seite der drei Gebäude hatte sich in den zwanziger Jahren ein Haus im Stil des Neuen Bauens etabliert. Die gerundeten Glasscheiben in der Eingangszone, die oberhalb der Fenster von einem Milchglas-Band gekrönt wurden, das abends sogar auf beiden Seiten beleuchtet war, zogen die Interessenten magisch ins Universum-Kino.
Ein Filmkunst-Theater!
Von vormittags bis in den späten Abend liefen alte und neue Filme aus Deutschland und der Welt. Fünf an jedem Tag. Hier hatte der Weltfilm eine Heimstatt: Von »Amarcord« bis »La notte«, von »Asche und Diamant« bis »Kalina Krasnaja«, von »Wilde Erdbeeren« bis »Das Messer im Wasser«, von »Der Untertan« bis »Scharf beobachtete Züge« und und und …
Manche Filme hörten wir sogar in der Originalsprache. Bald erlebte ich, wie ein Mann im Kino in einer Art Portierloge mit Kopfhörern saß und von dort mit dem Blick auf die Leinwand das Geschehen übersetzte.
Dieser eine Mann war für alle Rollen zuständig. Bei dem Liebesgeflüster eines Paares sprach er also Mann und Frau. Wir saßen im Parkett und amüsierten uns besonders über solche Dialoge in seiner etwas knarzigen Stimme.
Und schließlich besah ich mir ausgiebig den Gründerzeit-Bau in der Mitte, an den sich beide Nachbargebäude anschmiegten, die Dominante dieses baulichen Dreiklangs und das Herz des Platzes – das Café Continental.
Und sofort fiel mir ein, dass ich ein schwarzes Schreibmaschinenungetüm besaß, auf dem ebenfalls in Goldschrift »Continental« zu lesen war. Der Name bedeutet bekanntlich, dass etwas auf einen Kontinent bezogen ist, hier also auf Europa. In jenen Tagen war leider nicht nur unser Land geteilt, sondern auch dieser Kontinent.
Und das politische Kontinentalklima litt unter dieser Teilung.
Ich hatte schon gehört, dass es in dieser Stadt ein originales Art-déco-Kaffeehaus gibt. Der Besitzer hatte es in den zwanziger Jahren in diesem Gründerzeit-Bau eröffnet.
Ich betrat das Café und fühlte mich sofort zu Hause. In einer gläsernen Vitrine, die als Raumteiler zwischen Tischen genutzt wurde, befand sich eine Sammlung von Kaffeehausgeschirr aus verschiedenen Epochen. Nahezu alle Plätze waren besetzt. Hier im Erdgeschoss plauderten vor allem die Älteren an den Marmortischen. Eine Gemeinschaft der Tortenesser.
Ich ging die Treppe nach oben und stieß auf ein Zwischengeschoss. Mezzanin nennt man so einen Raum in Prag oder Wien. An den Zweiertischen saßen zumeist Liebespaare. Das war unschwer an den Blicken zu erkennen oder an einer Hand, die sich über die andere gelegt hatte oder über das Haar und die Wange streichelte. Was man eben so macht auf der Insel der Seligen, die hier das Mezzanin des Glücks war.
Ein farbiges Bleiglasfenster ließ gerade durch die Sonnenstrahlen intensiv die verschiedenen Farben aufleuchten. In diesem Zwischengeschoss waren schon die Stimmen aus dem ersten Stock deutlicher zu hören. Ein Lachen drang an mein Ohr.
Am Anfang der Treppe nach oben stand auf einem Treppenpfeiler eine kleine geschnitzte Säule. Noch ein paar Stufen, das Gemurmel nahm immer mehr zu, und ich war im Allerheiligsten.
Mein Blick ging zunächst zur Stuckdecke, die florale Elemente jenes Stils zeigte. An den Wänden, als obere Begrenzung eines sechstürigen Büfetts und Umrahmung einer Nische mit diversen Spiegeln, sah ich hölzerne, dunkelbraune, geschnitzte Zierfriese. Die zweiarmigen Leuchten, die die Spiegel flankierten, und die metallenen Kronleuchter warfen ein mildes gedämpftes Licht durch die pergamentenen gefalteten Lampenschirme.
Und nun die Gäste: Die Sprachwolke dieser Gemeinschaft hüllte mich sofort ein. Ich hatte sogar schon das Gefühl, einige mich freundlich anblickende Besucher zu kennen. Dem war natürlich nicht so, aber wie oft habe ich mich in den Jahren danach dort mit Freunden oder Bekannten getroffen und wie oft habe ich neue interessante Menschen kennengelernt.
In diesem Café wurden Freundschaften geschlossen und auch so manche Liebe gestiftet.
Schon nach wenigen Wochen waren mir die Kellnerinnen vertraut. Ich scherzte und plauderte mit Christa, Renate, Traudel, Hertha und »Marlene«, die eigentlich anders hieß, aber wir nannten sie nach der Dietrich wegen ihrer schönen Beine so.
Ich gestehe, dass ich während des Studiums fast jeden Tag einige Zeit im »Conti« verbrachte. Bei 84 Pfennig für einen Kaffee konnte man sich das als Student leisten. Selbst ein Glas Wermut war erschwinglich.
So ein altes Kaffeehaus ist ein besonderer Ort. Hier hat sich die Geschichte des Landes von der Weimarer Republik bis in die Gegenwart in unzähligen Gesprächen widergespiegelt. Die Patina verweist auf die Gäste der Jahrzehnte davor. Die abgegriffene Stuhllehne. Der kleine Sprung im Marmor. Der Rauch von unzähligen Zigaretten, der sich in der grün-goldenen Stoffbespannung an der Wand festgesetzt hat.
An diesem Ort wird man unterhalten, informiert, getröstet und angeregt.
Man schätzt die Gemeinschaft, kann aber auch in der Menge das Alleinsein genießen.
Ich erlebte das Kaffeehausleben in zwei Gesellschaftsordnungen: Im Sozialismus, der nie einer war, und im Kapitalismus, der sofort einer war.
Dieses Café Continental symbolisierte letztlich einen besonderen Kontinent, dessen zeitweilige Bewohner oft das Große im Kleinen abgebildet haben.
Ich biete Ihnen die Möglichkeit, jene Menschen, die ich hier getroffen habe, nun ebenfalls kennenzulernen.
Und Sie sind natürlich mein Gast.
Der Malerstammtisch
Neben Studenten verkehrten im Conti, wie es von den Stammgästen abgekürzt wurde, vor allem viele Künstler: Vom Musiker über den Schauspieler bis zum Maler. Und natürlich auch verkrachte Typen, die auf Künstler machten. Sich also mit einem Bart, einer Pfeife und einem schwarzen Rollkragenpullover ausstatteten. Auch Lederjacken waren sehr angesagt.
Für den Maler, von dem ich Ihnen erzählen will, traf das auch zu. Wenn er die Treppe in den ersten Stock des Kaffeehauses hochkam, ließ er beim Betreten des Raumes zunächst kurz seinen Blick durch den Raum schweifen. Das hatte seinen Grund.
Er tat dies nicht aus Eitelkeit, um zu überprüfen, ob ihn vielleicht jemand erkannt hat. Und auch nicht, um zu eruieren, wo wohl seine Kollegen sitzen würden. Das wusste er seit Jahren. Auf dem rechteckigen Marmortisch in einer Ecke mit dem Polstersofa stand immer ein Reserviert-Schild.
Nein, unser Mann war nahezu täglich auf der Suche nach Modellen.
Lanzendorff, so sein Name, nutzte sein Talent, das ihm der Himmel geschenkt hatte, vor allem, um mit Frauen in Kontakt zu kommen.
Und so registrierte er beim Rundblick auf die Schnelle im Kopf: »Aha, Tisch 8 und 12 sind ja sehr interessant.« Von einer Kellnerin hatte er die Nummerierung der Tische erfahren und schnell auswendig gelernt.
Beim Vorbeigehen versuchte er schon mal einen Blick der jeweiligen Schönen zu erhaschen. Gelang der Augenkontakt, dann zeigte Lanzendorff ein charmantes Lächeln, das, so hoffte er, in der Wirkung zwischen Gary Cooper und Gérard Philipe angesiedelt war.
Letztlich ähnelte er jedoch eher einem Vorstadtcasanova.
Der Maler war nicht sehr groß, aber von ausgesprochen männlicher Statur, hatte kräftige Arme und zupackende Hände. Beides hatte er auch bei gelegentlichen Ausflügen in die Bildhauerei trainiert.
Nachdem er seine Kollegen begrüßt hatte, wurden erste Floskeln und Scherze ausgetauscht.
»Na? Habt ihr heute schon das ND gelesen? Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es sieht auf den Feldern sehr gut aus. Unsere Erntekapitäne siegen an allen Fronten!«
Die Runde am Tisch grinste.
Dann setzte er sich mit Blick in das Café, holte die Raucherutensilien aus einem abgegriffenen Ledertäschchen und stopfte sich eine Pfeife.
Die Maler trafen sich jeden Tag. Eine Handvoll Künstler bildeten den Kern.
In der Hauptsache nahmen an diesem Stammtisch Männer Platz, aber die Philosophin Susanne Pippig, eine temperamentvolle und lebenslustige Frau mit dunklem halblangem Haar, gehörte mit zum festen Stamm. Zu den sporadischen Gästen zählte die Kunstwissenschaftlerin Sieglinde Hahn. Sie kannte alle Maler der Stadt und sprach zur Eröffnung mancher Bilderausstellung. Mitunter saß auch Maria Petroff aus Bulgarien am Tisch, die lebenspralle, farbintensive Bilder malte, unverwüstliche Karo rauchte und einem Schoppen Wein nie abgeneigt war. Und schließlich gehörte zur Runde hin und wieder die ungarische Tänzerin Zsuzsa Stern. Wenn sie durch den Raum schritt oder nahezu schwebte, dann richtete sich nicht nur so manches männliche Augenpaar auf die Grazie ihres Körpers. Lanzendorff hatte Zsuzsa bei seinem Rundumblick irgendwann im Kaffeehaus entdeckt, angesprochen und sie als Modell gewonnen.
Als ein schwedischer Arzt, der zu einem Kongress in der Stadt weilte, das Bild der schönen Tänzerin in einer Verkaufsausstellung von Lanzendorff gesehen hatte, war es auf Anhieb um ihn geschehen. Er ließ sofort den roten Punkt neben das Bild kleben und bezahlte es auf der Stelle. Dann fahndete Axel Bergström nach Lanzendorff, um herauszubekommen, wie die Schöne hieß und wo sie wohnte. Bergström erreichte ihn schließlich über die Galerie am dritten Tag. Schon am Abend saß er in der Oper, um Zsuzsa auf der Bühne zu erleben, hinterließ für sie beim Pförtner eine Nachricht und bat um ein Gespräch nach der Aufführung.
Beim Treff an der Portierloge, so erzählte Lanzendorff, habe es im Raum vernehmlich geknistert. Und dieses Knistern hatte nicht mit der Folie zu tun gehabt, aus der gerade der Pförtner seinen abendlichen Imbiss wickelte.
Bergström stellte sich als Besitzer ihres Porträts vor, und Zsuzsa nahm die Einladung auf ein Glas Wein ohne lange Ziererei an. Dann lobte er die Aufführung und sie im Besonderen, hatte er sich doch extra ein Fernglas besorgt, um sie auf der Bühne im Corps de Ballet auszumachen, was ihm schließlich nach einiger Mühe auch gelang.
Der Abend bei einer Flasche Erlauer Stierblut weckte nicht nur bei der Tänzerin wegen des Weins aus ihrer Heimat besondere Gefühle, sondern zwischen der Ungarin und dem Schweden stieg der Sympathiepegel im halbstündlichen Rhythmus.
Schon ein knappes Jahr später kam Bergström wieder, und die beiden saßen in der hintersten Ecke des Conti. Die augenscheinliche Liebe zwischen ihnen konnten nur verstockte und hartherzige Menschen übersehen. Von Zsuzsa wussten wir, dass sie sich in der Folge mehrmals in Prag oder Budapest mit ihrem Axel getroffen habe. Sie übernachtete in Hotels, die sie ohne den devisenträchtigen Schweden nie kennengelernt hätte.
Inzwischen peilten sie tatsächlich ihre Hochzeit an, und es war nur eine Frage der Zeit, dass Zsuzsa im Stockholmer Corps de Ballet über die Bühne schweben würde. Und die Stammtisch-Truppe würde, das hatte sie ihnen schon versprochen, ab und an eine Hochglanz-Postkarte aus Schweden (und nicht nur von dort) herumreichen können.
So schaffte es immer wieder mal ein Paar, durch seine Liebe die sichtbaren und unsichtbaren Mauern zu überwinden. Wenn das nicht ein Beleg für die Kraft von Gefühlen war!
Der Stammtisch-Treff war für die Maler außerordentlich wichtig. Tag für Tag saß oder stand man mutterseelenallein vor der Staffelei und blickte auf das entstehende Bild. Man führte permanent nur tonlose Selbstgespräche.
Und der Mensch sehnt sich doch nach dem Austausch mit anderen.
Gestritten wurde natürlich auch, aber öfter klang dröhnendes Lachen aus dieser Ecke, vor allem dann, wenn man sich über die provinzielle Kulturpolitik des Landes oder über dogmatische Kulturfunktionäre amüsierte. Oder über die stinklangweilige Presse sowie bestimmte Sendungen des DDR-Fernsehens.
Es wurde natürlich auch mal über ein Bild eines Kollegen gelästert. Lanzendorff war allerdings immer fair. Wenn derjenige nicht am Tisch saß, verzichtete er auf Kritik. Man konnte generell mit ihm gut auskommen. Er war überhaupt nicht streitsüchtig.
Zwei der temperamentvollsten Maler am Tisch, Grambach und Mager, sollen sich als Studenten bei einem gewissen Alkoholpegel seinerzeit in die Haare geraten sein, besser in die Barthaare. Man erzählte, dass Mager Grambach plötzlich im Zorn ein brennendes Feuerzeug unter seinen stattlichen Bart gehalten habe. Der fing sofort zu brutzeln an, und ein Schwapp Bier verhinderte Schlimmeres. Die beiden hätten daraufhin eine Klopperei begonnen und wurden schließlich durch Kommilitonen getrennt.
Und nun saßen sie nach Jahren einträchtig am Tisch im Conti, und die Sache war längst vergessen.
Lanzendorff hatte inzwischen seine Pfeife in Gang gebracht, warf ab und an einen Satz in die Runde und versuchte sich größer zu machen, als er war, um Tisch 8 und 12 ins Blickfeld zu bekommen. Es machte den jungen Frauen schon Eindruck, wenn sie von ihm angesprochen wurden.
»Entschuldigen Sie, mein Name ist Lanzendorff, ich bin Professor für Malerei an der hiesigen Hochschule. Ich würde Sie sehr gern malen. Wären Sie bereit, mir Modell zu stehen?«
Welche junge Frau fühlte sich da nicht geschmeichelt?
Ein echter Professor will mich malen!
Er erzählte am Stammtisch (und alles, was dort erzählt wurde, machte die Runde), dass eine der Schönen ihm nach seiner Frage wie aus der Pistole geschossen geantwortet habe: »Gärne, aber nich naggsch!«
Von Lanzendorff weiß man, dass er sehr gern Akte malt und nichts dagegen hat, wenn seine Entdeckung auch einem anderen Akt gegenüber nicht abgeneigt ist …
Ateliers sind schließlich schon seit Jahrhunderten Brutstätten der Lust. Auf Fotos sieht man oft ein Chaiselongue oder eine andere Liege, da der Künstler angeblich mal ausruhen muss. Die verkrampfte Haltung! Der Rücken!
Mit einer Geschichte hat der Maler am Stammtisch seinerzeit den Vogel abgeschossen. Genussvoll erzählte Lanzendorff eines Tages: »Stellt euch vor, sie saß tatsächlich am Tisch 6! Ein Omen! Sex. Es war am Abend. Ich war allein hier, um noch einen Schoppen zu trinken. Eine unglaubliche Frau!«
Mit glänzenden Augen beschrieb er ihr Gesicht, ihr Haar und vor allem – die Figur. »Sie blätterte in einer ›Sybille‹. Ich sprach sie an und meinte, in diese Zeitschrift gehöre sie bei ihrem Aussehen. Sie lächelte. Ich lud sie auf ein Glas Wein ein. Es wurde eine Flasche. Für jeden! Wir redeten und scherzten. Schließlich hatten wir das Gefühl, uns schon seit Jahren zu kennen. Irgendwann kam es zu ersten Berührungen. Es war warm, aber uns wurde heiß. Außerdem hatten wir natürlich längst einen in der Krone.«
Die Maler saßen mit Gesichtern, die zeigten, dass ihre Phantasie parallel zur Geschichte lief. Und Maler haben viel Phantasie! Fast alle beugten sich leicht nach vorn.
»Längst hatten sich unter dem Tisch unsere Beine berührt, drückten sich aneinander.«
Grambach atmete hörbar aus. Mager trank sein Bier in einem Zug und hing anschließend sofort wieder an den Lippen von Lanzendorff.
»Die Atmosphäre, die Gefühle zwischen uns waren aufgeheizt. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt!«
»Und?«, fragten zwei aus der Runde.
»Die körperliche Anziehung war mit Händen zu fassen!«
Schneidereit warf ein: »Aber du konntest sie ja nicht vor allen Leuten anfassen.«
Lanzendorff nickte seinem Kollegen zu. »Dabei merkte ich, dass sie auch wollte, dass wir uns näherkommen.«
»Also, seid ihr in dein Atelier?«, schlussfolgerte Kampfer.
»Wir hatten doch noch Wein in der Flasche.«
»Scheiß auf den Wein!«, ließ sich Grambach vernehmen.
»Die Sehnsucht nach Berührung wuchs ständig.«
»Aber wo solltet ihr …?«, fragte Grambach.
»Leute«, unterbrach Lanzendorff die Frage, »das muss aber wirklich unter uns bleiben.«
»Ehrenwort. Klar. Du kennst uns doch!«
»Eben deshalb.«
»Wir halten dicht. Großes Pionierehrenwort!«
»Nun erzähl schon.«
In dem Moment trat Traudel, die Kellnerin, an den Tisch und fragte: »Na, Männer, habt ihr noch einen Wunsch?«
»Jetzt nicht!«, rief laut Grambach und winkte mit der Hand ab.
»Na, ihr seid aber heute komisch.« Kopfschüttelnd drehte sie ab.
»Also?«, fragte Mager.
»Na ja …«, sagte Lanzendorff und machte eine Kopfbewegung zur Treppe hin, »die Telefonzelle …«
Ein Orkan brach am Tisch los. »Was?! Das gibt es nicht! Das ist doch unglaublich!
Wenn das jemand gesehen hätte! Professor der Kunsthochschule knutscht in der Telefonzelle vom Conti!«
Auf halber Treppe gab es, wie schon eingangs erwähnt, ein Zwischengeschoss. Dort stand eine holzvertäfelte Telefonzelle. Über der Tür hing ein schwarzes gläsernes Schild, auf dem man in Goldbuchstaben »Fernsprecher« lesen konnte.
Grambach haute sich auf die Schenkel. »Mensch, du traust dich was!«
Lanzendorff machte eine abwehrende Bewegung: »Es war doch kurz vor Schluss, und die Kellnerinnen hatten mit der Abrechnung zu tun.«
Mager sagte: »Ich gebe einen aus« und rief nach Traudel. Sie trat an den Tisch und meinte: »Auf einmal wollt ihr wohl wieder was?«
»Eine Runde Weißen. Auch für dich einen.«
»Ihr habt wohl was zu feiern?«
»Traudel, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist!«
Lanzendorff drohte Mager, aber der machte schon eine beschwichtigende Bewegung mit beiden Händen. »Ich kann es dir nicht erzählen. Habe jemand am Tisch mein großes Pionierehrenwort gegeben.«
»Ihr seid mir schon eine Truppe.« Kopfschüttelnd lief sie Richtung Büfett.
Man muss wissen, dass in dieser Telefonzelle aus alten Zeiten das Licht anging, sobald man sie betrat. Im Boden gab es einen Kontakt.
»Mensch, wenn du dort reingehst«, fiel Kampfer ein, »geht doch das Licht an!«
Lanzendorff grinste: »Die Birne hab ich schnell noch locker gedreht.«
»Das gibt’s doch nicht!«, meinte Schneidereit und strich sich über den stattlichen Bart, »der Mann denkt an alles!«
In diesem Moment warf Grambach in die Runde, dass das darin befindliche Emailleschild »Fasse dich kurz« in dem Zusammenhang durch Lanzendorff eine völlig neue Bedeutung bekommen hat. Die Bemerkung erheiterte die Runde.
Traudel brachte die Schnäpse. Man stieß an. Die Kellnerin übte entsprechende Arbeitsdisziplin, hob nur symbolisch das Glas, stellte es wieder auf ihr Tablett, weil sich das nicht für eine Arbeitskraft schickte, im Café zu trinken.
Das tat sie dann hinter der Pendeltür in der Küche.
Mager kam noch mal auf die Flasche Wein zurück. »Aber, als ihr endlich ausgetrunken habt, bist du mit ihr in dein Atelier.«
Lanzendorff nickte.
Schneidereit resümierte. »Zum Akt malen bist du vermutlich nicht mehr gekommen.«
Der Maler lächelte versonnen. »Aber Leute, das bleibt unter uns.«
»Natürlich! Was denkst du denn?!«
Am nächsten Tag kannte das halbe Kaffeehaus die amouröse Geschichte.
Damit wäre die Sache eigentlich am Ende. Ist sie aber nicht.
Eines Tages kam Lanzendorff total geknickt an den Stammtisch. Er machte einen absolut erschöpften Eindruck. Nichts da von jenem sonst federnden Gang. Er schlich wie ein schwerkranker Mann durch das Café, ohne nach links und rechts zu gucken.
Die Maler machten sich gegenseitig auf den Herankommenden aufmerksam, und man sah tatsächlich sorgenvolle Mienen. Umständlich nahm er Platz und packte auch nicht seine Pfeife aus. Schließlich hörten die Stammtischbrüder, wie er mit nahezu tonloser Stimme sagte: »Leute, das glaubt ihr nicht, was ich euch jetzt sage …«
Allen Gesichtern war die Spannung anzusehen. Dann machte er eine Pause, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und verkündete mit strahlendem Gesicht so laut, dass es auch die angrenzenden Gäste hören konnten: »Ich werde Vater!!!«
Das Tohuwabohu, das nun am Tisch ausbrach, war garantiert bis zum Mezzanin zu hören.
Traudel eilte herbei, ob nun einige der Maler total durchgeknallt wären, aber sie wurde mit einer Bestellung von Hochprozentigem wieder zum Büfett geschickt.
»Aber, was ihr alle nicht für möglich halten würdet: Verena …«, nun erfuhren die Kumpels, wie sein Schwarm eigentlich hieß, »… und ich benehmen uns sogar sehr altmodisch und – heiraten!«
Da gab es großen Beifall, und alle ließen Verena und Lanzendorff hochleben.
Wenn es Sie interessiert, und es ist wirklich interessant, welchen Namen Lanzendorff schließlich für seine Tochter fand, dann erzähle ich Ihnen auch noch diese Geschichte.
Woher ich das alles weiß?
Schließlich saß ich ja nicht mit am Tisch. Erst nach Abschluss des Studiums durfte man dort Platz nehmen. Die Gründe sind verständlich, denn Grambach und Mager lehren an der Hochschule, und die Interna sind nicht für Ohren von Studenten bestimmt. Mit Kampfer, einem der Stammgäste, hatte ich einmal auf einer Messe gearbeitet, und von ihm kenne ich so manche Episode aus den Stammtischgesprächen.
Nun zum Namen seiner Tochter: Lanzendorff hatte eines Tags eine Eingebung und fragte seine Frau, ob sie etwas dagegen hätte, wenn sie ihre Tochter Conti nennen würden.
Sie lachte und hatte überhaupt nichts dagegen.
Der Maler wollte seiner Tochter diesen Namen zur ewigen Erinnerung an den Ort ihres Kennenlernens geben. Da rannte Lanzendorff aber in der DDR gegen eine Mauer im dafür zuständigen Amt. Die Frau blätterte in einem Verzeichnis und sagte: »Conti gibt’s nicht.«
Der Maler erzählte der etwas missmutig dreinblickenden Mittfünfzigerin im ärmellosen grauen Sackkleid vom klassischen Italien und dass dort ein berühmter Künstler eine Tochter namens Conti hätte. Dann gebe es noch eine landesweit bekannte Schlagersängerin, die ebenfalls …
»Ja, das steht aber nicht in unserem Verzeichnis. Wir sind hier im Stadtbezirk Süd und nicht in Italien. Und was nicht in unserem Verzeichnis steht, das gibt’s nicht.«
»Könnten Sie da nicht vielleicht eine Ausnahme …«
»Da könnte doch jeder kommen.«
Lanzendorff versuchte nun vorsichtig eine andere Tour. »Vielleicht kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein …?«
Die Beamtin stutzte und sah über ihre Brille. »Wie wollen Sie mir denn behilflich sein?«
»Was haben Sie denn für ein Hobby?«
Nun schaute die Frau den Maler sehr verwundert an. »Hobby? Was hat denn mein Hobby damit zu tun?«
Lanzendorff ließ nicht locker. »Na, wofür interessieren Sie sich denn besonders?«
Und nun passierte etwas mit der Amtsperson. Das Gesicht der Frau entspannte sich, sie lächelte etwas versonnen und merkte gar nicht, dass sie ihre amtliche Sprache vergaß und in ihren Dialekt verfiel. »Mir indressiern uns besonders für Daggl.«
»Dackel?«
»Daggl.«
»Aha, da sind Sie also eine echte Hundeliebhaberin.«
Nun huschte ein Schatten über ihr Gesicht. »Genau, awwer unser Lumbie, der machds nich mehr lang. Der is grangk, der arme Hund.«
Nun sah man im Gesicht von Lanzendorff eine Idee aufleuchten.
»Na … und wenn ich … Ihnen nun noch ein Bild von Ihrem Lumpi malen würde?«
Die Frau sah ihn nahezu fassungslos an. »Was?! So was gönn Sie?«
»Ich lehre als Professor an der hiesigen Hochschule.«
Die Frau am Schreibtisch war sichtlich beeindruckt. Und nun hatte sie auch ihre amtliche Sprache wiedergefunden.
»Ach hier an der … Tja, wenn das so ist …«, und nach einer kurzen Pause ließ sie vernehmen, »… also mir ist es jetzt auch so, als hätte ich den Namen Conti schon mal gehört.«
Und so kam seine Tochter doch zu ihrem besonderen Namen.
Was bei der Mutter zu erhoffen war: Conti wuchs zu einem bildhübschen Mädchen heran. Die Gene der Mutter dominierten, aber sie wollte auch Lanzendorff dominieren. Das ging nicht gut. Die Ehe der beiden hielt nur einige Jahre.
»Weißt du«, sagte er mir mal später nach meinem Studium, »ich brauche als Maler Bewegungsfreiheit. Und die Modelle halten mich jung. Und dann will ich dir noch eins sagen: Ich habe im Krieg so viel Schreckliches gesehen. Zerfetzte Körper. Tod und Verderben. Die Hölle. Ich habe mir damals geschworen, im Frieden nur noch schöne Sachen zu genießen. Und kannst du dir etwas Schöneres vorstellen als einen jungen Frauenkörper?«
Er zog an seiner Pfeife, blies eine dicke blaugraue Wolke in den Raum und murmelte vor sich hin: »Tisch 7 ist sehr verheißungsvoll …«
Prag
Wenn die Geschichte von Lanzendorff auch die Teilnehmer des Stammtisches wegen ihrer erotischen Brisanz für eine Zeit erregte, so bestimmten 1968 natürlich ganz andere, viel wichtigere Ereignisse dort die Diskussion. In diesem turbulenten Jahr war in Europa allerhand los – durch aufmüpfige Studenten in Frankreich, in der Bundesrepublik, in Polen und vor allem in der Tschechoslowakei.
1968 spielte der »Prager Frühling«, die Reformen, die aus der Kommunistischen Partei selbst kamen, als Gesprächs- und Diskussionsstoff an den Tischen im Conti die größte Rolle. Nach den Jahren des unmenschlichen Stalinismus im Ostblock sprach man in der ČSSR nunmehr von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Unglaublich!
Der Hradschin forderte den Kreml heraus.
Carola Kleinschmidt, eine Studentin der Fotografie, die ich durch die Kunsthochschule kannte und mit der ich mich angefreundet hatte, plante, mit ihrer Freundin Vera in der zweiten Augusthälfte nach Prag zu fahren. Mein Kommilitone Benno und ich waren Anfang August aus der Goldenen Stadt an der Moldau zurückgekehrt. Die beiden waren sehr interessiert, von unseren Eindrücken zu hören.
Im Sommer waren eher mal Plätze im Conti frei, weil die Menschen gern die Stühle im Freien nutzten. Wir konnten deshalb oben in einer ruhigen Ecke Platz nehmen. Carola und Vera sahen uns erwartungsvoll an.
Ich holte tief Luft: »Ich kann euch nur sagen, es ist nicht zu fassen, was sich dort abspielt. Ich habe ja Prag vor fünf Jahren zum ersten Mal gesehen. Eine großartige Stadt! Diese Bauten. Alle Stile vom Mittelalter bis zum Bauhaus. Ich habe damals unentwegt Motive in meinen Zeichenblock skizziert. Benno war jetzt zum ersten Mal dort.«
»Und ich kann nur sagen«, unterbrach mich Benno, »es war Liebe auf den ersten Blick.«
»Aber die Menschen, die Ereignisse, die Atmosphäre in diesem Jahr«, nahm ich meinen Bericht wieder auf, »das ist eine völlig andere Stadt als vor fünf Jahren. Die Tage in Prag waren von so viel Optimismus auf ein neues Leben erfüllt, dass wir zwei glaubten, an einem Scheidepunkt der Weltgeschichte zu stehen.«
Und Benno fügte an: »Ich habe noch nie so viele offene und heitere Gesichter gesehen. Um es mal etwas poetisch zu sagen … Als im Prager Frühling die Knospen platzten, wuchs parallel zum Erwachen der Natur die Hoffnung der Menschen auf ein neues Leben.«
»Wirklicher, nicht vorgegaukelter Optimismus erfüllt sie. So viel Kreativität in allen Bereichen der Gesellschaft. So viele Ideen! Benno und ich sind überzeugt, die Zukunft, wie wir sie uns mit einem reformierten Sozialismus erträumen, die wird nun Realität.«
Benno berichtete: »Wir haben da zwei tolle Typen kennengelernt … Karel und Hanna … mit denen müsst ihr euch treffen. Wir haben eine Telefonnummer.«
Ich unterbrach Benno. »Unser zweiter Tipp. Studentenklub ›Vltava‹, also Moldau. Dort müsst ihr unbedingt hin: Da sind wir auch Karel und Hanna begegnet. Das istder Treffpunkt. Tolle Musik. Viele Studenten aus der ČSSR, aus Westdeutschland, Ungarn, Holland, Polen, Hippies aus den USA und Skandinavien … und natürlich auch reichlich Leute von uns.«
»Und immer wieder sahen wir an Hemden und Jacken den Anstecker Make love, not war.«
Benno begann zu schwärmen: »Nie werde ich einen Sonnenuntergang vergessen, den ich mit Richard und solchen Typen auf der Karlsbrücke erlebte. Am Ende der Brücke, kurz vor der Kleinseite, spielte eine kleine Band Beatles-Songs und Welthits von Simon und Garfunkel, Bob Dylan und Joan Baez. Und viele sangen mit.«
»Und es wurde getanzt. Habt ihr schon mal in der DDR auf einer Brücke getanzt?«, fragte ich die beiden. Vera meinte: »Da käme doch sofort ein Vopo und würde fragen: ›Na Bürger, was machen wir denn hier auf der Brücke?!‹«
Wir lachten. Und ich konnte berichten: »Aber in Prag gab es weit und breit keinen Polizisten, der uns zur Ordnung rief.«
Carola fragte: »Gibt es denn dort so was wie unser Café Continental?«
»Na klar! Ein Besuch ist geradezu Pflicht: das Café Slavia. Da sitzen die gleichen Typen wie hier. Bloß, dass sie eben Tschechisch sprechen.«
»Und dass sie in einem Land mit viel Hoffnung leben. Ich habe ein Foto von der Demonstration am 1. Mai gesehen. Da stand nicht wie bei uns die Parteiführung auf einer Tribüne, um sich bejubeln zu lassen, sondern sie marschierte in der ersten Reihe und hatte symbolisch das Volk im wahrsten Sinne des Wortes hinter sich.«
Das Beispiel imponierte der Fotografin Carola. Nun wollte Vera wissen: »Stimmt es, dass man dort Westzeitungen kaufen kann?«
Benno und ich nickten. »Wir saßen tatsächlich im Slavia mit dem ›Spiegel‹ in der Hand.«
»Da würden sie dich hier gleich einkassieren!«, sagte Vera.
»Den Laden dafür findet ihr in einer Straße im Zentrum, die Jungmannova heißt.«
Vera schrieb sich das gleich auf.
»Und ihr müsst ins Kino!«
»Welchen Film?«
»Na ›Help‹ mit den Beatles!«
Die beiden Studentinnen gaben einen Ton des Entzückens von sich. »Den zeigen die dort?!«
»Na klar. Und die Stimmung und der Beifall im Kino, als Dubček auf der Leinwand in einer Wochenschau erschienen ist. Immer wieder Sprechchöre: ›Viva Dubček!‹«
Vera fragte nachdenklich: »Und was glaubt ihr, wie das weitergeht?«
»Ich hoffe«, meinte ich, »das macht Schule.« Und mein Freund Benno war überzeugt: »Polen, Ungarn und die DDR werden die Nächsten sein.«
Carola neigte allerdings zu Wermutstropfen. »Ich glaube nicht, dass sich das die Betonköpfe in der SU und bei uns einfach so gefallen lassen.«
»Was sollen sie denn machen?«
»Die werden sich schon was einfallen lassen.«
»Mein Schlagbaum der Hoffnung«, warf ich in die Runde, »steht jedenfalls steil nach oben. Fahrt erst mal hin und seht euch diesen Aufbruch an. Ihr müsst auch am Graben …«
»… wo ist denn der Graben, und was ist das?«, wollte Carola wissen.
»Die Straße, die vom Wenzelsplatz zum Pulverturm führt. Tschechisch: Na přikopě.«
»Sauschwer«, fand Vera, »und was ist dort am Graben?«
»Eine Art Hyde-Park. Jeder kann reden. In den warmen Sommernächten bildeten sich viele kleine Gruppen. Wir standen dort mit Leuten aus aller Welt, und die jungen Tschechen wollten wissen: Was sagt ihr zu unserem neuen Gesellschaftsmodell? Könnt ihr euch das in der DDR auch vorstellen? Und sie freuten sich über unsere Zustimmung. Als wir unser Bett im Studentenhotel ansteuerten, dämmerte bereits der Morgen.«
»Sagenhaft«, resümierte Carola.
»Die Menschen in der Tschechoslowakei sind tatsächlich auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben«, fasste Benno zusammen.
»Mitten im Sozialismus!«
Als wir auseinandergingen, verabredeten wir, dass sich die beiden nach ihrer Rückkehr bald melden, um uns ihre Erlebnisse zu erzählen.
Und dann paar Tage später dieser Schock!
Die Nachricht vom Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes am 21. August traf uns wie ein Keulenschlag.
Panzer in Prag!
Die helle Leichtigkeit des Seins stürzte ins Dunkel. Panzerkettengerassel statt Gitarrenklänge. Schüsse statt Küsse. Befehle statt Lachen. Ein friedliches Volk wurde in den Kriegszustand katapultiert. Aber nach dem Schock kam bei Tschechen und Slowaken ein unbändiger Wille zum Widerstand.
Ich sagte zu Benno: »Stell dir vor, Carola erlebt das alles mit Vera vor Ort. Hoffentlich passiert den beiden nichts, denn ich kann mir denken, dass sich Carola mit ihrem Fotoapparat weit vorwagt.«
Nachdem die beiden Prag verlassen konnten, erfuhren wir von ihnen, wie die Stunden nach der Besetzung im Einzelnen verlaufen waren. Wir trafen uns aber für ihren Bericht nicht in unserem Kaffeehaus. Bei Partei und Stasi war die Stimmung höchst gereizt. In der DDR tauchten vereinzelt Parolen an Häusern und Flugblätter gegen den Einmarsch auf. Und im Conti hielten die Spitzel Augen und Ohren offen. Deshalb verabredeten wir uns bei Carola, um vor allem ihre Fotos zu sehen. Wie viele Studenten in dieser Stadt hatte sie eine Wirtin. Eine Reihe alleinstehender Frauen, oft waren es Kriegswitwen, vermieteten ein Zimmer.
Carola legte einen Packen Bilder auf den Tisch. Sie hatte die Fotos alle selbst in der Hochschule entwickelt und abgezogen.
Es waren unglaubliche Aufnahmen von jenem 21. August 1968, also vom ersten Tag des Überfalls, und wir sahen sie in einer Mischung aus Wut, Resignation und Traurigkeit. Jedes Foto war ein einmaliges schwarz-weißes Zeitdokument. Und Carola meinte: »Ich habe schnell noch in Prag alle Filme aufgekauft, die ich bekommen konnte, und so manches Mal mit Angst, Gänsehaut und Tränen fotografiert.«
Auf einem Foto saßen zwölf sowjetische Soldaten mit Stahlhelm auf einem Panzer, in den Händen Maschinenpistolen. Die Prager betrachteten sie zornig. Und Carola steuerte aus der Erinnerung ihre Beobachtung bei: »Die jungen Russen blickten manchmal regelrecht verwirrt, verunsichert, verlegen. Manche aber auch trotzig. Sie machten nicht den Eindruck von stolzen Sowjetsoldaten. Vermutlich hatten sie erwartet, dass sie mit Blumen begrüßt würden, weil man ihnen erzählt hatte, dass man sie gerufen hatte, um zu helfen, die Konterrevolution zu besiegen. Und nun sagten ihnen Menschen mit dem Abzeichen der Kommunistischen Partei am Revers, dass sie niemand gerufen habe. Und das sagten sie ihnen in Russisch. Die verstanden die Welt nicht mehr!«
Vera erzählte uns: »Die Panzer waren nicht nur mit aufheulenden Motoren durch die Stadt gebraust, sie hatten auch geschossen. An der Fassade des Nationalmuseums sah man die Spuren.«
Ein Foto zeigte junge Männer, die Steine auf die metallenen Ungetüme warfen. Eine an sich hilflose Geste. Ich hatte sofort ein Bild aus dem Jahr 1953 vor Augen. Da warfen Ostberliner Pflastersteine auf sowjetische Panzer. Man kann sich vorstellen, dass die Steine lediglich auf dem Metall einen dumpfen Ton verursachten, aber die Insassen werden sich bei diesem Klang zumindest unwohl gefühlt haben, denn sie merkten: Wir sind hier alles andere als willkommen.
Auf einem Foto sahen wir hunderte Menschen, die sich am Denkmal des heiligen Wenzel sammelten. Auf dem Sockel des Reiterstandbildes stand in Großbuchstaben
DUBČEK HURÁ
SSSR TAHNÉTE DOMÚ
So viel konnten wir uns zusammenreimen, dass man mit dieser Losung Dubček hochleben ließ und die Russen in die UdSSR zurücksollten. »Domoi«, sagen die Russen, wenn sie nach Hause gehen. Also konnten sie das auf Tschechisch auch schnell kapieren.
So viel Bitterkeit, so viel Fassungslosigkeit, so viel Trauer in den Blicken der Menschen. Das ganze Gegenteil von jenen Gesichtern, die Benno und ich vor unserer Abreise gesehen hatten.
Wie zum Beispiel auf der Prager Burg, als Tito zu einem Solidaritätsbesuch nach Prag gekommen war und die Massen beide Politiker feierten. Die unentwegten Rufe nach Dubček führten schließlich dazu, dass sich ein Fenster auf der Burg öffnete und er den Menschen zuwinkte. Jubel über Jubel. Mir schien, die Rufe wären bis zum Wenzelsplatz zu hören gewesen.
Carola legte ein Foto nach dem anderen auf den Tisch. Vor einem großen Plakat »Filmove novinky« an einer Hauswand stieg aus einem Haufen brennender Teile eine schwarze Wolke in den Himmel. »In der Innenstadt lagen überall auf den Straßen ausgebrannte Ruinen von Omnibussen oder zerquetschten Autos, die den Panzern im Wege standen. Und es brannten auch Gebäude.« Sie zeigte uns als Beleg ein Foto, auf dem die Feuerwehrleiter bis ins vierte Stockwerk reichte.
»Kreide war der Stoff jener Tage, um den Protest schnell an die Hauswände zu schreiben. Kreide und weiße Farbe.« Und Vera fügte hinzu: »Mit Kreide haben mutige Leute auch Hakenkreuze auf Panzer gemalt. Sie stellten die Okkupanten mit den Nazis auf eine Stufe. Einer hatte ein Hakenkreuz in einen Sowjetstern gezeichnet.«
»Das war ja für das Volk auch nicht begreifbar, dass sie 1945 von den Sowjets befreit und 1968 von ihnen besetzt werden«, ergänzte ich.
Und immer wieder Menschen, die mit ernsten Gesichtern auf der Straße miteinander redeten. Ein Mann mit dunklem gewelltem Haar und großen Augen hatte völlig deprimiert seine Hände unter der Nase aneinandergelegt. Fast wie im Gebet. Carola hatte ihn als Halbfigur fotografiert. Er schaute verzweifelt: Was soll nun werden?
Dann ein Bild von einer Demonstration. Unübersehbar viele Menschen. In der ersten Reihe fünf junge Männer, die eine blutgetränkte Nationalflagge trugen. »Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da auf dem Platz plötzlich für eine Stille herrschte. Friedhofsruhe auf dem sonst quirligen Wenzelsplatz. Das ging unter die Haut. Es hatte die ersten Toten und Verletzten gegeben.«
»Ich glaube«, meinte ich, »wir brauchen jetzt erst einmal zur Dämpfung einen Schluck. Das ist ja ohne Alkohol gar nicht zu ertragen. Ich besorg uns was.«
Als ich mich gerade aufmachen wollte, sagte Carola: »Warte.« Sie verschwand in der Küche und kam blitzschnell mit einer Flasche Karlsbader Becherbitter wieder. »Die stammt noch aus dem besetzten Prag.«
Wir stießen auf den Mut der Prager an.
»Ihr müsst euch vorstellen«, begann Carola, »am 21. August, Punkt 12 Uhr, zeigte sich der Protest hörbar in der ganzen Stadt: Es heulten alle Fabriksirenen, hupten alle Autos und Omnibusse, klingelten auf sämtlichen Strecken die Straßenbahnen und läuteten alle Kirchenglocken. Wir hatten beide Tränen in den Augen … Das waren Signale des Widerstands. Die Russen blickten verunsichert in der Gegend umher, der drehbare Geschützturm mancher Panzer rotierte, weil sie fürchteten, dass dies vielleicht das Zeichen zum Aufstand und zum Angriff wäre.«
Vera ergänzte Carola, die sichtlich von dem Gesehenen noch emotional beeindruckt war. »Wir sollen euch natürlich herzlich von Karel und Hanna grüßen. Wir waren auch nach dem 21. August mit ihnen im Zentrum unterwegs. Ich ließ mir übersetzen, was die Menschen den Russen auf ihren Panzern zuriefen. Es waren die beiden wichtigsten Fragen: ›Was wollt ihr hier?!‹ und ›Warum seid ihr gekommen?!‹«
Carola erinnerte sich: »Und immer wieder die Sätze: ›Hier gibt es keine Konterrevolution!‹ Und der hundertfache Ruf junger Menschen: ›Wir wollen frei sein!‹
Damit sprachen sie jenen Satz aus, vor dem sich Breschnew und Konsorten am meisten fürchteten. Genau das sollte verhindert werden.«
»Wart ihr noch im Studentenclub Vltava?«, wollte ich wissen.
»Wir waren vor dem Einmarsch mit Karel und Hanna drin. Er wurde dann sofort geschlossen. Karel erzählte uns eine schöne Episode. Er war in einer Kneipe, als zwei Russen hereinkamen und ein Bier wollten. Da meinte der Kellner lakonisch zu ihnen: ›Trinkt euer Bier in Moskau!‹ Pause. Sie bekamen nichts. Die beiden verließen tatsächlich bedeppert das Lokal.«
Carola sprach mich direkt an: »Ich musste an dich denken, als ich an den Häusern, in den Schaufenstern am Wenzelsplatz die Karikaturen und Plakate sah. Das hätte dich und Benno besonders interessiert.« Und sie nahm aus einer Fotoschachtel entsprechende Motive, die die Okkupanten zeichnerisch verspotteten. Auf einem Bild sah man die Beine eines Mannes, der Stiefel mit dem Sowjetstern trug. Er stand auf Rollschuhen in der Form sowjetischer Panzer, und die Übersetzung lautete auf die Rollschuhe bezogen, dass »sie für Ausflüge nach Mitteleuropa geeignet wären …«.
Der feige Anschlag auf das tschechoslowakische Volk provozierte nun besondere Prager Anschläge durch die Bevölkerung. Mit Witz, Zorn und Trauer.
Und Vera legte weitere Bilder aus. Eine Zeichnung zeigte einen Panzer und darüber das Gesicht des weinenden Lenin … Carola schwärmte von der künstlerischen Kreativität des Widerstands: »Mein Eindruck war, wer in Prag zeichnen konnte, der zeichnete. Vom Schüler bis zum Professor.«
Und Vera ergänzte: »Alles, was dort im Zusammenhang mit der Besetzung satirisch aufgespießt wurde …«
»… das wurde am Abend tatsächlich aufgespießt«, vollendete Carola den Satz. Die beiden lächelten über unsere verwunderten Gesichter und klärten uns auf: »Abends nach 22 Uhr, wenn die Prager vom Wenzelsplatz verschwunden sein mussten, kamen die sowjetischen Soldaten und richteten ihre Bajonette gegen diese papiernen Zeugen, rissen alles in Fetzen.«
»Und am nächsten Tag …?«, wollten wir wissen.
»Klebten nach der Ausgangssperre noch mehr Zeichnungen, Losungen und Aufrufe!«, lachte Vera. »Darauf noch einen Becherbitter!« Sie goss ein und animierte uns zum tschechischen Trinkspruch »Na zdravi!«
Mir fiel ein: »So eine Ausgangssperre habe ich noch aus meiner Kindheit 1953 in Erinnerung. Da rollten die sowjetischen Panzer in der DDR durch einige Städte.«
»Und 1956 in Budapest«, erinnerte Benno. »Bei Strafe ihres Unterganges schaffen sie es eben nicht, ohne Panzer den sozialistischen Block bei der Stange zu halten.«
»Der Widerstand ist so originell, so kreativ«, nahm Carola wieder die Beschreibung der Situation auf, »auf Richtungsanzeigern zu Städten las man plötzlich in russischen Buchstaben MOSKAU oder ALMA ATA. Straßenschilder wurden abmontiert. Die Russen fanden sich in Prag nicht mehr zurecht.«
Vera beschrieb Namensschilder, die sie an einem Hochhaus entdeckt hatte. »Da wohnten nur noch Familien, die Dubček, Swoboda und Smrkowský hießen …«
»Ja, und wie geht das nun weiter?«, ließ sich still und nachdenklich Benno vernehmen.
»Jetzt sind alle noch im Schock. Es ist unfassbar. Und es hilft ihnen ja auch niemand. Die UNO gleich gar nicht. Klar, es gibt ein paar Protestnoten. Aber letztlich akzeptiert der Westen, dass zum Gleichgewicht des Schreckens gehört, dass die UdSSR kein Land aus dem Warschauer Pakt entlässt.«
»Aber die Hoffnung auf Freiheit ist natürlich nicht totzukriegen«, ließ sich Vera hören.
»Das wird jetzt ein paar Jahre dauern«, war meine Meinung, »aber das gärt weiter, und der Protest wird sich wieder formieren. Vielleicht kommt ja auch in einem dieser Länder irgendwann wieder ein Dubček an die Macht.«
Benno hatte die kühnste Idee: »Am besten direkt in Moskau!«
Alle lachten. Und ich kommentierte: »Na, da kannst du lange warten!«
Das Original
Es zählte bald zu meinen besonders geschätzten Gewohnheiten, dass ich vor oder nach einem Kaffeehausbesuch dem benachbarten Antiquariat einen Besuch abstattete. Einmal suchte ich ein bestimmtes Buch über Kabarett in den zwanziger Jahren. Meine Frage hatte ein älterer Herr mitbekommen, während er in einem dicken Notenband blätterte. Er schaute kurz auf und sagte in meine Richtung: »Die zwanziger Jahre … das war meine große Zeit!«
Man hörte an der Artikulation, dass er zwar Sachse war, aber umgangssprachlich den Dialekt zurücknahm.
Ich äußerte die Vermutung: »Sie haben diese Jahre noch selbst erlebt?«
Er nickte mir zu: »Oh ja! Oh ja! Ich war damals oft in Berlin. Mein Bruder lebte dort. Wir waren beide große Liebhaber der Unterhaltungskunst. Und Berlin! Was war das damals für eine Stadt! Mein lieber Kokoschinsky!
Das können Sie sich nicht vorstellen, junger Mann. Damals lebten dort fast vier Millionen Menschen. Es war nach London und New York die drittgrößte Stadt der Erde! In Berlin gab es 50 Theater … 75 kleine Bühnen … Und wenn ich an diese Revuen denke! Das größte Berliner Varieté-Theater stand in der Lutherstraße und hatte 3000 Plätze!«
Ich war verblüfft. »3000! Und wie hieß das?«
»Das war die Scala.«
»Und diese urgemütlichen kleinen Brettlbühnen. Auf einer erlebte ich zum Beispiel Valeska Gert. Haben Sie von dieser Dame jemals gehört?«
»Sicher. Sie erfand die Tanzpantomime, wurde auch Grotesktänzerin genannt, war Kabarettistin und Schauspielerin.«
Der Mann war sichtlich beeindruckt. »Für Ihr Alter wissen Sie ja allerhand! Tucholsky nannte Valeska Gert eine ›dolle Nummer‹. Und das war sie auch!
Gezá von Cziffra, Filmregisseur und einer der Experten für die Unterhaltungsbranche jener Tage, schreibt in einem Buch, dass sie reihenweise bekannte Schauspieler vernaschte.«
»Obwohl sie ja alles andere als schön war.«
Mein Gegenüber stimmte mir zu. »Das ist wohl wahr. Manche hielten ihre Tänze über Wahnsinn, Qual, Tod und Liebe für schrecklich extrem und auch mitunter sehr vulgär. Ich sah sie in langen schwarzen Strümpfen, die sie bis über das Knie gerollt hatte. Darüber war die weiße Haut ihrer Schenkel zu sehen. Damals noch sehr ungewohnt. Eine Provokation!
Im Publikum wurde gepfiffen und gebrüllt.
Es verließen auch Leute den Raum. Das störte sie alles nicht. Sie provozierte gern. Und was ihr Äußeres betrifft, da tröstete sich die Gert mit Brechts sarkastischer Bemerkung: Sie sind gar nicht hässlich, wie die anderen sagen. Im Gegenteil, in Tibet gälten Sie als Schönheit. Sie leben im falschen Land.«
Ich musste lachen: »Typisch Brecht. Sehr schlitzohrig formuliert!«
»Aber soviel ich weiß, hat sie es nicht in Tibet darauf ankommen lassen, ob sie dort tatsächlich als anerkannte Schönheit akzeptiert wurde.«
»… und lieber in Deutschland weiter Schauspieler vernascht.«
»Mein lieber Kokoschinsky!«
Diese Redewendung schien bei dem alten Herrn ein Ausdruck höchster Wertschätzung oder Verblüffung zu sein.
»Schließlich gewann sie sogar noch einen Liebhaber von Weltrang: Den großen Regisseur Eisenstein, dessen ›Panzerkreuzer Potemkin‹ bekanntlich ein Meilenstein der Filmgeschichte wurde.«
»Wie ist sie denn an den geraten?«
»Sie lernte ihn bei einem Gastspiel in Moskau kennen. Er tauchte dann plötzlich öfters in Berlin auf, hielt Vorträge, aber in Wirklichkeit ging es ihm nur um die Tänzerin Valeska Gert.«
»Und als die Nazis an die Macht kamen …«
»… da ging sie ins Exil«, vollendete der Alte meinen Satz, »Paris, London und schließlich Los Angeles. Sie war aber eine der ersten Emigranten, die ins zerstörte Deutschland zurückkam …«
»… und eine von den wenigen jüdischen, die überhaupt zurückkehrten.«
»Da haben Sie recht. Valeska Gert hat das deutsche Publikum stets sehr genau beobachtet und kam zu folgendem Urteil … Moment … es muss sich bloß noch oben in meinem Gehirnkasten zusammenrütteln … warten Sie … jetzt hab ich’s: ›Der Durchschnittsdeutsche hat wenig Selbstvertrauen. Er hält für groß, was er nicht versteht. Sich bei einem Kunstwerk zu amüsieren erscheint ihm minderwertig. Langweilen muss man sich, dann hat man etwas für seine Bildung getan.‹«
Der ältere Herr war ein wenig stolz, dass er dieses ironische Urteil der Gert noch original zitieren konnte, und sah mich etwas triumphierend an.
»Na ja, wenn ich mir das so überlege«, entgegnete ich, »an dieser Aussage ist heute auch noch was dran!«
Das bestätigte er mir mit einem Kopfnicken.
Ich hatte das starke Gefühl, dass ich mit ihm auf eine Goldader gestoßen war. Das war für mich die Gelegenheit, einen Augenzeugen befragen zu können. Ich nahm all meinen Mut zusammen und sagte: »Ich interessiere mich sehr für diese Jahre auf den Kleinkunst-Bühnen, vor allem für Kabarett. Hätten Sie etwas Zeit? Dürfte ich Sie auf einen Kaffee ins Continental einladen?«
Er überlegte nur kurz. »Warum nicht – die Noten kann ich dann auch noch kaufen. Wenn Sie sich dafür interessieren – da sind Sie tatsächlich an den richtigen Mann geraten. Was machen Sie denn beruflich?«
»Ich bin Student …«
Er reagierte verblüfft: »… und da wollen Sie mir einen Kaffee ausgeben?! Das machen wir lieber andersrum.«
»Ich habe gerade auf einer Messe gearbeitet und gut verdient und bitte Sie, meine Einladung anzunehmen.«
Er machte ein überraschtes Gesicht. »Das ist mir noch nicht passiert, dass mir ein Student einen ausgibt! Was studieren Sie denn?«
»Ich bin an der Kunsthochschule. Malerei und Grafik. Mein Name ist übrigens Richard Dumont …«
»… wenn das kein toller Name für einen Maler ist! Passt aber auch für einen Chansonnier!«
»Da hätte ich auch nichts dagegen! Den Namen Dumont gibt es aber in Frankreich oft.«
Mein Gesprächspartner stimmte zu. »Ich weiß, ich weiß, er heißt ja so viel wie am oder vom Berg.«
»Genau.«
»Und Ihre Vorfahren waren vermutlich Hugenotten?«
»Väterlicherseits. Man sagt, dass es in Deutschland etwa eine Million Menschen gibt, die Nachfahren der Hugenotten sind!«
»So viele!« Der ältere Mann atmete tief durch. »Was weiß heutzutage schon ein junger DDR-Bürger von den Hugenotten – nichts! Reineweg gar nichts.«
»Bei den Alten wird es auch nicht viel besser sein …« Er winkte ab. »Etwas schon, etwas schon … Hugenotten, französisch Huguenots, ist ja eigentlich ein Spottname, eine Verstümmelung des französischen Wortes für Eidgenossen – eignots. Sie waren Protestanten, schlugen sich tapfer in Glaubenskriegen.« Er zeigte mit seinem Arm in die Höhe und wackelte mit der rechten Hand: »Ich nenne nur die legendäre Bartholomäusnacht …«
»Genau. In dieser Nacht wurden tausende Hugenotten in Paris und in der Provinz getötet.«
»Mein lieber Kokoschinsky! …« Er schüttelte den Kopf. »Schrecklich! Schrecklich! Immer wieder gibt es in der Geschichte dieses sinnlose Töten und nur, weil jemand einen anderen Glauben hat … Nicht zu fassen! … Die Hugenotten erhielten ja erst Glaubensfreiheit durch Heinrich IV. im Edikt von Nantes, aber Ludwig XIV.