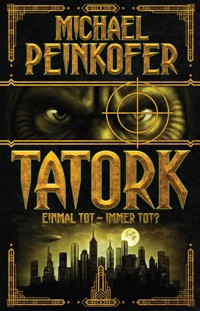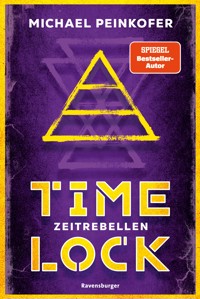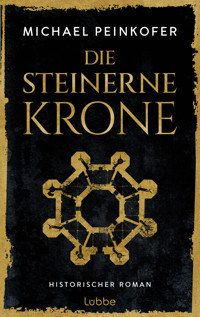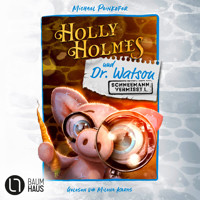5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein sagenumwobener Orden, der Orden der Unsichtbaren, strebt nach der Weltherrschaft. Nur eine kleine Anzahl Menschen hat den Mut, sich seinen finsteren Machenschaften in den Weg zu stellen, allen voran die Historikerin Alexandra Lessing und ihr Freund Ismael. Während sie in Afrika eines der grausamsten Geheimnisse des Ordens aufdecken, liefern sie sich eine erbitterte Schlacht mit ihren Gegnern. Dabei geht es um nichts weniger als die Rettung der Menschheit – und um das Leben von Alexandras und Ismaels ungeborenem Kind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-98343-3
Mai 2017
Die »Invisibilis«-Reihe ist ursprünglich unter Michael Peinkofers Pseudonym Marc van Allen bei den Ullstein Buchverlagen erschienen.
© der Originalausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010
© dieser Ausgabe: Piper Fahrenheit, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: agsandrew_shutterstock
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Die Eigenschaft der Unsichtbarkeit ist nur für zwei Dinge gut: um unbemerkt zu fliehen oder sich unbemerkt zu nähern. Also eignet sie sich hervorragend, um zu töten …«
H. G. Wells, Der Unsichtbare
»Nehmen wir einmal an, es gäbe zwei von diesen Ringen, die unsichtbar machen – einen, der von einer moralisch guten Person, und einen anderen, der von einer unmoralischen Person getragen wird. Dann wären beide Personen unsichtbar, und niemand könnte die moralisch gute Person von der moralisch schlechten Person unterscheiden …«
Plato, Über den Staat, 2. Buch
Prolog
Flucht …
Der Gedanke war so ausgeprägt, so beherrschend, dass er ihr Bewusstsein ganz ausfüllte und alles andere verdrängte: die Furcht, die Erschöpfung, die Benommenheit, Hunger und Durst. Sogar den Schmerz.
Wankend setzte Zaynah einen Fuß vor den anderen, obwohl ihre Kräfte kaum dazu ausreichten, während sie beide Hände auf den schmerzenden, blutenden Unterleib presste. Sie konnte das Blut fühlen, das den Stoff des OP-Lakens tränkte und warm und dünnflüssig zwischen ihren Fingern hindurchsickerte, aber sie zwang sich, nicht hinzusehen. Stattdessen lief sie weiter, immer weiter, verfolgt von den sengenden Strahlen der Sonne und von dem bedrohlich brummenden Geräusch, das sich rasch näherte.
»Sie kommen, sie kommen«, schrie die junge Frau, die neben ihr über den steinigen Boden stolperte und deren Namen sie nicht einmal kannte. Sie wusste nur, dass sie ein Opfer war wie sie selbst, mit kahl geschorenem Schädel, unbekleidet bis auf einen Fetzen blutbesudelten Stoffs, den sie Schutz suchend an sich presste, und von nackter Angst gezeichnet. Sie waren beide erwacht, nur um festzustellen, dass die Wirklichkeit schlimmer war, als jeder Alptraum es hätte sein können, und ihre erste und einzige Reaktion war Flucht gewesen …
Atemlos rannten sie weiter, achteten kaum auf die spitzen Steine, die ihnen die Fußsohle zerschnitten. Sie wollten nur fort, weg von diesem fürchterlichen Ort und dem, was man ihnen angetan hatte – aber das Motorengeräusch, das sich unaufhaltsam näherte, machte ihnen klar, dass ihre Flucht wohl scheitern würde.
»Wir … müssen uns … trennen«, stieß die andere Frau keuchend hervor.
»Nein!«, flehte Zaynah. »Bitte nicht …«
»Auf diese Weise … vielleicht nur eine von uns finden …«
Zaynahs Instinkte drängten sie dazu zu widersprechen, aber ihr Verstand sagte ihr, dass ihre Gefährtin recht hatte. Sich zu trennen, erhöhte die Chancen zu entkommen.
Zu überleben …
Es blieb keine Zeit, sich zu verabschieden oder gegenseitig Glück zu wünschen – der Feind war ihnen auf den Fersen, jene erbarmungslosen Dämonen, die sie aus der Geborgenheit ihrer Dörfer und ihrer Familien gerissen und an jenen schaurigen Ort gebracht hatten. Mit einem kurzen Blick verständigten sich die beiden jungen Frauen, dann wandte sich jede in eine andere Richtung.
Zaynah lief, so schnell ihre kraftlosen, dünnen Beine sie trugen. Mehrmals kam sie zu Fall, schlug sich Kinn und Wangen blutig, aber die Erinnerung an das, was sie gesehen und erlebt hatte, brachte sie trotz ihrer Erschöpfung und der Schmerzen dazu, sich wieder aufzuraffen und weiterzulaufen. Der blutbefleckte Stoff, den sie um sich geschlungen hatte, zerriss dabei, und sie warf ihn von sich, floh nackt vor ihren erbarmungslosen Häschern. Mit keuchendem Atem und von Furcht getrieben, rannte sie einen von Felsbrocken übersäten Hang hinab, auf der verzweifelten Suche nach einem Versteck. Das Motorengeräusch wurde lauter. Einem plötzlichen Drang gehorchend, flüchtete sich Zaynah hinter einen großen Felsblock, ungeachtet des dornigen Gebüschs, das ihn umgab – und das keinen Augenblick zu früh!
Das Brummen verstärkte sich, und während sich die junge Frau an den staubigen, von der Sonne des Tages aufgeheizten Fels presste, konnte sie aus dem Augenwinkel etwas wahrnehmen, das pfeilschnell über den Hügelkamm geschossen kam.
Ein offener Geländewagen, voll besetzt mit Bewaffneten …
Sie konnte ihre Rufe hören, ihr aufgeregtes Geschrei, als sie etwas entdeckten. Das Motorengeräusch veränderte sich während der Jeep seine Fahrt verlangsamte und in eine andere Richtung fuhr. Und plötzlich hörte Zaynah etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ: den spitzen Schrei einer jungen Frau.
Ihre Gefährtin war entdeckt worden!
Zaynah hielt den Atem an.
Das Geräusch des Motors verstummte. Das Fahrzeug hatte angehalten. Stille folgte, die Zaynah an jenen grässlichen Ort erinnerte, von dem sie geflohen war. Sie begann zu zittern. Trotz der Wärme, die der Fels abstrahlte, fror sie erbärmlich, und der Schmerz wurde so stark, dass sie das Gefühl hatte, etwas würde ihre Leibesmitte zerreißen. Die Sinne drohten ihr zu schwinden, aber sie hielt sich eisern aufrecht.
Dann folgte ein Knall, der die Stille über dem Grenzland zerriss und von den umliegenden Felsen dutzendfach zurückgeworfen wurde – und ohne dass Zaynah gesehen hätte, was geschehen war, wusste sie, dass sie nun allein war.
Ihr Atem ging schnell und heftig, und ihr wurde schwarz vor Augen. Erneut wollte sie fortlaufen, aber es gelang ihr nicht mehr. Sie geriet ins Taumeln und verlor das Gleichgewicht, landete inmitten des Dornengestrüpps, das ihre Haut zerkratzte – und ihr das Leben rettete.
Denn just in diesem Moment heulte der Motor wieder auf, und eine Staubwolke war zu sehen. Einen Herzschlag später kam der Jeep hinter einem Fels hervor. Die Kerle, die darin saßen – fünf Männer in Tarnanzügen, die mit Gewehren bewaffnet waren –, blickten sich suchend um.
Zaynah hielt den Atem an und bewegte sich keinen Millimeter – nicht, weil ihr Verstand ihr dazu riet, sondern weil sie vor Furcht unfähig war, sich zu bewegen. Durch das Gestrüpp konnte sie sehen, wie der Wagen abermals seine Fahrt verlangsamte und einer der Kerle, die auf den Rückbänken kauerten, aufstand und in ihre Richtung blickte.
Entsetzen ergriff von Zaynah Besitz, und alles in ihr drängte sie dazu, sich zu erkennen zu geben und auf die Gnade ihrer Häscher zu hoffen. Aber schon im nächsten Moment ließ sich der Mann wieder fallen. Mit heiserer Stimme rief er dem Fahrer etwas zu – und der Geländewagen entfernte sich, umhüllt von einer Staubwolke.
Zaynah regte sich noch immer nicht.
Erst als der Jeep hinter dem Hügelkamm verschwunden und der Motorenlärm in der Ferne verklungen war, wagte sie sich zu erheben. Die Sonne war inzwischen untergegangen, ein blutrotes Band säumte den westlichen Horizont. Geschwächt und kraftlos, wie sie war, setzte die junge Frau ihre Flucht fort, um jenem grauenvollen Los zu entrinnen, das die dämonischen Schatten ihr zugedacht hatten.
Teil I:
Resolutio
1.
Eine Erfindung, deren Bekanntwerden die Welt in ihren Grundfesten erschüttern würde … Eine geheime Organisation, die nach der Weltherrschaft strebt … Ein Krieg, der im Verborgenen geführt wird, vom Rest der Menschheit unbemerkt …
Hätte man mir in jungen Jahren von diesen Dingen erzählt, hätte ich gesagt, dass da jemand über zu viel Phantasie verfügt. Doch die beiden zurückliegenden Jahrzehnte meines Lebens haben mich eines Besseren belehrt.
Jene bahnbrechende Erfindung wurde tatsächlich gemacht, jene geheime Organisation existiert – und jener Krieg tobt tatsächlich und fordert Opfer, Tag für Tag, vor den Augen der Weltöffentlichkeit verborgen.
Unsichtbar …
Ich maße mir nicht an, die Geschichte des Ordens in allen Einzelheiten zu kennen. Doch ich weiß, dass sie wirklich unter uns weilen – jene, für die die Gesetze der optischen Physik keine Gültigkeit haben, weil etwas, das als »molekulare Oszillation« bezeichnet wird, sie der Wahrnehmung durch das bloße menschliche Auge entzieht. Der alte Menschheitstraum, über den Plato nur philosophieren und Herbert George Wells nur spekulieren konnte, ist für sie Wirklichkeit geworden.
Doch wie sich zeigte, ist der Preis dafür zu hoch gewesen, und alle Bedenken, die jemals über die Gabe der Unsichtbarkeit geäußert wurden, haben sich als wahr erwiesen. So vieles, woran wir uns klammern, die Errungenschaften unserer vermeintlich fortschrittlichen Zivilisation, beruhen auf dem Prinzip des äußerlich Wahrnehmbaren, und dies gilt umso mehr für unsere von optischen Einflüssen geprägte moderne Welt. Eine Naturkatastrophe, die nicht im Fernsehen gezeigt wird, existiert praktisch nicht; eine Hungersnot, zu deren Linderung nicht weltweit zu Spenden aufgerufen wird, wird nicht wahrgenommen; ein Präsidentschaftskandidat, dessen Erscheinungsbild nicht der Norm entspricht, wird nicht gewählt; Umweltschutz schließlich wird erst dann zum Thema, wenn die Folgen ökologischen Raubbaus unübersehbar sind.
Aus diesem Prinzip zieht die Unsichtbarkeit Nutzen: Ein Verbrechen, für das es keine Zeugen gibt, wird nicht geahndet; ein Feind, den man nicht sieht, wird nicht bekämpft; eine Macht, die aus dem Verborgenen heraus die Fäden zieht, wird nicht aufgespürt. Diese Erkenntnisse waren es, die Forscher daran arbeiten ließen, eine Technik zu entwickeln, die Mensch und Material der optischen Wahrnehmung entzieht.
Unter dem Codenamen »Laurin« verschrieb sich eine Gruppe deutscher Wissenschaftler in den Dreißigerjahren dem Ziel, eine Armee unsichtbarer Kämpfer ins Leben zu rufen, die im Dienst des Dritten Reichs die alliierten Gegner das Fürchten lehren sollten. Die Forschungen jedoch kamen nur langsam voran, und es beschämt mich zutiefst, dass es meine amerikanischen Landsleute waren, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Wissensstand der Nazis angeeignet und ihre Untersuchungen fortgesetzt haben.
Der Name des Projekts wurde in »Gyges« geändert, das ehrgeizige Ziel jedoch blieb – und schließlich waren die Bemühungen von Erfolg gekrönt. Während die Bestrebungen, Waffen und anderes anorganisches Material unsichtbar zu machen, nach unzähligen Fehlversuchen aufgegeben wurden, gelang es, Menschen aus dem sichtbaren Spektrum auszugliedern, indem man die Moleküle ihres Körpers durch intensive Bestrahlung in einen Zustand beständiger Oszillation versetzte. Der Preis, den die Probanden für diesen Erfolg zahlten, war allerdings hoch, denn die Bestrahlung führte zu schweren körperlichen Schäden und grauenvollen Entstellungen, so dass nur dreizehn der jungen Militärangehörigen, die sich freiwillig für diese Versuche meldeten, die Prozedur überlebten. Sie wurden die »Grauen«, die Unsichtbaren der ersten Generation.
Noch während sie im Zuge des Kalten Krieges als Agenten eingesetzt sowie für verdeckte militärische Operationen in Korea herangezogen wurden, gelang es den Wissenschaftlern, eine zweite Generation von Unsichtbaren ins Leben zu rufen, die besser ausgebildet und vorbereitet war und keine physischen Beeinträchtigungen mehr durch die Bestrahlung erlitt. Während sich die invisibiles der ersten Generation lediglich aus Männern rekrutierten, kamen nun Agenten beiderlei Geschlechts zum Einsatz, und es entstand, womit niemand gerechnet hatte: eine dritte Generation von Unsichtbaren, die bereits im Zustand der Oszillation zur Welt kamen; auf eine Weise, die sich die Wissenschaft nicht erklären konnte, hatte die Bestrahlung das Genmaterial der zweiten Generation beeinflusst und so für die Entstehung eines neuen Menschentypus gesorgt – des homo invisibilis.
Während die Wissenschaftler von einer Sensation sprachen und Geheimdienstler und Militärs lediglich den Nutzen sahen, der sich aus dieser unerwarteten Entwicklung ergab, stellten die Unsichtbaren der dritten Generation für die Grauen den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution dar, und in konsequenter Verfechtung der Darwin’schen Lehre erhoben sie die Interessen des homo invisibilis über jene des homo sapiens. Was mit einzelnen Insubordinationen und Befehlsverweigerungen begann, wurde schließlich zu einem so umfassenden Problem, dass sich CIA und Streitkräfte außerstande sahen, weiter auf unsichtbare Agenten zu setzen. Projekt Gyges wurde für beendet erklärt – die Unsichtbaren jedoch blieben.
Unter Führung der dreizehn Grauen schlossen sie sich zu einer eigenen Organisation zusammen, dem ordo invisibilium, und verlangten von der Regierung Kompensation für ihre Dienste und die Opfer, die sie gebracht hatten. Anfangs wurde diesem Ersuchen nachgegeben, aber mit jeder Forderung, die man erfüllte, erwuchsen zwei neue. Als Präsident Kennedy dem Treiben der Unsichtbaren ein Ende setzen wollte, stellte der Orden erstmals das Ausmaß seiner Möglichkeiten unter Beweis – in Dallas, am 22. November des Jahres 1963.
Unter der Nixon-Administration wurde schließlich der Invisible Balance Act unterzeichnet, ein Schriftstück, das die Regierung vor weiteren Forderungen des Ordens schützen sollte, indem es den Grauen weitgehende Freiheiten einräumte und ihnen Grundstücke und Immobilien aus Staatsbesitz überschrieb. Der Vertrag war jedoch das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben war – denn obgleich es in der Folge keine offiziellen Kontakte zwischen der US-Regierung und dem Orden der Unsichtbaren mehr gab, haben die Grauen niemals aufgehört, Forderungen zu stellen.
Sie wanderten in den Untergrund und formierten sich neu, und ihre Gier wuchs ins Unermessliche. Von einem verborgenen Hauptquartier aus ziehen sie die Fäden und beeinflussen die Weltpolitik, inszenieren Kriege und Hungersnöte, wenn es ihren Zwecken dient. All dies jedoch ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was die Menschheit erwartet, wenn der Orden erst sein ultimatives Ziel verwirklicht hat: die Herrschaft des homo invisibilis. Bar aller Skrupel oder moralischen Bedenken trachten die Grauen danach, die Weltherrschaft zu erlangen, und die Zahl derer, die ihnen sowohl in der sichtbaren als auch in der unsichtbaren Welt zu Gebote stehen, ist unüberschaubar.
Nur eine kleine Anzahl Aufrechter gibt es, die von der Verschwörung wissen und sich ihr entgegenstellen: Unsichtbare der dritten Generation, die an höhere Werte und Ideale glauben und sich vom Orden losgesagt haben; und einzelne, mutige Vertreter der sichtbaren Welt, die die Augen nicht länger vor der Wirklichkeit verschließen wollen oder können. Mancher von ihnen hat den Kampf gegen den Orden mit dem Leben bezahlt – doch nun endlich scheint dieser Kampf Früchte zu tragen. Nachdem es uns gelungen ist, den Anschlag zu vereiteln, den der Orden in New York verüben wollte, sind wir am buchstäblichen Ende der Welt auf Hinweise gestoßen, die es uns ermöglichen werden, die Existenz der Unsichtbaren aller Welt zu beweisen – und damit den Orden seiner mächtigsten Waffe zu berauben.
Der Ignoranz …
Amazonasdschungel
80 km nordwestlich von Manaus
18 Uhr 27 Ortszeit
Sie kamen.
Sechzehn Gestalten, die sich ebenso lautlos wie geschmeidig durch das dunkelnde Dickicht des Dschungels bewegten. Das gefleckte Grün ihrer Tarnanzüge verschmolz mit der Umgebung und ließ sie nahezu unsichtbar werden – anders als jene, die ihnen folgten und deren Körper für das menschliche Auge tatsächlich nicht wahrnehmbar waren.
Demons …
Killer, die in den Diensten des Ordens standen und darauf trainiert waren, erbarmungslos zu töten.
Der Befehl, den man dem Kommandotrupp erteilt hatte, war einfach: suchen – und zerstören.
Die Ausrüstung der Killer reichte von Kevlarwesten über Infrarotsichtgeräte bis hin zu mit Laserzielvorrichtung ausgestatteten Maschinenpistolen des deutschen Typs HK7 A1.
Der Feind sollte keine Chance bekommen.
Nicht dieses Mal …
Es galt, dem Peilsignal zu folgen, das die Kämpfer geradewegs dorthin führte, wo sich die feindliche Expedition aufhielt. Den Gegner auszuschalten und jede Spur seiner Anwesenheit zu beseitigen, würde die Aufgabe der sichtbaren Kämpfer sein. Ihre unsichtbaren Begleiter jedoch, die ihnen wie Schatten folgten und nur im Display der Wärmesichtgeräte als leuchtende Schemen wahrzunehmen waren, hatten eine weitere, noch wichtigere Aufgabe …
»Zielansprache«, erstattete der Anführer der sichtbaren Kämpfer flüsternd Bericht. »Noch achthundert Meter.«
»Sehr gut«, zischte es aus der Dunkelheit zurück. »Bei Feindkontakt sofort das Feuer eröffnen. Wir machen keine Gefangenen, Commander, von zwei Ausnahmen abgesehen.«
»Verstanden.«
»Ich wünsche, dass keiner von ihnen am Leben bleibt. Die Frau und das Kind allerdings werden Sie uns überlassen. Haben Sie verstanden?«
Der Truppführer war ein altgedienter Kämpfer. Seine Ausbildung hatte er in jungen Jahren bei der Legion Etrangère absolviert, danach hatte er sich überall auf der Welt als Söldner verdingt. In diesem Moment jedoch spürte er, wie ihm Furcht die Kehle zuschnürte und ihn trotz der feuchten Hitze, die unter dem dichten Blätterdach herrschte, ein eisig kalter Schauer durchlief.
»Natürlich, Ma’am«, hörte er sich selbst sagen.
»Gut so«, hauchte es zurück. »Denn der Orden will die beiden lebend, und der Wille des Ordens ist Gesetz …«
Unterirdisches Bunkersystem
1,2 km nördlich des Basislagers
18 Uhr 34 Ortszeit
Zu behaupten, dass Alexandra Lessing fassungslos war, wurde der Lage nicht im Ansatz gerecht.
Zum einen hatte sie erst vor wenigen Augenblicken erfahren, dass das geheimnisvolle Oberhaupt des Widerstands kein anderer als ihr Vater war, der ihre Mutter und sie verlassen hatte, als sie noch fast ein Kind gewesen war.
Kenneth Bowder – oder »Oberon«, wie er sich nannte – war als Sergeant der U. S. Army in Deutschland stationiert gewesen, wo er Alex’ Mutter kennen und angeblich auch lieben gelernt hatte. Geheiratet hatte er sie allerdings nie, und eines Tages war er verschwunden, ohne ein Wort des Abschieds oder auch nur eine Nachricht zu hinterlassen. Alexandra hatte lange gebraucht, um über diesen Verlust hinwegzukommen, aber irgendwann war es ihr doch gelungen. Sich dem Urheber ihres Schmerzes nun plötzlich gegenüberzusehen, war an sich schon bestürzend genug – was ihr Vater ihr jedoch berichtet hatte, war so schockierend, dass Alex noch immer nicht wusste, worüber sie mehr entsetzt sein sollte: über die Tatsache, dass jener Mann vor ihr stand, den sie mehr hasste als jeden anderen; oder darüber, dass sie nun wusste, woher die Unsichtbaren kamen, was ihr Ursprung und ihre Vergangenheit war – und in gewisser Weise auch ihre Zukunft …
Innerlich bebend blickte sie an dem riesenhaften Gebilde empor, das sich in der unterirdischen Höhle erhob und dessen tatsächliche Abmessungen im Halbdunkel der Taschenlampen mehr zu erahnen denn wirklich festzustellen waren – zwei Reihen gebogener, sich nach oben verjüngender Stahlpfeiler, die einander gegenüberstanden und ein bizarres Spalier bildeten, das wie der skelettierte Rumpf eines riesigen metallenen Untiers aussah. Wozu genau die unzähligen technischen Apparaturen gut waren, mit denen die Pfeiler versehen waren, vermochte Alex nicht zu sagen; aber sie wusste inzwischen, was einst der Zweck dieses ungeheuren Gebildes gewesen war, und das war abenteuerlich genug.
Es war eine Zeitmaschine …
Eine Apparatur, die dazu in der Lage gewesen war, ein künstliches Wurmloch zu erzeugen, also eine Verbindung, die Zeit und Raum zu überbrücken vermochte, genau wie Albert Einstein und Nathan Rosen sie 1935 in konsequenter Weiterführung der Relativitätstheorie postuliert hatten – natürlich ohne zu ahnen, dass es solche Brücken in die Vergangenheit längst gegeben hatte. Oder hatten Einstein und Rosen irgendwie davon erfahren und lediglich nach einer wissenschaftlichen Erklärung dafür gesucht?
Alex war verwirrt. Vergangenheit und Zukunft, Ursache und Wirkung waren nicht mehr voneinander zu unterscheiden, wenn die zeitliche Abfolge in Frage stand – und genau das war der Fall. Unzählige Male hatte sich Alex in den zurückliegenden Monaten gefragt, woher die erstaunliche Technik stammen mochte, mit deren Hilfe es deutschen und amerikanischen Wissenschaftlern in den Vierzigerjahren gelungen war, Menschen mittels Bestrahlung unsichtbar zu machen.
Die Zeitmaschine barg die Antwort.
Die Unsichtbarkeitstechnologie war aus der Zukunft gekommen, durch Menschen, die eines noch fernen Tages das Geheimnis der Zeit entschlüsseln und lernen würden, ihre Grenzen zu überschreiten. Sie würden ausgedehnte Reisen in die Vergangenheit unternehmen, um die Geschichte der Menschheit zu erforschen, und um nicht Gefahr zu laufen, dabei entdeckt zu werden, würden sie sich einer Methode bedienen, die es ihnen erlaubte, sich ungesehen unter den Menschen der Vergangenheit zu bewegen. Ihre Selbstüberschätzung und Hybris würde jedoch dazu führen, dass sie die Vergangenheit mehr und mehr als Experimentierfeld betrachteten, und es würde einige unter ihnen geben, für die die Geschichte nichts anderes sein würde als ein riesiges Versuchslabor und die Menschen vergangener Zeit die Ratten darin. Sie würden verborgene Stützpunkte wie diesen errichten, würden sich als Götter verehren lassen und die Entstehung ganzer Zivilisationen veranlassen, nur um sie anschließend wieder untergehen zu lassen – begrenzte Experimente, um den Fortgang der Geschichte und damit die eigene Existenz nicht zu gefährden. Kulturen wie die minoische im alten Griechenland oder jene der Anasazi im Südwesten der USA waren auf diese Weise entstanden – oder eben jene versunkene Zivilisation, der Alexandra und der italienische Archäologe Paolo Genaro im brasilianischen Regenwald nachgespürt hatten. Das »Fiorino-Traktat«, die Aufzeichnungen eines mittelalterlichen Gelehrten, der von der Existenz der Unsichtbaren offenbar Kenntnis gehabt hatte, hatte Alex und ihre Begleiter an diesen Ort geführt – doch niemals hätte sie geglaubt, etwas Derartiges vorzufinden.
Nachdem sie erfahren hatte, dass Unsichtbarkeit keine bloße Phantasterei war und es zudem eine Organisation ruchloser Verschwörer gab, die nach der Weltherrschaft trachtete, hatte sie geglaubt, dass sie nichts mehr würde erschüttern können. Die Zeitmaschine allerdings war eine weitere Ungeheuerlichkeit, die Alex erst einmal verdauen musste, obgleich sie andererseits auch vieles erklärte. Nicht nur, woher die Unsichtbarkeitstechnik gekommen war, sondern auch, weshalb es im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder versteckte Hinweise auf die invisibiles gegeben hatte. Und weshalb der Orden alles daransetzte, dies zu verheimlichen.
Im Jahr 1908 hatte sich nahe des sibirischen Flusses Tunguska eine Explosion von geradezu apokalyptischen Ausmaßen ereignet, über deren Ursache bis zum heutigen Tag gerätselt wurde. Die offizielle Forschung favorisierte einen Kometeneinschlag als wohl plausibelste Begründung – die Wahrheit war weit bestürzender.
In Wirklichkeit nämlich hatte die vorerst letzte Zeitreise in das Jahr 1908 geführt – und in einer Katastrophe geendet. Das Wurmloch war kollabiert, die Zeitreisenden aus der Zukunft getötet worden bis auf zwei. Einer der Überlebenden war von einer Expedition deutscher Geologen aufgefunden worden, die dadurch von der Existenz der Unsichtbarkeitstechnik erfuhren – und so war die Saat ausgebracht worden für eine unheilvolle Entwicklung. Denn nachdem in den zwanziger Jahren die Grundlagen der Strahlenforschung entwickelt worden waren, begannen die Nazis in geheimen Kammern nach dem Prinzip der Unsichtbarkeit zu suchen – und hier schloss sich der Kreis mit dem, was Alex als gesicherte Geschichte kannte.
Obwohl eine Gruppe von Wissenschaftlern im Auftrag der Wehrmacht mit Verbissenheit versucht hatte, das Rätsel der Unsichtbarkeit zu entschlüsseln, war es ihnen bis Kriegsende nicht gelungen. In den streng geheimen Forschungslaboratorien des US-Militärs jedoch erzielte man drei Jahre nach Kriegsende den Durchbruch – der Beginn einer neuen Zeitrechnung und in gewisser Weise auch die Geburtsstunde des Ordens …
»Begreifst du jetzt, wie alles zusammenhängt?«
Alex hatte sich noch immer nicht an die Stimme ihres Vaters gewöhnt. Kenneth Bowder war ein gutes Stück älter als in ihrer Erinnerung. Seine Gestalt war hager, sein Gesicht von Falten gezeichnet, das militärisch kurz geschnittene Haar schütter und grau. Aber in seinem Blick und an dem Lächeln, das um seine blassen Züge spielte, erkannte Alex noch genug von dem Mann, den sie einst über alles geliebt hatte, um einen schmerzhaften Stich zu verspüren, wenn sie ihn ansah.
»Ja«, versicherte sie, obwohl es zur Hälfte gelogen war. Von »begreifen« konnte keine Rede sein. Sie hatte Fakten geschildert bekommen und sie sich eingeprägt, ein wenig wie ein Schüler, der mathematische Formeln für eine Prüfung paukte, ohne deren Prinzip zu verstehen – und so kam sie sich auch vor. Alex konnte nicht anders, als sich angesichts der jüngsten Enthüllungen getäuscht und übergangen zu fühlen, und das wollte sie ihren Vater spüren lassen. »Ich erkenne jetzt, wie alles zusammenhängt. Nur dich verstehe ich nicht.«
»Wer könnte dir das verdenken, Tochter«, entgegnete Bowder mit einem entschuldigenden Lächeln und wandte sich Genaro zu, dessen Digicam im Abstand weniger Sekunden blitzte und das Riesenskelett unheimlich beleuchtete. »Sehen Sie zu, dass Sie die Pylonen draufkriegen, Doktor. Und auch den Generator. Je mehr wir den Menschen davon zeigen können, desto besser.«
»Du willst damit also wirklich an die Öffentlichkeit gehen?«, fragte Alex. »Glaubst du denn, die Menschen werden einer derart haarsträubenden Geschichte Glauben schenken?«
»Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben«, war ihr Vater überzeugt, »denn wir werden diesen Ort so ausführlich und umfassend wie nur irgend möglich dokumentieren.«
»Dennoch wird es Zweifler geben.«
»Die gibt es immer.« Bowder grinste freudlos. »Es gibt auch Menschen, die bis zum heutigen Tag nicht wahrhaben wollen, dass die Mondlandung wirklich stattgefunden hat.«
»Welche Mondlandung?«, fragte Alex bissig.
»Schön«, meinte ihr Vater. »Deinen Humor hast du offenbar nicht verloren.«
»Nein«, gab sie zu, »und meinen Verstand ebenfalls nicht, auch wenn es alles andere als leicht gewesen ist. Weißt du, was ich in den letzten Wochen und Monaten durchgemacht habe?«
»Allerdings«, entgegnete er unumwunden, »denn all das habe auch ich durchlebt. Aber es wird ein Ende haben, wenn es uns gelingt, all dies hier« – er machte eine ausladende Bewegung mit dem Arm, die die Höhle, den Generator und die Zeitmaschine einschloss – »der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Die Existenz des Ordens wird dann nicht länger ein Geheimnis sein, und der Krieg, in dem wir kämpfen, wird nicht mehr nur im Verborgenen geführt. Wir werden Verbündete bekommen, Alex, mächtige Verbündete, die uns helfen werden, den Feind zu besiegen. Dafür habe ich all die Jahre gearbeitet, und nun endlich bin ich am Ziel.«
»Endlich«, stimmte sie zu und nickte. Ein Teil von ihr wusste, dass ihr Vater recht hatte und sie allen Grund gehabt hätte, sich zu freuen. Aber es gab einen anderen Teil, der sich gekränkt und verletzt fühlte und in diesem Augenblick nur an den langen und gefahrvollen Weg denken konnte, der hinter ihr lag, an die Opfer, die sie zu beklagen hatte – und an das neue Leben, das in ihr heranreifte …
»Wie schön für dich, Vater«, sagte sie leise.
In diesem Moment fiel der erste Schuss.
Basislager
1,2 km südlich der Ausgrabungsstätte
Wenige Minuten zuvor
»Nun, Kim Li? Spielst du schön?«
Dr. Elizabeth Kwon saß auf einer der Feldpritschen in dem Zelt, das sie sich mit Kim Li teilte. Vor ihr auf dem Boden kauerte das Kind und spielte mit kleinen Steinen und Holzstücken, die sie am Flussufer aufgelesen hatten.
»Mhm«, machte das Mädchen und nickte, ohne jedoch von seinem Spiel aufzublicken, und einmal mehr konnte Elizabeth nicht anders, als von der Kleinen beeindruckt zu sein.
Eine Ewigkeit schien vergangen zu sein, seit sie den Forschungsalltag an der Universität von Berkeley unterbrochen hatte, um sich einem praktischen Fall zuzuwenden. Als Psychologin hatte sich Elizabeth Kwon auf das Phänomen sogenannter »Savants« spezialisiert, also von Menschen, deren intellektuelle Fähigkeiten das gewohnte Maß überstiegen, auf sensorischem, motorischem und emotionalem Gebiet dafür jedoch gravierende Defizite aufwiesen. Als man ihr berichtete, dass ein kleines Mädchen in Hongkong über eine äußerst ungewöhnliche Nischenbegabung verfügte, war Elizabeth daher sofort aufmerksam geworden, und entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit hatte sie sich dazu durchgerungen, die Geborgenheit Berkeleys zu verlassen und eine Flugreise von fünftausend Meilen auf sich zu nehmen, um den Gerüchten auf den Grund zu gehen – freilich ohne zu ahnen, worauf sie tatsächlich stoßen würde.
Dass Kim Li in der Lage war, mit bloßem Auge auch im infraroten Lichtspektrum zu sehen, war eine Sensation ersten Ranges, deren Bekanntgabe Dr. Kwon nicht nur jede Menge wissenschaftlichen Ruhm, sondern mit etwas Glück auch einen eigenen Lehrstuhl eingetragen hätte. Aber in diesen Kategorien dachte Elizabeth nicht mehr – denn was sie in der Folge erlebt und erfahren hatte, hatte ihren Forscherdrang verlöschen lassen wie eine Kerze im Wind.
Sie war nicht die Einzige, die auf Kim Lis besondere Fähigkeit aufmerksam geworden war. Auch eine geheimnisvolle Organisation, der ordo invisibilium, war dem Mädchen auf der Spur, ein Geheimbund von unsichtbaren Menschen, der in Kim Lis Gabe eine Bedrohung ihrer Existenz sah.
Natürlich hatte sich Elizabeth zunächst geweigert, an derart abstruse Dinge zu glauben – der Mordanschlag, dem das Mädchen und sie in Hongkong nur knapp entgangen waren, hatte sie jedoch überzeugt. Der Orden der Unsichtbaren existierte, ebenso wie die »Anderen«, jene kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, die die Pläne des Ordens zu durchkreuzen versuchten und alles daransetzten, sowohl ihr Leben als auch das von Kim Li zu schützen.
Als Elizabeth das Mädchen kennengelernt hatte, war es völlig in sich zurückgezogen gewesen, an Körper und Seele verkümmert. Doch so grässlich die Ereignisse von Hongkong auch gewesen waren, hatten sie in Kim Li eine Veränderung bewirkt, die man nur als ungewöhnlich bezeichnen konnte. In kognitiver wie emotionaler Hinsicht hatte das Mädchen erstaunliche Fortschritte gemacht. Eine plausible Begründung hatte Elizabeth dafür nicht. Sie konnte es sich nur so erklären, dass sich das Kind in Gesellschaft der Anderen wohl fühlte und vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben der Meinung war, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Vielleicht war das dadurch entstehende Gefühl von Glück und Harmonie so tiefgreifend, dass es Kim Li half, Defizite zu kompensieren, ein wenig wie es bei den Delphintherapien der Fall war, die bei jungen Patienten mit psychischen Störungen häufig angewandt wurden und oftmals erstaunliche Ergebnisse zeigten. Kim Li hatte Fürchterliches durchgemacht und viel verloren, aber sie hatte auch manches dazugewonnen.
Elizabeth hingegen stand noch immer unter dem Schock der jüngsten Ereignisse. Der Orden, die Demons, die Weltverschwörung der Unsichtbaren … Sie nahm es inzwischen als gegeben hin, dass all diese Dinge existierten, aber es war zu viel, um es bis in die letzte Konsequenz zu realisieren. Und zu dem Aufruhr an Emotionen, der ohnehin schon in ihr herrschte, gesellte sich ein Gefühl, das sie zuvor noch nie verspürt hatte: die Zuneigung zu einem Kind, das ihren Schutz und ihre Hilfe brauchte.
Voller Fürsorge betrachtete Elizabeth das Mädchen, das vor ihr kauerte, ins Spiel vertieft. Im Laufe der letzten Tage und Wochen war Kim Li für sie so viel mehr geworden als eine Patientin. Sie mochte das Kind und fühlte sich verantwortlich. Fraglos war diese Haltung unprofessionell für eine Psychologin und hätte ihr eine Rüge des Dekanats eingetragen. Aber die alten Denkstrukturen galten nicht mehr, die Welt schien ohnehin im Begriff sich aufzulösen.
Sowohl Kim Lis leibliche Eltern als auch ihre Pflegeeltern, die Tangs, waren tot, und Elizabeth war für das Mädchen nun einmal das, was einer Familie am nächsten kam.
Ihre Mutter …
Der Gedanke war Elizabeth fremd. Sie hatte sich nie mit dem Gedanken befasst, eines Tages Kinder zu haben, hatte sich stets nur in der Rolle der Wissenschaftlerin gesehen, deren Karriere ein Kind nicht eben förderlich gewesen wäre. Aber ihre wissenschaftliche Laufbahn war nicht nur ins Stocken geraten, sondern im Grunde nicht mehr existent, und sie ertappte sich dabei, dass sie Gefühle hegte, zu denen fähig zu sein sie stets bestritten hatte.
Der Gedanke erfüllte sie mit Wehmut, aber auch mit Zufriedenheit und einem Stolz, dessen sie sich fast schämte. Unwillkürlich streckte sie die Hand aus, um Kim Lis Kopf zu streicheln. Schon mehrmals hatte sich das Kind auf diese Weise von ihr berühren lassen, ohne in Panik auszubrechen.
Sanft berührte sie das glatte schwarze Haar des Mädchens – als Kim Li plötzlich aufsprang, sie entsetzt anblickte und in gellendes Geschrei verfiel.
»Kim Li! Es tut mir leid …!«
Elizabeth war erschrocken und bestürzt zugleich, dass das Kind sie offenbar doch nicht in dem Maß akzeptierte, wie sie geglaubt und insgeheim wohl auch erhofft hatte. Dann jedoch bemerkte sie, dass das Kind nicht auf sie starrte, sondern an ihr vorbei auf etwas, das sich hinter ihr befand! Alarmiert fuhr Elizabeth herum, konnte im offenen Eingang des Zeltes jedoch niemanden erkennen.
Ein schrecklicher Verdacht überkam sie, und sie griff nach der Spezialbrille, die in der Brusttasche ihrer khakifarbenen Bluse steckte und die das Unsichtbare sichtbar machte, indem sie Infrarotbilder auf einen halbtransparenten Hintergrund projizierte. Mit einer raschen Bewegung streifte Elizabeth die Brille über – und gab einen entsetzten Laut von sich, als sie die beiden leuchtenden Schemen sah, die im Zelteingang standen.
»Nein!«, rief sie entsetzt und sprang auf, um Kim Li an sich zu reißen und notfalls mit ihrem Leben zu beschützen – als sie etwas traf.
Elizabeth Kwon wurde auf die Pritsche zurückgeworfen. Dann kam der Schmerz, und während sich ihr Bewusstsein bereits einzutrüben begann, sah sie den Gegenstand, der auf Höhe des Herzens in ihrer Brust steckte.
Das Letzte, was sie hörte, waren der entsetzte Schrei Kim Lis und das ferne Rattern einer Maschinenpistole.
Dann folgte Dunkelheit.
Unterirdisches Bunkersystem
1,2 km nördlich des Basislagers
18 Uhr 45 Ortszeit
»Was ist da los?«
In den vergangenen Wochen und Monaten war Alexandra Lessing zu oft selbst unter Beschuss geraten, um den charakteristischen Klang einer Maschinenpistole nicht sofort zu erkennen. Ihr fragender Blick richtete sich auf ihren Vater, der sich Paolo Genaro zugewandt hatte, um zusammen mit dem italienischen Archäologen die Pylonen zu untersuchen. Beim Klang des Schusses war er ebenso erstarrt wie die bizarren stählernen Gebilde, die zur Höhlendecke ragten.
Einen endlos scheinenden Augenblick lang herrschte atemlose Stille. Dann fielen weitere Schüsse, und Kenneth Bowders Hand zuckte zu dem Funkgerät, das in der Brusttasche seines tarnfarbenen Overalls steckte.
»Oberon an Gruppenführer, Oberon an Gruppenführer, kommen …«
Die einzige Antwort war ein heiseres Rauschen, das von der Höhlendecke widerhallte und unheimlich durch die Halle geisterte.
»Zwecklos«, sagte Paolo. »Die Bunkerdecke ist viel zu dick und durch das Metall zusätzlich abgeschirmt.«
Alex’ Vater wollte etwas Zustimmendes erwidern, als erneut Schüsse zu hören waren – diesmal nicht in weiter Entfernung, sondern vom anderen Ende der Halle her. Dort, wo der Ausgang des Bunkers lag …
»Was geht da vor sich?«, wollte Alex wissen, die fühlte, wie ihr das Adrenalin in die Adern schoss.
»Demons«, war Bowders einzige Antwort. Seine ohnehin schon blassen Züge wurden kreidebleich.
»Unmöglich!«, wandte Paolo ein. »Wie sollte der Orden erfahren haben, dass wir hier sind? Vielleicht sind es nur Guerilleros oder gewöhnliche Räuber oder …«
Im nächsten Moment wurde es stockdunkel.
Es war, als fiel ein schwarzes Tuch herab, das sie alle bedeckte. Die Scheinwerfer, die herangeschafft worden waren, um die unterirdische Anlage zu beleuchten, verloschen schlagartig – jemand musste den Generator abgeschaltet haben, der an der Oberfläche stand. Erneut war der ratternde Klang einer Maschinenpistole zu hören, diesmal gefolgt von einem heiseren Schrei.
»Demons«, wiederholte Alex’ Vater mit furchtbarer Endgültigkeit, und sie konnte hören, wie er seine Waffe durchlud, eine Armeepistole vom offiziell außer Dienst gestellten Typ M1911 A1, die er hervorgezogen hatte.
»Vater!«, zischte Alex entsetzt.
»Bleibt hier!«, wies er sie an, während er seine Taschenlampe anschaltete und Richtung Ausgang huschte, die Pistole schussbereit.
Alexandra schaltete ebenfalls ihre Lampe an und schickte Paolo einen gehetzten Blick. Was hatte das zu bedeuten? War ihnen der Orden tatsächlich auf den Fersen? Hatte er sie entdeckt und ihnen seine Killer auf den Hals gehetzt?
Wie Bowder griffen auch sie nach den Pistolen, die sie bei sich trugen – halbautomatische Waffen des deutschen Typs HK P2000, die von geringer Größe und vergleichsweise einfach zu handhaben waren. Ob sie ihnen im Kampf gegen unsichtbare Killer von großem Nutzen sein würden, war fraglich. Aber Alex war fest entschlossen, alles zu tun, um zu verhindern, dass sie selbst oder ihr ungeborenes Kind in die Gewalt des Ordens fielen.
Vom Ende der Halle drang plötzlich Schusslärm. Bowder ließ seine Pistole krachen, grelle Mündungsflammen zuckten aus dem Lauf seiner Waffe und erhellten den vor ihm liegenden Korridor. Für Sekundenbruchteile glaubte Alex, zwei in Tarnanzüge gekleidete Gestalten zu erkennen. Im ersten Moment atmete sie auf, weil es sich um sichtbare Angreifer handelte, aber dann erblickte sie die Infrarotgeräte, die die Kerle vor ihren Gesichtern trugen, und ihr wurde klar, dass es Söldner des Ordens waren – und wo sie auftauchten, waren Demons meist nicht fern …
Ihr Vater feuerte, bis das Magazin seiner Waffe leer war, und Alex glaubte zu erkennen, wie eine der vermummten Gestalten zusammenbrach. Dann allerdings wurde das Feuer erwidert, und mehrere MPi-Garben sengten lärmend in die Höhle, um von den Pylonen abzuprallen und kreuz und quer durch die Luft zu fliegen.
»In Deckung!«, hörte sie Paolo rufen, während sie merkte, wie jemand sie packte und zu Boden riss.
»Vater!«, brüllte sie – aber ihr Ruf ging im neuerlichen Hämmern einer Maschinenpistole unter. Das Gesicht auf den kalten Steinboden pressend, glaubte sie, fühlen zu können, wie die todbringenden Geschosse über sie hinwegsengten. Von Wut und Furcht gleichermaßen getrieben, streckte sie ihre eigene Waffe vor, entschlossen, auf alles zu feuern, was sich ihr näherte – doch schon im nächsten Moment war der Kampf zu Ende.
Das Feuer der Killer hatte schlagartig ausgesetzt. Alex atmete auf. Offenbar hatten sie Hilfe bekommen.
Unsichtbare Hilfe …
Rasch erhob sich Alex und eilte zum Ende der Halle, wo sie auf ihren Vater traf. Kenneth Bowders Züge waren zur Maske gefroren. Milde war nicht mehr darin zu erkennen.
»Seid ihr in Ordnung?«, erkundigte er sich.
Alexandra nickte, ebenso wie Paolo, der die Pistole in seiner Rechten hielt und sichtlich nichts damit anzufangen wusste. Er war Archäologe, Wissenschaftler, ein Mann des Geistes und nicht der Gewalt …
Bowder ließ den Lichtkegel seiner Taschenlampe über die Leichen der feindlichen Schützen gleiten, deren Köpfe in grotesken Winkeln von ihren Körpern abstanden. »Söldner«, stellte er fest. »Gedungene Mörder.«
»Es sind viele«, berichtete eine atemlose Stimme, die aus dem Nichts zu kommen schien, »und sie sind gut ausgerüstet. Wärmesichtgeräte, Kevlarwesten – das ganze Programm.«
»Wo sind die anderen?«
»Valjean bewacht den Ausgang, Rostow und Faber sind tot«, lautete die erschütternde Antwort. »Da wusste jemand offenbar sehr genau, was ihn erwartet.«
Mit zitternder Hand griff Alex nach ihrer Spezialbrille und zog sie sich vors Gesicht. Sofort erkannte sie die beiden gelb umrandeten Schemen, die bei ihrem Vater standen. Offenbar seine Leibwächter …
»Aber wie ist das möglich?«, erkundigte sich Bowder fassungslos. »Wie konnten sie uns finden?«
»Das wissen wir nicht, Sir. Aber es ist ganz bestimmt kein Zufall, dass sie hier sind. Das Lager wurde ebenfalls überfallen. Wir haben Schüsse gehört.«
»Merda«, knurrte Genaro.
»Wir müssen zurück«, sagte Alex entschlossen. »Sofort.«
»Nein«, widersprach Bowder entschieden.
»Aber Dr. Kwon und Kim Li sind im Lager! Wir müssen ihnen zu Hilfe kommen!«
»Nein«, sagte er noch einmal, nun nicht mehr mit der Stimme des wohlwollenden Vaters, sondern mit der des militärischen Befehlshabers.
»Wieso nicht?«
»Es sind mehr als genug Wachen im Lager, um Kim Li und Dr. Kwon zu beschützen – wenn sie versagen, können auch wir nichts mehr für sie tun. Außerdem geht es dem Orden nicht darum, das Mädchen zu töten. Er will die Kleine lebend.«
»Aber du hast selbst gesagt, dass Kim Li eine Schlüsselposition im Kampf gegen den Orden einnimmt. Ihre Fähigkeit …«
»… ist bemerkenswert, daran besteht kein Zweifel«, räumte Bowder ein, »aber zehn Kim Lis sind für uns nicht halb so viel wert wie dieser Bunker hier.«
»Wie kannst du nur so etwas sagen!«, rief Alex entsetzt.
»Es ist die Wahrheit. Diese Anlage ermöglicht es uns, dem Orden die Maske der Anonymität vom Gesicht zu reißen und der Welt von seiner Existenz zu berichten. Deshalb hat unsere Sorge in erster Linie ihr zu gelten und erst danach unseren Kameraden.«
»Ich verstehe«, sagte Alex ebenso leise wie spitz. »Im Setzen von Prioritäten warst du ja schon immer sehr gut, nicht wahr?«
Bowder, der nicht gewillt schien, sich auf einen Streit einzulassen, wandte sich wieder seinen Leuten zu – als erneut der hässliche Lärm einer Maschinenpistole erklang, dazu ein gepresster Schrei.
»Das war Valjean«, stellte einer der Unsichtbaren fest. »Der Feind greift wieder an!«
»Haltet sie auf, so lange wie möglich!«
»Verstanden, Sir!«
Die Leibwächter huschten davon, nicht ohne vorher noch die M960-Maschinenpistolen der beiden getöteten Killer an sich zu nehmen. Die Waffen würden zwar zu sehen sein, auch wenn zwei Unsichtbare sie hielten, angesichts der Ausrüstung des Gegners war die Unsichtbarkeit jedoch ohnehin von untergeordneter Bedeutung. Es kam nur noch darauf an, die Angreifer auf Distanz zu halten …
Sie verschwanden in der Dunkelheit des Korridors, und Bowder wies Alex und Genaro an, sich mit ihm in die Haupthalle zurückzuziehen, wo die Zeitmaschine stand.
»Wieso?«, fragte Paolo, während in einiger Entfernung das hämmernde Stakkato der Maschinenpistolen zu hören war. »Was soll das bringen?«
»Das Schott!«, stieß Alex’ Vater hervor, auf die beiden massiven Metallblöcke deutend, die zu beiden Seiten des Halleneingangs aufragten und das Licht der Taschenlampen matt reflektierten. »Es muss uns irgendwie gelingen, es zu schließen! Die Ordenskiller dürfen diese Halle nicht betreten, sonst werden sie alles zerstören!«
»Wie sollen wir das anstellen?«, fragte Alex. Sie hatte es aufgegeben, ihrem Vater zu widersprechen – zu gegebener Zeit würde sie alles mit ihm klären. Sofern es überhaupt je dazu kam, fügte sie in Gedanken hinzu, während vom Ende des Korridors erneut Schusslärm drang.
»Es muss einen Mechanismus geben«, war Bowder überzeugt. »Irgendetwas, womit sich das Ding bewegen lässt.«
»Ohne Energieversorgung?« Alex schüttelte den Kopf.
»Der Generator«, rief Paolo, auf das würfelförmige Gebilde auf der anderen Seite der Halle deutend. »Man müsste ihn aktivieren! Wenn ich nur wüsste, wie.«
Im nächsten Moment wurden alle Überlegungen hinfällig. Ein Geräusch war zu hören, ein Knall, so dumpf und mächtig, dass sich die ratternden Maschinenpistolen dagegen wie Knallfrösche ausnahmen. Jäh verstummten sie, und eine Erschütterung erfasste die Anlage und ließ das Spalier der Säulen erbeben. Alex richtete den Lichtkegel ihrer Taschenlampe in den Korridor, sah den Staub, der daraus hervorquoll, und begriff.
Eine Explosion!
»Sie … sprengen den Eingang!«, rief Paolo entsetzt, der den gleichen Gedanken hatte.
Ken Bowders Erwiderung war nicht zu verstehen. Eine zweite und eine dritte Detonation folgten, die die Kaverne abermals in ihren Grundfesten erzittern ließen. Gesteinsbrocken lösten sich von der Decke und fielen herab.
Dann kam eine vierte Explosion, die heftiger war als alle bisherigen zusammen – und mit ihr die Druckwelle.
Alex begriff nicht, wie ihr geschah, als sie von einer unwiderstehlichen Kraft erfasst und zurückgeschleudert wurde. Sie fiel, schlitterte rücklings über den Boden, während über ihr ein wahres Inferno losbrach.
Die zwar stählernen, in ihrer Statik jedoch höchst fragilen Pylonen waren dem Druck der Explosion nicht gewachsen! Ein markerschütterndes Ächzen war zu vernehmen, und im Lichtkegel ihrer Taschenlampe, der steil nach oben gerichtet war, konnte Alex sehen, wie sich einer der gebogenen Pfeiler neigte und schließlich nach vorn kippte – und damit eine wahre Kettenreaktion auslöste.
Die Stränge aus armdicken Kabeln, die die Pylonen miteinander verbanden, strafften sich. Einige gaben nach und rissen mit einem jaulenden Laut, der an eine E-Gitarre erinnerte, andere hielten der Beanspruchung stand und brachten die nächsten Pfeiler zu Fall. Bolzen sprangen mit lautem Knall, Schweißnähte platzten, und über allem war das grässliche Kreischen von Metall zu hören, das sich deformierte und schließlich mit dumpfem Bersten zusammenbrach.
Alex lag längst nicht mehr am Boden. In gebückter Haltung, um das Kind zu schützen, das sie in sich trug, war sie zum Rand des Gewölbes geeilt, den sie in Staub und Dunkelheit nur noch erahnen, aber nicht mehr wirklich sehen konnte.
Auch von ihren beiden Begleitern war weit und breit nichts mehr zu entdecken. Alex wusste nicht, was mit ihnen geschehen war, und hatte im Augenblick auch keine Möglichkeit, es herauszufinden. Sie musste an sich selbst denken, musste ihr eigenes Leben retten und das des Kindes …
Von Hustenkrämpfen geschüttelt, erreichte sie die mit blankem Metall verkleidete Höhlenwand und sank daran nieder. Den Kragen ihrer Khakibluse vors Gesicht schlagend, versuchte sie, die staubdurchsetzte Luft ein wenig zu filtern, während ein frenetisches Knirschen und Bersten die Höhle erfüllte. Am ganzen Körper zitternd, schloss Alex die Augen und hoffte und betete, dass es möglichst bald enden würde.
Und sie wurde erhört.
Irgendwann – und sie hätte nicht zu sagen vermocht, ob es Sekunden, Minuten oder Stunden gewesen waren – kehrte Stille ein. Ein Schweigen, das jedoch nicht weniger Unheil verkündend war als das Lärmen der Schusswaffen und der Explosionen …
»V-Vater?«, wollte Alex fragen, brachte jedoch nicht mehr als ein Röcheln zustande. Sie spuckte aus und räusperte sich, um ihre Stimmbänder vom Staub zu befreien. »Vater?«
»Hier«, stöhnte jemand rechts von ihr. Sie hob die Taschenlampe, die sie die ganze Zeit über mit eiserner Faust umklammert hatte, und ließ ihren Lichtkreis suchend umhergleiten.
Die Halle bot ein Bild der Zerstörung.
Nur rund die Hälfte der Pylonen war stehen geblieben, der Rest war eingestürzt. Verbogene Metallstücke ragten allenthalben auf, abgerissene Kabelstränge und zertrümmerte technische Apparaturen lagen überall umher. Der Vergleich mit einem Schrottplatz drängte sich Alex auf. Die Vorstellung, dass dieser Müllhaufen einst dazu gedient haben könnte, eine Verbindung durch Raum und Zeit zu schaffen, schien plötzlich geradezu absurd.
Sie entdeckte ihren Vater, der humpelnd auf sie zukam. Er blutete aus einer Platzwunde an der Schläfe, schien ansonsten jedoch unverletzt. Und Paolo?
Alex wollte auch nach ihm suchen, als sie am anderen Ende des Gewölbes fahlen Lichtschein aufflackern sah, der durch die noch immer staubgetränkte Luft schimmerte.
»Hier drüben beim Ausgang«, hörte sie den Italiener rufen, der das Inferno ebenfalls unbeschadet überstanden zu haben schien, jedoch hörbar unter Schock stand. »Seht euch nur diese Scheiße an …«
Alex ließ sich von ihrem Vater auf die Beine helfen. Sich gegenseitig stützend, stiegen sie über geborstene Kondensatoren und losgelöste Kabel hinweg und gesellten sich zu dem Archäologen, der sie mit düsterer Miene erwartete.
Der Grund dafür war klar ersichtlich.
Es gab keinen Ausgang mehr.
Der Korridor zum Einstiegsschacht war eingestürzt. Die Killer des Ordens hatten ihn gesprengt und damit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen hatten sie sich aller Gegner entledigt, die sich noch im Bunker aufgehalten haben mochten, zum anderen hatten sie dafür gesorgt, dass niemals jemand Kenntnis erlangen würde von dem sensationellen Fund, auf den Paolo Genaro und sein Team gestoßen waren. Der Zugang zum Bunker war versiegelt, der Wurmloch-Generator vor Entdeckung bewahrt. Das Geheimnis des Ordens würde gewahrt bleiben, tief unter der feuchten Erde des Amazonasdschungels …
Der Staub setzte sich, und im Lichtkreis ihrer Lampe konnte Alexandra ihren Vater sehen. Kenneth Bowder wirkte müde und erschöpft. Innerhalb weniger Augenblicke schien er um Jahre gealtert, was nicht nur am Staub lag, der sich über sein Haar gelegt und es grau gefärbt hatte. Der jugendliche Glanz war aus seinen Augen gewichen, und eine Hoffnungslosigkeit hatte sich in seinen Zügen breitgemacht, die Alex erschreckte.
»Vater?«, fragte sie leise.
Ein freudloses Grinsen huschte über sein Gesicht, das Resignation ausdrückte. »Vorbei«, flüsterte er. »Dieser Bunker war unsere letzte Chance. Unsere einzige Möglichkeit, den Orden entscheidend zu treffen, ihn endlich einmal anzugreifen, statt stets nur aus der Defensive heraus zu operieren. Nun ist sie vertan. Die Maschine ist zerstört, niemand wird uns jemals glauben, wozu sie Verwendung fand.«
»Äh – Sir?«, ließ sich Paolo vernehmen.
Bowder erwiderte nichts, schaute ihn aber fragend an.
»Ihre Enttäuschung in allen Ehren, aber da ist etwas, das mir ehrlich gesagt noch sehr viel größere Sorge bereitet.«
»Und das wäre?«
»Nicht nur diese Anlage ist von der Außenwelt abgeschnitten, sondern auch wir – und ich muss Ihnen nicht sagen, was das bedeutet …«
2.
Über die Annäherung des Organismus an die Flatline – also jene Nulllinie des Ausschlags beim Elektrokardio- und Elektroenzephalogramm, die von der Schulmedizin zur Definition des Todesbegriffs herangezogen wird –, nicht etwa durch Medikamenteneinfluss, sondern durch pure Willenskraft, wurde in der Vergangenheit wiederholt spekuliert. Bei den sogenannten Magiern und selbsternannten Medien, die derlei Kunststücke vor zahlendem Publikum präsentieren, dürfte es sich wohl allesamt um zwar sehr talentierte, nichtsdestotrotz ruchlose Scharlatane handeln, die sich nicht scheuen, die Leichtgläubigkeit ihrer Zuschauer für ihre Zwecke auszunutzen. Tatsächlich ist aus jüngerer Zeit kein Fall bekannt, bei dem eine bewusstseinsgesteuerte Annäherung oder gar Überschreitung der Todeslinie – und damit eine gewollt herbeigeführte Nahtod-Erfahrung – glaubhaft dokumentiert wäre. Den wohl eindrucksvollsten Hinweis auf eine derartige Handlung finden wir in den Aufzeichnungen des in der südchinesischen Provinz Yunnan gelegenen Klosters Cha Wan.
Ein Mönch, der sich auf eine Pilgerreise »über das große Gebirge« – also nach Indien – begab, hätte von dort das Geheimnis des »Falschen Todes« mitgebracht und es nach seiner Rückkehr an seine Brüder weitergegeben. Später sei es nach Japan gelangt, wo es Geheimzirkel angeblich verwendeten, um beispielsweise den Tod überführter Verbrecher vorzutäuschen und sie so ihrer Bestrafung zu entziehen. Auch manche Ninja-Krieger sollen über das geheime Wissen verfügt haben, ihrem Leben kraft bloßen Willens ein Ende zu setzen, wenn sie in Gefangenschaft gerieten, und auf diese Weise zu verhindern, dass sie ihre Auftraggeber verrieten. Was davon wahr ist und was nicht, wird wohl nie abschließend geklärt werden können …
aus: Matsuo Hashimi
Der übernatürliche Buddhismus
Tokio, 1996
Rom, genaue Lokalität unbekannt
Zur selben Zeit
Trauer …
Ismael hatte sich daran gewöhnt, dass sie sein ständiger Begleiter war. Verluste und Entbehrungen hatten ihn geprägt, so weit er zurückdenken konnte.
Als er noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte er menschliche Nähe vermisst, als Heranwachsender die Möglichkeit, über sich selbst zu bestimmen und frei zu entscheiden. Auf der Kaderschule des Ordens, wo er zu einem Werkzeug des Kollektivs hatte erzogen werden sollen, hatte es weder das eine noch das andere gegeben – dennoch hatte Ismael Trost gefunden. Denn unter all den Gesichtslosen, die sein Schicksal teilten, hatte es einen gegeben, dem er sich in besonderer Weise verbunden gefühlt hatte, der sein Freund geworden war und der ihm geholfen hatte, die Einsamkeit des Unsichtbaren zu ertragen.
Frankie …
Schon die Tatsache, dass es einen Vornamen gab, an den er sich erinnern konnte, war ungewöhnlich, denn im Kollektiv gab es keine Individualität. Der Orden verlangte strikte Unterordnung. Der Einzelne zählte nichts, die Organisation alles. Ismael und Frankie jedoch hatten gegen diese Regel verstoßen, indem sie Freundschaft geschlossen hatten, allen Verboten zum Trotz – und sie waren dafür bestraft worden …
Auf dem nackten Steinboden kauernd, vergrub Ismael das Gesicht in seinen Händen. Tränen sickerten ihm aus den Augen, die in dem Moment, als sie seinen Körper verließen, sichtbar wurden und seine Handflächen benetzten. Zum ungezählten Mal fragte er sich, ob er hätte verhindern können, was geschehen war, und ob er dafür die Verantwortung trug.
Die erste Frage ließ sich eindeutig verneinen – auf die zweite jedoch wusste er keine Antwort …
Er hatte nicht ahnen können, damals, als er vor dem Orden geflüchtet war und sich dem Widerstand angeschlossen hatte, dass er Frankie einst wieder begegnen würde. Wie auch? Er hatte ja angenommen, dass sein bester Freund von den Schergen der Grauen ermordet worden wäre. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass Frankies Verschwinden einer der Gründe dafür gewesen war, dass sich Ismael vom Orden abgewandt hatte – dabei war Frank Gallagher in Wirklichkeit aus dem Kader ausgesondert worden, weil seine Lehrer in ihm besondere Fähigkeiten gesehen hatten. Isoliert von seinen Mitschülern, hatten sie ihn zum Demon erzogen, zum Killer, der auf Befehl seiner grauen Herren ohne Zögern tötete – und so hatten sich ihre Wege nach vielen Jahren wieder gekreuzt: Frankie als treuer Diener des Ordens, Ismael als Kämpfer des Widerstands. Aus den Freunden von einst waren Todfeinde geworden, und im Grunde hatte von vornherein festgestanden, dass nur einer der beiden die Konfrontation überleben konnte.
Wenn sich Ismael etwas vorzuwerfen hatte, dann dass er zu nachlässig gewesen war. Sein Plan, Frankie nach Rom zu locken und ihm eine Falle zu stellen, hatte funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt, da sich Frank Gallagher in der Gefangenschaft des Widerstands befunden hatte. Denn obwohl Ismael klar gewesen war, dass ein Demon alles daransetzen würde, dem Feind nicht lebend in die Hände zu fallen, hatte er nicht mit dieser Konsequenz gerechnet, nicht mit diesem blindwütigen Hass, nicht mit diesem Drang zur eigenen Vernichtung.
Mit bloßer Willenskraft hatte Gallagher seinem Leben ein Ende gesetzt und damit verhindert, dass er Informationen preisgeben konnte, die für den Widerstand von Wichtigkeit waren – Informationen über das geheime Versteck des Ordens, von dem aus die Grauen die Fäden zogen. Und so war es am Ende der Orden gewesen, der einen Sieg errungen hatte.
»Frankie«, flüsterte Ismael leise. »Was hast du nur getan …?«
Er bezweifelte, dass die Grauen jemals etwas von Frank Gallaghers heldenhaftem Opfer erfahren oder auch nur davon Notiz nehmen würden. Für sie war er nur ein Diener von vielen, ein Demon, der seine Arbeit versehen hatte. Austauschbar. Ismael jedoch hatte seinen Freund verloren, zum zweiten Mal in seinem Leben – und er wurde das quälende Gefühl nicht los, dass niemand anderer als er selbst die Schuld daran trug.
Hatte Frankie am Ende recht gehabt? War er ein verblendeter Narr, der verlorenen Idealen nachjagte? Würde die Welt tatsächlich im Chaos versinken, wenn der Orden nicht eingriff? Waren Kriege und Katastrophen die unausweichliche Folge, wenn die sichtbare Welt selbst über ihr Schicksal bestimmte? Führten die ethischen Grundsätze, denen sich der Widerstand verpflichtet fühlte, die Welt tatsächlich ins Verderben?
Frankie gegenüber hatte Ismael diese Vorwürfe allesamt abgestritten – vergessen hatte er sie jedoch nicht, und nun kehrten die Zweifel zurück. Die Stimme des toten Frank Gallagher schien noch lauter zu sein als die des lebenden, und Ismael konnte dem nichts mehr entgegnen. Es begann an ihm zu nagen. Wofür, fragte er sich, trat der Widerstand ein, wofür hatte er all die Opfer gebracht, wenn am Ende nur Tod und Chaos standen?
Sein rechtes Auge schmerzte, und er schaute auf. Seine Handflächen waren nicht nur von Tränen benetzt, sondern auch von Blut. Er blinzelte, aber der Schmerz wollte nicht vergehen. Ismael erwog, zu Dr. Livesey zu gehen, aber er entschied sich dagegen. Er wollte keine Tabletten schlucken, um den Schmerz zu vertreiben. Der Schmerz gehörte zu seiner Trauer, war ein Teil davon. Zumindest das war er Frankie schuldig …
»Commander Ismael?«
Er zuckte zusammen, als er aus dem Nichts heraus angesprochen wurde. Menschen, die wie er von Geburt an unsichtbar waren, hatten ein feines Gespür für die Präsenz ihrer Artgenossen entwickelt, das normalerweise längst angesprochen hätte. Ismaels Überraschung war nur ein weiteres Indiz dafür, wie sehr Frankies Tod ihn getroffen hatte und wie abgrundtief die Leere war, die in ihm herrschte.
»Ja?«
»Sir, es tut mir leid, Sie zu stören. Oberon wünscht Sie zu sprechen.«
Ismael erkannte die Stimme. Sie gehörte Hawkeye, einem Unsichtbaren, der wie er selbst der dritten Generation entstammte und schon lange beim Widerstand war. Da es beim Orden keine individuellen Namensbezeichnungen gab, hatte er sich wie alle anderen Rebellen aus dem reichhaltigen Fundus der Weltliteratur bedient und einen Namen ausgewählt, der einerseits seine persönliche Geschichte widerspiegelte und andererseits auch als Codebezeichnung diente …
»Schon gut.« Ismael erhob sich, und er war fast dankbar dafür, dass seine Knochen dabei schmerzten, denn auf diese Weise hatte er das Gefühl, noch am Leben zu sein; gerade noch war es ihm so vorgekommen, als wäre ein Teil von ihm zusammen mit Frank Gallagher gestorben.
Hawkeye begleitete ihn den von kaltem Neonlicht beleuchteten Gang hinab, in dessen steinerne Wände zu beiden Seiten schmale, waagrechte Nischen eingelassen waren.
Gräber.
Schon vor rund zwei Jahrtausenden hatten diese Katakomben, die sich tief unter der Stadt Rom befanden, als Zufluchtsstätte gedient. Dass ihnen diese Aufgabe wieder zugefallen war, war eine weitere der vielen Ironien, die die Geschichte immer wieder bereitzuhalten schien.
Mit dem Aufzug gelangte Ismael noch weiter in die Tiefe. Dort betrat er die Schleuse und ließ die Überprüfung durch die Wachen über sich ergehen. Erst dann wurde er in die Kammer vorgelassen, von der aus Oberon, das geheimnisvolle Oberhaupt der Widerstandsbewegung, seine Gefolgsleute zu instruieren pflegte. Ein kahler, schmuckloser Raum, dessen Wände mit Metall verkleidet waren, dazu einige Bildschirme und Lautsprecher, mehr nicht.
»Ismael?«
»Ja, Sir?«
»Es gibt Neuigkeiten.«
»Welcher Art, Sir?«
Die automatenhaft schnarrende Stimme, mit der Oberons Worte aus dem Lautsprecher drangen, kannte keine Nuancen. Dennoch hatte Ismael das Gefühl, einen Anflug von Trauer wahrzunehmen – oder waren es seine eigenen Gefühle, die seine Wahrnehmung beeinflussten?
»Die Amazonas-Expedition«, antwortete das Oberhaupt der Anderen nur.
»Alex!«, entfuhr es Ismael. »Was ist mit ihr?«
Frank Gallagher, sein eigener Schmerz und seine Zweifel, all das rückte schlagartig in den Hintergrund und machte der Sorge um die Frau Platz, die er mehr liebte als sein eigenes Leben – und dem noch ungeborenen Kind, das sie unter ihrem Herzen trug.
Sein Kind …
»Wir bekommen keinen Kontakt mehr«, erklärte Oberon hart. »Jegliche Verbindung zu Professor Lidenbrock und Dr. Genaro ist abgerissen …«
Unterirdisches Bunkersystem
23 Uhr 46 Ortszeit
Der Staub hatte sich gelichtet.
Wie ein Leichentuch hatte sich eine weiße Schicht über den Höhlenboden und die Trümmer gebreitet, die der sensationellste Fund in der Geschichte der Archäologie hätten werden können. Nun jedoch würde die Höhle zu ihrer Grabstätte werden – und wer wusste zu sagen, ob nicht in ein paar hundert oder tausend Jahren erneut jemand auf den abwegigen Gedanken kommen würde, im Amazonasgebiet nach den Spuren einer verlorenen Zivilisation zu suchen, und dabei auf ihre sterblichen Überreste stoßen würde?
Über Alexandra Lessings Züge huschte ein freudloses Lächeln. Die ersten zwei Stunden nach der Explosion und dem Einsturz des Stollens hatte sie in heller Panik verlebt und in schrecklicher Todesangst. Irgendwann jedoch war ihr aufgegangen, dass sich dadurch nichts ändern würde, und der rational arbeitende Verstand der Wissenschaftlerin hatte die Kontrolle übernommen. Die gezackten Rinnsale auf ihrem staubbedeckten Gesicht waren getrocknet, und sie hatte damit begonnen, ihre Lage nüchtern zu analysieren.
Gemessen am Sauerstoffvorrat und an dem wenigen Proviant, den sie bei sich hatten und der nur aus einigen Schlucken Wasser und ein paar Energieriegeln bestand, würden ihnen vier, vielleicht fünf Tage bleiben.
Zeit genug, um den Verstand zu verlieren – aber kaum ausreichend, um gefunden und gerettet zu werden.
Das Hauptquartier wusste von der Expedition, allerdings waren die exakten GPS-Koordinaten des Fundorts aus Sicherheitsgründen nicht übermittelt worden. Von denen, die zum Zeitpunkt des Überfalls im Camp gewesen waren, war zweifellos keiner mehr am Leben – der Orden kannte keine Gnade, wenn es darum ging, seine Interessen zu wahren. Lidenbrock, der unsichtbare Gelehrte, der die Expedition begleitet hatte, war vermutlich ebenso tot wie alle anderen. Was Kim Li und Elizabeth Kwon betraf, so war sich Alex nicht sicher, ob sie überhaupt hoffen sollte, dass beide noch lebten – die Verhörspezialisten des Ordens standen mittelalterlichen Folterknechten an Brutalität und Grausamkeit in nichts nach, auch wenn ihre Methoden ausgefeilter waren …
Alex musste an ihr eigenes Kind denken. Die Ängste, die sie gehabt hatte, das Ringen um die Entscheidung, das Baby allen Widrigkeiten zum Trotz zu behalten, auch wenn es möglicherweise unsichtbar sein würde wie sein Vater und damit eine potentielle Bedrohung für die Menschheit darstellte – all das war plötzlich bedeutungslos geworden, ebenso wie ihre Zweifel bezüglich Ismael. Das Wiedersehen mit ihrem Vater, der Kampf gegen den Orden – das alles brauchte Alex nicht mehr zu kümmern, und übermüdet und ausgezehrt, wie sie war, ertappte sie sich dabei, dass ihr der Gedanke gefiel.
»Ich habe versagt«, sagte Kenneth Bowder zum ungezählten Mal in die Stille. »Ich habe versagt …«
Ein Stück von Alex entfernt kauerte ihr Vater am Boden, wo genau, wusste sie nicht, da sie die Taschenlampen abgeschaltet hatten, um die Batterien zu schonen. Wozu das angesichts ihrer aussichtslosen Lage gut sein sollte, entzog sich Alex’ Verständnis, aber sie hatte nicht widersprochen.
»Alles schien so einfach, so klar«, fuhr Bowder fort. »Der Plan war von langer Hand vorbereitet. Wir wussten, dass es einen Ort wie diesen geben musste …«
»Der Orden wusste es offenbar auch«, konterte Alex hart.
»Nein – sonst hätte er uns niemals so weit kommen lassen. Die Grauen haben erst von der Existenz dieser Maschine erfahren, nachdem wir sie gefunden hatten.«
Alex war klar, was ihr Vater damit sagen wollte, und der Gedanke war so hässlich, dass er sie aus ihrer Lethargie riss. »Du meinst …?«
»Es ist offensichtlich«, war Bowder überzeugt. »Wir wurden verraten. Irgendjemand hat ein doppeltes Spiel gespielt und uns damit um die Chance gebracht, dem Orden einen schweren Schlag zu versetzen. Dass es so weit kommen konnte, habe allein ich zu verantworten. Ich muss etwas übersehen haben, irgendetwas …«
»Wenn es wirklich einen Verräter in unseren Reihen gab, kannst du nichts dafür«, hörte sich Alex sagen, auch wenn sie eigentlich keinen Grund sah, ihren Vater zu trösten. Nicht nach allem, was er ihr angetan hatte.
»Ich hätte es ahnen, es voraussehen müssen. Verstehst du denn nicht, wie viel bei dieser Sache für uns auf dem Spiel stand? Es ging um alles oder nichts!«
»Doch, natürlich verstehe ich das«, entgegnete Alex, sich mühsam zur Ruhe zwingend, »aber vielleicht verstehst du ja auch, dass mir das inzwischen völlig egal ist! Wir werden in diesem verdammten Bunker zugrunde gehen! Dein Enkelkind wird sterben, noch ehe es das Licht der Welt überhaupt erblickt hat! Darüber solltest du dich sorgen und nicht um vergebene Chancen. Aber offenbar gibt es Dinge, die dir wichtiger sind.«
Für einige Sekunden schaltete ihr Vater seine Taschenlampe an und richtete sie auf Alex’ Gesicht. »Glaubst du das wirklich von mir?«
»Was soll ich denn glauben?«, fragte Alex, nachdem die Höhle und alles um sie herum wieder in Dunkelheit versunken waren. »Ich kenne dich ja kaum.«
Eine Weile lang blieb es still. Bowder schien sich seine nächsten Worte sorgfältig zu überlegen.
»Ich habe dir gesagt, warum ich deine Mutter und dich damals verlassen habe«, entgegnete er schließlich. »Es ging mir darum, euch zu schützen.«
»Spar dir deine Erklärungen«, zischte sie. »Für Mom kommen sie ohnehin zu spät.«
»Ich weiß. Ich habe mit großem Bedauern von ihrem Tod erfahren.«
»Tatsächlich? Wie rührend.«
»Sonja war eine außergewöhnliche Frau. Wenn ich dich anschaue, sehe ich viel von ihr …«
»Nein!«, rief Alex so laut, dass es von der hohen Decke widerhallte. »Tu das nicht, hörst du? Fang nicht so an!«
»Warum nicht? Ich bin dein Vater …«



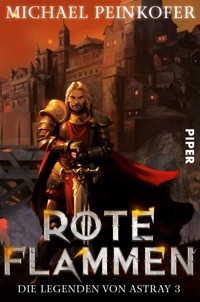


![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)