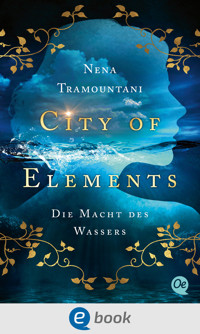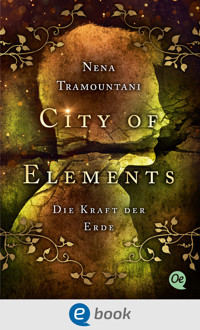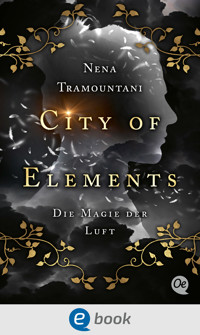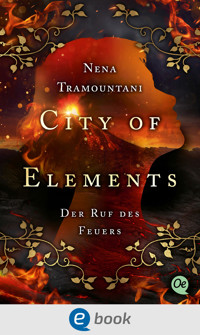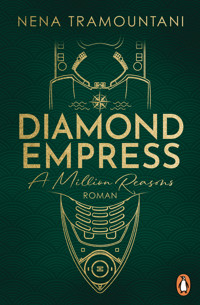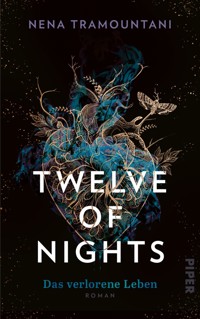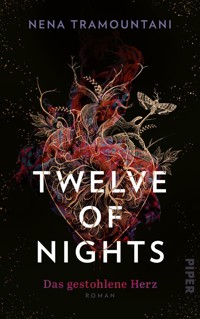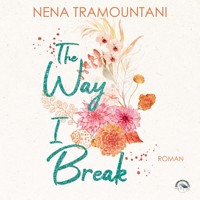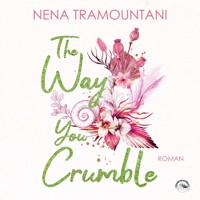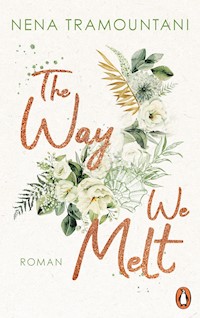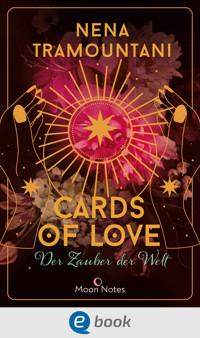
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Giulietta erwacht in einem Zimmer im Grand Hotel in Venedig und versucht zu begreifen, was passiert ist. Nach und nach dämmert es ihr: Sie ist selbst zu einer Tarotfigur geworden. Nun muss sie nicht nur lernen, mit ihrer damit einhergehenden Gabe zurechtzukommen. Ihr rachsüchtiger Onkel hetzt auch noch andere Kartenfiguren gegen sie auf. Er behauptet, dass Giulietta die Macht hat, die Figuren für immer in die Karten einzusperren, und sie ewig in Freiheit leben können, wenn sie Giulietta aus dem Weg räumen. Giulietta ist verzweifelt. Wem kann sie noch vertrauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Irgendetwas fühlt sich anders an.
Warum kann Giulietta Venedig nicht mehr verlassen?
Langsam dämmert es ihr. Sie wurde verraten, und das ausgerechnet von dem Menschen, dem sie am meisten vertraut hat. Niemals hätte sie gedacht, dass Malvolio fähig wäre, sie so zu hintergehen.
Giulietta muss sich neue Verbündete suchen. Denn es steht mehr als ihr Herz auf dem Spiel: ihr Leben und das der Venezianer.
Band 2 der magischen Dilogie über die Macht des Tarots – übersinnlich, intensiv und romantisch
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
Schau gern in der Triggerwarnung nach, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. (Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern, steht der Hinweis hinten im Buch.)
Für alle, die in uns weiterleben.
Playlist
James Arthur – Train Wreck
Lola Blanc – Angry Too
Donna Missal – Let You Let Me Down
Madison Beer – Follow The White Rabbit
Matt Maeson – Dancing After Death (Stripped)
The Chamber Orchestra Of London – The Secret History
Beth Crowley – I Scare Myself
Faith Marie – Devil on My Shoulder
Faouzia, John Legend – Minefields
Ursine Vulpine, Annaca – Lovers Death
Katie Garfield – Gallows
Elley Duhé – LOVEMEHARD
I WASTHELION – Never Take Me Alive
Steelfeather – Heart of Darkness
The White Birch – Breathe
Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani – Experience
Novo Amor – Anchor
The Script – Flares
Ben Howard – Oats In The Water
Noah Gundersen – Oh Death
Madison Beer – Default
KAPITEL 1Der Anfang und das Ende
Mein erster Atemzug war friedlich. Alles in mir wehrte sich dagegen, die Augen zu öffnen. Wärme umhüllte mich. Ich war in Sicherheit. Mir ging es gut.
Wie lange hatte ich geschlafen? Wann hatte ich das letzte Mal so gut geschlafen? Ein Lächeln lag auf meinen Lippen. Für ein paar köstliche Sekunden ließ ich mich treiben.
Und dann schlug ich die Augen auf. Gold und Rot blitzten vor mir auf, zunächst unscharf, verschwommen. Ich blinzelte. Die Umrisse der Suite wurden immer schärfer. Ein Kronleuchter, eine antike Kommode, ein Deckenfresko.
Ich fuhr hoch. Der innere Frieden verschwand so schnell, wie er gekommen war. Die Erinnerung war erbarmungslos. In Tausenden Details flutete sie mein Hirn. Mein Keuchen erfüllte den Raum. Papa. Venedig. Tarot. Das Grand Hotel. Die großen Arkana. Malvolio. Cosima. Das Kartendeck.
Scheiße.
Mein Herz raste. Reflexartig fuhr meine Hand zu meinem Hals. Nichts. Trockene, glatte Haut. Ich schlug die Daunendecke zurück und kletterte aus dem Himmelbett. Wieso war ich hier aufgewacht? In diesem Zimmer? Wer hatte mich ins Bett gebracht?
Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte …
Malvolio. Der Junge, dem ich so vertraut hatte. Der Junge, der mich nach Strich und Faden belogen hatte. Sein Schrei. Seine weit aufgerissenen Augen, von Schock und Schmerz durchzogen. Die zweiundzwanzig Karten vor mir, beschmiert mit meinem Blut. Mit meinem und dem der anderen Nachfahren. Ich, mit einer Wunde am Hals und Entsetzen in den Augen. Wieso war es mir so vorgekommen, als hätte ich mich von außen betrachtet? Vermutlich lag es am Schock. Denn neben mir … Cosimas regungsloser Körper, das Messer in ihrem Brustkorb.
Cosima. Meine Mutter.
Du bist Lorenzos Tochter, durch und durch. Ich kann es mir nicht leisten, deinem Schwur zu glauben.
Meine Mutter, die mich hatte töten wollen.
Lebe wohl, Giulietta. Grüße Lorenzo, solltest du ihn wiedersehen. Ihr beide gehört zusammen.
Das Zimmer begann sich zu drehen, die Details verwischten erneut vor meinen Augen. Ich befand mich nicht in dem Raum, in dem alles sein Ende genommen hatte. Auf wackeligen Beinen wankte ich in den angrenzenden. Mein Herz schien vergessen zu haben, dass es schlagen sollte.
Ich schnappte immer wieder nach Luft, versuchte zu Atem zu kommen.
Endlich gelang es mir. Zumindest so lange, dass ich meine Umgebung erkennen konnte. Es war genau dieselbe Suite. Zimmer 121. Zweifellos. Das hier war Cosimas Zimmer. Und außer mir befand sich niemand in ihm. Hektisch scannte ich den Raum. Mir war mit einem Mal so schlecht. Keine Spur von den Karten. Keine Spur von Cosima oder Malvolio. Als sei alles nur ein böser Traum gewesen.
Meine Beine gaben nach. Im nächsten Moment kauerte ich auf dem rot-goldenen Teppich. Meine Finger berührten etwas Hartes. Ich zwang mich, den Blick darauf zu richten, und schreckte prompt zurück. Getrocknetes Blut. Cosimas? Meines?
Ein Schluchzen entwich mir. Natürlich. Natürlich war niemand hier. Ich hatte sie eingesperrt. Ich hatte das Einzige getan, was mir noch übrig geblieben war, nachdem Malvolio mir das Leben gerettet hatte. Um dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.
Du hast ein glückliches, erfülltes Leben vor dir.
Ich verspreche dir, du wirst eines Tages wieder Glück empfinden.
Seine Worte kamen von allen Seiten auf mich zu, verhöhnten mich.
Glück? Er hatte es gewagt, von Glück zu sprechen?
Ich kippte vornüber und atmete tief durch, während die Übelkeit immer schlimmer wurde. Der Schwindel. Mein Herzrasen. Oh Gott, das konnte alles nicht wahr sein. Ich war nach Venedig gekommen, um Antworten zu bekommen. Um herauszufinden, was mit Papa geschehen war.
Und jetzt? Was jetzt?
Plötzlich verschwand das Teppichmuster vor mir. Ich kniete noch immer auf dem Boden, doch ich befand mich nicht mehr im Hotel. Ich stand in der Küche eines Hauses, das bis vor Kurzem der sicherste Ort der Welt für mich gewesen war. Alles war noch genau so, wie es gewesen war, als Papa sich von mir verabschiedet hatte. Die hölzerne Küchentheke. Die Zeitungen auf dem Tisch. Die halb abgebrannte Kerze. Die Stühle mit den abgenutzten Polstern. Ich sah jedes Detail, ich hörte sogar die gewohnten Geräusche – die Gespräche unserer Nachbarinnen aus dem Garten nebenan, das Bellen eines Hundes –, und doch fühlte es sich nicht real an. Das hier war nicht real. Es war nichts als eine Erinnerung an ein Leben, das ich nie wieder zurückbekommen würde.
Im nächsten Augenblick stand ich nicht mehr in der Küche, sondern in dem Raum, in dem mein Plan, nach Venedig zu kommen, entstanden war. Notizzettel, vollgestopfte Bücherregale, Stifte, eine alte Schreibmaschine, der Globus. Papas Arbeitszimmer. Es roch nach Staub und Verwahrlosung, nicht nach seinem gewohnten Aftershave. Seit wie vielen Tagen war niemand mehr in diesem Zimmer gewesen?
Ich stolperte auf den Globus zu und tastete nach der Scherbe. Dabei rutschte das Armband an meinem Handgelenk nach vorn. Der Baum des Lebens. Die Weltseele. Ein Globus. Ich schluchzte so heftig auf, dass ich noch weniger Luft bekam. Er hatte überall Hinweise versteckt. Weil er sie geliebt hatte, oder? Er hatte sie geliebt, aber nicht wie mich. Alles, was er seit meiner Geburt getan hatte, war für mich gewesen.
Ich trat zurück und umklammerte mich selbst. Unaufhörlich strömten mir die Tränen über die Wangen.
Halte dich von Venedig und Tarotkarten fern.
Seine letzte Nachricht an mich war deutlich gewesen. Alles, was noch gefehlt hatte, war, mich vor seinem Bruder zu warnen. Doch zu dem Zeitpunkt hatte er nicht gewusst, dass sein Bruder ihn töten würde, oder? Sonst wäre er niemals in die Stadt der tausend Brücken ge–
Ein Schrei. Aus weiter Ferne ertönte ein Schrei.
Auf einen Schlag war die Erinnerung weg, und ich befand mich wieder im Hotel. Auf dem Teppichboden in der Suite meiner Mutter.
Stille. Als hätte ich mir nicht nur mein altes Zuhause, sondern auch den herzzerreißenden Schrei eingebildet. Ich stützte mich auf dem Boden ab und richtete mich mühsam auf.
Die Karten waren eingesperrt, aber ich befand mich nach wie vor im Hotel, das vom Mörder meines Vaters geleitet wurde.
In den Momenten, in denen du nicht für dich weiterleben kannst, lebe für ihn.
Malvolio hatte mich belogen und mich für seine Pläne benutzt, aber nicht alles, was er zu mir gesagt hatte, war Schwachsinn gewesen. Ich drängte den Schmerz zurück, die Verzweiflung und den Schock. Mein kühles, gefasstes Ich übernahm. Seit Papa tot war, hatte ich mich lang genug in Verdrängung geübt. Jetzt musste ich es noch einmal tun.
Ich rannte zurück ins Schlafzimmer und riss den Schrank neben der Kommode auf. Kleider in den verschiedensten Farben hingen dort. Teure, edle Stoffe und hauptsächlich ausgefallene Muster. Und dennoch hatte Cosima jedes Mal, wenn ich ihr begegnet war, ein und dasselbe Kleid getragen …
Ich beugte mich hinunter, öffnete alle drei Schubladen und wurde bei der letzten fündig. Masken. Dutzende venezianische Masken, manche bunt und auffällig, andere schlicht und einfarbig. Ich griff nach einer dunkelblauen, die das komplette Gesicht bedeckte, zog sie mir über und versuchte, mir das Stoffband an meinem Hinterkopf zusammenzubinden. Meine Finger zitterten so sehr, dass die Maske immer wieder herunterrutschte. Parallel achtete ich auf die Geräusche von draußen. Musik war zu hören. Musik und Gelächter. Der Karneval war im vollen Gange.
Mein Onkel könnte jede Sekunde hier reinplatzen. Immerhin hatte er mich auf dieses Zimmer hier bestellt, nachdem er mir am Telefon gesagt hatte, dass er Bescheid wusste. Ich musste weg. So schnell wie möglich.
Wo waren die Karten?!
Nein. Nein, nein, nein, das war jetzt die kleinste meiner Sorgen. Ich war die einzige Nachfahrin. Ich hatte sie eingesperrt, und nun würde ich ein für alle Mal diese verfluchte Stadt verlassen.
Endlich gelang es mir, das Band zu verknoten. Die Maske saß fest, sie hatte nur eine Augenöffnung. Mein Atem war heiß und stickig an meinem Gesicht. Und immer noch mehr als beschleunigt. Egal.
Blind tastete ich nach meiner Umhängetasche. Handy und Bargeld. Ich hatte alles bei mir, was ich gerade brauchte.
Ein letztes Mal ließ ich den Blick durch den Raum schweifen, drohte, an den Erinnerungen zu ersticken, dann stürzte ich zur Tür und auf den Flur. Ein paar Meter von mir entfernt befanden sich zwei maskierte Gestalten mit Perücken und Ballkleidern. Arm in Arm wankten sie in Richtung Treppe, kicherten, schienen mich nicht zu bemerken. Ich begann zu rennen. Mein Blick streifte die Nummer 113, als ich an dem Zimmer vorbeikam, mein Magen krampfte sich zusammen, doch ich rannte weiter. Weiter und weiter und immer weiter, bis ich die beiden Frauen überholte und die Treppe nach unten polterte. Das Atrium war immer noch voller Menschen in Karnevalskostümen. Wie vor nicht allzu langer Zeit, als ich ins Grand Hotel zurückgekehrt war, um mich mit Vincenzo zu treffen.
Niemand beachtete mich. Beide Concierge-Tische waren besetzt, doch die Mitarbeiter waren mit Neuankömmlingen und Touristen beschäftigt. Ich schnappte ein paar Satzfragmente auf, während ich mir meinen Weg zur goldenen Drehtür bahnte.
»… nur für dieses eine Foto, bitte! Der Hintergrund ist sooo abgefahren …«
»Signora, Sie befinden sich seit geschlagenen dreißig Minuten –«
Von Vincenzo war nichts zu sehen.
Meine Schritte beschleunigten sich. Der Portier, der beim letzten Mal schon neben der Tür gestanden hatte, nickte mir zu. Erkannte er mich an meinem Kleid oder dem Umhang?
Auch das war egal. Denn in diesem Moment betrat ich die Drehtür, und im nächsten beförderte sie mich schon ins Freie. Die eisige Februarluft war die reinste Erlösung. Ich unterdrückte ein erleichtertes Schluchzen und zwang mich, an Tempo zuzulegen, nachdem ich mein Handy hervorgezerrt und die Route zum Bahnhof Santa Lucia eingegeben hatte. Der Fußweg dauerte genauso lang wie der Wasserweg, und das Vaporetto, das an der Anlegestelle stand, sah ohnehin überfüllt aus. Für ein Wassertaxi fehlte mir das Geld, also schlängelte ich mich an einer Menschengruppe vorbei, die sich vor drei Jongleuren in roten Glitzeroutfits versammelt hatte, passierte zwei Jungen, einen dunkelhaarigen, der den Arm schützend um den kleineren, blonden gelegt hatte und sich nervös umschaute, als wären sie auf der Flucht, und bog in die enge Calle de le Rasse ein, ließ das Treiben vor dem Canal Grande hinter mir. Auch hier waren unzählige Menschen unterwegs, die meisten maskiert, und niemand würdigte mich eines Blickes.
Die Kälte half. Genau wie das ganz normale Treiben in den engen Gassen und auf den hübschen Brücken. In den Menschenmassen konnte man problemlos unsichtbar werden. Mein Kleid war zwar noch immer dasselbe, das ich auf dem Maskenball getragen hatte, und in jeder anderen Situation hätte ich mich umgezogen, weil ich die Erinnerungen an diese Nacht nicht ertrug, aber dafür war jetzt wirklich keine Zeit. Und außer den Kartenfiguren würde mich niemand darin erkennen. Die Figuren befanden sich dort, wo ich sie eingesperrt hatte – im originalen Tarotkartendeck. Ich hatte nichts zu befürchten. Vincenzo würde mich nicht finden. Trotzdem stülpte ich mir die Kapuze des Umhangs über den Kopf.
Ich war so beschäftigt damit, mich nicht zu verlaufen, dass meine Verzweiflung im Hintergrund blieb. Ich spürte sie. Natürlich tat ich das. Sie zerrte an mir, wenn ich auch nur für den Bruchteil einer Sekunde die Konzentration verlor, doch ich kämpfte gegen sie an. Ich kämpfte, wie Papa es gewollt hatte, versuchte, nicht an Schreie und an unbändigen Hass, an blutbeschmierte Karten und dunkelgrüne Augen, an warme Haut auf meiner, an regungslose Körper auf kalten Fliesen oder teuren Teppichböden, an Verrat und Schmerz und Todesangst zu denken.
Als ich gerade die Holzbrücke mit den vier Obelisken, die ich zuletzt bei einer nächtlichen Gondelfahrt gesehen hatte, überquerte, vibrierte mein Handy, und der Name meines Onkels erschien auf dem Display. Ich zuckte so sehr zusammen, dass ich das Teil um ein Haar fallen gelassen hätte. Für einen Moment blieb ich stehen und konnte mich nicht rühren. Mein Körper verharrte in Schockstarre, mein Herz ratterte unregelmäßig in meiner Brust. Die kostümierten Menschen strömten an mir vorbei, rempelten mich an, zischten mir Vorwürfe zu.
Reiß dich zusammen, Giulietta.
Mit bebenden Fingern schaltete ich mein Handy aus und ließ es in meine Umhängetasche gleiten. Von hier aus waren es nur noch fünf Minuten geradeaus. Der Bahnhof war nicht zu verfehlen. Vincenzo hatte Kontakte bei der Polizei, nicht wahr? Hatte er Papas Tod mithilfe von seinen Bekannten vertuscht? Würden diese ihm auch dabei helfen, mich aufzutreiben? Würden sie mein Handy tracken?
Nein. Eins nach dem anderen. Erst ein Zugticket. Dann raus hier. Sobald ich mich nicht mehr in der Stadt befand, hatte ich immer noch Zeit, mich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen. Ich würde einen Weg finden, Noemi und Speranza einzuweihen. Sie glaubten an Tarotkarten. Vielleicht würden sie diese abgefahrene Geschichte auch glauben. In jedem Fall würden sie sich auf meine Seite schlagen. Bei ihnen war ich sicher.
Mein Atem war kaum mehr als ein Keuchen, meine Beine waren bleischwer, doch ich zwang mich weiterzurennen. Scheiß auf meine miserable Ausdauer. Das Adrenalin peitschte durch meine Adern und half mir dabei durchzuhalten.
Vor nicht allzu langer Zeit war ich bereit gewesen aufzugeben, jetzt schrie alles in mir nach Flucht. Ich hörte Papa nicht mehr in meinem Kopf. Keine tröstenden Worte, keine Unterstützung. Die Zeit der Illusionen war vorbei. Ich war vollkommen auf mich allein gestellt, und doch war es genug.
Der Bahnhof kam in Sicht. Ich quetschte mich an den Souvenirständen und den Menschen vorbei, die unzählige Fotoshootings vor dem Kanal veranstalteten, und hastete die Treppen nach oben, wobei ich einen Taubenschwarm aufscheuchte. Als ich auf der letzten Stufe angekommen war, drehte ich mich ein letztes Mal um. Nur einen Herzschlag lang.
Die Masken, die prachtvollen Kleider, die Wasserbusse, die Gondeln, die Nachmittagssonne, die die Wasseroberfläche glitzern ließ.
Auf Nimmerwiedersehen, Venedig.
Dann drehte ich mich um.
Die nächsten Minuten vergingen rasend schnell. Ich checkte die abfahrenden Züge, realisierte, dass in Kürze ein Direktzug nach Rovigo fuhr – ein weiterer Glücksfall inmitten dieses Desasters, es wurde nicht mal ein Zwischenhalt eingelegt, alles würde gut werden, bald, bald, bald war ich weg –, kaufte mir mit meinem letzten Bargeld ein Ticket und rannte in die richtige Richtung. Der abgenutzte rot-silberne Trenitalia-Zug fuhr genau in dem Moment ein, in dem ich schwer atmend am Gleis ankam. Er war nicht besonders voll. Um diese Zeit kamen die meisten Leute nach Venedig, sie verließen es nicht.
In einem fast leeren Abteil ließ ich mich auf einen Zweisitzer fallen. Presste die Augen zusammen, presste meine Finger auf meine stechenden Seiten. Während ich meine Atemzüge zu kontrollieren versuchte, lauschte ich der elektronischen Ansagestimme, die alle Passagiere willkommen hieß.
Ich würde warten, bis wir die Stadt verlassen hatten, dann würde ich bei Noemi und Speranza anrufen und sie bitten, mich am Bahnhof von Rovigo abzuholen.
Obwohl mir der Schweiß unter der Maske über die Haut rann, nahm ich sie nicht ab. Es war unwahrscheinlich, dass mich jemand erkannte, aber ich durfte kein Risiko eingehen. Allerdings traute ich mich, die Kapuze abzusetzen. Das war okay. Es war viel zu heiß.
Mein Herzschlag beruhigte sich kein bisschen. Auch nicht, als der Zug sich in Bewegung setzte. Ich schlug die Augen auf und starrte durch die milchige Scheibe nach draußen auf den Bahnhof.
Meine Gedanken überschlugen sich. Die Karten waren nicht mehr im Hotelzimmer gewesen, als ich aufgewacht war. Was passierte mit dem Kartendeck, nachdem man das Ritual vollendet hatte? Verschwanden sie an einen bestimmten Ort? Oder war jemand ins Zimmer gekommen und hatte sie an sich genommen? Ich hätte Malvolio nach mehr Informationen fragen sollen, als ich noch die Chance dazu gehabt hatte …
Kopfschüttelnd richtete ich meinen Blick auf meine zitternden Finger. Es war egal, wo das Deck war. Ich hatte die Karten eingesperrt, und ich war die Einzige, die die Macht hatte, sie jemals wieder zu befreien.
Aber was, wenn Vincenzo mich erpressen würde? So wie er höchstwahrscheinlich meinen Vater erpresst hatte, sie zu befreien, ehe er ihn ermordet hatte?
Es würde kein Ende haben, oder? Nicht, solange ich am Leben war und Vincenzo die Freiheit der Kartenfiguren wollte. Er war wahnsinnig. Und außerdem war er verrückt nach Cosima.
Die Übelkeit kehrte mit voller Wucht zurück. Ich beugte mich vor, während mein Magen sich zusammenkrampfte.
Alles gut. Ich würde eine Lösung finden. Alles gut. Dann würde ich mich eben verstecken.
Um mich abzulenken, schaute ich wieder nach draußen. Gerade flog das »Venezia Mestre«-Schild an uns vorbei, wir legten an Tempo zu, und da geschah es.
In einer Sekunde saß ich noch auf meinem Sitz, den Blick aus dem Fenster gerichtet, in der nächsten wurde ich von einer unsichtbaren Macht nach oben gezerrt. Es ging alles viel zu schnell. Ohne dass ich es ihnen befahl, bewegten sich meine Beine mit beängstigender Geschwindigkeit. Einen Moment später befand ich mich vor den Automatiktüren, durch die ich vor wenigen Minuten den Zug betreten hatte. Mein Körper schien mir nicht mehr zu gehorchen. Meine Hände schnellten nach vorn, quetschten sich durch den Spalt zwischen den beiden Türen und zerrten daran. Ein scharfer Schmerz durchzuckte mich, doch ich gab nicht nach.
Ich japste. Was zur Hölle tat ich hier? Was geschah mit mir?
Der Zug fuhr weiter, die Umgebung draußen flog an uns vorbei. Das Gefühl, gefangen zu sein, in der Klemme zu sitzen, nahm alles ein. Widerstand war zwecklos. Mit gesammelter Kraft versuchte ich, die Türen zu öffnen, und als sie nicht nachgaben, trat ich einen Schritt zurück, holte mit einem Bein aus und donnerte meinen Fuß gegen das Glas. Ein Krachen ertönte, dicht gefolgt von einem Schrei. Ich wankte durch den Aufprall zurück.
War ich es, die schrie?
Der verdammte Zug wurde nicht langsamer. Warum wurde er nicht langsamer?
Warum sollte er langsamer werden? Was war los mit mir?
Schon wieder holte ich aus und kickte gegen das Glas. Diesmal zersprang es. Die Öffnung war nicht groß genug, also holte ich mit meinen Händen aus. Irgendwann hatte ich sie zu Fäusten geballt.
Träumte ich? War das real? Wieso konnte ich mich nicht gegen die Reflexe meines Körpers wehren?
Wieder erklang ein Schrei. Diesmal war ich mir sicher, dass es nicht meiner war. Hektisches Stimmengewirr in meinen Ohren. Die anderen Passagiere wurden auf mich aufmerksam. Doch ich achtete nicht auf sie – ich vollendete mein Werk. Ein letztes Mal nahm ich Anlauf, und dann ließ ich mich mit meinem gesamten Körpergewicht gegen die zerbrochene Scheibe fallen.
Ich spürte die Glassplitter auf meiner Haut, spürte den Schmerz, spürte die Panik, doch es spielte keine Rolle, nichts spielte eine Rolle, denn im nächsten Augenblick kam ich auf dem harten Asphalt auf, direkt neben den Gleisen.
Die Wucht des Aufpralls nahm mir alle Sinne, schillerndes Rot flackerte über mein Sichtfeld, aber mein Körper blieb nicht liegen, obwohl mich der Schmerz zu zerreißen drohte, ich rollte mich zur Seite, keine Sekunde zu früh, während der Zug an mir vorbeidonnerte. Sein Knattern vermischte sich mit den Schreien und wurde rasch von einem kräftigen Krachen über mir verschluckt.
Ich drehte mich auf den Rücken, halb gefrorene Grashalme unter mir, und starrte zum Himmel hoch, der sich in Sekundenschnelle verdunkelte. Ich blieb liegen, bis der Zug vollständig aus meinem Blickfeld verschwunden war und die ersten Regentropfen auf meine Maske trafen.
Als ich mich aufrichtete, spürte ich überhaupt nichts. Keine Spur vom Schmerz. Das musste das Adrenalin sein. Ich streckte meine Hände aus, schaute auf die Innenflächen, wo das zersplitterte Glas auf meine Hand getroffen war. Nichts. Nicht mal rote Striemen. Meine Haut war unversehrt.
Ich warf einen Blick zurück. Die Bahnstation Venezia Mestre war in der Ferne noch zu sehen. Vor mir lag nichts als gähnende Leere. Gleise inmitten von kahlen Bäumen.
Ich riss mir die Maske vom Gesicht, schmiss sie ins Gras. Versuchte verzweifelt, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ohne es zu wollen, war ich aus einem fahrenden Zug gesprungen. Einem Zug, der mich nach Rovigo und in Sicherheit gebracht hätte.
War ich vollständig verrückt geworden? War das der Schock?
Ich fühlte mich nicht verrückt. Ich fühlte mich normal. Viel zu normal dafür, dass ich gerade etwas absolut Irres getan hatte. Und dass jeder Zentimeter meines Körpers hätte schmerzen sollen.
Ganz langsam drehte ich mich um meine eigene Achse. Niemand hatte mich gezwungen, aufzustehen und aus dem Zug zu springen. Und doch hatte es sich nicht wie mein eigenes Werk angefühlt. Oder wie mein eigener Wille …
Mein Atem stockte. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen. Lief ein, zwei, drei Schritte in die Richtung, in die der Zug weitergefahren war.
Alles okay. Es ist alles okay, Giulietta. Du bist nicht verrückt. Du bist nur ein bisschen durch den Wind.
Ich hatte gerade den vierten Schritt tun wollen, doch ich kam nicht weit. Im nächsten Augenblick traf ich auf eine unsichtbare Barriere und wurde mehrere Meter nach hinten geschleudert. Unsanft kam ich auf dem harten Boden auf. Mein Keuchen erfüllte die Luft. Ein paar Sekunden konnte ich nichts tun, außer dort zu kauern und auf die Stelle zu starren, an der ich zurückgeworfen worden war. Dann rappelte ich mich auf und wagte einen neuen Versuch. Wurde wieder nach hinten geschmissen. Der Schock trat in den Hintergrund, denn diesmal war ich darauf vorbereitet.
Dafür kroch etwas anderes aus den Untiefen meines Herzens hervor. Erkenntnis. Eine grausame, absolut wahnsinnige Erkenntnis. Nein. Das war unmöglich. Mit aller Macht drängte ich sie zurück und wiederholte das Prozedere. Ich versuchte andere Stellen, versuchte es mit Anlauf.
Zwecklos.
Die Erinnerung traf mich aus dem Nichts. Worte, die in einer Gondel bei Nacht gesprochen worden waren. Es kam mir wie Monate vor, dass Malvolio und ich dort gesessen und er diese Geschichte mit mir geteilt hatte, obwohl es nur Tage zurücklag.
Wieso diese Stadt?, hatte ich ihn gefragt.
Weil das Kartendeck hier entworfen wurde. Weil der Fluch hier begann, in dem Gebäude, in dem sich heute das Grand Hotel Visconti befindet. Die Figuren sind an die Stadt gebunden. Sie können Venedig niemals verlassen.
Meine Knie gaben nach.
Erst lachte ich. Dann schrie ich.
KAPITEL 2Vorschnelle Schlüsse
Chi troppo vuole, nulla stringe.
(Wer zu viel will, hält nichts fest.)
Am Anfang fühlte es sich stets nach Seelenfrieden an. Als erwache man aus einem besonders entspannten Schlaf, in dem man von den schönsten Dingen geträumt hatte, die diese Welt für uns bereithielt.
Ich schlug die Augen auf, und wie so oft fand ich mich in meinem Hotelzimmer wieder. Schwarz. Silber. Purpurrot. In meinem Hotelzimmer, von dem ich gedacht hatte, es nie wiederzusehen.
Mein Körper verlangte danach, den Augenblick auszudehnen, den Frieden zu genießen, doch ich zwang mich aufzustehen. Es war jedes Mal dasselbe. Welch grausame Ironie, dass der Fluch uns zu Beginn vorgaukelte, in Sicherheit zu sein. Vollkommen. Glücklich.
Nein, es war nicht dasselbe. Ich wankte in die Richtung meines Balkons, zerrte die schweren Vorhänge beiseite, öffnete die Tür und trat nach draußen. Der kalte Wind peitschte mir entgegen und ließ meine Haare nach hinten flattern. Ein Blick nach unten genügte. Mir bot sich das gleiche Bild wie beim letzten Mal, als ich bei Bewusstsein gewesen und mit Panik im Herzen zum Grand Hotel gerannt war, weil ich aufgewacht war und das Bett, in dem ich mit Giulietta eingeschlafen war, leer vorgefunden hatte.
Karneval. Die Musik, die Kostüme. Es bestand kein Zweifel. Und es war ohnehin die einzig logische Erklärung. Giulietta war die einzige Nachfahrin.
Das Mädchen aus meinen Albträumen. Sie und ich in Cosimas Suite. Sie und ich und ihre Schattengestalt. Die Wunde an ihrem Hals. Das Blut auf den Karten. Cosimas Blut, das den Teppich tränkte. Die Ziffern über ihrer Gestalt, die in Rekordschnelle verblassten. Mein Schrei. Eine Erkenntnis, die zu spät kam.
»Giulietta«, brachte ich hervor. Alles in mir zog sich zusammen.
Der Fluch.
Und schließlich kam die Erleichterung. Ich konnte nichts dagegen tun. Es sprach gegen alles, was ich die letzten Jahrhunderte über empfunden hatte, und doch durchströmte sie mich von oben bis unten.
Es hatte nicht funktioniert. Giulietta hatte versucht, uns einzusperren, doch es hatte nicht funktioniert, weil sie nicht nur die letzte Nachfahrin, sondern nun selbst eine Karte der großen Arkana war. Ich hatte ihr nicht das Leben genommen. Ich …
Die Erleichterung hielt nicht lange an.
Ich hatte sie nicht zu einer Ewigkeit in den Karten verdammt, jedoch zu einer Ewigkeit mit dem Fluch. Ihr menschliches Leben war vorbei, und ich trug die Schuld daran. Weil ich als einzige Karte in der Lage war, einer anderen das Leben zu nehmen. Ich hatte Cosima nur das Messer in die Brust gerammt, um Giulietta zu schützen. Niemals hätte ich damit gerechnet, sie wahrhaftig zu töten.
Es war nicht von Bedeutung. Es ging um die Konsequenzen, nicht um meine Intention.
Der Selbsthass wollte mich mitreißen. Mich in seine Tiefen ziehen. Es war nahezu unmöglich, ihm zu widerstehen.
Meine Gedanken drehten sich, mit jeder Sekunde kamen neue hinzu. Ich war nicht nur in der Lage, mich selbst, sondern auch andere Karten zu töten. Cosima war tot. Giulietta kannte die ganze Wahrheit und hatte den Platz ihrer Mutter eingenommen. Sie hatte zuvor versucht, uns einzusperren, doch es hatte nicht funktioniert – vermutlich waren wir alle einfach wieder in unsere Zimmer geschleudert worden.
Es war kaum Zeit vergangen, nicht wahr? Was bedeutete, Giulietta befand sich zu dieser Sekunde in ihrer Suite und verstand nicht, was mit ihr geschah. Und dann war da noch Vincenzo. Der Hoteldirektor mit dem Magiefanatismus, der seinen eigenen Bruder getötet hatte. Der mit dessen Frau anbandelte. Der mit ihr einen Pakt geschlossen hatte, um Giulietta aus dem Weg zu räumen. Hatte er Cosima geliebt? Oder war sie Mittel zum Zweck gewesen, da er mit ihr der Magie näher sein und sich an Lorenzo rächen konnte?
Ich schüttelte den Kopf, fuhr mir durch die Haare, zerrte daran, bis der Schmerz mir die Tränen in die Augen trieb und mich erblinden ließ.
Meine allererste Priorität war es, das Geschehene so lange wie möglich zu verbergen. Vor Vincenzo, vor den anderen. Ich brauchte Zeit. Giulietta brauchte Zeit. Niemand durfte erfahren, was ich getan hatte. Was ich in der Lage war, zu tun …
Mit großen Schritten ging ich zur Tür und riss sie auf, rannte los in Richtung Zimmer 121. Dabei lief ich beinahe in ein Zimmermädchen hinein, das gerade damit beschäftigt war, einen Servierwagen den Flur entlangzuschieben. Sie war jung, hatte ein schmales Gesicht und kleine runde Augen. Sie kam mir bekannt vor, doch sicher sein konnte ich mir nicht. Ihr Todesdatum ignorierte ich geflissentlich.
»Bitte … bitte entschuldigen Sie.«
»Gar kein Problem«, erwiderte sie mit einem strahlenden Lächeln. »Kann ich etwas für Sie tun?«
Erst schüttelte ich den Kopf, dann überlegte ich es mir anders. Ich benötigte Sicherheit. »Würden Sie mir bitte das Datum des heutigen Tages nennen?«
Ohne Umschweife nannte sie es mir.
Tiefe Atemzüge.
»Und welches Jahr?«, wisperte ich.
Jetzt flackerte Verwirrung in ihren Augen auf. Ihre Stimme klang, als sei sie sich nicht sicher, ob ich mir einen Scherz erlaubte, doch ihre Antwort bestätigte mir meine Vermutung.
Natürlich hatte ich mich nicht getäuscht. Es war die einzige Möglichkeit.
»Herzlichen Dank.« Ich rang mir ein Lächeln ab und wollte gerade meinen Weg fortsetzen, da ertönten Schritte hinter uns.
Sobald ich mich umgedreht hatte, erstarrte ich.
Vincenzo Visconti stürmte den Flur entlang, geradewegs auf uns zu. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hatte er dasselbe Ziel wie ich. Ohne zu überlegen, stellte ich mich ihm in den Weg.
Er sah übernächtigt aus. Das breite Gesicht wirkte irgendwie aufgequollen, die Tränensäcke unter seinen Augen ausgeprägter als sonst, aufgeplatzte Äderchen umgaben sie, und eine wilde Mischung aus Emotionen kam mir aus seinem Blick entgegen.
Für ein paar Sekunden erinnerte ich mich an damals. An unseren längsten Aufenthalt im Grand Hotel. An eine Zeit, in der Vincenzo sogar jünger als ich gewesen war. Er war gerade erst adoptiert worden, in einem Alter, das ungewöhnlich für eine Adoption war. Viele von uns hatten sich damals gefragt, was den ehemaligen Hoteldirektor und Giuliettas Großvater Edoardo Visconti geritten hatte. Sein leiblicher Sohn Lorenzo hatte keinerlei Interesse an der Magie gehabt, doch weshalb hatte er sich einen x-beliebigen Jungen ausgesucht? Pure Nächstenliebe? Oder das Bedürfnis, einen willigen Zuhörer zu haben? Edoardo war mir nie besonders selbstsüchtig vorgekommen. Er hatte uns studieren wollen, aus Faszination, nicht aus Gier. Unzählige Male hatte ich mich mit ihm bei einem Aperitivo am Kanal oder auf der Dachterrasse unterhalten. Mein Plan war es gewesen, ihm so viele Informationen wie möglich zu entlocken, doch darüber hinaus war er eine äußerst angenehme Gesellschaft gewesen. Sein Adoptivsohn war anders. Bereits damals hatte ich den Wahnsinn in seinen Augen gesehen. Nur hatte ich ihm nie sonderliche Beachtung geschenkt, denn Vincenzo besaß das Gen nicht und war somit unbrauchbar für mich gewesen. Außerdem war er an Durchschnittlichkeit nicht zu übertreffen. Er war immer zurückhaltend gewesen, hatte sich im Hintergrund gehalten. Wie ich. Das hätte meine größte Warnung sein sollen. Unscheinbare Menschen wie wir waren diejenigen, vor denen man sich am allermeisten in Acht nehmen sollte.
»Signor Visconti!«, rief ich aus und packte ihn an den Schultern, als seien wir gute Freunde und hätten uns viel zu lange nicht mehr gesehen. »Wie geht es Ihnen?«
Er riss sich los und versuchte, sich an mir vorbeizudrücken, was ich gekonnt verhinderte. »Lass mich durch, Junge.«
Mein Lächeln wurde breiter. Interessant, dass er so gar keine Angst vor mir zu haben schien. Immerhin war ich bei Lorenzos Tod dabei gewesen und könnte diese Information jederzeit gegen ihn verwenden. Hatte Cosima ihm erzählt, dass er nichts zu befürchten hatte? Dass ich ungefährlich war und nicht die geringste Ahnung hatte, wer Lorenzos Mörder war?
»Signor Visconti, wir hatten bisher noch keine Möglichkeit, uns näher zu unterhalten«, fuhr ich seelenruhig fort, obwohl in meinem Inneren eine Explosion nach der anderen stattfand.
Er schien um Fassung zu ringen und packte mich, um mich beiseitezuschieben. »Hast du Giulietta gesehen?« Die Worte kamen gepresst. Schweißtropfen glänzten auf seiner Stirn.
Ich runzelte die Stirn. »Giulietta?«, wiederholte ich, als hörte ich den Namen zum ersten Mal.
»Meine Nichte«, zischte er.
»Oh! Oh, ja, ein hübsches Mädchen. Sie haben sie knapp verpasst. Vor Kurzem kam sie hier vorbei.« Ich deutete in Richtung Treppe. »Sah aus, als wollte sie sich den Karneval ansehen. Ich bin mir recht sicher, dass sie inzwischen das Hotel verlassen hat.«
Er warf einen Blick über seine Schulter, dann schaute er wieder zurück zu mir. Seine Brust hob und senkte sich hektisch. Was auch immer in ihm vorging, meine Antwort war nicht die, die er hatte hören wollen.
Gut. Hoffentlich würde sie ihn lang genug ablenken.
Bevor ich noch etwas sagen konnte, flog ein paar Meter von uns entfernt eine Zimmertür auf, und heraus kam Fortuna. Mit zerzausten Haaren, einem verrutschten Ballkleid und Verwirrung auf dem Gesicht.
»Heee, Kleiner, willst du mit auf einen Grappa kommen?«, rief sie in meine Richtung. Das Lallen in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
Vincenzo nutzte den Moment, in dem ich abgelenkt war, und stieß mich weg. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich ignorierte Fortuna und rannte dem Hoteldirektor hinterher. Der goldene Schlüssel blitzte in seiner Hand auf.
Ich musste irgendetwas tun. Er durfte Giulietta nicht in Cosimas Zimmer finden. Genauso wenig wie das Kartendeck. Durfte Cosimas Leiche nicht sehen … Er würde den Verstand verlieren. Und viel zu schnell verstehen, was geschehen war. Vincenzo kannte die Regeln der Magie. Er hatte sie sein Leben lang genauso intensiv studiert wie ich. Vermutlich noch intensiver. Auch wenn Edoardo immer vorsichtig gewesen war, welche Informationen er mit seinem Adoptivsohn teilte. Obwohl der Hoteldirektor bei der Adoption womöglich noch geglaubt hatte, in Vincenzo einen Verbündeten gefunden zu haben, war schnell klar geworden, dass dieser ein bisschen zu interessiert an der Magie war – und das aus egoistischen Gründen.
Endlich erreichte ich ihn. Ich packte ihn an beiden Schultern, zerrte ihn weg vom Zimmer, an die gegenüberliegende Wand. Er war größer als ich und mit großer Wahrscheinlichkeit auch stärker. Aber er schien kurz vor dem Kontrollverlust zu stehen. Und ich war unsterblich, soweit er wusste. Er nur ein Mensch. Also hatte ich einen Vorteil.
Mit Mordlust in den Augen packte er mich und machte Anstalten, mich wegzuschieben.
»Davide«, brachte ich hervor, weil es das Erste war, was mir in den Sinn kam. Für den Moment war es mir gleich, dass ich damit zu viel Aufmerksamkeit auf mich zog. Zu viel Aufmerksamkeit darauf, dass ich nicht lediglich eine depressive Kartenfigur war, die sich um nichts als ihren eigenen Schmerz scherte. »Der Küchenjunge. Sie haben seinen Mord vertuscht, habe ich recht?«
Vincenzo erstarrte. Sein Blick veränderte sich. Als sähe er mich zum ersten Mal richtig.
»Wovon redest du?«, erwiderte er nach einer kurzen Pause, in der weitere Zimmertüren hinter uns aufflogen. Ich schenkte ihnen keine Beachtung, hielt seinem Blick stand. Solange die allerletzte Tür sich nicht öffnete, war alles in Ordnung.
»Ich habe Sie belauscht«, fuhr ich fort und zwang mich zu einem Lächeln, obwohl es mir sämtliche Kräfte raubte. »Cosima und Sie.«
Als ich Cosimas Namen aussprach, schüttelte es ihn plötzlich am ganzen Leib. Der Sturm in seinen Augen war nicht zu übersehen, und ehe ich etwas dagegen tun konnte, hatte er mich zur Seite gestoßen und war zur Tür 121 gelaufen. Gerade wollte ich mich wieder auf ihn stürzen, doch da erschien Maurizio vor mir. Ich hatte ihn nicht kommen hören.
»Alles in Ordnung mit dir?«
»Nicht jetzt«, knurrte ich und drückte mich an ihm vorbei. Als ich die letzte Suite erreicht hatte, war es zu spät. Vincenzo hatte die Tür in Sekundenschnelle geöffnet und verschwand gerade im Zimmer. Ich lief ihm hinterher, als könnte ich das Unheil damit abwenden. Wollte etwas sagen, ein letzter verzweifelter Versuch, ihn abzulenken, da ging er ein paar Meter vor mir in die Knie. Auf dem Teppichboden, auf dem vor wenigen Minuten Cosimas Leiche gelegen hatte. Seine Finger tasteten nach dem Blut. Mein Herzschlag schien nicht nur meinen Körper, sondern das gesamte Hotel zum Beben zu bringen. Ich setzte einen Fuß vor den anderen, durchsuchte die gesamte Suite, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Vincenzo zu abgelenkt war. Nichts. Wir waren allein.
Weder Giulietta noch Cosima waren zu sehen. Und auch das Kartendeck war spurlos verschwunden.
KAPITEL 3Schatten
Es dauerte weniger als eine Minute, um wieder ins Zentrum Venedigs zu gelangen, und das, obwohl ich mich keinen Zentimeter von der Stelle rührte.
Ich starrte auf die unsichtbare Barriere vor mir, versuchte sie zum tausendsten Mal zu durchbrechen, scheiterte, zum tausendsten Mal, und dann … dann verschwanden die Gleise, und ich befand mich zwischen maskierten, feiernden Menschen auf einer der unzähligen Brücken Venedigs.
Kaum jemand schien sich daran zu stören, dass eine junge Frau von einem Moment auf den anderen vor ihnen auftauchte. Nur ein kleiner Junge starrte mich mit großen runden Augen an und zog am Rock seiner Mutter, um ihr zu zeigen, was er entdeckt hatte.
Als sie den Blick hob, war es bereits zu spät.
Es dauerte weniger als eine Sekunde, bis meine Umgebung erneut vor mir verschwamm. Der Geräuschpegel blieb, die Musik, das Gelächter, ebenso wie der Geruch nach Schminke und Schweiß und Kanalwasser, doch mit einem Mal befand ich mich nicht mehr in Venedig, sondern in meinem Heimatdorf. Mein dröhnender Herzschlag verschluckte alle anderen Geräusche.
Ich war nicht in unserer Küche gelandet wie beim letzten Mal, sondern zwischen den Ruinen einer antiken Villa, in einem verschneiten Rosengarten, der sich keine vierhundert Meter von unserem Haus entfernt befand. Ich war allein. Der Garten war das ganze Jahr über frei zugänglich, obwohl im Februar selten jemand hier zu sehen war. Nur Papa und ich waren Wochenende für Wochenende hergekommen, egal zu welcher Jahreszeit, egal ob es wie aus Eimern schüttete oder die Sonne am Himmel stand. Das schlechte Wetter war uns sogar lieber, denn so waren wir für uns. Wie oft waren wir hier entlangspaziert? Wie oft hatte ich ihn mit Fragen gelöchert? Wie oft hatte er mich getröstet, wenn sie sich in der Schule über mich lustig machten?
Wenn er auf Geschäftsreisen war, war ich manchmal allein hergekommen. Es war nie dasselbe. Papas Anwesenheit hatte mir immer gefehlt. Und trotzdem hatte mich etwas davon abgehalten, einen anderen Menschen zu diesem Ort mitzunehmen. Nicht mal die Tarotkarten nahm ich mit. Der Ort gehörte Papa und mir. Ich wollte ihn für uns bewahren.
Auch heute war ich allein.
Ich ging zu Boden, und meine Finger trafen auf den unberührten Schnee. Sie wirkten irgendwie gräulich und durchsichtig … unecht. Ich grub sie tief hinein, bis ich die gefrorene Erde darunter spürte und die Kälte die anderen Empfindungen übertönte. Ein trockenes Schluchzen entwich mir. Es klang nicht menschlich. Die Farbe der Ruine zerfloss mit dem Schneeweiß. Alles drehte sich. Der Sauerstoff erreichte mich nicht.
»Unmöglich«, brachte ich hervor. Es war unmöglich. Ich wiederholte das Wort so oft, bis es seinen Sinn verlor. Un-mög-lich.
Aber es gab noch etwas, was unmöglich war. Von einer Sekunde auf die andere seinen Standort wechseln. Mit kaum mehr als einem Wimpernschlag. Mit kaum mehr als einem Gefühl.
Meine Umgebung drehte sich immer schneller. Was war real? Was der Schock? War ich überhaupt wach? Lag ich im Koma? Wurde ich wahnsinnig?
Geh zurück. Zähl die Fakten auf. Klammere dich an ihnen fest. Du schaffst das. Und atme. Verdammt noch mal, du musst atmen!
Ich war in Cosimas Hotelzimmer erwacht. In ihrem Bett. Allein. Dann war ich aufgestanden, und meine Knie hatten nachgegeben. Die Erinnerungen waren zu viel für mich gewesen. Ich hatte mir eingebildet, in unserem Haus zu stehen. Dann in Papas Arbeitszimmer. Doch die Einbildung hatte nicht lange angehalten – ich war zurück ins Hotelzimmer gekehrt. Das war real.
Aber die Küche und der chaotische Raum hatten sich auch real angefühlt … Genau wie der eisige Schnee an meinen Händen. Ich blickte auf, zwang mich, über die Schulter zu schauen, zum Eingangstor des Gartens. Es war verschlossen. Dahinter waren die ockerfarbenen Häuser meines Heimatdorfes zu sehen.
Ich hob beide Hände und presste sie mir aufs Gesicht, schauderte vor Kälte, schrie fast auf. Das war kein Traum. Kein Traum fühlte sich so beschissen echt an. Und es war auch kein Traum gewesen, dass ich in diesen Zug gestiegen und nach Rovigo hatte fahren wollen. Bis mich eine unsichtbare Macht dazu verleitet hatte, die Scheibe zu zerbrechen und aus dem Zug zu springen.
Weil es unmöglich für mich war, Venedig zu verlassen.
Ich schüttelte den Kopf, hin und her, immer wieder, bis der Schwindel unerträglich und mir kotzübel wurde. Und dann dachte ich an Cosima. An die Frau in dem altrosafarbenen Ballkleid vor unserem Haus, kurz nach Papas Tod. An meine Mutter, deren tränenverschmiertes Gesicht mich schon verfolgt hatte, bevor ich auch nur einen Fuß in diese verdammte Stadt gesetzt hatte.
Schließlich kehrten Malvolios Worte zurück, glasklar hallten sie in mir wider, als würde er sich direkt in meinem Kopf befinden.
Ihr Talent ist die Replikation. Cosima kann eine Kopie von sich selbst erzeugen. Diese Kopie enthält Teile ihres Bewusstseins und sieht so aus wie sie, sie hört und sieht alles, was sich in ihrer Umgebung abspielt, doch sie ist kein eigenständiger Mensch. Sie wird durch Cosima gesteuert, die ihr Bewusstsein aufteilen muss, um an zwei Orten gleichzeitig sein zu können. Dieser Schatten kann Venedig verlassen, Cosima selbst nicht.
Ich würgte, keuchte heftiger, kippte vornüber. Doch plötzlich befand ich mich nicht mehr am selben Ort. Die Karnevalsgeräusche waren immer noch im Hintergrund zu hören, aber ich war nicht im Zentrum Venedigs. Und ich kniete nicht mehr auf dem Boden in dem Garten, sondern stand vor einem Haus, das wie Papas und meines aussah. Und das sich nur wenige Meter neben unserem befand.
Ich presste meine Nase gegen die Fensterscheibe und eine Hand vor meinen Mund, damit mein Schluchzen nicht entweichen konnte. Von hier aus hatte man den perfekten Blick ins Wohnzimmer. Die geblümten Vorhänge ließen einen Spalt frei. Hier hatte niemand Angst, beobachtet zu werden. Jeder kannte jeden. Man hatte nichts zu befürchten.
Noemi und Speranza lagen Arm in Arm auf dem Sofa. Der alte Fernseher lief. Der Rauch der Räucherstäbchen stieg hinter ihnen in die Luft. Speranza döste, Noemi löste den Blick nicht von ihr, während sie ihr zärtlich durchs Haar fuhr. Sie trugen beide Pyjamas, die ich schon unzählige Male an ihnen gesehen hatte. Dunkelgrün und pastellblau. Auf dem kleinen Holztisch vor ihnen war ein Kartendeck zu sehen. Mein Magen drehte sich um. Ich musste nur meine Hand ausstrecken, nur wenige Zentimeter, und auf die Klingel drücken. In ein paar Sekunden könnte ich mich in ihre Arme werfen und mich trösten lassen. Das hatte ich doch gewollt. Nach Hause kommen. Zu ihnen zurückkehren und gemeinsam nach einer Lösung suchen.
Nur dass ich nicht wirklich hier war. Ich war nichts als ein Schatten.
Die Verzweiflung übermannte mich. Ich konnte den Schrei nicht unterdrücken. Ich zuckte selbst vor seinem Klang zurück. Und auch Noemi fuhr zusammen. Ihr Kopf ruckte hoch. Doch bevor sie sich einen Reim darauf machen konnte, wer da vor ihrem Haus stand, war ich verschwunden.