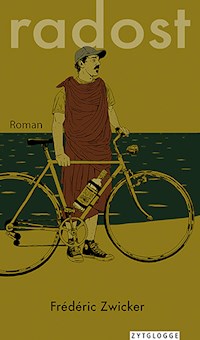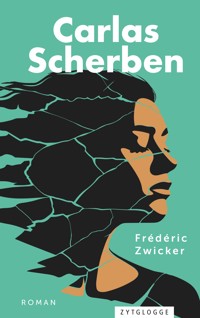
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod ihrer Grossmutter Lili findet die Keramikkünstlerin Carla in deren Nachlass einen Schuhkarton mit Liebesbriefen. Ihr Grossvater Paul hat sie 1943 an Lili geschrieben. Eigentlich sollte Carla an einer Installation für die Hamburger Kunsthalle arbeiten. Doch in Pauls Briefen und in Gesprächen mit ihrer Mutter Larry tun sich ungeahnte Abgründe in der Familiengeschichte auf. Paul ist seit vielen Jahren tot. Aber er bestimmt die Familiengeschicke noch immer, wie Carla feststellt: «Du hattest deine Finger im Spiel, nicht nur bei meiner Arbeit, sondern auch in meinem Privatleben, du Puppenspieler, du Geist, du Wiedergänger.» Und als sie sich mit dem Äthiopier Dawit anfreundet, muss sie sich fragen, wie weit der Einfluss ihres Grossvaters tatsächlich reicht. Frédéric Zwicker erzählt einfühlsam, originell und bissig aus einem turbulenten Jahr der Künstlerin Carla. Der Roman richtet dabei den Blick auf drei Frauengenerationen im Wandel eines bewegten Jahrhunderts und schlägt einen Bogen von der Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg bis hin zu den Migrationsbewegungen der Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Dank
Über den Autor
Über das Buch
Frédéric Zwicker
Carlas Scherben
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Der im Buch verwendete Textauszug von Thomas Bernhard erfolgt mit freundlicher Genehmigung aus: Thomas Bernhard, Frost, in: ders., Werke in 22 Bänden. Band 1. Herausgegeben von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2003. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.
© 2024 Frédéric ZwickerZytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Vanessa Ruppert, Thomas GierlKorrektorat: Philipp HartmannUmschlaggestaltung: Weiß-Freiburg GmbH, FreiburgeBook-Produktion: 3w+p, Rimpar
ISBN ePub: 978-3-7296-2436-8
www.zytglogge.ch
Frédéric Zwicker
Carlas Scherben
Roman
Pour toute la famille
1
Die Katze stürzt nah an der Felswand in die Tiefe, dreht sich ein paarmal um die eigene Achse, schlägt unten auf den Steinen auf und wird zerschmettert.
Ich spähe und lausche. Keine Stimmen, keine Schritte. Nichts als verfrühtes Vogelgezwitscher und gleichgültige Bäume. Also ziehe ich die zweite Katze aus dem Sack.
Drei Katzen werfe ich hinunter, dann kommen die Amseln und Meisen an die Reihe. Teils sind ihre Flügel gebrochen, teils quillt ihnen Gedärm aus dem Bauch. Kein Flügelflattern. Sie fallen ungebremst, zerschellen wie zuvor ihre vierbeinigen Feinde. Nun ist der Sack leer, und ich arbeite mich durch Gestrüpp und Sträucher zurück auf den schmalen Pfad, der aus dem Wald führt.
2
So will ich einsteigen, Paul. Irgendwo muss man einen Anfang machen, und jener Februarmorgen im Wald scheint mir geeignet als Einstieg. Ein Stückchen Alltag vor dem Eintreten des folgenschweren Ereignisses. Ein paar Stunden Normalität, ehe mein Telefon klingelte.
Bist du erstaunt, von deiner Enkelin zu hören? Es ist tatsächlich lange her. Die Gespräche mit dir sind mir abhandengekommen, wie mir das Beten abhandengekommen ist. Beides – das Beten und die Gespräche mit dir – hat mich Lili gelehrt. Und du und Gott, ihr wart für mich auch nah beisammen. Beide Vaterfiguren, Überwesen. Vielleicht freut es dich, dass ich mit Gott schon lange nicht mehr rede, mit dir jetzt aber wieder. Das hat wohl mit dem Sofa zu tun, auf dem ich liege. Es wirkt als Medium. Der Geruch ist noch derselbe, und auch der senfgelbe Cord fühlt sich vertraut an, wenn ich mit den Fingern darüberstreiche, wie ich das früher oft tat. Streicht man hoch, wird der Stoff hell, streicht man wieder runter, wird er dunkel. Aus vier Sesseln und diesem Sofa bestand die Polstergruppe in eurem Wohnzimmer. Inzwischen weiß ich, dass Larry sie ausgewählt hat. Da zeigte sich schon die Innenarchitektin, die deine Tochter nach dem steinigen Umweg über das Hausfrauendasein werden sollte.
Du saßest stets in dem Sessel, der am nächsten beim Fernseher stand. Das Sofa war Lilis Platz. Als du nicht mehr da warst, saß ich in deinem Sessel. Wie ein Thron fühlte er sich an, weil ich wusste, dass es dein Sessel war. Und es störte mein royales Empfinden nicht, wenn Lili anfing zu schnarchen. Bevor sie einschlief, schauten wir ihre Seifenopern, Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Marienhof und wie sie alle hießen. Die zwei genannten waren ihre Lieblingsserien, die sie nicht verpassen wollte. «Uuuh, das ist eine Falle!» oder «IIIh, das ist ein Falscher!», rief sie, wenn jemand ein falsches Spiel spielte. Und sie durchschaute die Protagonisten eigentlich immer. Im echten Leben waren diese weniger scharf gezeichnet. Oder Lili fehlte der scharfe Blick für Fallen und die Falschen. Wobei – nach allem, was ich weiß, hat sie es nie bereut, dich geheiratet zu haben. Aber was weiß ich schon. Heiraten werde übrigens auch ich bald. Wie es dazu gekommen ist, sollst du ebenfalls erfahren. Du hattest deine Finger nicht nur bei meiner Arbeit im Spiel, sondern auch in meinem Privatleben, du Puppenspieler, du Geist, du Wiedergänger, du. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, dass dein Einfluss so weit reicht, du graueste aller Eminenzen. Dass du es früher gewohnt warst zu befehlen, war mir bekannt. Du hattest eine Firma und eine Familie zu führen und am Schweizer Nachkriegswunder mitzubauen. Fünfzig Arbeiter, drei Kinder und eine Frau hattest du in deinen besten Zeiten zu kommandieren. Aber nicht nur das Befehlen warst du gewohnt, sondern auch Befehle zu empfangen und auszuführen. Ja, auch das weiß ich inzwischen.
Eins nach dem anderen. Die Geschichte ist nicht frei von Verstrickungen. Die Geschichte ist genau genommen eine Verstrickung. Beginnen will ich eben im Februar, als ich noch keinen Gedanken ans Heiraten verschwendete und im Hinblick auf Hamburg in totaler Finsternis tappte. Denn Hamburg und der ganze Rest, das hing alles miteinander und mit dir zusammen. Du Drahtzieher. Du Schlüsselfigur.
3
Die größte Chance meiner Karriere sei diese Sache mit Hamburg. Und die logische Konsequenz meines bisherigen Schaffens, das sie natürlich verfolgt habe. Das sagt mir eine meiner ehemaligen Dozentinnen von der Kunsthochschule an einem viel zu warmen Februarmorgen, als wir einander in der Stadt über den Weg laufen und ich ihr davon erzähle. Ihre Begeisterung überrascht mich. Während des Studiums hat sie wenig davon für meine Arbeiten gezeigt. Was sie zur Chance sagt, mag stimmen. Die erste Einzelausstellung in einem renommierten Museum, die umfangreichste Präsentation meiner bisherigen Arbeiten, die erste Ausstellung im Ausland. Dass diese aber eine logische Konsequenz sei, bezweifle ich. Ich sehe die Anfrage aus Hamburg weniger als das Resultat meiner eigenen Leistung, sondern vielmehr als dasjenige der Arbeit des berühmten US-amerikanischen Kunstkritikers Victor Strinsky, der während eines Ferienaufenthaltes in der Schweiz im Sommer des Vorjahres zufällig Gudruns Galerie entdeckte, wo meine Werke ausgestellt waren. Am Beispiel der Mauerblümchen beschrieb er meine Arbeit in seinem Blog und erwähnte als Vorzug meiner Objekte, was nicht wenige seiner Schweizer Kolleginnen und Kollegen oft als Schwäche kritisiert hatten: ihre wörtlich zu nehmende Zerbrechlichkeit. Zwar wurde die Eleganz der hauchdünnen Keramiken auch von heimischen Journalisten gelobt; nicht selten beanstandeten diese jedoch, die Feingliedrigkeit führe allzu häufig zu Scherben und damit zum totalen Wert- und Ästhetikverlust der Werke, die deshalb als Sammlerobjekte nicht im Geringsten taugten.
Strinsky erkannte beim Anblick der getöpferten Blumen die Vergänglichkeit, die ich ihnen eingepflanzt habe. Die Mauerblümchen sind winzige, im Raum verteilte Tonblumen, die scheinbar aus dem Boden wachsen. Die Gefahr ist groß, dass jemand sie zertritt. Strinsky verstand, dass ich einerseits die Unsterblichmachung ad absurdum führte, die Ziel fast jeder künstlerischen Abbildung ist. Und andererseits den Menschen zwang, für die Natur Sorge zu tragen. Damit erfasste er das Konzept all meiner jüngeren Arbeiten.
Seit Strinskys lobender Erwähnung pflegt auch die hiesige Kritik einen wohlwollenderen Umgang mit mir. Zu meinem Beitrag in einer Ausstellung junger Schweizer Kunst im Zürcher Kunstmuseum wagte ein profilierter Journalist ein paar Wochen später gar den Vergleich mit Prometheus: So wie dessen aus Lehm geschaffenem Werk – dem Menschen – ein Makel innewohne, hafte ein solcher – im besten, menschlichsten Sinne – auch meinen Kreationen an. Meine Arbeit war eine Installation von fünfundfünfzig Blumen in Blumenvasen, wobei die Vasen aus Wiesenblumen geflochten und die Blumen darin aus rotem Töpferton geformt und bunt glasiert waren. Ich konnte nicht an der Vernissage teilnehmen, weil ich mit Fieber im Bett lag. Als ich erfuhr, dass schon am Eröffnungstag vier Blumen Schaden genommen hatten, nahm ich mir vor, sie schnellstmöglich zu ersetzen, da ich es mit der Zerbrechlichkeit diesmal wohl übertrieben hatte. Aber dann las ich am nächsten Tag die Sache mit Prometheus in der Zeitung, und mir waren von höherer Gewalt die Hände gebunden.
Nicht lange nach Strinskys Ritterschlag folgte die Anfrage aus Hamburg. Fast alles mit musealem Potential will die begeisterte Kuratorin zeigen. Auch die fünfundfünfzig Blumen sollen Teil der Ausstellung sein. Das meiste stammt aus dem Atelier oder aus Gudruns Galerie, nur eine Arbeit aus Privatbesitz. Normalerweise stellen Sammler ihre Kunstwerke gern zur Verfügung, weil Ausstellungen wertsteigernd wirken. Bei mir sagten vier von fünf Angefragten ab. Zu hoch die Risiken von Hin- und Rücktransport und drei Monaten Ausstellung.
Als Sahnehäubchen des Hamburg-Projekts gab das Museum eine Installation bei mir in Auftrag, die es kaufen will. Sie soll einen Raum von 29,76 Quadratmetern bespielen. Das habe ich mir mit meinem Wunsch nach einer raumfüllenden Arbeit selbst eingebrockt. 4,8 Meter Breite, 6,2 Meter Länge. Freie Hand, Carte blanche, der Traum jeder Künstlerin und hoffentlich am Ende nicht mein Albtraum. Denn an dieser Installation beiße ich mir seit Jahresbeginn die Zähne aus. Die erste Tranche des Honorars hat das Museum als Vorschuss überwiesen. Töpferkurse werde ich in diesem Jahr keine anbieten müssen. Keine spätberufenen Frischgeschiedenen, die Vulven modellieren; keine wuchtigen Banker Mitte fünfzig, die am Ende des Kurses mit glänzenden Augen ein klobiges Krippenspiel nach Hause tragen. Endlich wieder einmal uneingeschränkte Konzentration auf meine Kunst.
Aber eben. Die Idee. Seit eineinhalb Monaten warte ich auf die zündende Idee.
4
Kein Grund zur Sorge. Die Wachstumskurve des Zeitdrucks verläuft exponentiell und wird auch dieses Mal die Blockaden sprengen, wenn der Abgabetermin naht. Das sage ich mir auch an jenem Morgen, als ich aus dem Wald zurück ins Atelier komme. Aber die Nervosität ignoriert mein Mantra; ich gehe auf und ab, um dem Damoklesschwert auszuweichen, das meine Kopfhaut ritzt, obwohl gute fünf Monate bleiben.
Im Atelier ist es kalt. Wenn es in meiner Wohnung kalt ist, drehe ich die Heizung auf, in Libyen oder Nigeria geht die Pumpe an, und der braune Quell des Lebens sprudelt via Pipeline, Tanker, Rheinschiff und Lastwagen direkt in den Heizöltank im Keller. Es gibt einmal einen Krieg, es brennt einmal eine Bohrplattform, und ein paar Fische und Vögel erhalten die letzte Ölung. Aber in der guten Stube ist's angenehm warm. Hier draußen ist das anders. Die Globalisierung hat mein Atelier übersehen. Zum Glück hat mein Vermieter den Holzvorrat aufgestockt. Ich spalte und staple Scheite und Späne so, dass alles ohne Zeitung und andere Hilfsmittel brennt, wenn ich das Streichholz in den Holzaltar führe. Sobald die ersten Flämmchen züngeln, lege ich nach, füttere das Feuer mit flinken Fingern und achte darauf, es nicht zu ersticken. Und wenn es dann knistert und knackt, wenn das Blut pulsiert, der Atem dampft und mir ein Rauchfähnchen als frühzeitlicher Odem in die Nase steigt, dann hoffe ich, die Sinne mögen erwachen, ein Schaffensdrang sich regen und der urmenschliche Selbsterhaltungstrieb Körper und Geist einstimmen auf die Arbeit mit Händen und Ton.
Stattdessen läuft und verläuft es, wie ich es schon seit eineinhalb Monaten kenne, im Kreis, im Sand, ins Nichts. Ich bin unkonzentriert und mag nicht im Atelier sitzen. Durch die Fenster dringt der Sirenengesang der Vögel. Mitte Februar ist es erst, und sie kreischen sich vor Wollust ihre Vogelseelen aus dem Leib. Hier draußen gibt es keinen Stadtlärm, gegen den sie anschreien müssen. Sogar das Bächlein, das sich hinter dem Atelier durch den Wald schlängelt, gurgelt deutlich vernehmbar eine Einladung.
Die Natur ist eine Zumutung. Und dann klingelt auch noch das Telefon.
Klaus ist es nicht. Klaus ist es nie.
5
Ergeht es so einem Reh im Scheinwerferlicht? Geblendet, erstarrt, dem Unheil ausgeliefert, das sich rasend schnell und zugleich in Zeitlupe nähert. Unausweichliches kennt keine Eile. Bedrohlich braust es heran, jedoch so unbegreiflich, dass die Wucht des Aufpralls schließlich doch verblüfft.
Ich fahre nach Hause und lege mich aufs Sofa im Wohnzimmer. Erst jetzt packen mich die Weinkrämpfe. Zyklisch schleudern sie mich herum. Wie eine Waschmaschine. Zuerst auf dem Sofa, dann am Küchentisch. Hierhin ziehe ich um, weil mich die Nachbarn da weniger gut hören können und ich mir von der Härte des Holzstuhls Halt erhoffe.
Hier sitze ich und zergehe.
Zeitweise beobachte ich hilflos und mit fast unbeteiligtem Staunen, wie es mich schüttelt und mir Geräusche entweichen, die mir peinlich sind. Ruckartige, gewaltsame Atemzüge irgendwo zwischen Röcheln und Schreien. Ich habe verlernt zu weinen, denke ich, während Speichel von meiner Unterlippe auf die Tischplatte tropft.
Wieso erschüttert mich die Nachricht so? Lili war seit vier Jahren im Heim, hat sich mit jedem Monat weiter verflüchtigt, ist geschrumpft, abgemagert, vergesslich, müde, brüchig, blass geworden. Bei meinem vorletzten Besuch hat sie mich nach langer Zeit wieder einmal erkannt. Beim letzten Besuch hat mir ihr charmantes «Grüß Gott», mit dem sie allen Fremden begegnete, wie gewohnt das Herz gebrochen.
Ein sanfter Tod im hohen Alter von achtundneunzig Jahren, eine Barmherzigkeit. Darf man sagen, zur rechten Zeit? Minuten vor ihrem letzten Atemzug habe deine Frau gesungen, dann sei sie friedlich entschlafen. Ist jemals jemand besser gestorben, Paul?
Larry hatte es von ihrem Bruder gehört, der bis zuletzt bei Lili war. «Deine Großmutter ist heute Morgen gestorben», sagte sie am Telefon. Ich war überrascht, wie gefasst sie klang. Ich überlegte, ob ich etwas Tröstendes sagen sollte. Aber ich wusste nicht, was und wie. Also blieben wir sachlich und sparten uns unsere Gefühle für die Einsamkeit nach dem Anruf auf. Wie immer.
Das erste Schluchzen und Zucken ist eine allergische Reaktion des Körpers auf die Todesnachricht, vom Unbewussten ausgelöst, bevor der Verlust ins Bewusstsein dringt. Die Trauer überschwemmt mich, als die Erinnerungen kommen.
Die erste ist die früheste. Wie ich mit ihr am runden Holztisch im Esszimmer saß und nach ihrem Mund griff, wieder und wieder, kreischend vor Entzücken und Schrecken, während sie mit über die Zähne gestülpten Lippen nach meinen Fingern schnappte.
Wie sie mir den Rücken kratzte, wenn ich auf deinem Sessel vor dem Fernseher saß. «Ein bisschen höher, ein bisschen weiter rechts, noch ein bisschen weiter ... Aaah, ja, genau dort!» Dann massierte sie mich, bis sie mir mit beiden Händen auf die Schultern schlug und rief: «Fünfzig!» Das war das Zeichen dafür, dass die Massage fertig war. Natürlich hatte sie die Knetbewegungen nicht gezählt.
Wie wir miteinander hoch ins Dorf und in die Kirche gingen. Ein Nachbar kam uns entgegen und fragte, ob sie für ihn auch ein wenig mitbeten könne. «Tut mir leid, ich nehme keine neue Kundschaft», antwortete sie und zuckte nicht mit der Wimper.
Auch ihren Lieblingsspruch höre ich, den sie zum Besten gab, wenn sie die Wohnungstür hinter uns schloss: «Wegen der Mädchenhändler.» Das potentielle Opfer war sie selbst.
Die Erinnerungen geben sich die Klinke in die Hand. Ich bin wieder Kind, kann sie sehen, riechen, hören, spüren. Der Tod macht Verstorbene im ersten Augenblick lebendiger.
Und dann nistet sich die Erkenntnis der Endgültigkeit dieser Erinnerungen ein. Seit Lili ins Heim gezogen und immer mehr in der Vergesslichkeit verloren gegangen ist, sind kaum neue hinzugekommen. Ihr Tod stößt die Tür, die noch einen Spaltbreit offen gestanden hat, ganz zu. Unzählige schöne Erinnerungen, keine schlechte. Gibt es einen zweiten Menschen, auf den das zutrifft?
Ich ziehe die Geige unter dem Bett hervor, wo sie jahrelang geschlummert hat. Muss i denn zum Städtele hinaus, Long, Long Ago und Lustig ist das Zigeunerleben. Das waren ihre Lieblingslieder. Sie lauschte verzückt, als ich die Stücke gerade im Unterricht gelernt hatte und sie wackelten und krächzten. Dann beklag dich auch jetzt nicht, Lili selig, wenn mir die Töne ungelenk von den Saiten stolpern.
Da: eine weitere auferstandene Erinnerung. Später spielte ich ihr manchmal etwas Klassisches vor. Eine kleine Nachtmusik, Montis Czardas, den ich allerdings nie zufriedenstellend meisterte, oder mein Lieblingsstück, Pièce en forme de Habanera von Ravel. Wenn ich geendet hatte, sagte sie: «Schön ... Und jetzt spiel mir bitte noch Lustig ist das Zigeunerleben.»
6
Der Tod kommt zur Unzeit, rüttelt auf, was sich fassen und konzentrieren sollte. Nichts ist mir jetzt ferner als Hamburg.
Larry ruft am Tag nach Lilis Tod schon wieder an. Sie fragt, ob ich den Nachruf aktualisieren und bei der Beerdigung vortragen könne. Ob das ihre Geschwister auch wollten? «Jetzt muss man einfach machen», sagt sie in einem Ton, der keine Widerrede duldet. Einfach war das Verhältnis zwischen den Geschwistern nie. Aber das weißt du ja.
Eine erste Version des Nachrufs habe ich vor vier Jahren geschrieben, als Lili ins Heim kam. Es widerstrebte mir, sie präventiv totzuschreiben, aber Larry meinte, man müsse vorbereitet sein, ich sei die Kreative in der Familie, niemand wisse, wie lange es noch gehe, und wenn es so weit sei, gebe es ohnehin genug zu tun, dann sei alles ein Segen, was man bereits erledigt habe. Ich war überrascht, dass sie gerade in dieser Angelegenheit so viel Pragmatismus an den Tag legte. Wie sich jetzt aber zeigt, hatte sie recht. Zum Glück muss der Nachruf inhaltlich nur da und dort ergänzt werden.
Ich lese das Geschriebene noch einmal durch: Geburt, Geschwister, Ausbildung, Heirat, Kinder, Mitarbeit im Bauunternehmen, Pflege ihres Ehemanns, Anlaufstelle für Sorgen und Nöte des halben Dorfs, Kaffee und Kuchen für alle, letzte Jahre im Heim. Ihr Schalk, die Liebe ihrer Enkelkinder, die so viel Zeit bei ihr verbrachten. Viel zu kurz, zu grob, eine verzerrte Maske. Es fehlt, dass sie sich zu mir auf den Autorücksitz setzte und mir die Füße warm rieb, wenn wir in die Skiferien fuhren, Larry, sie und ich. Dass Stühle und Menschen weichen mussten, wenn der Zillertaler Hochzeitsmarsch im Radio lief, damit wir beide hin und her und im Kreis hüpfen konnten. Dass sie, wenn ich sie anrief und fragte, ob ich sie besuchen könne, nicht ein einziges Mal nein sagte. Wenn ich niedergeschlagen war, ging ich zu ihr, wenn ich Liebeskummer hatte, Streit mit Larry, Probleme in der Schule. Dann nahm ich den Zug und zweieinhalb Stunden später trank ich Tee bei ihr und aß frischen Apfelkuchen. «Schön, dass du mich besuchst», sagte sie und strahlte und fragte: «Hast du deine Schuhe ordentlich hingestellt?»
Es fehlt auch, dass sie eine einfache Frau war, in ihrem Denken, in ihrem Glauben, in ihrer Menschenliebe. Einfach, praktisch, anspruchslos.
Wir redeten gar nicht so viel miteinander. Wir pflückten Bohnen, legten Socken zusammen, spielten Karten, schauten fern, schauten vom Balkon hinüber zur Straße, und wer zuerst «Puk» sagte, wenn ein Auto vorbeifuhr, durfte sich einen Punkt gutschreiben.
Nur während meiner Pubertät nervte sie mich manchmal. Sobald sie einen Pickel sah, wollte sie mir irgendeine Salbe ins Gesicht schmieren.
Zur vereinbarten Zeit bin ich fertig, aber Larry kommt eine Dreiviertelstunde zu spät. Ich bin genervt, auch wenn ich es nicht anders erwartet habe. Larry kommt immer zu spät. Nur einmal war sie zu früh. Auch das weißt du. Bei Schwangerschaft und Ehe. Letztere war schon gescheitert, als ich auf die Welt kam. Gescheitert, nicht geschieden. Zweiundzwanzig war sie. Fort der Ehemann und Vater, der Feigling und Scheißkerl. Auf Nimmerwiedersehen.
Seither kommt Larry zu spät. Zu spät zum Innenarchitekturstudium, zu spät zu Anstellung und komfortablem Auskommen, zu eigenem Geschäft und Erfolg. Und deshalb auch zu spät zum Bahnhof, wenn ich aus dem Skilager nach Hause kam und als einziges Kind keine Mutter fand, die mir die Tasche und Ski abnahm. Einen Vater fand ich schon gar nicht. Und hätte einmal einer auf mich gewartet, der sich in dieser Funktion versuchte, hätte ich ihn womöglich nicht erkannt. Larry hüpft seit ihrem gescheiterten Eheversuch in akrobatischer Sprunghaftigkeit von Federbett zu Federbett.
7
Wir fahren ins Heim, um das Zimmer zu räumen. Ich schäme mich, weil ich lange nicht mehr dort war, und bin froh, wenigstens jetzt etwas beitragen zu können. Außerdem zieht mich etwas dorthin, in dieses Zimmer, wo sie gestorben ist.
Im Auto bittet mich Larry, ihr den überarbeiteten Nachruf vorzulesen. Während ich lese, blickt sie auf die Straße, nickt abwesend, als ich fertig bin.
Sie regt sich auf: «Dieser verdammte Stadtverkehr.»
«Du wolltest mich abholen. Ich hätte den Zug nehmen können.»
Darauf geht sie nicht ein.
«Zweieinhalb Stunden Fahrt. Bei diesem Verkehr drei. Die anderen wohnen nur zehn Minuten entfernt.»
«Die haben auch zu tun.»
«Schon klar», presst sie heraus, und ich höre ihrem Ton an, dass sie wahrscheinlich mit dem Bruder oder der Schwester gestritten hat und nicht darüber reden will. Sie zündet sich eine Zigarette an. Das macht sie im Auto nur, wenn sie wütend ist. Wie dünn sie ist. In ihren ehemals pechschwarzen Locken dominiert jetzt Silber. Es steht ihr gut. Kein Wunder, dass sie die Männer bis heute von den Bäumen pflückt.
Minutenlanges Schweigen, während sie mit der Rechten steuert und mit der Linken raucht, Ellbogen und Handgelenk angewinkelt, als posierte sie für eine Kamera. Erst auf der Autobahn frage ich: «Was hältst du von meinem Text?»
«Lies ihn mir bitte noch einmal vor.»
Ich schüttle den Kopf und schnaube. Auch das war schon immer so, dass sie mir nicht zuhört und ich alles wiederholen muss.
«Tut mir leid. Ich bin nicht bei der Sache.»
«Mhm.»
«Sag mal, hast du schlechte Laune?»
«Ja, ich habe schlechte Laune. Meine Großmutter ist gestorben. Wieso? Hast du gute Laune?»
Larry schweigt. Ich lese und merke erst, dass sie weint, als ich wieder aufschaue. Bevor ich etwas sagen kann, überkommt es mich auch. Sie streicht mir mit der rechten Hand über die Wange. Wann hat sie das das letzte Mal getan?
Larry weint immer heftiger, es schüttelt sie, Rotz läuft ihr aus der Nase.
«Ach, Scheißdreck ... Fahr rechts ran!», befehle ich.
Sie hält auf dem Pannenstreifen, nimmt das Taschentuch, das ich ihr hinhalte, schnäuzt sich die Nase und presst die Hände aufs Gesicht. Ich lege eine Hand auf ihre Schulter und drücke sie; sie legt eine Hand auf meine.
«Was du geschrieben hast, ist sehr schön», sagt sie.
«Komm, wir wechseln», schlage ich vor und ziehe meine Hand weg.
Während ich ums Auto herumgehe, klettert sie behänd auf den Beifahrersitz. Als wir wieder fahren, erkundigt sie sich nach Hamburg, will wissen, ob ich vorankomme. Ich schüttle den Kopf, und Larry fragt nicht weiter. Wir merken es beide, wenn die andere nicht reden will.
8
Weißt du, was ich mich frage, Paul? Wie sich die Dinge wohl entwickelt hätten, wenn Lili ein halbes Jahr später gestorben wäre. Denn du warst zwar der Schattendirigent und Taktgeber dieser Entwicklungen. Aber Lili war der Urknall. Alles, was auf ihren Tod folgte, folgte dem physikalischen Gesetz von Ursache und Wirkung. Bis hin zu meiner geplanten Ehe. Aber da zeigt sich eben, wie schnell die Dinge unerwartete Wendungen nehmen, sobald sie einmal angestoßen sind. Manchmal fliehen die Wirkungen hakenschlagend wie aufgeschreckte Hasen, wenn ihnen die Ursachen auf die Blume treten. Und dann kommt es vor, dass sogar ein Schattendirigent die Kontrolle verliert.
Wusstest du, dass der Schwanz bei Hasen Blume heißt? Oder dass Eichhörnchen den wissenschaftlichen Namen Sciurius tragen, weil man in der Antike glaubte, Eichhörnchen würden sich mit ihrem buschigen Schwanz selbst Schatten spenden? Sciurius, zusammengesetzt aus den altgriechischen Wörtern skia, Schatten, und oura, Schwanz. Ich erwähne das, weil auch so ein Sciurius ein Glied der Ursache-und-Wirkungen-Kette war. Aber zu Eichhörnchen später mehr.
9
In diesem Bett ist sie also gestorben. Vor etwas mehr als vierundzwanzig Stunden. Den Körper haben sie schon abgeholt. Die Leiche. Was für ein hässliches, bleiches Wort. Dass der Laich, aus dem Leben entspringt, fast gleich heißt, ist eine teuflische Präzision der deutschen Sprache. Der Tod ist im Zellhaufen angelegt.
Ich spüre nichts. Kein Geist, der im Vorhang oder unter der Decke hängt. Trotzdem schließe ich das Fenster, das gekippt ist. Was noch von ihr vorhanden ist an Atem, Ausdünstung und Anima, soll nicht entweichen, soll sich nicht weiter verdünnen.
Das Zimmer ist mir vier Jahre lang fremd geblieben. Ihren Schrank und einen Sessel aus der senfgelben Polstergruppe hat man mit ihr ins Heim transportiert. Nicht deinen Sessel. Der wurde entsorgt, ehe ich ihn für mich beanspruchen konnte, weil Larry und ihre Geschwister ihn für zu abgenutzt befanden.
Lilis Kommode steht auch hier, darauf derselbe Fernseher wie in ihrer Wohnung, dieselben Fotos. Sie blieben Objekte in einer temporären Ausstellung mit gewissem, zeitlich nicht bestimmtem Ende. Die weißen Wände warteten schon auf die nächste Bewohnerin und die nächste Installation. Und dass Lili als lebendiges Ausstellungsstück im Bett lag, verlor bis zuletzt nichts von seinem grotesken Charakter.
Larry und ich funktionieren. Sie schluchzt gelegentlich, während wir Fotos von den Wänden nehmen und sie in eine Kartonschachtel legen. Bilder von dir, von Lili, ihren Geschwistern, meiner Mutter, Onkel und Tante, Cousinen und Cousins und deren Kindern auf den Knien der Urgroßmutter. Auch ich hänge dreifach an der Wand. Vier Generationen. Als fünffache Urgroßmutter ist sie gestorben. Ich bin die Einzige, die keine Kinder hat, die Einzige, die allein lebt. Klaus sei Dank. Scheißkerl.
Meine Tante ruft Larry an. Ich höre nicht, was sie sagt, verstehe aber, dass Larry wegmuss.
«Wir müssen den Pfarrer treffen. Der hat nur heute Nachmittag Zeit. Ich soll dabei sein. Geht um den Ablauf des Gottesdienstes. Kommst du mit? Dann kommen wir später zurück und räumen weiter auf.»
«Nein, geh du. Ich mache das hier.»
«Tut mir leid. Ich rufe an, sobald wir fertig sind, und komm dich dann abholen. Hol dir unten mal einen Kaffee.»
Sie will mir eine Zehnernote in die Hand drücken. Ich schüttle den Kopf und schaue sie an mit einem Blick, der fragt: Ist das dein Ernst? Sie steckt mir die Note in den Ausschnitt, zwinkert mir zu und entschwebt wie Herbstlaub im Wind.
10
Sobald Larry gegangen ist, lege ich mich aufs Bett. Es ist nur noch die Matratze da, Decke und Kissen sind sicher in der Reinigung. Wie viele Menschen sind auf dieser Matratze gestorben?
Zwei Minuten lasse ich mich gehen, dann stehe ich auf. Nicht, dass jemand reinkommt und mich hier so findet. Außerdem möchte ich das Aufräumen hinter mich bringen.
Viel ist es nicht. Die Möbel und den Fernseher vermachen wir dem Heim. Die haben ein Lager. Wenn jemand gar nichts hat, wird das Zimmer damit hergerichtet. Und zweimal im Jahr machen sie einen Flohmarkt.
Die Kleider staple ich auf dem Bett, um sie nachher zusammenzulegen und in die mitgebrachten Säcke zu packen. Sie stammen aus Zeiten, in denen die Damenwelt blumiger ausstaffiert war. In den meisten sehe ich sie; viele Kleider trug sie jahre-, wenn nicht jahrzehntelang. Jetzt kommen sie in die Textilsammlung. Zumindest für die Kleider der gläubigen Großmutter gibt es ein Leben nach dem Tod.
Zuhinterst im obersten Fach des Schranks ist eine Schuhschachtel. Ich lege sie auf den Tisch und entferne die Gummibänder, die den Deckel halten. In der Schachtel befinden sich Briefe. Sie sind in zierlicher, geschwungener Schreibschrift an Lili adressiert. Aber die Adresse ist eine andere als die mir bekannte, und Lilis Nachname ist ihr Mädchenname. Vorsichtig ziehe ich den Brief aus dem ersten Couvert.
Oben rechts steht das Datum: 3. Juni 43.
Liebe Liliane, lautet die Anschrift.
Zuunterst: viele Grüße. Paul.
Du.
Ich setze mich aufs Bett und beginne zu lesen. Es geht nur sehr langsam vorwärts, Buchstabe für Buchstabe. Deine Schrift lässt sich kaum entziffern.
Liebe Liliane
Ich weiß nicht, ob ich recht handle, wenn ich mir erlaube, an Dich diese Zeilen zu richten.
Ich hoffe, Du werdest mich richtig verstehen.
Ich weiß auch nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, wenn ich glaube, Deinen Augen eine kleine Zuneigung für meine Wenigkeit entnehmen zu dürfen.
Ich bin in einem Alter, in dem ich ein liebes, verständiges Menschenkind suche, mit dem ich mich auf die Dauer verbinden könnte.
Du bist mir eben nicht gleichgültig, sonst würde ich diese Worte nicht an Dich richten.
Darf ich eine mündliche oder schriftliche Äußerung in nächster Zeit von Dir erwarten?
Solltest Du Dich in bejahender Weise zu einer Antwort entschließen können, würdest Du mir eine ungeahnte Freude machen!
Empfange meinen besten Dank und
viele Grüße.
Paul
So hast du also um ihre Hand angehalten. Etwas gestelzt, du warst wohl nervös. Aber die blumige Sprache zeichnet auch deine späteren Briefe aus. Und falls du weißt, wie umstandslos und unromantisch die Partnersuche heute häufig vonstattengeht und wie sehr ich Lilis Beziehung mit dir romantisiert habe, kannst du dir meine Rührung an jenem Tag ausmalen.
Ich stecke das Papier wieder ins Couvert. Meine Hände sind feucht. Insgesamt sind es zwölf Briefe, viele davon mehrseitig. Sie sind chronologisch geordnet. Du hast sie zwischen dem 3. Juni und dem 16. Dezember 1943 an Lili geschickt. Einige sind auf Armeepapier geschrieben.
In der Kopfzeile steht: Militärschreibpapier – Papier à lettre militaire – Carta da lettra militare.
Ich wusste nichts von diesen Briefen.
Weiß Larry davon?