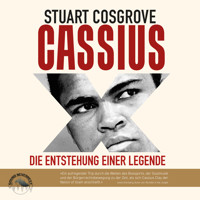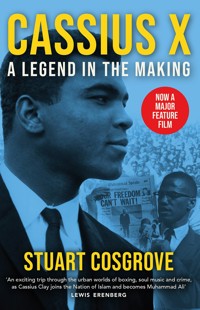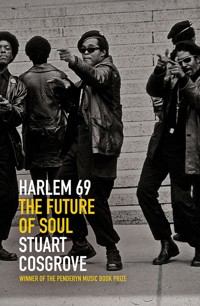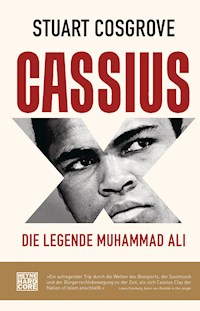
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Cassius X" handelt von der Verbindung zwischen Malcolm X, Soulsänger Sam Cooke und Cassius Clay, der kurz darauf zum Islam konvertierte und als Muhammad Ali in die Geschichte eingehen wird. Im Jahre 1963 trafen sie sich in Miami, als Cassius dort trainierte, wo er ein Jahr darauf seinen legendären Kampf gegen Sonny Liston führen wird. Der preisgekrönte schottische Journalist Stuart Cosgrove verbindet auf faszinierende Art und Weise die Biografien dreier Legenden aus Sport, Soul und Politik, deren Wege sich an einem entscheidenden Wendepunkt der amerikanischen Geschichte kreuzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
STUART COSGROVE
CASSIUS X
Die Legende Muhammad Ali
Aus dem Englischen von Kristof Hahn
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel CASSIUS X: A LEGEND IN THE MAKING bei Polygon, an imprint of Birlinn Ltd., Edinburgh.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter www.heyne.hardcore.de/facebook
@heyne.hardcore
Copyright © 2020 by Stuart Cosgrove
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Markus Naegele
Redaktion: Jürgen Teipel
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen
unter Verwendung des Originalumschlags von Chris Hannah
Umschlagabbildung: Alamy Stock Photo / CPA Media Pte Ltd.
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-28038-3V001
Cassius Clay zählt die letzten Tage des Jahres 1962. Von der Öffentlichkeit unbemerkt, hat er sich in aller Stille der Nation of Islam angeschlossen und trägt bereits einen schlichten schwarzen Anzug und eine dunkle Krawatte als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser Organisation. Es wird jedoch noch fünfzehn Monate dauern, bis er allgemein unter dem Namen Muhammad Ali bekannt wird.
© James Drake / Sports Illustrated Classic
Vorbemerkung
Das in diesem Buch verwendete Wort »Rasse« ist eine direkte Übersetzung des englischen Wortes Race, das in den USA eine andere Bedeutung hat als in Deutschland, wo es historisch natürlich extrem belastet ist. Wissenschaftlich ist dieser Begriff nicht haltbar. Das ebenfalls verwendete Wort »Neger« ist durch die Verwendung des Begriffs Negro seitens der Originalquellen (Martin Luther King, James Baldwin etc.) bedingt.
»Ich bin Amerika. Ich bin der Teil, den ihr nicht anerkennt. Aber ihr solltet euch besser an mich gewöhnen. Schwarz, voller Selbstvertrauen, mit großer Klappe. Mit einem eigenen Namen, den ich mir selbst gegeben habe, nicht ihr, mit meiner eigenen Religion und nicht eurer, meinen eigenen Zielen. Gewöhnt euch daran.«
Cassius X, 1964
»Das gemeinsame Ziel von zweiundzwanzig Millionen Afroamerikanern ist es, als menschliche Wesen respektiert zu werden, ist das gottgegebene Recht, ein menschliches Wesen zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Menschenrechte zu erlangen, die Amerika uns bislang verweigert hat. Wir können niemals die Bürgerrechte in Amerika bekommen, solange unsere Menschenrechte nicht wiederhergestellt sind. Wir werden niemals als Bürger anerkannt werden, solange wir nicht als menschliche Wesen anerkannt sind.«
Malcolm X, 1964
INHALT
Vorwort
Miami
Wo die Neonröhren zum Sterben hingehen
Detroit
Detroit Red und der Sound des jungen Amerika
Philadelphia
The Guy with the Goods
New York
Wenn im Boxen Winter herrscht
London
Skandal in Soho
Miami
Der Kampf, der Amerika veränderte
Requiem
Boxen und Soul: Eine Playlist
Bibliografie
Index
VORWORT
Cassius X ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Menschen, doch es ist darüber hinaus die Geschichte der vielen gesellschaftlichen Kräfte, die schließlich Muhammad Ali formen sollten.
Der Großteil des Buches spielt 1963 in Miami. Und zwar im Vorfeld von Cassius Clays erstem Titelkampf gegen Sonny Liston – mit dem Schwerpunkt auf jener Phase, als er den Namen Cassius X benutzte. Seine Konvertierung zum Islam, durch die er den Namen Muhammad Ali bekommen sollte, war noch nicht abgeschlossen.
In gewisser Weise kann man das Buch als Vorspann meiner Trilogie über Soul lesen: Detroit 67 – The year that changed Soul, Memphis 68 – The Tragedy of Southern Soul und Harlem 69 – The Future of Soul. Und zwar insofern, als es die Entwicklungen beleuchtet, die zum Aufstieg des Soul zu einem der prägendsten musikalischen Genres der populären Musik in den Sechzigerjahren führten. Im Grunde jedoch geht es um den komplexen politischen und religiösen Hintergrund, der Cassius X und später dann Muhammad Ali hervorbrachte, und die bemerkenswerte Magie, die durch ihn in den Boxsport und die Unterhaltungsbranche Einzug hielt.
Über Muhammad Ali wurden etliche ausgezeichnete Biografien verfasst, die sein gesamtes Leben behandeln. Doch darum geht es in diesem Buch nicht. Cassius X ist das Porträt eines Mannes während seiner formativen Phase, in den Tagen, als der junge Boxer seine Identität auslotete, sein Image entwarf und langfristig vorteilhafte Freundschaften mit Malcolm X, Sam Cooke und innerhalb der Medien schloss. Es dreht sich nicht nur um seine Wahrnehmung eines von Rassentrennung geprägten Landes, sondern auch um die neuen, von Selbstbewusstsein geprägten Musik- und Unterhaltungsgenres, die seine Jugend beherrschten.
Mein tiefer Dank geht an meinen Verlag Polygon, insbesondere an meine Lektorin Alison Rae, sowie an meinen amerikanischen Verlag Chicago Review Press.
Mein persönlicher Dank gilt meinen Freunden und Verwandten und – wie immer – der merkwürdigen Lehranstalt des Northern Soul.
Stuart Cosgrove
Glasgow, 2020
Cassius Clay bei einer Trainingspause in Chris Dundees Gym in der 5th Street in Miami. Das Design des T-Shirts stammt von seinem Vater, der in seiner Heimatstadt Louisville, Kentucky als Schildermaler arbeitete. Der Fotograf Flip Schulke machte während der Jahre 1961 bis 1964 Hunderte von Aufnahmen des jungen Boxers, einschließlich der berühmten Fotos im Swimmingpool: Cassius hatte damals lauthals verkündet, dass er unter Wasser trainierte, um seinen Jab zu verbessern, doch es war nur ein Schwindel, den er sich zusammen mit seinem Trainer ausgedacht hatte. In Wirklichkeit konnte er gar nicht schwimmen.
MIAMI
Wo die Neonröhren zum Sterben hingehen
Das Jahr 1963 hatte gerade begonnen, und Miami erwachte mit einem heftigen Kater. Die Stadt war vollgepackt mit Silvesterpartygängern, Ganoven und wandelnden Leichen. Touristen aus Chicago und Detroit – Snowbirds genannt – fielen scharenweise über die Strände Floridas her, um dem ohrenbetäubenden Lärm und der strengen Kälte der Industriestädte des Nordens zu entfliehen. Die Hotels waren hoffnungslos überbelegt, und allenthalben sah man enttäuschte Gäste, die ihr Gepäck die Collins Avenue entlangschleiften in der vergeblichen Hoffnung, doch noch irgendwo ein freies Zimmer zu ergattern. Hinter den polarkalten Empfangshallen, in denen Halbweltfiguren Zuflucht vor der Hitze suchten, wankten Männer in unziemlich kurzen Hosen durch die glitzernden Casinos und ließen zerknüllte Trinkgeldscheine und misstrauische Blicke in ihrem Fahrwasser zurück.
Cassius Clay war nun schon seit über zwei Jahren in Miami, doch noch nie war ihm ein solches Maß an nervöser Gereiztheit begegnet. Die ganze Stadt war von Hektik erfüllt und gleichzeitig am Verrotten. Der Beat-Comedian Lenny Bruce, der seine Verachtung für das urbane Amerika gerne in zweifelhaftes Lob kleidete, hatte einmal erklärt, Miami sei die Stadt, wo »die Neonröhren zum Sterben hingehen«. Ganze Stadtviertel waren in das zuckende Licht verendender Neonreklamen getaucht, die immer mal wieder kurz zum Leben erwachten, bevor sie als Glasscherben auf den Gehwegen landeten. Die glamourösen Leuchtreklamen, die auf Postkarten so malerisch wirkten, hauchten röchelnd ihren letzten Atem aus und waren höchstens noch ein Sinnbild für den unausweichlichen Niedergang der Stadt. Selbst die Palmen blieben nicht verschont – besonders in den schattigen Gegenden der Stadt waren sie von Blütenfäule befallen, einer für die Bäume tödlichen Pilzkrankheit, die dazu führte, dass ihre ehemals majestätischen Palmwedel kraftlos und nikotingelb verfärbt von den Wipfeln herabhingen.
Begünstigt von billigen Flugpreisen und der zunehmenden Verbreitung von Klimaanlagen hatte Miami nach dem Krieg ein ungebremstes Wachstum erlebt; doch dieser Boom ließ sich nicht endlos fortsetzen. Es gab in erster Linie befristete, unsichere Jobs, die Arbeitslosigkeit stieg und fiel parallel zur Touristensaison, und der Andrang von Einwanderern aus Kuba und der Karibik führte zu einer Überlastung der sozialen Dienste. Viele Hotels der mittleren Preiskategorie kämpften immer noch mit den Folgen des letzten Hurrikans und kamen mit Reparaturen und Renovierungen gar nicht nach, sodass weite Teile der Stadt vermüllt, verrottet und vernachlässigt wirkten.
Trotz alledem existierte der Mythos Miami weiter. Geradeso, als ob das sonnige Image der Stadt die harsche Realität einfach ausblendete. Oder wie es die große Schriftstellerin Joan Didion in ihrem aufschlussreichen Buch Miami formuliert: »Miami schien gar nicht wie eine Stadt, sondern vielmehr wie ein Märchen, eine romantische Tropenidylle, eine Art Wachtraum, in dem alles möglich und machbar zu sein schien.« Doch hinter dieser Traumfassade erkannte Didion, in Anspielung auf die kartografische Lage Miamis, eine Stadt am Ende eines Pistolenlaufs, »bevölkert von Leuten, die in dem festen Glauben waren, dass sie von den Vereinigten Staaten im Stich gelassen und verraten wurden«. Und der schlimmste Verräter von allen war – jedenfalls in den Augen der kubanischen Bewohner der Stadt – der Präsident der USA.
John F. Kennedy stattete der Stadt einen Besuch ab, und seine Anwesenheit hatte die ohnehin aufgeheizte Neujahrsstimmung noch weiter verschärft. Das Jahr 1963 würde später als ein Jahr finsterer Verschwörungen in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem der Präsident ermordet wurde. Doch auch anderswo in der nach Rassen getrennten Stadt rumorte es unter der Oberfläche.
Anfangs nahezu unbemerkt, hatte sich Soul im ganzen Land zu einem musikalischen Trend entwickelt, der kurz davorstand, über Amerika hinwegzufegen wie ein tosendes Gewitter, das die kommenden, ereignisreichen Jahre entscheidend prägen sollte.
Und dann war Miami eben noch der Ort, an dem Cassius Marcellus Clay, ein hoch aufgeschossener junger Bursche aus Louisville in Kentucky, sich in einen geradezu größenwahnsinnigen Traum verstiegen hatte: Boxweltmeister im Schwergewicht zu werden. Cassius und seine Berater in Louisville hatten sich nach reiflicher Überlegung darauf geeinigt, dass der altgediente Trainer Angelo Dundee am besten geeignet war, die Karriere des jungen Boxers voranzutreiben. Dundee war aus seiner Heimatstadt Philadelphia nach Miami gezogen, um im Gym seines Bruders Chris in der 5th Street zu arbeiten. Und so kam es, dass im November 1960 der achtzehnjährige Cassius mit dem Zug aus Kentucky eintraf, um in diesem beengt wirkenden Raum zu trainieren, der, wie der Miami Herald schrieb, in einer »heruntergekommenen, dampfigen Gewerbeetage über einem Schnapsladen« an einer schäbigen Straßenecke in Downtown Miami untergebracht war.
Zurückhaltend und unsicher, was auf ihn zukam, wurde Cassius von seinem neuen Trainer und einer lebhaften Gruppe kubanischer Boxer vom Bahnhof abgeholt. Man brachte ihn zu einem merkwürdigen Haus, dessen Fenster mit schweren Vorhängen verhängt waren. Die Bewohner sprachen nur Spanisch, und Cassius zog sich erst mal in sich selbst zurück, weil er keine Ahnung hatte, wie er sich mit diesen Leuten verständigen sollte. Als es dunkel wurde, brachte man ihn in ein vollgestelltes Zimmer in einem Haus unweit der Calle Ocho in Little Havanna, wo er, kaum dass er seine Sporttasche abgestellt hatte, einem demütigenden Initiationsritual unterzogen wurde. Er musste bei seiner ersten Nacht in Miami das Bett mit Luis Rodriguez teilen – mit dessen Füßen im Gesicht. Der brillante kubanische Boxer war nach eigener Aussage stolzer Träger der längsten Nase Amerikas, die ihn eines Tages in die Lage versetzen würde, Fidel Castro einfach wegzurotzen.
Und so verbrachte Cassius seine erste Nacht in der Stadt umschwirrt von Moskitos und eingehüllt in stechenden Schweißgestank in einem dunklen Zimmer und lauschte den fremden Stimmen, die sich irgendwo draußen auf Spanisch unterhielten, untermalt von dem ohrenbetäubenden Schnarchen von Rodriguez.
Als erklärter Feind des Castro-Regimes war Rodriguez in etliche konspirative Gruppen involviert und ein enger Freund von Ricardo »Monkey« Morales, einem ehemaligen Mitglied des kubanischen Geheimdienstes, der sich 1960 in die USA abgesetzt hatte und dort von der CIA angeworben wurde, um als Offizier paramilitärischer Einheiten Kriege im Verborgenen zu führen und weitere Landsleute im Exil anzuwerben – darunter auch die Boxer, die mit Cassius im 5th Street Gym trainierten. Rodriguez spielte die Rolle des patriotischen Agitators; er war ein unermüdlicher Propagandist, der immer wieder versuchte, den desinteressierten und ohnehin mit anderen Sachen befassten Cassius in die neuesten Gerüchte aus den Kreisen der Exilkubaner zu involvieren. Rodriguez hatte im Gym die Rolle des Leitwolfs übernommen, der Besucher herumführte, die Schlüssel für die Schließfächer verteilte, mit den Scharen junger Boxer, die um den Ring herumhingen, Witze austauschte und der außerdem die klapprigen Spinde heimlich als Munitionsdepot verwendete.
Genau hier, inmitten von Sägespänen und umgeben von dem Geflüster kubanischer Mittelgewichtler, perfektionierte der junge Cassius seinen Shuffle, jenen tänzerischen Stil, der ebenso wie seine überschwänglichen Wortkaskaden zu seinem Markenzeichen werden sollte.
Bei allen Unterschieden verstanden sich Rodriguez und der quirlige Junge aus Louisville jedoch prächtig. Während ihrer ganzen seltsamen Freundschaft herrschte zwischen ihnen Einigkeit darüber, dass Boxen zuallererst Teil der Unterhaltungsindustrie war – zwar gefährlich und manchmal sogar tödlich, aber nichtsdestotrotz Entertainment. Bei seinen fruchtlosen Bemühungen, Cassius in die Rätsel, Widersprüche und Mysterien kubanischer Politik einzuführen, betete Rodriguez ihm die Namen einer bemerkenswerten Generation von exilkubanischen Boxern herunter, die aus dem Inselstaat geflohen waren und nun ein neues Kapitel der Geschichte des Boxens schreiben sollten. Cassius lernte sie in den folgenden Wochen und Monaten nach und nach kennen und teilte sich die Trainingshalle mit ihnen. Schon ihre Namen hatten einen vollmundigen und verführerischen Klang – Kid Chocolate, Kid Gavilan und der elegante Federgewichtler Ultiminio »Sugar« Ramos. Rodriguez überzeugte Cassius, dass, wenn er auch nur einen Tag damit zubrächte, die Kubaner bei ihrem Schwof über die Bretter zu beobachten, auch er lernen würde zu tanzen wie der Wind. Cassius hörte ihm lächelnd zu. Er fand zunehmend Gefallen an dem »Hässlichen«, wie Rodriguez auch genannt wurde, und erkannte auch, dass sich in dessen Scherzen und ständigen Bemühungen, seine Umgebung zu unterhalten, ein Schimmer seiner eigenen Persönlichkeit widerspiegelte.
Abgeschreckt von seiner ersten schlaflosen Nacht in Miami, beschloss Cassius, sich lieber erst mal unter seinesgleichen einzuquartieren; und keine sechsunddreißig Stunden später hatte er Angelo Dundee dazu gebracht, die Finanzen des 5th Street Gym zu strapazieren, und sich damit ein billiges Hotelzimmer in Overtown gesucht, einem belebten Ghetto etwas weiter vom Strand entfernt. Anfangs wohnte er im Mary Elizabeth Hotel auf der North West Second Avenue – das von Ferdie Pacheco, dem Arzt des Boxstudios, als »Absteige für Luden, Nutten und Diebe« beschrieben wurde –, zog nach einer eher unkomfortablen Woche jedoch um ins Sir John Hotel, den coolsten R&B-Treffpunkt in ganz Overtown. Das Sir John war eine Institution, das Zentrum der jungen Soulszene von Miami, und darüber hinaus war es ein relativ komfortables Hotel mit einem eigenen Swimmingpool und einem bis spät in die Nacht geöffneten Soulclub, dem Knight Beat. Für den Großteil der nächsten drei Jahre sollte es Cassius’ Zuhause werden; der Ort, an dem sein Leben eine neue Richtung nahm. Hier, in einem nach üblichen Gesichtspunkten eher einfachen Hotelzimmer, begann er seinen Transformationsprozess, an dessen Ende sein Image, seine religiösen Überzeugungen und schließlich auch sein Name nicht mehr die gleichen sein sollten wie zuvor.
Nach dem Einchecken packte er seine Trainingstasche aus, deren bescheidener Inhalt einige Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zuließ: Neben dem üblichen Boxzubehör (Mundschutz, Bandagen und Vaseline) befand sich darin auch eine Grundausstattung für den Amateurzauberer – ein Zauberstab, ein Satz Würfel, ein Kartenspiel und ein abgewetzter Zylinder. An der Innenseite der Tasche hing eine Spinne aus Gummi. Sie sollte in den stürmischen Tagen und drückend heißen Monaten, die vor ihm lagen, noch für Momente der Heiterkeit sorgen. Er nahm sein Boxtrikot von den Olympischen Spielen 1960 aus der Tasche, strich es glatt und hängte es über einen Stuhl – eine schimmernde Erinnerung an seinen ersten großen Erfolg. Den Gewinn der Goldmedaille im Halbschwergewicht durch einen Sieg über den Polen Zbigniew Pietrzykowski bei der Olympiade in Rom.
Floyd Patterson, der Schwergewichtsweltmeister zu Beginn der Sechzigerjahre, erzählte später dem Magazin Esquire in einem Interview, Cassius Clay sei bei seiner ersten Begegnung mit ihm ein »völlig anderer Kerl« gewesen: »Das war 1960. Ich war damals Weltmeister und als Tourist in Rom. Ich hatte eine Audienz beim Papst, besuchte dann die Olympiamannschaft der USA und traf bei der Gelegenheit auch Cassius Clay. Er war der beste Boxer des amerikanischen Teams, aber er war sehr höflich und voller Enthusiasmus. Als ich im Mannschaftscamp ankam, sprang er auf, nahm mich bei der Hand und sagte: ›Kommen Sie mit, ich führe Sie herum.‹ Er zeigte mir alles, und das Einzige, das ein bisschen ungewöhnlich an ihm war, war seine überschäumende Begeisterung. Ansonsten war er ein sehr zurückhaltender und sympathischer Bursche.«
Cassius fand bald heraus, dass freundliche Zurückhaltung finanziell nicht hoch im Kurs stand und die Dollars eher in Richtung derer strömten, die Aufmerksamkeit für sich beanspruchten. Er wirkte manchmal wie ein kleiner Junge mit einem geradezu verzweifelten Bestreben, andere zu unterhalten – und bei anderen Gelegenheiten wie ein junger Mann, dessen Verhalten nicht selten in Richtung unangenehmer Großspurigkeit abdriftete. Bei seiner Ankunft in Miami war er auf den Straßen noch weitgehend unbekannt, doch er verließ sich auf seinen Instinkt, arbeitete hart an seinen Entertainerqualitäten und entwickelte sich so zu der schillernden Persönlichkeit, die in den kommenden Jahren ins Rampenlicht rücken sollte.
Im westlich von Downtown gelegenen Orange Bowl Stadium drängten sich fünfundsiebzigtausend Zuschauer, um die spektakuläre Eröffnungszeremonie des bedeutendsten Sportereignisses der Stadt, des Orange Bowl, zu verfolgen und Präsident Kennedy und die First Lady Jacqueline »Jackie« Kennedy mitzuerleben, die als Ehrengäste daran teilnehmen sollten. Der Präsident schwebte per Helikopter vom Himmel herab, landete auf dem Spielfeld und tauchte dann unter in einer Prätorianergarde aus Geheimdienstleuten, die ihren verkabelten Professionalismus im strahlenden Schein der Sonne Floridas hinter dunklen Sonnenbrillen versteckten. Unter ihnen war auch Clint Hill, ein unscheinbarer Mann, den niemand kannte, der aber an den Kennedys klebte wie eine Klette. Hill hatte die späten Fünfzigerjahre als Spezialagent in der Außenstelle Denver zugebracht, bevor er zur Eliteeinheit des Weißen Hauses abgeordnet worden war. Im Herbst desselben Jahres sollte er in der Wagenkolonne des Präsidenten bei der Fahrt durch Dallas sitzen. Und er war es, der von einem der nachfolgenden Wagen zu der Präsidentenlimousine sprintete, um Jackie Kennedy vor den Kugeln zu schützen, die auf sie und ihren Mann einprasselten.
Schon zu Beginn des Jahres hatte sich im Umfeld des Präsidenten eine Paranoia ausgebreitet, die beinahe physisch spürbar war. Bereits eine Woche vor Kennedys Ankunft hatte der Geheimdienst im Americana Hotel in Bal Harbour jeden Winkel abgesucht und schließlich anstelle des Penthouse, das schwieriger zu sichern gewesen wäre, eine Reihe von Zimmern in einem der unteren Stockwerke in Beschlag genommen. Handwerker des Hotels waren angewiesen worden, eine Wand einzureißen und eine neue Tür einzubauen, die breit genug war, damit der Präsident sie zusammen mit seinen Leibwächtern durchschreiten konnte. Deren Nerven wurden auf eine schwere Probe gestellt, als Kennedy draußen auf den vollbesetzten Rängen der Sportarena zwischenzeitlich den Kontakt zu seiner Security verlor. Er hatte eine unglaubliche Anziehungskraft auf die Menschen. Umringt von Kongressabgeordneten, politischen Trittbrettfahrern und entzückten Touristen warf er vor Spielbeginn auf der Tribüne stehend eine Münze. Der Historiker Paul George beschreibt ihn als »cool aussehend mit seiner Ray-Ban-Sonnenbrille und an einer Zigarre paffend«.
Die Kennedys auf dem Höhepunkt ihrer Popularität brachten politischen Glanz und Glamour in eine Stadt, die sich im Schein billiger Glitzerfassaden sonnte. Miss Florida fuhr auf einem Paradewagen voll riesiger Alabaster-Orangen durch die Arena, während Blaskapellen in Kostümen aufspielten, die an die römischen Uniformen aus dem Film Ben Hur erinnerten. Hunderte von Mitgliedern der exilkubanischen Gemeinde Miamis strömten in das Stadion. Teresita Rodriguez Amandi, damals zehn Jahre alt und im Jahr zuvor mit ihren Eltern von der Karibikinsel nach Miami geflohen, erklärte dem Miami Herald:»Ich weiß noch, wie ich ihn von unserem Platz auf den Rängen gesehen habe. Ich saß da mit meiner Familie. Es war ein sehr bedeutender Tag für uns. Es war das erste Mal, dass ich den Präsidenten mit eigenen Augen sah.« Vor ihm auf dem Feld waren die beiden Teams angetreten – Alabama und Oklahoma – sowie die Marschkapellen beider Colleges.
Durch persönliche Intervention des Präsidenten waren die Ehrenplätze im Stadion für eine ungewöhnliche Gruppe von VIPs reserviert worden – die arg dezimierte Brigade 2506, jene paramilitärische Einheit von Exilkubanern, die mit Unterstützung der CIA eine Operation zur Invasion ihrer Heimat und zur Beseitigung von Fidel Castros Revolutionsregierung unternommen hatte. Das Unternehmen hatte in einer blutigen Niederlage mit 114 Gefallenen und 1.189 Gefangenen auf Seiten der Invasoren geendet. Die Überlebenden empfanden tiefe Beschämung angesichts der vernichtenden Niederlage und standen Kennedy überaus skeptisch, wenn nicht sogar feindselig gegenüber. Was immer Kennedy auch unternahm, um ihnen entgegenzukommen, es würde nie genug sein. Die kubanischen Konterrevolutionäre machten ihn für alles verantwortlich, weil er es in einem entscheidenden Moment der Operation unterlassen hatte, ihnen Unterstützung aus der Luft zukommen zu lassen. So standen sie nun da, schüttelten ihm widerwillig die Hand und waren sich unsicher, ob ihre Anwesenheit als ein Zeichen des Mutes oder der Unterwerfung gedeutet werden würde.
Kennedy hingegen war nicht wegen des sonnigen Wetters oder aus Sportbegeisterung nach Miami gereist, sondern in der Hoffnung, der katastrophal verlaufenen Invasion in der sogenannten Schweinebucht nachträglich einen heldenhaften Anstrich zu verpassen und sie als eine heroische Militäroperation in der öffentlichen Meinung zu verankern. Das Protokoll sah vor, dass er den Kämpfern vor laufenden Kameras live im Fernsehen seinen Respekt bezeugte. Vor vollbesetzten Rängen nahm er die kanariengelbe Kriegsflagge entgegen, die ihm von zwei in Miami lebenden Veteranen des Einsatzes überreicht wurde: Erneido Oliva, stellvertretender Kommandant der Brigade, und Manuel Artime, ein ehemaliger Angehöriger von Castros Revolutionsarmee, der vom US-Geheimdienst angeworben worden war, damit er den Angriff auf die Insel anführte.
Flankiert von seiner Frau erklärte Kennedy auf einem mit roten Gerbera gesäumten Podium am Spielfeldrand stehend: »Diese Flagge wird der Brigade eines Tages in einem befreiten Havanna zurückgegeben werden.« Es war eine angestrengte Inszenierung, mit der krampfhaft versucht wurde, eine vernichtende militärische Niederlage in einen Sieg an der Propagandafront umzuwandeln, und deren Worte in Miami wissentlich als Andeutung darauf fehlinterpretiert wurden, dass ein weiterer Versuch einer Invasion in naher Zukunft bevorstand. Dies war jedoch nicht der Fall, und so schwärte die offene Wunde weiter und ließ in der kubanischen Gemeinde der Stadt einen tiefen Hass gegen einen Präsidenten aufkeimen, dessen Charme ansonsten nahezu überall wirkte. Hier verpuffte er. Die Exilkubaner hielten ihn für einen hinterhältigen kleinen Arsch, dem man nicht über den Weg trauen konnte.
Die Invasion in der Schweinebucht sollte über Jahre hinweg eine Wunde der US-amerikanischen Politik bleiben, und in den Verschwörungstheorien im Anschluss an die Ermordung Kennedys spielten Exilkubaner immer wieder eine Rolle. Lyndon B. Johnson, der nach Kennedys Tod das Präsidentenamt antrat, erklärte bei einer Gelegenheit, dass Kennedy in Zusammenarbeit mit der CIA eine »wahre Mord-AG in der Karibik betrieben« hatte. Kaum zu glauben, dass eine Generation später ein Kommando aus Exilkubanern – allesamt Überlebende der Invasion in der Schweinebucht – an der Operation um den Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten im Washingtoner Watergate-Gebäudekomplex beteiligt war. Offensichtlich war ihr Hass auf die Partei Kennedys noch immer nicht abgeklungen – falls das überhaupt jemals der Fall war.
In der Folge des Desasters in der Schweinebucht wurden Darstellungen verbreitet, die der Niederlage einen ehrenhaften Anstrich geben sollten. Der Historiker Theodore Draper nannte die Invasion ein »perfektes Scheitern«, und der Schriftsteller Jim Rasenberger bezeichnete sie als »brillantes Desaster« – doch an der Operation Schweinebucht war nichts perfekt oder brillant, und die Konsequenzen in Miami, das sich in eine abgeschottete Blase von Intrigen, Verschwörungen und kriminellen Absprachen verwandelt hatte, waren katastrophal. Bewaffnet mit Schusswaffen, Bomben und verletztem Stolz hingen die kubanischen Ex-Patrioten dem Narrativ an, dass sie von der Geschichte betrogen worden waren.
Als das volle Ausmaß des Schweinebucht-Desasters in Miami bekannt wurde, kam es zu einem Deal zwischen den USA und Kuba. Keine zwei Wochen vor Kennedys Ankunft in Miami hatte die US-Regierung dem verarmten Inselstaat eine Nahrungsmittel- und Medikamentenspende im Wert von zweiundsechzig Millionen Dollar zukommen lassen, als Gegenleistung für die Freilassung von elfhundert Angehörigen der Invasionsbrigade. De facto eine Lösegeldzahlung, die es dem Präsidenten unmöglich machte zu verschleiern, dass Kuba dem mächtigen Nachbarn die Stirn geboten hatte. Gefördert von äußeren Mächten war die umkämpfte Insel von einer humanitären Krise heimgesucht worden, die dazu führte, dass Flüchtlinge in großer Zahl in die USA strömten und die dortige Staatsbürgerschaft beantragten, wodurch der urbane Charakter Miamis eine grundlegende Wandlung erfuhr. Die Migrationsströme in die Stadt schwollen nach 1959 dramatisch an. Die meisten Kubaner gelangten aufgrund von speziellen Hilfsprogrammen dorthin oder beantragten politisches Asyl mit dem Hinweis auf die Unterdrückung durch die Kommunisten in ihrer Heimat. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte. Die kubanische Regierung verabschiedete sich von ganzen Familien, erklärte sie für »unerwünscht« und nutzte die Gelegenheit, in den Gefängnissen des Landes Platz zu schaffen, indem einer Vielzahl von Insassen die Möglichkeit gegeben wurde, das Land ebenfalls zu verlassen. Einige gingen freiwillig. Anderen musste man erst gut zureden, und diejenigen, die in der Diaspora landeten, waren größtenteils wirklich arme Schlucker, die darauf hofften, dass das Leben in den USA ihnen und ihren Kindern größere Chancen bot.
Eine Gruppe Freiwilliger bei der Musterung in einem Rekrutierungsbüro der CIA in Miami. Kubanische Flüchtlinge meldeten sich freiwillig, um gegen Fidel Castro zu kämpfen. Die Operation fand im April 1961 statt und wurde als Invasion in der Schweinebucht bekannt. Das 5th Street Gym, wo Cassius trainierte, war die Heimat einer Generation exilkubanischer Ausnahmeboxer und somit ein Ort, an dem eine strenge Anti-Castro Stimmung herrschte.
© Everett Collection Historical / Alamy Stock Photo
Cassius’ Trainingspartner Luis Rodriguez war kubanischer Landesmeister im Weltergewicht gewesen. Als jedoch im Januar 1959 die Regierung Batista durch Castros Revolutionäre gestürzt wurde und sich die Stimmung innerhalb des neuen kommunistischen Regimes zunehmend gegen den Profisport wandte, emigrierte er nach Miami und wurde zu einem der Stars des 5th Street Gym. Ganze Scharen von kubanischen Einwanderern wurden mit Hochglanzpropaganda in die »freie Welt« gelockt. An Wochentagen flog zweimal täglich eine Chartermaschine von Varadero nach Miami. Eine Armeekaserne auf dem Gelände des Miami International Airport wurde mit Etagenbetten ausgestattet und unter dem Namen Freedom House als temporäres Auffanglager für ankommende Flüchtlingsfamilien umfunktioniert. Innerhalb eines Jahrzehnts wuchs die Zahl der Kubaner in den USA auf fast das Sechsfache an: von 79000 im Jahr 1960 auf 439000 im Jahr 1970. Miami wurde zur Hauptstadt der Exilkubaner, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung dort auf sechsundfünfzig Prozent anwuchs. Oder, wie ein Reporter des Miami Herald schrieb: Sie waren »überall präsent – ein ständiges, unergründliches Gewusel«.
Die Touristen, die sich lediglich am Strand und in den Lobbys ihrer Luxushotels aufhielten, bekamen weder etwas mit von den unergründlichen Kubanern noch von den Untergrundklängen, die durch die Bars und Nachtclubs des Overtown-Ghettos dröhnten. Hier existierte ein ganz anderes Miami – ein buntes Gewirr von pastellfarbenen Häusern mit teilweise abenteuerlich aussehenden Dachgärten, Billardsalons und illegalen Bars, versteckt unter den Fahrbahnrampen des Highway I-95 gelegen, der sich über sie hinwegwölbte. Feuerwerkskörper erhellten den Himmel, Austern schmorten auf den Grills, und allenthalben wurden klebrig süße Cocktails angeboten, die mit Rohalkohol zusammengerührt waren. An dunklen Straßenecken wurden verstohlen Glasröhrchen mit überaus potentem kubanischen Kokain verkauft, und überall lagen noch Schutt und Trümmer herum, die der Hurrikan »Donna« hinterlassen hatte. Cassius war umgeben von Trubel, Laster und Versuchungen, doch er schwor sich, all dem zu widerstehen und weiterhin mit eiserner Disziplin auf seinen Erfolg im Ring hinzuarbeiten.
Wenn er am Nachmittag mit seinem intensiven Training fertig war, zog er mit seinem jüngeren Bruder Rudolph, genannt Rudy, der nach dem Highschool-Abschluss ebenfalls nach Miami übergesiedelt war, durch ein von Afroamerikanern bevölkertes Viertel entlang der 2nd Avenue in Overtown, das The Stroll genannt wurde. Hier reihten sich Friseursalons, Plattenläden und Bars, die tagsüber geöffnet waren, aneinander. Cassius war Stammkunde im Famous Chef, dem Restaurant gleich neben seinem Hotel, und vertrieb sich die Zeit häufig in Sonny Armbristers Barbiersalon, wo er sich bei dem unter jungen Afroamerikanern angesagten vollmundigen Reimduell Speaking the Dozens schnell als Verbalakrobat einen Namen machte.
In diesem Viertel erlebte er die ersten Tage des Soul aus nächster Nähe und traf drei Männer, die in verschiedener Hinsicht eine bedeutende Rolle in seinem Leben spielen sollten. Rein zufällig trugen alle den Namen Sam. Sam Saxon würde ihn für die Nation of Islam rekrutieren – jene kontroverse religiöse Gruppierung, die von da an seine Ideen und seine Haltung zum Leben prägte; Sam Moore war ein Soulsänger aus Miami und Ex-Sträfling, der als MC im Knight Beat arbeitete und innerhalb weniger Jahre zusammen mit seinem Partner Dave Prater als Gesangsduo Sam and Dave zu einem der erfolgreichsten Acts von Stax/Atlantic wurde; und dann war da noch Sam Cooke, der legendäre Gospel-Pop-Star, der nach Miami kam, um eines der spektakulärsten Livealben in der Geschichte der schwarzen Musik aufzunehmen, und später seine ausgezeichneten Kontakte nutzte, um Cassius einen Plattenvertrag mit Columbia Records in New York zu vermitteln. Cooke gehörte zu einer Reihe von Künstlern aus der Soulszene, mit denen Cassius enge Freundschaften unterhielt, die er sorgsam pflegte. Dazu gehörten unter anderem noch Chubby Checker, der König des Twist, dessen Labelkollegin Dee Dee Sharp, Motowns blindes Wunderkind Little Stevie Wonder, der R&B-Star Lloyd Price, die aus East Orange, New Jersey stammende Dionne Warwick, Veronica Bennett, Leadsängerin der Ronettes (später bekannt unter dem Namen Ronnie Spector), und Ben E. King, der Soulcrooner aus Harlem, dessen Welthit »Stand by Me« Cassius auf seinem eigenen Debütalbum coverte.
Cassius’ Freundschaft mit Sam Cooke fiel genau in die Zeit, als die schwarze Musik an einer entscheidenden Wegmarke angelangt war: Gospelmusik waberte aus den Kirchen in die Schlafzimmer der Jugendlichen, und die Liebe zu Gott verwandelte sich in eine weltlichere, sexualisierte Form von Hingabe. Der Plattenproduzent Jerry Wexler beschrieb den ehemaligen Gospelstar Sam Cooke als die Verkörperung der Entwicklung des Soul: »Er hatte alles: die grandiose Präzision bei der Intonation und die absolute Kontrolle über Ton und Timbre, und zwar bis in die kleinsten Nuancen – selbst wenn er Töne verschleppte oder sich scheinbar nur an sie herantastete.« Sam Cookes Stimme hob nicht nur eine neue Musikrichtung aus der Taufe, sondern auch eine neue Art von Geschäftspolitik. Er gründete seine eigenen Plattenfirmen, betrieb eine eigene Management-Agentur und bestimmte mit seinem eigenen Verlag über seine Urheberrechte. Er war ein Leuchtfeuer des Fortschritts in einer Branche, die schwarze Künstler über Jahrzehnte hinweg ausgebeutet hatte. Cooke war charismatisch, ehrgeizig und fest entschlossen, selbst die Kontrolle über seine Karriere zu behalten, und er wurde damit zu einem bedeutenden Einfluss auf Cassius und dessen Denken.
Seit Kindheitstagen war Cassius immer wieder eingetrichtert worden, wie wichtig Eigenständigkeit und Selbstvertrauen waren. Sein Vater hatte ihm Vorträge über die Lehren von Marcus Garvey gehalten, während seine Mutter ihm einfachere Ratschläge mit auf den Weg gab: gute Manieren an den Tag zu legen und Verbrechen aus dem Weg zu gehen. Zum Zeitpunkt seiner ersten Begegnung mit Sam Cooke gab es bereits etliche Branchen, in denen Schwarze erfolgreich waren – Apotheken, Bestattungsunternehmen, lokale Taxiunternehmen –, doch in der Unterhaltungsindustrie manifestierten sich die Vorstellungen von Eigenverantwortung, Erfolgsstreben und Selbstständigkeit nunmehr in ihrer dramatischsten Form. In den Soulstudios von Detroit und den Gospelmusik-Plattenläden auf der South Side von Chicago machten Sam Cooke und seine Mitstreiter für alle sichtbar vor, dass es möglich war, die Kontrolle selbst zu übernehmen. Es war eine Botschaft, die Cassius aus nächster Nähe mitbekam und die er bald auf sein eigenes Leben anzuwenden begann.
Der Wichtigste unter seinen Bekannten war allerdings Sam Saxon; ein Mann von gedrungener Gestalt, der sich in früheren Jahren in Billardsalons als Profizocker verdingt hatte, dann nach Miami gezogen war und sich dort die Konzession für die Toilettenwärter und die Schuhputzer auf der Hialeah-Pferderennbahn auf der Central Eastside an Land gezogen hatte. Saxon dachte allerdings übers Schuheputzen hinaus. Er war ein erfahrener Anwerber der Nation of Islam, der nach Miami gesandt worden war, um in den heruntergekommenen Straßen von Overtown junge Männer zu rekrutieren und den wieder in ihr altes Ghettorevier zurückgekehrten Ex-Insassen des Hochsicherheitsgefängnisses in Raiford, genannt Flat Top, neue Hoffnung zu geben. In Problemvierteln kannte Saxon sich aus. Er war selbst in den John Eagan Homes Projects aufgewachsen, einer finsteren Sozialbausiedlung für schwarze Familien in Atlanta. Als Teenager trat er zum Islam über und erhielt nach Jahren intensiven Studiums die Auszeichnung »Rock of the South« (Fels des Südens), mit der die erfolgreichsten »Menschenfischer« der Nation of Islam geehrt wurden.
Irgendwann im März 1961, kurz nachdem Cassius aus Louisville nach Miami übergesiedelt war, kam es zur ersten Begegnung zwischen Saxon und dem jungen Boxer. Es war zunächst nur eine beiläufige Unterhaltung, doch es folgten zahlreiche weitere Gespräche, und es war schließlich Saxon, der Cassius überzeugte, seinen Sklavennamen abzulegen und stattdessen den vorläufigen Namen Cassius X anzunehmen. Während die anderen Hotelgäste oder Soulmusiker auf der Durchreise sich am Pool amüsierten, führten Saxon und Cassius häufig lange und tiefgründige Gespräche hinter verwitterten Jalousien im Dämmerlicht seines Zimmers im Sir John Hotel – und trotz der widrigen Umstände legte Saxon hier das Fundament für den Übertritt des Boxers zum Islam, die historische Transformation von Cassius Clay zu Muhammad Ali.
Saxon, dessen muslimischer Name Abdul Rahaman lautete, erinnerte sich später an diese Momente: »Mein Job war es, dafür zu sorgen, dass die Männer im Tempel angeleitet wurden, gut für ihre Familien zu sorgen, sich physisch auf Vordermann zu bringen und ein anständiges Leben zu führen … Es gab nicht viele Mitglieder, die regelmäßig kamen … Realistisch betrachtet, waren es in Miami etwa dreißig … Ich bin Ali im März 1961 zum ersten Mal begegnet, als ich die Zeitung Muhammad Speaks auf der Straße verkaufte. Er sah mich, sagte: ›Hallo, Bruder‹, und redete drauflos. Und ich fragte ihn: ›Hey, du kennst die Lehren des Propheten?‹ Er antwortete: ›Nun ja, ich war noch nicht im Tempel, aber ich weiß, wovon du redest.‹ Und dann stellte er sich vor: ›Ich bin Cassius Clay. Ich bin der nächste Schwergewichtsweltmeister im Boxen.‹«
Dieses zufällige Treffen an einer Straßenecke an der 2nd Avenue war der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Noch am gleichen Nachmittag blätterte Saxon das Album durch, in dem der Boxer die Zeitungsausschnitte über sich gesammelt hatte, von denen die meisten aus dem Courier-Journal, der Lokalzeitung seiner Heimatstadt Louisville, stammten. »Sein Interesse galt sich selbst und dem Islam, und wir haben über beides zugleich geredet«, erinnert sich Saxon. »Er war halbwegs vertraut mit einigen unserer Lehren, doch er hatte sie nie gründlich studiert oder Anleitung erfahren. Und natürlich fiel mir seine Großspurigkeit auf. Ich wusste, wenn ich es schaffte, ihn auf den Weg der Wahrheit zu führen, dann würde er einfach großartig sein. Also habe ich ihn zu unserem nächsten Treffen eingeladen.«
Cassius erinnerte sich später an seinen ersten Besuch in der bescheidenen Moschee in einem Ladengeschäft und daran, dass er anfangs nervös war wegen der eventuellen Konsequenzen für das Boxen: »Drei Jahre lang, bis zu meinem Kampf gegen Sonny Liston, habe ich mich immer nur durch die Hintertür zu den Treffen der Nation of Islam hineingeschlichen. Ich wollte vermeiden, dass jemand mitbekam, dass ich da war. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht um den Titel boxen lassen würden, wenn es herauskam. Doch an dem Tag, als ich den Islam fand, fand ich eine Kraft in meinem Inneren, die kein Mensch jemals zerstören oder mir wegnehmen konnte. Als ich zum ersten Mal diese Moschee betrat, da fand nicht ich den Islam … sondern der Islam fand mich.« Und weiter berichtete er seinem Biografen Thomas Hauser: »Das erste Mal, dass ich wahre Spiritualität empfand, war der Moment, als ich den muslimischen Tempel in Miami betrat. Ein Mann namens Bruder John redete, und das Erste, was ich hörte, waren die Worte: ›Warum nennt man uns Neger? Weil das die Masche des weißen Mannes ist, uns unserer Identität zu berauben.‹«
Der Rassenkonflikt hatte seine gesamte Jugend geprägt. Er war aufgewachsen vor dem dramatischen Hintergrund der Bürgerrechtsbewegung – der am stärksten polarisierenden Bewegung der Moderne. Während seiner prägenden Jahre als Teenager an der Highschool wurde er Zeitzeuge des Lynchmords an Emmett Till (1955), des Busboykotts von Montgomery (1955–56) und der Aufhebung der Rassentrennung in der Highschool in Little Rock (1957).
Danach, als junger Mann während seiner Zeit im Gym in Miami, erfuhr er von der Einschreibung von James Meredith an der University of Mississippi (1962), und während der Vorbereitung auf den Titelkampf gegen Sonny Liston war der Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama das Topthema in den Fernsehnachrichten. Bis 1963 hatte über die Hälfte der Südstaaten und ihrer Nachbarregionen, gegen teilweise erheblichen Widerstand, Maßnahmen zur Aufhebung der Rassentrennung im Erziehungssystem ergriffen. Auch die Warenhauskette Woolworth hatte angekündigt, dass die bisherigen, nach Hautfarben getrennten Kassen in allen Filialen abgeschafft würden, und die Restaurantkette Howard Johnson verkündete, dass nur noch in achtzehn von landesweit fast dreihundert ihrer Restaurants nach Rassen getrennt würde.
Der politische Wandel lag allenthalben in der Luft, doch in den Kirchen, Plattenstudios, Tanzschuppen und Nachtclubs vollzog sich auf einer anderen, subtileren Ebene eine weitere Revolution, die eng zusammenhing mit dem Kampf um Bürgerrechte, jedoch mehr auf private Aspekte fokussiert war: Liebe, Verliebtheit, Eifersucht und Untreue. Zu Anfang der 1960er begannen die verschiedenen Genres afroamerikanischer Musik – Jazz, Blues, Gospel, R&B, Doo Wop und Pop –, sich miteinander zu vermischen, bis sie zu einer machtvollen neuen Strömung zusammenflossen, die unter der Bezeichnung Soul populär wurde. Es war der Soundtrack des jungen Cassius Clay, der zu einem der berühmtesten Anhänger dieser Musikrichtung wurde und sämtliche Neuentwicklungen aufmerksam verfolgte.
Cassius und sein Bruder Rudy, der ebenfalls Boxer wurde, waren nach dessen Aussagen in einer vergleichsweise ruhigen Umgebung aufgewachsen: »In Louisville herrschte Rassentrennung, aber es war eine ruhige Stadt – sehr sauber und friedlich.« Es herrschte also durchaus Rassentrennung, jedoch ohne die hässlichen und offen gewalttätigen Auswüchse, wie man sie aus Birmingham oder Memphis kannte. Die Brüder wuchsen im Westend von Louisville auf, in einem mit leuchtrosa Schindeln verkleideten Haus mit einem verwilderten Rasen vor der Tür. Ihre Mutter Odessa Grady Clay gehörte der Baptistengemeinde an, und ihre liebevolle Art und ihre Religiosität wurden zu einem prägenden Einfluss auf die beiden Kinder. Ein Magazinartikel beschrieb Odessa als eine »rundliche, schwarze Frau mit hellem Teint und Sommersprossen, einem zurückhaltenden Benehmen und einem herzhaften Lachen. Alle, die mit der Familie bekannt waren, erklärten, dass ihre freundliche Art auf den Jungen abgefärbt hatte.« Sie war es auch, die in dem jungen Cassius die Begeisterung für die mitreißende Musik der Gospelsänger weckte – auch wenn ihre Bemühungen, ihre beiden Söhne für die Mitwirkung in einem Kirchenchor zu begeistern, erfolglos blieben.
Ihr Vater Cassius Clay Sr. hingegen war das genaue Kontrastprogramm. Er war ein kontaktfreudiger Mann, der sein Geld als Schildermaler verdiente – und dabei so viel Talent an den Tag legte, dass mehrere Kirchen der näheren Umgebung sich sogar Wandgemälde von ihm anfertigen ließen. Seine Freunde und Kollegen nannten ihn Cash. »Von Odessa hatte der junge Cassius seine freundliche und großzügige Art«, schrieb der Autor Dave Kindred, »und von seinem Vater die manische Energie und sein theatralisches Talent.« Cash war ein strenger Vater, der, auch wenn er zweimal nach Schlägereien wegen Körperverletzung verhaftet worden war, im Grunde keine gewalttätigen Neigungen hatte und sich fürs Boxen beispielsweise kaum interessierte. In der Nachbarschaft kannte man ihn als einen Mann mit einer ausgeprägten Fantasie, der sich manchmal als arabischer Scheich oder als mexikanischer Bauer verkleidete und eine exzentrische Aura verströmte, die auf seinen Sohn abfärbte. Sein jüngerer Sohn Rudy attestierte ihm einmal »wahres Showtalent«. Cash war Stammgast in den Bars für Schwarze, den Jazzclubs und Billardsalons von Louisville, wo man ihm wegen seines säbelförmigen schmalen Schnurrbarts in Anlehnung an Clark Gable den Spitznamen »Dark Gable« verpasste. Er war es auch, der Cassius’ Interesse an Rassenpolitik weckte – im Wandschrank der Familie lag seine Mitgliedskarte der von Marcus Garvey gegründeten Universal Negro Improvement Association, der wichtigsten Bewegung zur Gründung einer schwarzen Nation. Cash versuchte, seine Söhne zur Selbstständigkeit zu erziehen; im Grunde aber wünschte er sich immer, dass Cassius in seine Fußstapfen trat und sich der Kunst, der Kartografie und der Extravaganz widmete.
Cassius’ Eltern waren ein Musterbeispiel für Gegensätze, die sich anziehen. Ein weiterer Biograf, Jonathan Eig, beschreibt sie so: »Er war ungestüm, sie war sanftmütig. Er war groß und schlank, sie war klein und pummelig. Er wetterte gegen die Ungerechtigkeit der Rassendiskriminierung, sie lächelte und litt still vor sich hin. Er war Methodist, der selten zur Kirche ging, während sie zu den Baptisten gehörte und niemals einen Sonntagsgottesdienst in der Mount Zion Church versäumte. Er trank und trieb sich bis spät in der Nacht herum, während sie zu Hause blieb, kochte und putzte. Doch bei allen Unterschieden hatten sie beide einen gesunden Humor und lachten gerne. Wenn Cash sie manchmal aufzog, eine seiner wilden Geschichten auftischte oder unvermittelt ein Lied anstimmte, stieß Odessa oft ein helles Kichern aus, das ihr den Spitznamen ›Bird‹ eintrug. Cassius’ Mutter war eine begnadete Gospelsängerin, wie man sie im tiefen Süden der USA häufig findet. Allerdings entwickelte sie nie den Ehrgeiz, eine Profikarriere anzusteuern. Sein Vater hingegen bevorzugte Jazz, Jump Blues und was immer sonst noch das Publikum in den Nachtclubs der Stadt auf Touren brachte. Und so vollführte auch die Familie Clay den Spagat zwischen Gott und dem Nachtleben – dem Spannungsfeld, auf dem die Soulmusik gedeihen sollte.«
Cassius’ Leistungen an der Highschool in Louisville waren unterdurchschnittlich. Eine seiner frühen Freundinnen, die Schriftstellerin, Journalistin und Erzieherin McElvaney Talbott, die mit seinem Bruder in eine Klasse ging, erinnerte sich an Cassius als einen aufgeweckten Jungen, der in den Pausen schattenboxend durch die Schulkorridore tänzelte, sich im Unterricht jedoch sehr zurückhielt. »Er war ein Klassenclown«, erklärte sie der New York Times. »Mit ihm gab es immer was zu lachen.«
Sein Enthusiasmus schien schier grenzenlos; Tag für Tag rannte er auf dem Gehweg neben dem Schulbus her und lieferte sich mit ihm ein Rennen, während seine Freunde drinnen saßen und ihn anfeuerten. Cassius war extrovertiert, großspurig und stets zu Streichen und Witzen aufgelegt. In späteren Jahren wären seine Verhaltensweisen wahrscheinlich als ADHS-Symptome interpretiert worden, doch je mehr er es schaffte, seine Hyperaktivität durch eine Kombination aus Seilspringen, Sandsacktraining und Sparringskämpfen zu kanalisieren, desto mehr wurde auch sie zu einem Ritual und Routine. Sports Illustrated bezeichnete ihn einmal als »wahres Original, einzigartig in jeder Hinsicht, ein Geistesblitzgewitter – unvorhersehbar, witzig, verschmitzt, komisch«. Seine Englischlehrerin aus der Oberstufe, Thelma Lauderdale, hingegen beschrieb ihn als Tagträumer: »Er passte im Unterricht selten auf. Die meiste Zeit war er mit Zeichnen und Malen beschäftigt. Aber er machte nie Ärger. Bei mir im Unterricht war er immer schüchtern und still. Fast schon meditativ.«
Cassius wurde niemals ein guter Schüler. Gerald Eskenazi von der New York Times, den die schnelle Auffassungsgabe, der Witz und die Wortgewandtheit des jungen Boxers immer beeindruckt hatten, schilderte seinen Unglauben, als er erfuhr, dass Cassius den ohnehin nicht besonders anspruchsvollen Einstufungstest der Armee nicht bestanden hatte. Völlig verblüfft rief er den Rektor der Highschool an, um sich diese Angabe bestätigen zu lassen. »Er eröffnete mir, dass Ali einen IQ von achtundsiebzig hatte. Sie haben richtig gehört. Der kontroverseste und gleichzeitig charmanteste und zornigste Athlet Amerikas – jemand, dessen Sprüche jeden Tag irgendwo zitiert wurden und der damals schon Weltruhm genoss – hatte einen IQ, der zweiundzwanzig Punkte unter dem Normwert lag«, schrieb er. Er enthüllte außerdem, dass Cassius mit seinen Leistungen auf Platz 367 von 391 Schülern rangierte. Der Rektor der Schule erklärte, es sei nicht ungewöhnlich, dass schwarze Schüler bei einem Test, der ursprünglich für weiße Kinder entwickelt war, schlechter abschnitten (wobei er nicht erwähnte, dass die Schüler, die in der Rangliste vor Ali gelandet waren, ebenfalls Schwarze waren), und dass Ali bei Prüfungen unter extremer Nervosität litt. Sein großspuriges, übertrieben selbstbewusstes Auftreten war einfach eine Strategie, diese Nervosität zu übertünchen.
In der Highschool hatte sich Cassius im Schlittschuhlaufen versucht. Doch was ihn auf die Eisbahn zog, waren weniger sportliche Ambitionen als der Versuch, gleichaltrige Freunde zu finden. Einer dieser Freunde war der stille und später als Boxer chronisch unterbewertete Jimmy Ellis, Sohn eines Arbeiters in einer Zementfabrik, der Prediger einer Baptistengemeinde geworden war. Jimmy hatte Cassius während seiner Zeit als Amateur einmal besiegt. Er war ein Mensch, den man einfach sympathisch finden musste – nicht nur, weil er zurückhaltend und bescheiden war und die großspurigen Sprüche von Cassius geduldig ertrug, sondern vor allem, weil er eine tiefe Spiritualität ausstrahlte. Er war einer der zahlreichen großartigen Sänger, die dem Gospel die Treue hielten und nicht zum Soul wechselten. In seiner Jugend war er über Jahre hinweg einer der Solosänger der Riverview Spiritual Singers, einem der renommiertesten Gospelchöre in Louisville. Später unterzeichnete er einen Plattenvertrag mit Atlantic Records.
Ein weiterer Schulfreund aus der Mittelstufe an der Highschool war der Soulsänger Buford »Sonny« Fishback, der später unter dem Namen Sonny Fisher bekannt wurde. In den Anfangsjahren seiner Karriere spiegeln sich die gesellschaftlichen Erschütterungen, von denen er und Cassius betroffen waren: Fishback, ein anerkanntermaßen talentierter Sänger im Kirchenchor, hatte schon als Teenager in den Bars von Louisville einige Auftritte und brach die Schule schließlich ab. Er spielte zusammen mit älteren Musikern in Bars und Clubs wie dem Top Hat, Charlie Moore’s, dem Crosstown Café und dem Diamond Horseshoe und geriet später unter die Fittiche des berüchtigten Don Robey. Zu dieser Zeit gab es nicht wenige bekannte Gospelkünstler, die das Korsett der Religiosität abstreiften und sich kommerzielleren Musikrichtungen zuwandten – Rock’n’Roll, R&B und den weltlichen Liebesliedern des Doo Wop. An diesem Punkt kam Robey ins Spiel. Er war ein windiger Geschäftsmann, der mit der »Musik des Satans« sein Geld verdiente und zu diesem Zweck den berühmten Peacock Nightclub in Houston, Texas betrieb – sowie eine Reihe von Plattenfirmen, die unter dem Hauptlabel Duke-Peacock zusammengefasst waren. Wie etliche andere Pioniere der ersten Generation unabhängiger Plattenlabels hatte auch Robey einen aufbrausenden Charakter und war berüchtigt dafür, seine Künstler über den Tisch zu ziehen, indem er sie um ihre Urheberrechte betrog und mit Gewalt gegen diejenigen vorging, die sich seinen Praktiken zu widersetzen wagten. Was die Veränderung der musikalischen Landschaft betraf, war Duke-Peacock allerdings auf der Höhe der Zeit; und so kam es, dass Fishback 1967 einen Vertrag mit Peacock unterzeichnete.
Fishback verließ Louisville im selben Jahr, als Cassius nach Miami übersiedelte. Seine Karriere verlief wechselhaft – er nahm Platten für eine Vielzahl von kleinen Independentlabels auf, die überall in den afroamerikanischen Vierteln des Landes aus dem Boden schossen; und wie so viele aufstrebende Soulsänger zog er nordwärts nach Harlem, vor allem wegen der Nähe zu den größeren Indielabels für schwarze Musik – Atlantic, Wand, Calla und Tay-Ster Records. Er blieb dort zwanzig Jahre lang und machte Aufnahmen für Plattenfirmen, die dem Papier nach in Houston, New Orleans, Chicago und Los Angeles ansässig waren – darunter am bedeutendsten vermutlich Tou-Sea Records aus New Orleans, das Label von Allen Toussaint. Es ist seine Stimme, die auf »Heart Breaking Man« zu hören ist, einer treibenden Underground-R&B-Nummer, die 1966 bei Out-A-Site erschien.
Fishbacks wechselhafte Karriere in der unabhängigen Soulszene plätscherte irgendwann aus. Er verbrachte wegen verschiedener Vergehen einige Zeit im Gefängnis, bis er schließlich nach Louisville zurückkehrte, wo er sich auf seine zuvor gekappten Wurzeln im Christentum und im Gospel zurückbesann. Heutzutage pflegt er ein Dasein als extravagant gekleideter Witwer, Tourneeleiter und Bürgerrechtler, der beharrlich davon berichtet, dass Cassius schon von Kindesbeinen an mit der »Gabe des machtvollen Wortes« ausgestattet gewesen sei.
Ein weiterer Zeitgenosse von Cassius war der Jazz-Soul-Musiker Odell Brown, ein Orgelvirtuose, der mit seiner Band Odell Brown and the Organizers regelmäßig in Louisville auftrat. Nach seiner Einberufung zum Militär diente er kurzzeitig in Vietnam, und 1966 wurde seine Band von der Zeitschrift Billboard als »Beste neue Band« ausgezeichnet. Er wurde von Chess Records in Chicago für deren Hausband als Studiomusiker unter Vertrag genommen und spielte auf Schallplatten der großen Blues- und Soulkünstler des legendären Labels, darunter Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Ramsey Lewis und das Underground-Duo Maurice & Mac. Seine und Cassius’ Wege kreuzten sich wieder, als es mit dessen Karriere steil bergauf ging und Brown als musikalischer Leiter mit bekannten Chicagoer Künstlern wie Minnie Riperton und Curtis Mayfield auf Tour war.
Odell Brown ist eine der tragischen Gestalten der Soulmusik. 1982 schrieb er zusammen mit Marvin Gaye den Hit »Sexual Healing«, verfiel jedoch kurz darauf in tiefe Depressionen. Ein Jahr später wohnte er in einer heruntergekommenen Absteige in Los Angeles. Während der Übertragung der Grammy-Verleihung saß er in einer Bar und schaute sich die Zeremonie von dort aus an – obwohl er in vier Kategorien nominiert war und schließlich mit der Instrumentalversion von »Sexual Healing« tatsächlich einen Grammy gewann. Als er seinem Sitznachbarn erklärte, dass er gerade einen Grammy gewonnen hatte, meinte der nur: »Na klar.«
Ungeachtet seiner eher mageren schulischen Leistungen wob Cassius munter Mythen und Legenden um seine Jugendzeit. Da gab es die Geschichte von seinem gestohlenen Fahrrad, das zu einer Zufallsbegegnung im Gemeindezentrum der Stadt führte, wo ihn der Polizeibeamte Joe E. Martin unter seine Fittiche nahm und ihn zu drei Meistertiteln im Amateurboxen führte. Oder die Geschichte mit der Goldmedaille, die Cassius bei der Olympiade in Rom gewonnen und später in Louisville in den Ohio River geschleudert hatte, nachdem ihm der Eintritt zu einem von Weißen geführten Restaurant verwehrt worden war. Die Geschichte schlug in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung einige Wellen, und Cassius wiederholte sie mehrfach, doch sie wurde von verschiedenen Seiten in Zweifel gezogen. Sein Bruder Rudy Clay beharrt darauf, dass sie wahr ist, und berichtete immer wieder, dass sich der Vorfall in der Nähe eines Hamburger-Restaurants ereignete und Cassius die Medaille tatsächlich in den Fluss warf. Andere haben behauptet, dass er die Medaille zwei Jahre später in Miami immer noch besaß und sie gelegentlich Kindern zeigte, die sich in den Straßen von Overtown regelmäßig um ihn scharten. Soulsänger Sam Moore behauptet, er habe Cassius mit der Medaille um den Hals durch den Hotelkorridor am Eingang des Knight-Beat-Clubs schlendern sehen. Es kann sein, dass er sich irrt, doch der Mythos der Goldmedaille wurde durch die Vielzahl von Behauptungen und Gegenbehauptungen jahrelang am Leben erhalten.
Cassius gab sein Profidebüt im Oktober 1960 auf dem Freedom Hall State Fairground, einer Sportarena in Louisville, wo er Tunney Hunsaker einstimmig nach Punkten besiegte. Er hatte sich vor Ort im Gym von Bud Bruner auf den Kampf vorbereitet und war angeblich mit einem rosafarbenen Cadillac vor der Arena vorgefahren – ein Auftritt, den er sich von Sugar Ray Robinson aus Harlem abgeschaut hatte. Da er selbst noch nicht genügend Geld verdient hatte, um sich ein Auto – geschweige denn einen Cadillac – leisten zu können, lautet die wahrscheinlichste Erklärung, dass sein Vater mit seinem Hang zur Extravaganz den Wagen für einen Tag gemietet hatte. Es war der Auftakt einer Reihe von glamourösen Auftritten, die in den nächsten Jahren folgen sollten. Die größere Aufmerksamkeit seitens der ländlichen Lokalzeitungen wurde allerdings seinem Gegner zuteil. Dieser war nämlich der Polizeichef der kleinen Stadt Fayetteville, der sich für diesen Kampf extra Urlaub genommen hatte und mit einer Gage von dreihundert Dollar abgespeist wurde, während Cassius für sich eine Summe von zweitausend ausgehandelt hatte.
Nach dem Kampf unterschrieb Cassius einen Vertrag über achtzehntausend Dollar, der besagte, dass sein Management von einem elfköpfigen Konsortium von Geschäftsleuten aus Louisville übernommen wurde. Dies war ein entscheidender Schritt, der seine Glaubwürdigkeit in den frühen Jahren seiner Karriere absicherte. Im Gegensatz zu den Beratern und Sponsoren der meisten seiner Gegner bestand die Louisville Sponsoring Group aus angesehenen Geschäftsleuten, die – ungewöhnlich im Schwergewichtsboxen – keine öffentlich bekannten Verbindungen zur Unterwelt hatten. Zehn der Mitglieder des Konsortiums waren Millionäre, und jedes investierte achtundzwanzigtausend Dollar, um Cassius zu fördern. Der Vertrag wurde gegengezeichnet von Cassius’ Rechtsanwältin Alberta Jones, die als erste Frau afroamerikanischer Herkunft zur Staatsanwältin in Louisville ernannt worden war. Jones bestand darauf, dass fünfzehn Prozent von Cassius’ Siegprämien in einen Treuhandfonds eingezahlt wurden, über den er erst mit fünfunddreißig Jahren verfügen konnte – eine weise Maßnahme in einem Sport, in dem hauptsächlich Hungerlöhne gezahlt wurden, sodass sich die Boxer von einem Kampf zum nächsten hangelten, um schließlich reihenweise als verarmte, physische und mentale Wracks mit teilweise schweren Hirnschädigungen zu enden.
Jones war eine Bürgerrechtsanwältin, die sich in der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)1 und für die Bewegung zur Registrierung von Wählern engagierte. Sie wurde beim Familiengericht in Louisville akkreditiert und befasste sich dort mit Gewalttaten gegen Frauen. 1965 wurde sie niedergeschlagen, ermordet und in den Ohio River geworfen. Es wurde zunächst vermutet, dass sie ertrunken war, doch in ihrem Wagen, der in der Nähe der Sherman Minton Bridge abgestellt war, fand man Blutspuren, und es meldeten sich Zeugen, die behaupteten, gesehen zu haben, wie drei unbekannte Männer etwas oder jemanden in den Fluss warfen. Die Polizeiberichte legen nahe, dass Jones von einer Bootsrampe aus in den Fluss geworfen wurde; andererseits wurde drei Jahre später ihre Geldbörse in der Nähe der Brücke gefunden. Es existieren verschiedene Mordtheorien – auch in Bezug auf mögliche Täter –, doch der Fall ist noch immer ungelöst. An Jones’ Auto wurden die Fingerabdrücke eines siebzehnjährigen Jungen aus der Umgebung gefunden, doch die Beweislage war so dünn, dass die Ermittlungen im Sande verliefen. Zwei Theorien haben sich seitdem gehalten: dass sie entweder von einer Gruppe weißer Rassisten ermordet wurde, die sich für Jones’ Engagement in der Bürgerrechtsbewegung rächen wollten, oder dass sie Opfer eines Mordkommandos der Nation of Islam wurde, als diese sich darum bemühte, die Kontrolle über Cassius’ Karriere an sich zu reißen. Keine der beiden Theorien konnte bisher bestätigt werden.
Während Cassius’ früher Jugendjahre in Louisville wurden die Charts von Singles mit immer neuen Modetänzen dominiert. Auch er war fasziniert von den vertrackten Rhythmen und den oft albernen Parolen und Slogans, die irgendwie mit seinem eigenen extrovertierten Wesen korrespondierten. An der Schule sah man ihn häufig Pirouetten drehend durch die Flure tänzeln und zu einem imaginären Beat wilde Schrittkombinationen vollführen. Dick Sadler, ein ehemaliger Trainer des legendären Archie Moore, erinnert sich an eine quälend lange und nervige Zugfahrt mit Cassius zu der Zeit, als Chubby Checkers »The Twist« und Dee Dee Sharps »Mashed Potato« gerade große Hits waren. Sadler zufolge brachte Cassius die gesamte Strecke von L. A. bis nach Texas auf dem Gang des Waggons damit zu, die aktuellen Hits lauthals singend und mit den entsprechenden Tanzschritten unterlegt zum großen Missvergnügen seiner Mitreisenden endlos zu wiederholen. Wobei er die Begeisterung für die Musik mit seinem Bruder teilte. Der Ruhm brachte die beiden in den folgenden Jahren mit einer Vielzahl großer Stars in Kontakt, doch paradoxerweise verhielt sich der junge Boxer, obwohl er berühmter war als nahezu alle von ihnen, in ihrer Gesellschaft sichtbar nervös, schüchtern und ehrfürchtig.
Dem Fotografen Howard Bingham zufolge, der bei der schwarzen Wochenzeitung Los Angeles Sentinel beschäftigt war, als er Cassius zum ersten Mal begegnete, verwandelte dieser sich in ein Kind, sobald er in Gesellschaft von R&B-Sängern war. »Ali verehrte Fats Domino, Little Richard, Jackie Wilson, Sam Cooke, Lloyd Price, Chubby Checker, all diese Typen … Er war immer noch der kleine Junge, der hochschaut, und da stehen sie alle auf ihrem Sockel.«
Seine Musikbegeisterung reicht allerdings zurück in die Zeit, bevor er berühmt wurde. Ende 1958 wartete Cassius trotz des strengen Verbots seiner Mutter, sich diesem Ort auch nur zu nähern, vor der Top Hat Lounge in Louisville, um sich schließlich durch eine Menge von Fans zu Lloyd Price zu drängeln, dessen Single »Stagger Lee« gerade zum Sturm auf die Charts ansetzte. Der Song über die Abenteuer eines Zuhälters aus St. Louis wurde zu einem von Cassius’ Lieblingssongs, obwohl die zwielichtige Welt, in der er spielt, herzlich wenig mit dem liebevollen und relativ gesicherten Umfeld zu tun hatte, in dem er selbst aufwuchs.
Mit Cassius’ wachsendem Selbstvertrauen wuchsen auch die Bedenken und Sorgen in der Familie. Seine Mutter hatte Angst, dass seine Extravertiertheit ihm irgendwann Ärger einbringen könnte, während der Vater in der scheinheiligen Weise, wie Disziplin in der Familie oft funktioniert, sich Sorgen machte, dass einige seiner eigenen schrulligen Neigungen auf den Sohn abfärben könnten. Und ihre Sorgen waren in hohem Maß begründet. Im September 1955, Cassius war gerade dreizehn Jahre alt, landete die neueste Ausgabe der Illustrierten Jet im Briefkasten der Familie. Jet war eine bunte Monatszeitschrift im Heftformat, in der hauptsächlich Erfolgsgeschichten und Porträts von afroamerikanischen Stars aus der Welt des Sports, des Kinos und des R&B abgedruckt waren. Der Comedian Redd Foxx bezeichnete Jet einmal als »die Bibel der Schwarzen«, und sie war in der Tat ein Fenster, das einen massenkompatiblen Ausblick auf den aufkommenden Soul, die Bürgerrechtsbewegung und Aufstiegsmöglichkeiten für Schwarze bot. Doch in dieser Ausgabe, die auch in den folgenden Teenagerjahren von Cassius in der Familie immer wieder zur Sprache kam, präsentierte die Zeitschrift, neben ihrer üblichen Kost aus Prominentenberichterstattung, eine hochgradig aufwühlende Fotoserie mit dem grausam entstellten Gesicht von Emmett Till, einem Teenager aus Chicago, der Ende August 1955, während er die Sommerferien bei seinem Großvater in der Gemeinde Money im Mississippi-Delta verbrachte, entführt und gelyncht worden war. Till war beschuldigt worden, sich einer weißen Frau aus dem Ort gegenüber zudringlich verhalten zu haben, woraufhin er von Familienangehörigen der Frau und ihren Freunden grausam misshandelt wurde. Der Historiker David Halberstam bezeichnete die Fotos als »das erste große Medienereignis der Bürgerrechtsbewegung«. Und für Reverend Jesse Jackson war es ihr »Urknall« – ein Dokument, das die grassierende soziale Ungerechtigkeit als ein Problem deutlich machte, gegen das alle Menschen mit klarem Verstand eine gemeinsame Allianz bilden konnten.
Die Entscheidung der Redaktion, diese Fotos genau zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung gegen die Mörder von Emmett Till zu veröffentlichen, stellte eine publizistische Meisterleistung dar und markierte zugleich eine Neuausrichtung von Jet