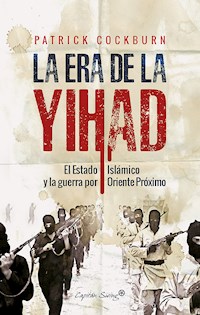16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kein westlicher Reporter hat von den kriegerischen Ereignissen im arabischen Raum und im Nahen Osten so intensiv berichtet wie der aus Irland stammende Korrespondent des englischen Independent, Patrick Cockburn. Aus nächster Nähe dokumentiert er Glaubenskriege und Chaos im Irak, in Libyen, in Syrien und im Kalifat des Islamischen Staates. In diesem Buch sind erstmals gesammelte Reportagen von Patrick Cockburn aus den Brennpunkten der Weltpolitik in deutscher Sprache versammelt. Er berichtet von den dramatischen Folgen des 1990 verhängten Embargos gegen den Irak, indem er dessen Opfer porträtiert. Er erzählt vom Aufstand der Sunniten gegen die amerikanischen Truppen im Irak, indem er deren Protagonisten interviewt. Und er begleitet die BewohnerInnen Syriens auf dem Weg in die Katastrophe, genauso wie jene Menschen, die unter der Herrschaft des IS-Kalifats leben müssen. Cockburns Reportagen sind auch eine Anklage an die westlichen Kriegstreiber und die lokalen Warlords, die eine ganze Weltregion ins Chaos gestürzt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Patrick CockburnChaos und Glaubenskrieg
© 2017 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
ISBN: 978-3-85371-854-4
(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-424-9)
Titel der englischen Originalausgabe: »Chaos and Caliphate. Jihadis and the West in the Struggle for the Middle East«, published by OR Books 2016.
Fordern Sie unsere Kataloge an: Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Patrick Cockburn, geboren 1950 in Irland, arbeitet als Nahost-Korrespondent für die englische Tageszeitung Independent. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine journalistische Tätigkeit, darunter den »Martha-Gellhorn-Preis« und den Preis für den »Auslandskorrespondenten des Jahres 2014«
I. Einleitung
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Alles zerfällt; die Mitte hält es nicht.
Ein Chaos, losgelassen auf die Welt,
Die Flut, bluttrüb, ist los, und überall
Ertränkt der Unschuld feierlicher Brauch;
Die Besten verzweifeln bloß, derweil das Pack
Voll leidenschaftlichem Erleben ist.
William Butler Yeats1
Bewaffnete Konflikte, die Palette reicht vom allgemeinen Kollaps der Sicherheitslage bis hin zu ausgewachsenen Kriegen, verschlingen den Nahen Osten und Nordafrika. Andere Teile der Welt sind zwar friedlicher als fünfzig Jahre zuvor, aber Chaos und Konflikte verbreiten sich in einem großen Streifen in islamischen Ländern vom Nordwesten Pakistans bis zum Nordosten Nigerias. Nicht wenige Zentralregierungen sind zusammengebrochen, sind geschwächt, sind mit mächtigen Aufständen konfrontiert oder kämpfen um ihr Überleben. Bürgerkriege im Kerngebiet dieser Region zerreißen den Irak, Syrien und den Jemen mit einer Brutalität, die wahrscheinlich zur Folge hat, dass keines dieser Länder jemals wieder als einheitlicher Staat zusammenfinden wird. Der Krieg in Afghanistan geht ohne Sieger weiter und in Libyen ist die Zentralregierung seit 2011 so zerrüttet wie zwanzig Jahre zuvor in Somalia, das sich noch immer im Zustand bewaffneter Anarchie befindet. An den Rändern dieser ungeheuren Region der Instabilität ist der türkisch-kurdische Bürgerkrieg in den Bergen im Südosten der Türkei wieder aufgeflammt und die Selbstmordattentäter von Boko Haram metzeln Menschen in Nigeria, Mali und Kamerun nieder.
Am intensivsten sind diese Konflikte zwischen der iranischen Grenze und dem Mittelmeer: von dort strahlen sie am stärksten aus auf den Rest der Welt. In den einhundert Jahren seit dem Sturz des Osmanischen Reiches ist diese Region niemals wirklich stabil gewesen: Sie sah ausländische Invasionen und Besatzung, die arabisch-israelischen Kriege, Militärputsche, Aufstände, Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten sowie zwischen Kurden, Arabern und Türken. Hier – mehr als irgendwo sonst – treffen die politischen, nationalen und religiösen Kontinentalplatten aufeinander. Und sie reiben sich aneinander, mit verheerendem Effekt. Denn niemals zuvor ist das Leben der Einwohner dieser Region so gefährlich und unsicher gewesen: mit 9,5 Millionen Vertriebenen in Syrien und 3,2 Millionen im Irak.
Die Wurzeln dieser Konflikte reichen weit in die Zeit zurück, aber ihre Ausbrüche sind seit 2001 häufiger und zerstörerischer geworden. Wir erleben eine Bürgerkriegsphase, in der sunnitisch-fundamentalistische Glaubenskrieger eine führende Rolle spielen. Den Startschuss für eine Reihe katastrophaler Ereignisse, die den alten Status quo zerstörten, bildete Nine-Eleven: die Lenkung mehrerer Flugzeuge in das World Trade Center am 11. September 2001. Der Angriff führte – und das war wohl seine Absicht – zu US-Militärinterventionen in Afghanistan und im Irak. Diese verwandelten die politische, konfessionelle und ethnische Landschaft in der Region und entfesselten Kräfte, deren Energie alle damalige Vorstellungskraft übersteigt. Wer hätte Ende 2001 (gerade als die Taliban in Afghanistan mit solch offenkundiger Leichtigkeit gestürzt wurden) vermutet, dass binnen dreizehn Jahren eine andere fanatische, sunnitisch-fundamentalistische Bewegung – der Islamische Staat im Irak und der Levante (verschiedentlich bekannt als IS, ISIS, ISIL oder Daesch) – im Westirak und in Ostsyrien ihr eigenes Kalifat errichten würde? Als es unter anhaltenden Beschuss durch die USA und deren Verbündete geriet, löste sich das Taliban-Regime schnell in Luft auf; das Kalifat aber erwies sich gegenüber seinen Gegnern auf internationaler Ebene als weit widerstandsfähiger. Ein Jahr nach seiner Gründung im Jahr 2014 hatte es immer noch Bestand – und es errang immer noch Siege, insbesondere im Mai 2015 mit der Einnahme von Ramadi im Irak und von Palmyra in Syrien. Während andere Staaten in der Region auseinanderbrechen, war allein der IS fähig, einen neuen Staat zu begründen, der – so monströs er auch sein mag – in der Lage ist, Soldaten einzuziehen und Steuern zu erheben.
Der Kriegsbeginn in Afghanistan war der Auftakt zu einer größeren Krise. In der arabischen und islamischen Welt hatte es bereits viele Verwerfungslinien gegeben, aber die US-geführte Invasion des Irak im Jahr 2003 war das Erdbeben, dessen Nachbeben noch heute zu spüren sind. Sie lud bestehende Konflikte und Auseinandersetzungen auf und dehnte sie aus: etwa zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden; zwischen Saudi-Arabien und dem Iran; zwischen Ländern, die der US-Politik ablehnend gegenüberstehen, und jenen, die sie unterstützen. Außerdem gibt es weitere langfristige Entwicklungen in der Region, die weniger Aufmerksamkeit erfahren, aber doch tiefgreifende Veränderungen im Kräfteverhältnis in und zwischen Ländern nach sich ziehen: Der ungeheure Ölreichtum der Golfstaaten – Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Katars und Kuwaits – hat sich in politische Macht verwandelt. Diese absolutistischen Monarchien sunnitischen Glaubens haben heute die Führung in der arabischen Welt inne; eine Position, die vor vierzig Jahren weitgehend in den Händen säkularer, nationalistischer Staaten wie Ägypten, Syrien, Irak, Algerien, Libyen und Jemen gelegen hatte. Im selben Zeitraum kam es zu einer damit zusammenhängenden, wichtigen ideologischen Verschiebung: der sunnitische Mehrheitsislam wird nun zunehmend beherrscht vom Wahhabismus, jener in Saudi-Arabien vertretenen Variante des Islam. Der saudische Reichtum vergrößerte den Einfluss dieser intoleranten und rückschrittlichen Strömung, die andere islamische Schulen wie den Schiismus als Ketzerei anprangert und Frauen behandelt, als wären diese den Männern auf ewig unterworfen. Nirgendwo anders auf der Welt, nur in Saudi-Arabien und im Kalifat, ist es Frauen verboten, Auto zu fahren.
Eine bedeutende Veränderung auf politischem Gebiet war auch der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991: Sie öffnete Tür und Tor für die ausgewachsene militärische Intervention des Westens, die zuvor von der Furcht vor der Reaktion der anderen Supermacht verhindert worden war. Eine der rationaleren Erklärungen Saddam Husseins für seinen Einmarsch in Kuwait 1990 war die, dass die Sowjetunion bald kein Gegengewicht zu den USA mehr darstellen und in der Zukunft die Handlungsfreiheit von Staaten wie dem Irak schrumpfen würde. Wie in vielen seiner außenpolitischen Entscheidungen lag Saddam auch mit dieser katastrophal falsch: Die Sowjetunion gewährte ihm keinerlei Schutz gegen den überwältigenden, US-geführten Gegenangriff, der seine Armee in Kuwait besiegte. Korrekt aber war seine Einschätzung, die Epoche gehe zu Ende, in der die regionalen Führungskräfte zum eigenen Vorteil zwischen den beiden Supermächten taktieren konnten.
Die Invasion und Besetzung des Irak durch die USA steht im Zentrum dieses Buches, denn sie zerstörten den Irak als einheitliches Land – und bisher war niemand fähig, ihn wieder zusammenzusetzen. Der Einmarsch setzte einen Zeitabschnitt in Gang, in dem sich die drei großen Bevölkerungsgruppen des Irak – Sunniten, Schiiten und Kurden – in einem Zustand der dauerhaften Konfrontation befinden: eine Situation, die zutiefst destabilisierende Auswirkungen auf die Nachbarn des Irak hat. Die natürliche Reaktion einer jeden der irakischen Gemeinschaften, die seitens eines heimischen Widersachers unter Druck gerät, ist nicht der Kompromiss, sondern die Suche nach ausländischen Verbündeten. Die inneren irakischen Krisen haben sich rasch internationalisiert. Angesichts dessen, dass es zweiundzwanzig arabische Länder mit einer Gesamtbevölkerung von 366 Millionen Menschen und rund fünfzig islamische Länder mit einer Bevölkerung von 1,6 Milliarden Menschen gibt, hatte dieser Umstand ernsthafte Konsequenzen für ein Viertel der Weltbevölkerung. Zudem hatte der Irak-Krieg Auswirkungen auf die USA und Großbritannien, deren Regierungen geglaubt hatten, einen kurzen, siegreichen Krieg zu führen, letztlich aber in einen langen, ermüdenden und erfolglosen Krieg gerieten. Sie mögen keine waschechte militärische Niederlage erlitten haben, aber ihr doch sehr offenkundiges Scheitern bedeutete für beide Länder, weniger glaubhaft mit militärischer Gewalt drohen zu können. Die Tatsache, dass die öffentliche Meinung in Amerika augenblicklich keine Basis dafür bietet, US-Bodentruppen in den Nahen und Mittleren Osten zu schicken, ist ein wichtiges Element jenes Krieges, der derzeit im Irak und in Syrien wütet.
Der explosive Druck, der sich seit 2003 aufbaute, detonierte vollends erst 2011 im »Arabischen Frühling«, wie man die Geschehnisse fälschlicherweise nannte. Der Begriffbeinhaltet zwar einen wahren Kern (deshalb wurde er ja zur Sammelbezeichnung für eine Reihe komplizierter Ereignisse), aber das Wort »Frühling« überzeichnet den fortschrittlichen und positiven Charakter der Begebenheiten. Es stimmt, dass Millionen von Menschen in Tunis, Bengasi, Kairo, Sanaa, Damaskus, Bahrain und darüber hinaus im Jahr 2011 das Ende der Polizeistaaten forderten, die von korrupten und brutalen Eliten beherrscht werden, und diese durch ehrliche, rechenschaftspflichtige, gesetzlich gebundene Regierungen ersetzen wollten. Aber diese gemäßigt klingenden Forderungen (einschließlich der Forderung nach freien Wahlen und einem Ende der Diskriminierung) bedeuteten eine wahre Revolution in einem Land wie Bahrain, in dem die schiitische Mehrheit unausweichlich die Macht von der sunnitischen Minderheit übernehmen würde, welche diese seit Jahrhunderten monopolisiert hat. In Syrien wäre das genaue Gegenteil der Fall: bürgerliche und politische Freiheit würde bedeuten, dass die sunnitischen Araber (sechzig Prozent der Bevölkerung) die Alawiten ersetzen würden, jene heterodox-schiitische Gruppe, welche die herrschenden Kreise des Regimes seit den 1960er-Jahren dominiert.
Einige gut informierte Zeitgenossen mögen nun einwenden, die Lage mit Hilfe von schlichten religiösen Kategorien zu analysieren, sei eine allzu starke Vereinfachung. Und das ist richtig, aber konfessionelle und ethnische Kämpfe spielen eine zentrale, wenn auch nicht ausschließliche Rolle in den Krisen im Irak, in Syrien, der Türkei, in Afghanistan und im Jemen.
*
Diese Epoche der Bürgerkriege ist das Hauptthema der hier veröffentlichten Aufzeichnungen und Reportagen aus den Jahren 1996 bis 2016. Ich möchte die Ereignisse unter zwei Blickwinkeln betrachten: einerseits der zeitgenössischen Beschreibung und andererseits der rückblickenden Erklärung und Analyse aus heutiger Sicht. Beide Ansätze haben ihre Vorzüge. Der Augenzeugenbericht dürfte (unverfälscht vom Wissen um spätere Ereignisse) eine Lebendigkeit aufweisen, die später geschriebenen Betrachtungen abgeht, und überzeugend erklären, warum Menschen handelten, wie sie eben handelten. Aber auch ein Rückblick, der zwölf oder mehr Jahre nach dem Beginn der Kriege in Afghanistan und Irak und vier Jahre nach den Erhebungen von 2011 geschrieben wurde, hat ebenso seine Vorteile: So werden gemeinsame Merkmale dieser Konflikte deutlich und es wird möglich, allgemeine Schlüsse über den Ursprung und Verlauf der verschiedenen, aber miteinander zusammenhängenden Ereignisse zu ziehen. Ich habe es immer als eine Schwäche in der Debatte über diese Kriege und Konflikte angesehen, wenn die beteiligten Syrienexperten wenige Kenntnisse aus erster Hand über den Irak haben und wenig oder gar nichts über die Türkei wissen, obwohl die Entwicklungen in jedem dieser Länder nicht gänzlich zu begreifen sind ohne ein Verständnis der anderen Länder. Ich erinnere mich, wie ich – kurz vor der Einnahme Mossuls durch den IS im Juni 2014 – an einer Konferenz über Syrien teilnahm und vergeblich versuchte, die versammelten Syrienexperten davon zu überzeugen, dass die zunehmende Stärke des IS im Irak die bedeutendste Entwicklung in der Region sei, die den Krieg in Syrien beeinflussen werde. Meine geschätzten Kollegen zeigten während meiner Beiträge eine höfliche Ungeduld und wandten sich dann rasch wieder der Erörterung ausschließlich syrischer Fragen zu. Andererseits ist es riskant, brauchbare Verallgemeinerungen über irgendwelche geschichtlichen Abläufe anzustellen, ohne die Einzelheiten wirklich bei der Hand zu haben: man ist doch allzu leicht versucht, allzu schlichte Parallelen zu ziehen. Ich erinnere mich an die 1980er-Jahre, an meine Zeit als Korrespondent in Moskau und daran, wie schwer mein Herz immer wieder wurde, wenn Besucher die komplexe Situation in der Sowjetunion leichtfertig mit irgendeinem Land verglichen, das sie gut kannten (mit Südafrika etwa), und Bemerkungen machten über Ähnlichkeiten, die es nicht wirklich gab. Aus diesem Grunde habe ich viele meiner Gedanken über diese sehr unterschiedlichen und komplizierten Ereignisse in ein ausführliches »Nachwort« am Ende des Buches gepackt, nach der Darlegung der Grundlagen für meine Schlussfolgerungen.
Ein Großteil meines Arbeitslebens in den vergangenen vierzehn Jahren bestand in der Berichterstattung über die Kriege in vier Ländern: Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen. Das summiert sich auf mehr als vier Kriege, denn bisweilen spielte sich im selben Land und zur selben Zeit mehr als nur eine Auseinandersetzung ab. Im Jahr 2004 zum Beispiel führte die US-Armee zwei sehr unterschiedliche Kriege im Irak: gegen einen sunnitischen Aufstand, in dem al-Qaida im Irak eine führende Rolle spielte, und gegen die schiitische Mahdi-Armee, die Miliz von Muqtada al-Sadr. Ebenso führte der IS 2015 verschiedene Kriege, einerseits gegen die Regierungstruppen im Zentrum Syriens und andererseits gegen die syrischen Kurden im Nordosten, die von den USA unterstützt wurden. Neben der Berichterstattung über diese augenscheinlichen Kriege besuchte ich Bahrain, wo die Proteste 2011 brutal niedergeschlagen wurden. Im selben Jahr war ich im Iran, bis man mich des Landes verwies. Jemen schließlich taumelte am Rand eines Krieges, seit ich 1978 das erste Mal dort war – aber erst 2014/15 kollabierte es letzten Endes in einen bewaffneten Großkonflikt.
Bewusst ausgelassen habe ich meine Texte über Ägypten, denn das Land befindet sich nicht im Krieg, obwohl es eine brutale staatliche Repression und zunehmende Guerillagewalt erlebt. Auf dem Höhepunkt der Demonstrationen in Kairo 2011 waren die ägyptischen Proteste ein strahlendes und ermutigendes Beispiel für den Rest der arabischen Welt. Die Losungen vom Tahrir-Platz wurden in Bahrain, Sanaa und Damaskus aufgegriffen. Aber die Protestierenden ergriffen niemals die Staatsmacht und zwei Jahre später schon standen die Ägypter unter der Gewalt eines noch repressiveren Polizeistaats, als sie ihn unter Präsident Husni Mubarak erlebt hatten. Diese politische Entwicklung unterscheidet sich von der übrigen Region.
Es lohnt sich zu betonen, dass die Regierungen, Völker und Bevölkerungsgruppen oder Gemeinschaften, über die ich schreibe, Bürgerkriege führen – das auszublenden, hat nämlich zu vielen irreführenden Analysen und enttäuschten Erwartungen geführt. Dabei handelt es sich nicht um Schwarz-Weiß-Situationen: um die guten gegen die bösen Buben, den niederträchtigen Tyrannen gegen ein aufrechtes Volk wie aus Victor Hugos DieElenden. Es ist erstaunlich und frustrierend zu sehen, wie westliche Regierungen – angeblich beraten von gut unterrichteten Diplomaten und Geheimdiensten – ihre Länder wiederholt in Kriege verwickelt haben, ohne diese grundlegende Tatsache zu bedenken. Ich erinnere mich an US-Pressekonferenzen in der Grünen Zone in Bagdad 2003, auf denen der offizielle Sprecher unbeirrt ewiggestrige »Überbleibsel« des alten Regimes, die sich auf »den neuen Irak« nicht einlassen wollten, für die sporadischen Guerilla-Angriffe auf US-Kräfte verantwortlich machte. Zunächst dachte ich, das sei bloß ein bisschen schlichte Propaganda. Dann aber musste ich erkennen, dass er seine Aussagen für wahr hielt und sich nicht bewusst war, dass die USA und ihre Verbündeten in einen bewaffneten Konflikt mit der gesamten, sechs Millionen zählenden sunnitischen Gemeinschaft im Irak hineinschlitterte. Dasselbe Schauspiel im Juli 2015, als sich Vertreter der USA und der EU unbekümmert mit den türkischen Luftschlägen und Militäroperationen gegen die »Terroristen« der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) solidarisierten, ohne zu erkennen, dass sie einen Angriff des türkischen Staates auf seine achtzehn Millionen kurdischen Bürger beklatschten.
Ein Problem von Propaganda ist es, dass niemand so sehr daran glaubt wie jene, die sie verbreiten: Die Verteufelung von Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi und Baschar al-Assad und das Verherrlichen ihrer Gegner als selbstlose Freiheitskämpfer schuf – ungeachtet einer unmittelbaren politischen Nützlichkeit – ein verzerrtes und irreführendes Bild von den Problemen im Irak, in Libyen und in Syrien. Regierungen neigen zum Wunschdenken und dazu, ihre Widersacher als Mitglieder einer kleinen, nicht-repräsentativen Bande zu betrachten. Dies hindert dieselben Politiker und Offiziellen jedoch nicht daran, anschließend so zu handeln, als wäre das genaue Gegenteil der Fall, und sehr viel größere Gruppen mit kollektiven Strafmaßnahmen zu überziehen – womit sie als Rekrutierungsoffiziere für jene Aufstände agieren, die sie zu unterdrücken suchen.
Die hier folgenden Aufzeichnungen und Reportagen wurden nicht aktualisiert, sondern lediglich gekürzt. Mir ist wichtig, sie hier unverändert darzulegen: in erster Linie, weil man die tatsächlichen Geschehnisse der jüngsten Geschichte ziemlich schnell vergisst. Das öffentliche Bewusstsein über die neuesten Nachrichten mag groß sein, denn die Berichterstattung der Medien ist oftmals gut – aber die Entwicklungen der vorhergehenden fünf, sechs Jahre bleiben unklar. Oftmals gibt es eine bedauerliche »Wissenslücke« über eben die Phase, in der die aktuellen Ereignisse heranreiften. So etwa herrscht in Großbritannien ein fast schon obsessives Interesse für die Geschehnisse der Jahre 2002 und 2003, als das Land in einen umstrittenen Krieg im Irak zog – aber es gibt nur ein begrenztes Wissen über die katastrophale britische Besetzung Basras von 2003 bis 2006, oder über die weiteren Entwicklungen der Folgejahre im Irak im Allgemeinen. Als sich die amerikanischen Streitkräfte nach 2008 zurückzogen, versiegte auch in den USA das Interesse an den Geschehnissen im Irak und der Irak war nun die Krise von gestern: Die Sender und Zeitungen schlossen ihre Nachrichtenbüros in Bagdad und berichteten nur mehr spärlich … bis zu dem Augenblick, in dem der IS im Juni 2014 die Stadt Mossul einnahm und das Land auseinanderfiel. Die Menschen sind schlecht informiert und können nur rätseln, warum es dazu kam – denn so viel Wichtiges ereignete sich in diesem entscheidenden, aber vernachlässigten Zeitraum zwischen der unmittelbaren und der ferneren Vergangenheit.
Außerdem braucht es Augenzeugenberichte, die geschrieben wurden, ohne die Gewinner und Verlierer einer Krise zu kennen. Ein Historiker bemerkte einmal, »man darf nicht vergessen, dass einst die Zukunft war, was heute Vergangenheit ist«. Anders gesagt: viele Optionen schienen offen, die im Rückblick verschlossen erscheinen. Weil eine bestimmte Handlungsoption gewählt wurde, erlangt die Entscheidung, so und nicht anders zu handeln, einen falschen Anschein der Unvermeidlichkeit. Und selbstverständlich haben die Entscheidungsträger allen Grund zu der Behauptung, dass nichts anderes hätte getan werden können (insbesondere, wenn sich die Entscheidung als katastrophal verfehlt und falsch herausstellt). In den USA gibt es scheußliche Ausdrücke wie Monday morning quarterbacking oder 20:20 hindsight, um Kritiker zu bezichtigen, Urteile auf der Grundlage von Erkenntnissen zu fällen, die den eigentlichen Entscheidungsträgern nicht zugänglich waren – dabei ist in Wirklichkeit vieles von dem, was in einer gegebenen Situation schiefläuft, aufgrund bereits einsichtiger Tatsachen vorhersehbar gewesen (und vorhergesehen worden).
Zum Beispiel glaubte ich 2003, vor dem Sturz Saddam Husseins, die USA und ihre Verbündeten würden damit durchkommen, in den Irak einzumarschieren und dessen Führer zu stürzen: Zu dieser Zeit waren die meisten Iraker – Sunniten ebenso wie Schiiten und Kurden – der Ansicht, dass Saddam ihr Land zerstört hatte, und sie wollten ihn loswerden. Ich war aber auch überzeugt, dass die Koalitionsstreitkräfte – sollten sie versuchen, den Irak langfristig zu besetzen – mit einem heftigen und unbezwingbaren Widerstand aus dem Landesinnern wie aus dem Ausland konfrontiert würden. Das war unschwer vorherzusehen und ich war sicherlich nicht der Einzige, der das sagte, bevor die US-Panzer auch nur Bagdad erreichten. Darüber schrieb ich damals mit einigem Grundvertrauen, denn genau das hatten mir gut informierte Iraker gesagt. Verblüffend war, dass es den Spitzenpolitikern in Washington und London derart gut gelang, sich von den Ansichten der Iraker abzukapseln, einem äußerst politischen Volk, während es doch in ihrem eigenen Interesse gelegen hätte, einmal zuzuhören. Es hat immer jede Menge Iraker gegeben, die willens waren, den Mächtigen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen; obgleich ihre Zahl aufgewogen wird von ebenso vielen, die es sich zur Regel machten, den Ausländern ganz genau das zu erzählen, was diese hören wollen. In der Besatzungszeit waren die vertrauenswürdigen Informanten nicht die Intellektuellen, die die Ereignisse vage vom Spielfeldrand aus beobachteten, sondern diejenigen aktiven Politiker und Minister, die fast täglich hochrangige Politiker des Westens trafen.
Dasselbe passierte zwischen 2011 und 2013, als einflussreiche Iraker wie der Außenminister Hoschjar Sebari, der Minister a. D. und Historiker Ali Allawi, der Politiker Ahmad al-Dschalabi und der altgediente kurdische Parlamentsabgeordnete Mahmud Otman mir erklärten, dass ein weiter andauernder Krieg in Syrien den Bürgerkrieg im Irak neu entfachen würde. Und 2013 sagten mir einige derselben Leute, dass die 350.000 Mann starke irakische Armee nicht kämpfen, sondern vom Schlachtfeld fliehen würde. Die westlichen Mächte hingegen schienen sich, aufgrund von erdrückenden Beweisen, davon überzeugt zu haben, dass Assad fallen und die Krise in Syrien den Irak nicht destabilisieren würde. Ich fragte mich immer, ob meine irakischen Gesprächspartner mir dasselbe erzählten wie den ausländischen Spitzenpolitikern, die Bagdad seit 2003 immer und immer wieder besuchten, aber ebenso schlecht informiert abzureisen schienen, wie sie gekommen waren. Ich kam schließlich zu der Auffassung, dass viele dieser Besucher insgeheim gesehen haben müssen, wie schlimm die Dinge standen. Warum sonst trugen sie Helm und kugelsichere Weste, warum sonst flogen sie die kurze Strecke zwischen Flughafen und Grüner Zone mit dem Hubschrauber, anstatt ein Auto zu nehmen? In Afghanistan soll es Diplomaten in Kabul gegeben haben, die Stellungen der afghanischen Armee besuchten und sich Berichte über deren jüngste Siege anhörten – und gleichzeitig die Augen abwandten von der schwarzen Taliban-Fahne, die wenige hundert Meter entfernt auf der Erhebung eines Dorfes wehte. Vermutlich waren sie fest entschlossen, nicht zum Boten schlechter Nachrichten für ihre Regierungen in der Hauptstadt zu werden.
*
Kriegsberichterstattung ist einfach, aber wirklich gute Kriegsberichterstattung ist sehr schwierig. Während der Kämpfe ist die Nachfrage nach Reportagen sehr groß, denn Kämpfe sind melodramatisch und fesseln die Leser und Zuschauer. Ich nenne das im Geiste »Gefechtslärm«-Reportagen, und verkehrt sind die nicht. Die ersten Zeitungen erschienen zu Beginn des 17. Jahrhunderts im Niederländischen Krieg gegen Spanien, im Dreißigjährigen Krieg und im Englischen Bürgerkrieg. Die Menschen verlangen berechtigterweise nach den neuesten Nachrichten über augenblickliche und interessante Geschehnisse wie Kriege, Naturkatastrophen und Verbrechen. Aber die ausschließliche Befassung mit dem Kampf kann täuschen, weil solch aufregende Ereignisse nicht notwendigerweise typisch sind und einem auch nicht immer verraten, wer den Krieg gerade gewinnt oder verliert. Auch ich berichtete über den Sturz der Taliban Ende 2001/Anfang 2002, der weitgehend dargestellt wurde als militärischer Sieg der Taliban-feindlichen Nordallianz mit US-Luftunterstützung. Die Fernsehzuschauer bekamen beeindruckende Bilder von explodierenden Bomben und langen Reihen deprimierter Gefangener zu sehen. Ich aber folgte den Taliban von Kabul nach Kandahar und in ihre Dörfer vor der Stadt: Ich sah den Rückzug und das Aufbrechen ihrer Streitkräfte, ohne dass sie wirklich geschlagen worden wären. Es gab wenige ernsthafte Kämpfe, dafür umso mehr Aufgeben und Heimkehren auf Seiten der Taliban-Kämpfer, die von ihren Kommandeuren dazu angewiesen wurden – denn diese wussten, dass sie den Krieg so oder so verlieren würden. Einmal, das war im Süden von Ghazni, fuhr ich aus Versehen durch die aufgelöste Frontlinie der Taliban und musste meinem Fahrer ganz nervös anweisen, zu wenden und so schnell wie möglich zurückzukehren, ohne die Aufmerksamkeit in den Stellungen der Nordallianz zu erregen. Ich glaubte immer noch, ich hätte die echten Kämpfe in unverantwortlicher Weise verpasst, gelangte aber schließlich zu der Ansicht, dass es so viele echte Kämpfe nicht gegeben hatte. Das war wichtig, denn wenn die Taliban nicht wirklich geschlagen waren, hieß das, dass sie in den kommenden Jahren zurückkehren könnten – was sie tatsächlich auch taten, und zwar mit spektakulärem Erfolg.
Es besteht hier natürlich die Gefahr, das »Ich hab’s euch ja gesagt« allzu lautstark vorzutragen – das nützt weder dem Verfasser noch dem Leser. Auch schwingt unausgesprochen eine Kritik an anderen Reportern mit: als oberflächliche Kollegen, die dem Drama des Krieges verhaftet bleiben und keine Langzeitperspektive einnehmen würden. Praktisch aber wird derjenige Journalist seine Stelle nicht lange behalten, der sich zu lange mit der Erklärung des Warum und Wozu eines Konfliktes aufhält und die Berichterstattung über die tatsächlichen Gefechte vernachlässigt. Zudem werden Kriegsberichterstatter bisweilen auf zwei völlig unterschiedliche Weisen diffamiert: entweder als »Lobbyjournalisten«, die sich in ihrem Hotel verstecken und aus zweiter Hand berichten, oder als »Kriegsjunkies«, als tragische Figuren, die süchtig sind nach dem Kick des bewaffneten Konflikts. Die erste Anschuldigung ist leicht entkräftet: Schließlich treffen diejenigen Journalisten, die sich nicht in einem Konflikt wiederfinden wollen, in dem sie möglicherweise getötet werden – eine nicht unvernünftige Einstellung –, schon eine ganz elementare Vorkehrung und halten sich einfach fern von gefährlichen Orten wie Bagdad, Kabul, Beirut, Damaskus, Tripolis und so weiter. Was die Unterstellung angeht, einige Berichterstatter seien »Kriegsjunkies«: Läuft nicht ein intensives Interesse in jedem Fachgebiet Gefahr, den Eindruck zu vermitteln, man nähre damit eine ungesunde Obsession? Tatsächlich aber sind nur wenige Korrespondenten so sehr in den Kampf verliebt, dass sie glaubten, nichts anderes zähle. Ein überraschender Aspekt der Kriege seit 2001 ist der, dass die Journalisten vor Ort oftmals sehr viel mehr Zeit in diesen Ländern verbracht haben als westliche Diplomaten oder Offizielle: Als der IS im Juni 2014 Mossul einnahm, bestand die politische Abteilung der britischen Botschaft in Bagdad nur aus drei Jungdiplomaten im Kurzzeiteinsatz.
Selbstverständlich mag es eine gewisse Berufsblindheit in der Kriegsberichterstattung geben. Berichtet man aus Afghanistan, Syrien, Libyen oder dem Irak, fällt es schwer, sich nicht einzureden, wie hochbedeutend irgendein Gefecht ist, über das man berichtet. Dieser Lapsus lässt sich fast unmöglich vermeiden, denn jeder ist geneigt, die Bedeutung eines Ereignisses zu übertreiben, in dem andere getötet werden. Auch gibt es eine natürliche Identifizierung mit jenen Soldaten und Milizionären – so schroff und dubios sie auch sein mögen –, die neben einem selbst erschossen oder bombardiert werden. Einige, aber nicht alle Korrespondenten romantisieren Aufständische, die letztlich zwar heldenhafte Verteidiger ihrer Gemeinden sein mögen, aber rasch zu Plünderungen und Morden übergehen, sobald sie über ihren Heimatboden hinaus vorrücken. All diese Faktoren kamen in den ersten Tagen der Aufstände in Libyen und Syrien zusammen und ließen die aufständischen Waffenträger weniger religiös und brutal erscheinen, als sie es tatsächlich waren. Erst in der ersten Jahreshälfte 2015 kam es zu dem allgemeinen Eingeständnis, dass – so rücksichtslos die syrische Regierung mit ihrem Einsatz von Fassbomben gegen die Zivilbevölkerung auch sein mochte – die bewaffnete Opposition inzwischen fast vollständig beherrscht wurde vom IS und von der al-Nusra-Front, einem Teil des al-Qaida-Netzwerks. Die wohlwollende Berichterstattung aus Gebieten, die im Irak, in Syrien und Libyen von Aufständischen gehalten werden, ist eben deswegen weitgehend abgestorben, weil diese Gebiete für jeden einheimischen oder ausländischen Journalisten zu gefährlich geworden waren, wollte dieser bei seinem Besuch nicht Entführung oder Enthauptung riskieren. Was die von Regierungstruppen gehaltenen Gebiete im Irak und in Syrien angeht, so haben die baathistischen Regierungen in beiden Ländern immer eine Art Fetisch aus ihrer Brutalität gemacht: als Zeichen der Loyalität und Entschlossenheit ungeachtet der zivilen Opfer. Die syrische Regierung setzte während ihrer langen Besatzung und Herrschaft im Libanon dieselben Verbrechermethoden der Ermordung, Bombardierung und unterschiedslosen Beschießung ein, die sie seit 2011 gegen ihre eigene Zivilbevölkerung anwendet.
Die Kriegsberichterstattung ist heute inzwischen sehr viel gefährlicher geworden, als sie es noch vor einem halben Jahrhundert war. Der erste bewaffnete Konflikt, über den ich schrieb, war Belfast in den frühen 1970ern – damals pflegte ich zu scherzen, die neugegründeten paramilitärischen Gruppen würden einen Pressesprecher ernennen, noch bevor sie auch nur eine Waffe gekauft hatten. In den ersten Jahren des libanesischen Bürgerkriegs seit 1975 händigten die verschiedenen Milizen den Journalisten für gewöhnlich formale Schreiben mit einer Liste ihrer Kontrollpunkte aus und garantierten ihnen so freies Geleit. Es gab damals so viele Milizen, dass ich fürchtete, die Schreiben durcheinander zu bringen, denn sie sahen einander ziemlich ähnlich; ich steckte also die von linken Gruppen in meine linke Socke, und die von rechten Gruppen in die rechte. Dieses Verhältnis zerbrach 1984, als schiitisch-fundamentalistische Gruppen begannen, Journalisten als Ziele für Lösegeld-Entführungen oder als politisches Unterpfand zu betrachten. Auf dem Höhepunkt des Konfessionskrieges um 2006/2007 war der Irak schon gefährlich, aber noch nicht so gefährlich, wie er es inzwischen geworden ist. Für gewöhnlich hatte ich einen Zweitwagen, der meinem Auto in Bagdad folgte, um zu erkennen, wenn man mich verfolgte; und ich stellte immer sicher, dass die Belegschaft in meinem Hotel gut bezahlt wurde, so dass man mir einen Tipp geben würde, falls sich irgendjemand zu sehr für meine Aktivitäten interessierte. Getötete Freunde und Kollegen – wie etwa David Blundy 1989 in El Salvador und Marie Colvin 2012 in Syrien – waren sehr erfahrene Journalisten. Einst hatte ich geglaubt, getötet würden eher junge und übereifrige Freiberufler, die sich einen Namen machen wollten. Letztlich aber stellte sich heraus, dass die Veteranen häufiger ihr Leben verloren; nicht, weil sie irgendwelche großen Fehler begangen hätten, sondern weil es zu oft gutgegangen war und sie so oft damit durchgekommen waren, dass sie schließlich ein Risiko zu viel eingingen.
Die Kriege der Gegenwart haben eine Eigenheit, die die Berichterstattung erschwert: die militärische Aktivität ist kein bewaffneter Flächenkonflikt. Es handelt sich quasi um eine Art Guerillakrieg mit starkem politischen Gehalt, dessen wichtigste Merkmale der religiöse Fanatismus, die Grausamkeit und militärische Expertise des IS und anderer al-Qaida-artiger Gruppen sind, die sich vom IS in Sachen Ideologie und Verhalten nur geringfügig unterscheiden, so etwa Dschabhat al-Nusra und Ahrar al-Scham. Wichtig aber ist, sich nicht nur auf ihre Aufmerksamkeit heischenden Gräueltaten zu konzentrieren, sondern auch auf die verblüffende Schwäche ihrer Feinde, ob nun in Washington oder Bagdad. Das militärische Know-how des IS ist weniger überraschend als die Schnelligkeit, mit der die irakische Armee 2014 in dem Moment zerfiel, als sie von weit unterlegenen Kräften angegriffen wurde. Wahrscheinlich hätte das keine solche Überraschung sein dürfen: 2013 hatte ich zum zehnten Jahrestag des US-Einmarsches einige Monate im Irak verbracht und war zu der Ansicht gelangt, dass die Regierung und die Armee völlig korrupt und vollkommen funktionsunfähig waren. Im darauffolgenden Jahr habe ich viel geschrieben und begann mit einem Buch über die zunehmende Stärke sunnitisch-extremistischer Glaubenskrieger und Dschihadisten. Aber selbst dabei hatte ich nie gedacht, dass der IS Mossul und den Großteil des Nord- und Westirak einnehmen würde. Ich hatte die goldene Regel für die Zukunftsvorhersage im Irak vergessen, die da lautet, vom schlimmstmöglichen Ergebnis auszugehen – dieses lässt vielleicht länger auf sich warten als man glaubt, aber wenn es eintrifft, fällt es weit schlimmer aus als in den schrecklichsten Vorstellungen. Ähnlich pessimistische Einschätzungen aus den vergangenen Jahren zu Syrien, Jemen und Libyen hätten deren gegenwärtig grauenvolle Lage ebenfalls zutreffend prognostiziert.
Man kann leicht professioneller Pessimist sein, in Bezug auf den Irak und einen Gutteil der übrigen Region; ich versuchte das indes zu vermeiden, manchmal entgegen der Tatsachen. Ich mag die Iraker, seit ich 1977 erstmals in ihr Land kam und hatte immer enge irakische Freunde. Bei diesem ersten Besuch sah alles noch ganz anders aus und das Land genoss eine seiner seltenen Friedensphasen: Der kurdische Aufstand war infolge des Abkommens von Algier im Jahre 1975 zeitweilig beendet, bei dem Saddam Hussein eine Abmachung mit dem Schah des Iran getroffen hatte, der – mit Rückendeckung der USA – seine ehemaligen kurdischen Verbündeten verriet. Das Land hatte (die Ölrendite sprudelte) einen Lebensstandard, der ungefähr jenem Griechenlands entsprach, und die Verwaltung, das Bildungs- und das Gesundheitswesen waren gut. Saddam war der stellvertretende Generalsekretär des Revolutionären Kommandorates und hatte noch keine absolute Machtposition erlangt. Noch unbekannt waren seine Fähigkeit zu äußerster Gewalt gegen sein eigenes Volk und seine Neigung zu gigantischen Fehleinschätzungen, die ihn dazu verleiten sollte, Kriege gegen den Iran und die USA zu führen, die der Irak unmöglich gewinnen konnte. Ich war 1980 gerade im Iran gewesen, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass Saddam einmarschieren würde – etwas, das ich damals nicht glauben mochte, weil er so was Idiotisches wohl nicht tun würde. Ich lag falsch; aber zehn Jahre später, als irakische Panzer im Norden der kuwaitischen Grenze zusammengezogen wurden, hatte ich meine Lektion gelernt und war der Überzeugung, dass ihm kein Akt megalomanischen Irrsinns zu weit ginge. Ich kannte einige seiner Hauptberater, die sich der absehbaren Folgen eines Angriffs auf den Iran oder des Einmarschs in Kuwait sicherlich bewusst waren; ich bezweifle aber, dass sie ihre Bedenken jemals äußerten. Ein russischer Diplomat, der die herrschenden Kreise des Irak gut kannte, sagte mir einmal, die einzig sichere Taktik für ein hochrangiges Mitglied des Regimes sei es, »zehn Prozent schärfer zu sein als der Chef«. Anders gesagt, wenn Saddam sagte, er werde in Kuwait einmarschieren, würde selbst der bestinformierteste seiner Militärs ihn drängen, weiter nach Saudi-Arabien zu ziehen. Diese Tradition der irakischen Führungskräfte, die über ihre militärische und politische Stärke grotesk desinformiert sind, nahm mit dem Sturz von Saddam kein Ende. Der Premierminister Nuri al-Maliki, der 2014 für eines der größten Militärdebakel in der Geschichte verantwortlich war, ließ sich weiterhin ablichten, wie er konzentriert auf eine große Karte starrte und sich an seine Generäle wandte – so wie Napoleon vor der Schlacht von Austerlitz. Sein weniger autokratischer Nachfolger, Haider al-Abadi, posierte 2015 in den Straßen des zurückeroberten Tikrit und erklärte der Welt, dass seine Armee bald in die vom IS gehaltene Provinz al-Anbar vorstoßen werde. Wenige Wochen später wurde Ramadi vom IS überrannt.
Manchmal beglückwünscht man Journalisten gönnerhaft dafür, »den ersten Entwurf des Geschichtsbuchs« zu schreiben; wobei der erste Entwurf oftmals besser ist als der letzte. Die Vor-Ort-Berichterstattung hat eine hohe Glaubwürdigkeit, bevor sie den Mahlstrom von banalen Weisheiten und akademischen Analysen durchlaufen hat. Journalisten sind oft übermäßig bescheiden, wenn es um ihre Erkenntnisse geht, und ihre Herausgeber noch viel mehr: Letztere sind äußerst beunruhigt, wenn ihr Mann oder ihre Frau vor Ort andere Sachen sagt als irgendeine Koryphäe, die sie gerade im Fernsehen gesehen oder in einer Zeitungsspalte gefunden haben. In den Vereinigten Staaten treiben solche talking heads – die für die Fernsehsender den Vorteil haben, dass sie ihre Dienste kostenfrei anbieten – die Journalisten an der Front oftmals in die Verzweiflung. Ich erinnere mich noch genau: Eines nachts in Bagdad, 1998, als amerikanische Raketen im Stadtzentrum Bagdads explodierten und die Granatsplitter des Luftabwehrfeuers vom Himmel regneten, sah ich, wie ein Journalistenfreund nach draußen kroch, um sein Satellitentelefon zu benutzen. Als er zurück war, fragte ich ihn, warum er so etwas Gefährliches gemacht habe, und er antwortet mir trocken, sein New Yorker Büro habe ihn angewiesen, irgendeinen Irak-Experten in einer Washingtoner Denkfabrik anzurufen und dessen Einschätzung der US-Luftschläge einzuholen. Niemals hat mich meine Zeitung, The Independent, solchen Bedingungen ausgesetzt oder mein Urteil in einem der Kriege und Konflikte infrage gestellt. Ich habe 2003 und auch wieder 2008 immer Mitleid gehabt mit meinen amerikanischen Kollegen, die sehr wohl wussten, dass der Krieg im Irak nicht gewonnen war – denen ihre Heimatbüros aber selbstbewusst widersprachen. Ich erinnere mich, wie mir 2008 der Korrespondent eines US-Fernsehnetzwerks finster erzählte, dass er – trotz der anhaltenden Gewalt – seit sechzig Tagen nicht auf Sendung gewesen sei, denn »New York ist überzeugt, dass der Krieg hier vorbei ist«.
Selbstverständlich hat der Krieg im Irak nie ein Ende gefunden, ebenso wenig wie in einem der anderen Länder, um die es in diesem Buch geht. Das ist eines der verblüffenden Zeichen der Zeit: Kriege verwandeln sich in blutige Pattsituationen ohne eindeutige Gewinner und Verlierer – abgesehen von den Millionen Zivilisten, die ihnen zum Opfer fallen. Politische Systeme brechen zusammen oder werden gestürzt, aber niemand ist stark genug, sie zu ersetzen. Ein islamischer Kult motiviert die Menschen derart, dass sie bereit sind, für ihn zu sterben – vom Nationalismus oder Sozialismus lässt sich das nicht mehr sagen. Es gibt Wut und Empörung über die Gräueltaten und Zerstörungen seitens des Kalifats, etwa wenn dessen Aktivisten die antiken Bauwerke von Palmyra in die Luft jagen und dem Chefarchäologen den Kopf abschlagen. Bisher aber gibt es keinen ernsthaften Gegenangriff, um den Islamischen Staat von der Landkarte zu tilgen.2 Die syrischen Kurden, die Sieger der viereinhalbmonatigen Belagerung von Kobanê – der ersten großen Schlacht, die der IS verlor –, wurden im Juli 2015 belohnt mit einem Abkommen zwischen den USA und der Türkei, das den syrischen Kurden mehr Schaden zufügt, als es die Dschihadisten vermocht hätten. Es ist schwierig, irgendeine bewaffnete Bedrohung für das Kalifat auszumachen, mit dem die islamistischen Aktivisten nicht klarkommen würden. Als ich in einem afghanischen Dorf im Norden Kabuls lebte, das von Krankheit und Armut heimgesucht war, und über die letzten Stunden der Taliban berichtete, erschienen diese – mit ihrer Behandlung der Frauen als Eigentum und ihrem Hass auf andere islamische Konfessionen – wie ein bizarrer, aber nur zeitweiliger Rückfall. Stattdessen und entgegen aller Erwartungen erwiesen sie sich als die Vorboten einer umkämpften und gewalttätigen Zukunft.
Editorische Notizen zur deutschen Ausgabe:
Die vorliegenden Texte aus den Jahren 1996 bis 2015 stammen aus dem Buch Chaos and Caliphate. Jihadis and the West in the Struggle for the Middle East, das 2016 bei OR Books erschienen ist. Für die deutsche Ausgabe wurde eine Auswahl getroffen und manche der Reportagen gekürzt. Ergänzungen zum Original sind in eckigen Klammern angegeben.
1. William Butler Yeats: »Das Zweite Kommen« (1919), in: ders., Die Gedichte, hg. v. Norbert Hummelt, Luchterhand: München 2005, übers. v. Mirko Bonné, S. 212.
2. Im Oktober 2016 begann eine irakisch-amerikanische Bodenoffensive gegen das bis dahin vom IS gehaltene Mossul. (Anm. d. Ü.)
II. Die Besatzung des Irak
Als die USA, Großbritannien und ihre Verbündeten 2003 in den Irak einmarschierten, traten sie eine Revolution los. Das war nicht ihre Absicht, denn ihr Ziel war es gewesen, Saddam Hussein und dessen Regime loszuwerden – sie waren sich über die Radikalität ihres Tuns nicht im Klaren. Die Invasion und Besetzung waren eine revolutionäre Veränderung, weil sie die sunnitisch-arabische Herrschaft beendeten, die über Jahrhunderte hinweg eine Konstante gewesen war: unter den Osmanen, unter den Briten und nach der Unabhängigkeit. Die Amerikaner lösten die Armee und Geheimdienste auf, die die Hauptinstrumente der sunnitischen Kontrolle über diejenigen achtzig Prozent der Bevölkerung waren, die Schiiten oder Kurden sind.
Die amerikanischen Repräsentanten sahen sich damals und in den kommenden Jahren als Kraft der Vermittlung zwischen konkurrierenden irakischen Bevölkerungsgruppen. Aber ihre militärische Präsenz destabilisierte auch das Gleichgewicht zwischen den Bevölkerungsgruppen, die sehr wohl wussten, dass sie keine Kompromisse mit den anderen Irakern eingehen müssten, wenn sie die Amerikaner (oder in späteren Jahren die Türken, Saudis, Iraner oder Katarer) auf ihre Seite ziehen könnten. Nie machten sich die Besatzungsmächte die Tatsache bewusst, dass die Identifizierung der neuen, auf Saddam folgenden Regierung mit den Amerikanern und mit einer ehemaligen Kolonialmacht wie Großbritannien sie in den Augen der Iraker von Anbeginn an diskreditierte.
Dumm waren natürlich nicht alle Amerikaner und ihre Verbündeten, die den Irak okkupierten – warum also begingen sie in den ersten beiden Jahren so viele Fehler? Die offenkundigste Ursache war schlicht Arroganz, und die zweite, dass die Besatzer glaubten, es sei recht egal, was die Iraker aus irgendeiner Bevölkerungsgruppe dachten oder taten. Von vielen selbsterklärten Irakkennern wurde dem Weißen Haus gesagt, die US-Armee stürze sich in einen Sumpf, aber der Einmarsch war erstaunlich gut vonstattengegangen: mit einem raschen Sieg und geringen amerikanischen Verlusten. Die irakische Armee, einschließlich der hochgelobten Republikanischen Garde von Saddam Hussein, hatte kaum gekämpft. Die Straßen waren mit verlassenen Panzern übersät. Alle Iraker wussten, dass Saddam den Krieg verlieren würde, und sahen keinen Grund, für eine verlorene Sache zu sterben. Mehr noch, die Mehrheit der Iraker – einschließlich der Sunniten – begrüßten den Sturz des Regimes, auch wenn sie die Besatzung nicht guthießen. Die Baathisten hatten nichts als Elend und Niederlagen gebracht, einschließlich dreizehn Jahren verheerender wirtschaftlicher Sanktionen, die Millionen Iraker zu Armut und Unterernährung verdammten. Ohne viel darüber nachzudenken, glaubten die Amerikaner, dass die Iraker – weil sie 2003 nicht gekämpft hatten – nicht kämpfen könnten. Als ihre Verluste in der zweiten Jahreshälfte 2003 anstiegen, erklärten amerikanische Sprecher beständig, das seien nur winzige »Überbleibsel« des alten Regimes, die gegen die Entstehung eines neuen Irak ankämpfen würden.
Aus einem weiteren Grund war die US-Besatzung schwächer als es den Anschein hatte, denn sie hatte alle Nachbarstaaten des Irak gegen sich: Saudi-Arabien, die sunnitischen Monarchien am Golf, Jordanien und die Türkei sahen ungern einen sunnitischen Staat durch einen schiitischen ersetzt, der wahrscheinlich enge Verbindungen mit dem Iran haben würde. Der Iran und Syrien ihrerseits waren froh über das Ende von Saddam Hussein, aber beunruhigt über die Ankunft einer großen amerikanischen Armee an ihren Grenzen. Sie lasen überhebliche Prahlereien von Politikern und Offiziellen in Washington, der Regimewechsel in Bagdad von heute könne morgen in Teheran und Damaskus wiederholt werden. Dieser Chauvinismus mag bloß Rhetorik gewesen sein, aber die syrischen und iranischen Spitzen zogen es verständlicherweise vor, die USA im Irak zu bekämpfen, bevor diese dort ihre Herrschaft stabilisierten. Syrien gewährte sunnitischen Dschihadisten freies Geleit und der Iran unterstützte die US-feindlichen schiitischen Milizen.
Vor dem Einmarsch war ich für einige Monate in Washington und arbeitete kurze Zeit für das Center for Security and International Studies. Entgegen der allgemein optimistischen Stimmung sagte ein amerikanischer Kollege eines Tages zu mir, er denke, der Einmarsch in den Irak würde für die Amerikaner 2003 ebenso katastrophal enden wie die Suezkrise für die Briten, als diese 1956 in Ägypten einmarschierten. Man gehe einen Schritt zu weit, führte mein Kollege aus: was als Demonstration politischer und militärischer Stärke gedacht sei, würde das genaue Gegenteil bewirken. Ich glaubte, diese Einschätzung ginge zu weit, erinnerte mich ihrer aber, als ich in den Irak reiste und über den Krieg zu berichten hatte. Die Bagdader Regierung betrachtete mich als eingefleischten Feind und verweigerte mir das Visum, also musste ich durch Syrien und überquerte dann den Tigris in das von Kurden gehaltene Gebiet. Dort verbrachte ich den Krieg und bewegte mich in Richtung Süden, in Richtung Hauptstadt, als die irakische Armee in sich zusammenbrach.
Für die Amerikaner war der Irakkrieg ein Desaster, wenn auch nicht ganz von dem Ausmaß, wie es Suez für die Briten gewesen war. Die USA waren 2003 im Nahen und Mittleren Osten eine Großmacht – und sie waren es noch 2015, obwohl sich ihr Gewicht verringerte. Sie hatten im Irak keine Niederlage erlitten, waren aber vor aller Augen damit gescheitert, einen gefügigen pro-amerikanischen Staat zu etablieren. Es lag auf der Hand, dass es in der amerikanischen öffentlichen Meinung keine Unterstützung dafür geben würde, eine weitere amerikanische Armee in den Nahen Osten zu schicken – solange es nicht zu einer weiteren Gräueltat wie Nine-Eleven kommt. Gleichzeitig war Präsident Obama in der Lage, ab 2014 die US-Luftwaffe gegen den IS im Irak und in Syrien einzusetzen, ohne daheim einen politischen Preis dafür zu bezahlen. Vielleicht wäre es eine bessere Analogie, den US-Krieg im Irak mit dem Burenkrieg zu vergleichen, den die britische Armee nach großen Anstrengungen tatsächlich gewann – damit legte sie aber auch die Grenzen der militärischen Stärke Großbritanniens offen.
Viel hat sich im Irak in den letzten dreizehn Jahren verändert, vieles ist aber auch gleich geblieben. Ich sah Mossul und Kirkuk 2003 an die Kurden fallen, umkämpft sind diese Städte auch heute noch. Falludscha wurde 2004 von sunnitischen Dschihadisten gehalten und von 2014 bis 2016 vom IS kontrolliert. Bagdad war vor zehn Jahren ein gefährlicher und dysfunktionaler Ort mit Wasser- und Stromknappheit – und das trifft auch heute noch zu. Es hat sich herausgestellt, dass die Schiiten ebenso wenig in der Lage sind, die Sunniten dauerhaft niederzuhalten, wie Saddam fähig war, die Schiiten und die Kurden zu unterwerfen. Ab 2005 begriffen die Amerikaner, dass sie in ein neues Vietnam marschiert waren, und leugneten zugleich ständig, dass so etwas passiert sei. Ich erinnere mich an das Mitglied einer US-Bombenräumeinheit, das mir erzählte, wie er vergebens ein Pentagon-Handbuch über vietnamesische USBVs (unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtungen) bestellt hatte, um daraufhin eine Verwarnung zu erhalten und erklärt zu bekommen, dass es keine Ähnlichkeiten gebe zwischen Vietnam und dem Irak – das Buch wurde einbehalten.
Wie im Falle Vietnams wollten die USA auch aus dem Irak aussteigen, ohne eine Niederlage einzuräumen. Das ist ihnen weitgehend gelungen. Siegesbehauptungen gründeten in »der Woge« – the surge: dem zahlenmäßigen Anstieg der US-Truppen – im Zusammenspiel mit einer Spaltung im bewaffneten sunnitischen Widerstand, die hervorgerufen wurde durch zweierlei: den verfrühten Versuch der Machtmonopolisierung durch al-Qaida im Irak und den mörderischen Druck auf die Sunniten seitens schiitischer Milizen. Aber die Verfechter der Woge waren zu optimistisch in Bezug auf ihre Errungenschaften. Al-Qaida war geschwächt, aber nicht zerstört – was nach dem endgültigen US-Rückzug im Jahr 2011 überaus offenkundig werden sollte, als der sunnitische Aufstand in Syrien den sunnitischen Extremisten im Irak neue Chancen bot. Viele schlaue Iraker erkannten, was passieren würde – ein Minister sagte mir: »Wenn der Krieg in Syrien weitergeht, wird er den Irak wieder destabilisieren.« Die Blindheit und übermäßige Selbstsicherheit der USA und ihrer Verbündeten war damals genauso groß und folgenschwer wie im Jahr 2003.
Die Sanktionen gegen den Irak
Irak, 1990–2003
In den dreizehn Jahren zwischen 1990 und 2003 verwüsteten UN-Sanktionen den Irak. Die Iraker erlebten, wie ihr Lebensstandard von dem Griechenlands auf den von Mali sank. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte 1996, »die große Mehrheit der Bevölkerung des Landes leidet seit Jahren unter extremer Mangelernährung«. Die Vereinten Nationen schätzten, dass infolge der Sanktionen monatlich zwischen sechs- und siebentausend irakische Kinder starben. Millionen von Irakern, die gute Arbeitsplätze gehabt und komfortabel gelebt hatten, waren in die Armut und oftmals zur Kriminalität gezwungen. Die einstmals erstklassigen Bildungs- und Gesundheitssysteme brachen zusammen, als ausgezeichnete Professoren und Doktoren damit konfrontiert waren, monatlich rund fünf US-Dollar zu verdienen. Ein ausländisches Ärzteteam auf Besuch »beobachtete einen Chirurgen, der mit Scheren zu operieren versuchte, die zu stumpf waren, um die Haut des Patienten zu durchschneiden«. Es gab Elektrizitäts- und Trinkwasserknappheit, weil Strom- und Wasseraufbereitungsanlagen während der Bombenangriffe 1991 ins Visier genommen worden waren und nur teilweise wiederaufgebaut wurden. Ohne die Mittel zur Bezahlung der Beamten wurde die Verwaltung hoffnungslos korrupt und hat sich bis heute nicht davon erholt. Die US-geführte Invasion von 2003 vernichtete den irakischen Staat und dessen Armee, aber die Sanktionen hatten bereits die Gesellschaft und Wirtschaft des Landes zerstört.
In diesem Buch geht es vor allem um die bewaffneten Konflikte infolge von Nine-Eleven, aber die UN