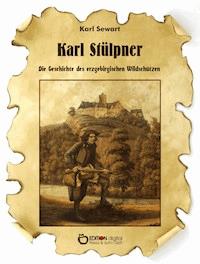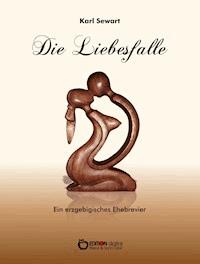6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nirgendwo sonst in deutschen Landen wird das Weihnachtsfest mit so vielen historisch gewachsenen Bräuchen und volkskünstlerischen Zeugnissen begangen wie im Erzgebirge. Schwibbogen und Pyramide, Nussknacker und Räuchermann, Bergmann und Lichterengel - erzgebirgische Weihnachtsfiguren - sie sind heute weltweit bekannt und beliebt. Karl Sewart erzählt in seinem Weihnachtsbuch aus ganz persönlichem Erleben, wie er erzgebirgische Weihnacht und ihr Brauchtum erfahren hat. In aufschlussreichen volkskundlichen Erörterungen geht er den Spuren dieser Bräuche nach. Ein Buch für alle, die sich für das »deutsche Weihnachtsland« interessieren. INHALT: Christbaum und Pyramide - ein Vorwort Wie ich das Schnitzen gelernt habe Vom erzgebirgischen Räuchermann Unser Weihnachtsberg Erzgebirgische Lichterweihnacht Der Heilige Abend Weihnachtlicher Glaube und Aberglaube Vom Neunerlei Schenken und Geschenke Die Innernächte und ihr Brauchtum Der erzgebirgische Weihnachtskalender Vorbemerkung 16. Oktober - St. Gallus 11. November - St. Martin 30. November - St. Andreas Advent - Vorweihnachtszeit 6. Dezember - St. Nikolaus 24. Dezember - Adam und Eva 25. Dezember - Weihnachten 26. Dezember - St. Stephan 27. Dezember - Johannes 28. Dezember - Unschuldige Kinder 31. Dezember - Silvester 1. Januar - Jesus - Namengebung des Herrn - Neujahr 5. Januar - Hohneujahrs-Heiligabend 6. Januar - Erscheinung des Herrn - Heilige Drei Könige 2. Februar - Mariä Lichtmess - Darstellung des Herrn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Karl Sewart
Christbaum und Pyramide
Ein erzgebirgisches Weihnachtsbuch
ISBN 978-3-86394-439-1 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1992 im Chemnitzer Verlag
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Christbaum und Pyramide - ein Vorwort
Christbaum und Pyramide - in besonders sinnfälliger Weise drücken sie erzgebirgisches Weihnachtsleben und Weihnachtserleben aus ... Erinnert das immergrüne Kleid des Christbaums in der Zeit der Winterstarre an neues Grünen und Blühen in der Natur, so weisen seine brennenden Kerzen auf die Wiederkehr der Sonne wie des neuen Lichtes, das mit Christus in die Welt kam, hin. In der Pyramide bewegen sich im Schein und durch die Wärme desselben Lichts die heiligen Gestalten der Christgeburtsgeschichte und die Vertreter irdisch-heimatlicher Berufe und Stände um die gleiche Achse. Der Christbaum zeugt von der Naturverbundenheit, die Pyramide von der Arbeitsamkeit, dem Erfindergeist, der tätigen Fantasie, beide miteinander zeugen sie von der Lichtfreude und Schönheitssehnsucht und von der tiefen Gläubigkeit des erzgebirgischen Menschen. Im Christbaum verbinden uralte Fruchtbarkeitssymbolik, in der Pyramide menschliche Alltagswirklichkeit sich eng und innig mit christlichem Gefühls- und Gedankengut. Zeigt der Christbaum die Weltoffenheit des Erzgebirglers - sein Gebrauch als Lichtträger gelangte von weither in seine Heimat, so spricht die Pyramide von seiner Bodenständigkeit - immer wieder aufs Neue wird sie von ihm erfunden und erschaffen, um die Reise in die Welt anzutreten und überall von der erzgebirgischen Weihnacht zu künden.
Christbaum und Pyramide - wie selbstverständlich ordnen diesen erzgebirgischen Weihnachtssinnbildern sich all die anderen erzgebirgischen Weihnachtsschöpfungen zu und unter: Lichterbergmann und Lichterengel, Nussknacker und Räuchermännchen, Schwibbogen und Leuchterspinne, Weihnachtsberg und Paradiesgarten. Und tief in der europäischen Kulturgeschichte wurzelnde Überlieferung wie neueres eigenständiges bergmännisches und christliches Kulturgut sind auch in den zahlreichen Sitten und Gebräuchen, die im Erzgebirge geübt wurden und teilweise noch heute gepflegt werden, miteinander verwoben und wie in einem lebendigen Weihnachts- und Brauchtumsmuseum bewahrt geblieben.
Und der Erzgebirger selbst sollte sich, gerade in den gegenwärtigen Nöten und Schwierigkeiten, auf seine Herkunft, auf die hervorragenden kulturellen Leistungen seiner Vorfahren besinnen und daraus Mut und innere Kraft gewinnen. Seine Heimat liegt nicht nur im geografischen Sinne im Herzen Europas.
So richtet dieses Weihnachtsbüchlein, das aus jahrzehntelanger praktischer und theoretischer Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem erzgebirgischen Weihnachtsbrauchtum hervorging, sich sowohl an den erzgebirgischen als auch an den nichterzgebirgischen Leser.
Und es will, in einer Zeit verbreiteten flachen und überhasteten Konsumdenkens, diesen wie jenen aufmerksam machen auf Werte, ohne die aller äußere Wohlstand letztlich ein Armutszeugnis ist, ja zur Gefahr für den Bestand der Menschheit wird.
Drebach, im Sommer 1992
Karl Sewart
Wie ich das Schnitzen gelernt habe
»Gahr fer Gahr gieht’s zen Advent of’n Buden nauf, werd ä Mannel aufgeweckt: >Komm, nu stiehst de auf!< ...«
Jahr für Jahr ging es auch bei uns daheim am Vorabend des ersten Adventsonntags auf den Oberboden hinauf, so wie es in dem viel gesungenen Lied vom »Raachermannel« des Olbernhauer Kantors Erich Lang heißt.
Doch wir holten nicht nur ein »Mannel« herunter. Eine ganze Schar weckten wir aus dem Sommerschlaf auf.
Es war eine feierliche Handlung, wenn der Vater die Weihnachtskiste in unserer Bodenkammer öffnete.
Ja, und da standen sie also - noch oder wieder -, unsere Advents- und Weihnachtsgäste, ein jeder auf seinem angestammten »Fleckel« auf Schrank, Kommode oder Fensterbrettel: der Waldarbeiter mit geschulterter Axt und Säge, der Schwammegeher mit angehängtem Beerkännel und Schwammekorb, der Vogelhändler mit seinen aufgehuckelten Käfigen und Bauern, Briefträger, Feuerwehrmann und Eisenbahner in ihren Uniformen, der Nachtwächter mit Laterne und Hellebarde, der Bäcker mit weißer Jacke und Mütze und der Fleischer im zünftigen weiß gestreiften Hemd, der Schäfer mit seinem breitkrempigen Wetterhut und seinem Hirtenstab, der »Feuerrüpel« mit Kehrbesen und Kehrzeug, der Seiffener Spielzeughausierer mit seiner Kiepe voller Reifentiere, der Stülpner-Karl mit Flinte und Hund, der Kurrendesänger im Umhang, mit Käppi und Notenblatt, der Rastelbinder, um und um behängt mit »Rattifalli, Mausifalli«, der vornehme Türke mit Turban und Halbmondschuhen ... Ein jeder bekam nun vom Vater sein »Pfeifel« angezündet, und die Mutter sang dazu:
»Wenn es Raachermannel nabelt, un es sogt kaa Wort drzu un dr Raach steigt an dr Deck nauf, sei mr allzamm su fruh.
UN schie ruhig is in Stübel, steigt dr Himmelsfrieden ro, doch in Herzen lacht’s un jubelt’s: Ja, de Weihnachtszeit is do!«
Konnte unsere Weihnachtsvorfreude treffender ausgedrückt werden als durch diese Liedverse? Ja, was wären Advent und Weihnachten ohne das stille Rauchen und Schmauchen der Räuchermänneln für uns gewesen, ohne den zugleich vertraut-anheimelnden und feierlichen Duft der Räucherkerzchen, der zur Decke aufstieg und sich in der ganzen Stube verteilte, ohne das traute und gemütliche Beieinandersitzen am Adventsabend? Und erinnerte der Weihrauchduft nicht schon an das Weihnachtsfest selbst, an den Heiligen Abend und an die Christgeburt? Hatten die drei Weisen aus dem Morgenlande dem neugeborenen Jesuskind nicht den Weihrauch als kostbares Geschenk mitgebracht?
Es war wirklich ganz feierlich in unserem Stübel, und der Himmelsfrieden stieg zu uns herab. Selbst zwischen uns Jungen ruhte jeder Zank und Streit, wir saßen still und schauten zu, wie die »Männeln« »nebelten«. Und im Schein der Kerzen schien es, als ob sie die Rauchschwaden von selber zur Decke hinauf bliesen und zu eigenem Leben erwachten. Jedes hatte seine besondere Gestalt, sein eigenes Gesicht, und jedes hatte seine eigene Geschichte für uns ...
Die Räuchermännchen waren nicht auf einmal in unsere Lehrerwohnung in der Großolbersdorfer Schule gekommen .Unser Vater hatte sie nach und nach angeschafft, als er, als junger Lehrer vom Annaberger Lehrerseminar ins Dorf gekommen, an schulfreien Tagen und in den Ferien noch seine ausgiebigen Wanderungen in die Umgegend gemacht hatte. Von jedem einzelnen Exemplar wusste er eine Geschichte zu erzählen, wie er es, in Annaberg oder Marienberg »oben« oder in Wolkenstein »drüben« oder in Lengefeld »hinten«, im Schaufenster eines Spielwaren- oder Kunstgewerbeladens hatte stehen sehen, wie er gar nicht anders gekonnt habe, als einzutreten und das Männel zu kaufen. Auf dem Heimweg hatte er es dann immer gar nicht erwarten können, das Männel aus der Schachtel herauszunehmen, und er ist öfters einmal stehengeblieben und hat sich an dem noch nach frischer Lackfarbe riechendem Männel gefreut, und er hat ihm die Gegend gezeigt und erklärt, und das Männel hat ihm erzählt, wo es herkam, wie es oben im Kammwald in einem Baumstamm versteckt gewesen sei, wie Waldarbeiter den Baum umgemacht hätten, wie der Stamm in die Sägemühle transportiert und dort zerschnitten worden sei und wie die Stücke zu einem Holzdreher nach Seiffen gekommen seien, der es, ohne ihm im geringsten dabei wehzutun, auf seiner Drehbank aus einem der rohen Klötze herausgedrechselt habe ... Daheim angelangt, wies der Vater dem neuen Männel seinen Platz auf Fensterbrett oder Schrank an und machte es auf dem Oberboden mit seinen schon anwesenden Brüdern bekannt, um es zum Advent herunterholen und ihm sein erstes Pfeifel anzünden zu können.
Und noch andere Geschichten wusste der Vater über die Räuchermännchen zu erzählen, Geschichten, die ihren Beruf oder ihr Herkommen anbetrafen. So erfuhren wir Jungen, wie die Menschen in unserer Heimat früher gearbeitet und gelebt hatten und wie auch Leute von weither in unser abgelegenes Gebirge gekommen waren, wie z. B. die Rastelbinder, die aus Draht Küchen- und Hausgeräte herstellten und aus der Slowakei hergewandert kamen, um ihre Waren von Haus zu Haus anzubieten und auch Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen.
An den folgenden Adventswochenenden gesellten sich unseren Räuchermännchen weitere Weihnachtsgäste bei. Der Reihe nach holten wir Nussknacker, Lichterbergmänner und Lichterengel, die Leuchterspinne mit den aufgesetzten Erzgebirgsfiguren, Grünhainichener Engelchor und Engelmusikanten und die Seiffener Kurrendesänger vom Oberboden herunter und stellten sie in der Wohnung auf.
Den Brauch, Engel und Bergmann ins Fenster zu stellen, hatte der Vater aus seiner Geburtsstadt Geyer mit ins Dorf gebracht. In dem Bergstädtchen war es üblich, dass jeder junge Mann einen Bergmann und jedes junge Mädchen einen Engel besaß und bei der Heirat mit in die Ehe einbrachte. In der Weihnachtszeit wurde das Figurenpaar mit angezündeten Kerzen ins Fenster gestellt, um die Stube drinnen und die Winternacht draußen gleichermaßen zu erhellen. Jeder Vorübergehende konnte sehen, dass hier ein Ehepaar wohnte. Kamen Kinder hinzu, so wurde für jedes, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, eine Bergmanns- oder eine Engelsfigur aufs Fensterbrett zu den übrigen Figuren gestellt. So hielten es auch unsere Eltern. Zuerst stand nur einsam und allein ein Bergmann im Fenster der Junggesellenwohnung unseres Vaters. Nach seiner Heirat trat Mutters Engel an dessen Seite, und dann kamen die Bergmänner von uns beiden Jungen hinzu. Unsere Lichter strahlten aus unserer hoch gelegenen Mansardenwohnung in der Großolbersdorfer Schule weithin übers Dorf und bis zum Heinzewald hinaus. Wir Jungen besaßen besonders feine Lichterbergmänner. Sie trugen »Bimmelperemetteln«, wie wir die kleinen Flügelpyramiden nannten, die sich auf ihnen durch die von den ihnen zu Füßen stehenden Kerzen aufsteigende Wärme drehten und mechanisch das Läuten eines Blechglöckchens auslösten. Dieses helle Glöckchenbimmeln gehört wie der Weihrauchkerzenduft und der Lichterglanz in unserer Stube zu meinen frühesten und nachhaltigsten Kindheitseindrücken.
Wenn die Lichter auf unseren Bergmannsfiguren brannten und in die Winternacht hinausleuchteten, sang unsere Mutter oft das schöne Lied vom »Bergmaa«, das, wie das vom »Raachermannel«, von Erich Lang stammt. Die erste Strophe lautet:
»Durch de Gassen weiß beschneit laaf ich garn zer Weihnachtszeit, bleib an manning Fanster stieh, ach, wie sieht dos schie! Uberol, aus jeden Haus guckt be Tog der Bergmaa raus, un dar denkt an Lichterpracht wuhl in der Heilign Nacht.«
Wie gern gingen wir Kinder mit unseren Eltern am Adventsabend durchs Dorf! Die Fenster waren erleuchtet, vor dem Rathaus stand der große Christbaum, vor der Krankenkasse ein lebensgroßer geschnitzter Bergmann, dessen Tscherper-(Werkzeug-)tasche eine Sparbüchse war, deren Geld Notleidenden zugutekam. Die Schaufenster der Geschäfte waren festlich geschmückt, in der Mitte des Ortes standen die Straße entlang Marktbuden, in denen Spielsachen und Weihnachtsfiguren, Kerzen, Nürnberger und Pulsnitzer Pfefferkuchen, Lübecker Marzipan, Bratwürste und Glühwein und vielerlei Naschereien angeboten wurden. Und manchmal kam, durch lautes Glockenbimmeln angekündigt, auf dem Pferdeschlitten schon der Knecht Rupprecht vorbeigefahren und warf eine Kostprobe an Süßigkeiten, Äpfeln und Nüssen für die Kinder herunter in den Schnee. Wenn man aber ein Stück die Straße aus dem Ort hinausging und von oben herunter zurückschaute, sah es wie ein lebendiger Weihnachtsberg aus.
Mit all dieser Lichter- und Weihnachtspracht war es mit einem Mal vorbei. Es war Krieg. Wegen der Fliegergefahr herrschte absolutes Verdunklungsgebot. Es war bei Strafe verboten, auch nur einen Lichtstrahl aus der Stube nach draußen dringen zu lassen.
Freilich zündeten wir in der Wohnung die Lichter an. Doch es war nicht die ganze und die reine Weihnachtsfreude, wenn sie nicht hinaus in die Welt leuchten durften. Wir Kinder sorgten uns, ob denn der Knecht Rupprecht in dieser unheimlichen Finsternis auch den Weg von draußen vom Heinzewald, wo er in seiner Hütte lebte, herein in unser Dorf finden werde, um uns am Heiligen Abend bescheren zu können ...
Der Rupprecht fand den Weg zu uns. Es fanden ihn, trotz des Verdunklungsbefehls, auch die feindlichen Bomber. Da war es auf eine andere Art mitten in der Nacht hell in unserem Dorf, als es das sonst immer zu Weihnachten gewesen war. Auch unser Hab und Gut ging mit in den Flammen auf.
Das war im Februar des Jahres 1945. Anfang Mai brach das Hitlerreich vollends zusammen. Dem Krieg folgten Hunger und Not auf dem Fuß. Wir Jungen aber »räuberten« draußen herum. Den ganzen Sommer und Herbst verbrachten wir im Freien. Wir bauten Reisighöhlen, sammelten Beeren und Pilze, gingen Ähren- und Kartoffellesen, trieben dem Bauern die Kühe aus. Erst als buchstäblich die ersten Schneeflocken des ersten Nachkriegswinters fielen, als die Felder und Büsche wie leer gefegt waren und sogar die wilden Tiere in ihre Winterschlupfwinkel zurückgewichen waren, zogen auch wir Nachkriegskinder uns in die elterlichen Behausungen zurück. Wir waren notdürftig bei der im selben Ort wohnenden Großmutter untergekommen. Nun hockten wir in der engen Stube, und Weihnachten rückte heran. Und die Großmutter, die eine einfache und arme Frau war, besaß an Weihnachtssachen nichts als eine primitive alte Engeldocke und ein halb verkohltes Räuchermännchen. Da begriff ich erst, was wir bei dem Bombenangriff verloren hatten. Ich konnte nicht mehr einschlafen, wenn ich an unsere verbrannten Weihnachtsfiguren dachte und an all die Lichterpracht und Weihnachtsfreude, die noch im vergangenen Jahr in unserer Wohnung geherrscht hatte. Neue Figuren gab es nicht zu kaufen. Die Eltern waren abgehärmt und niedergedrückt, und der Vater schlief, erschöpft von der schweren Waldarbeit, die er jetzt verrichten musste, schon am Abendbrottisch ein. Sie hatten ganz andere Sorgen, als an Weihnachten zu denken. Und auch ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben und glaubte, es werde dieses Jahr und vielleicht niemals mehr ein Weihnachten für uns geben ...
Da kam mir ein Gedanke. Ich sagte mir, wenn wir keine Weihnachtsfiguren besaßen, mit denen wir die Stube festlich schmücken konnten, dann musste ich sie eben selbst hersteilen. Da habe ich in meiner Angst um Weihnachten zu schnitzen angefangen.
Alles, was ich vom Schnitzen wusste, war, dass es etwas mit einem Messer und mit einem Stück Holz zu tun haben musste. Mit einem alten Wetzstein, den ich auf einem Feldweg gefunden hatte, machte ich das alte Küchenmesser Großmutters scharf. Das Holz fand ich im Schuppen auf dem Hof. In der hintersten Ecke des Schuppens richtete ich meine kleine Werkstatt ein. Aus einem Brennholzscheit habe ich mein erstes Bergmännel gemacht. Von zehn Schnitten gingen zuerst gewiss fünf daneben und drei in den eigenen Finger. Die Narben an meiner linken Hand zeugen noch heute von dem mühseligen und blutrünstigen Weg, auf dem ich das Schnitzen gelernt habe.
Immerhin brachte ich zuwege, dass am Heiligen Abend ein Dutzend Figuren in der Stube stand. An jedem Männel war alles dran, was hinangehörte, Kopf, Füße, Arme, Hände. Was nicht hinangeschnitzt war, war angeleimt. Und was nicht angeleimt war, war angemalt. Der Räucher-Türke hatte zwar keinen hohlen Leib. Beim Aushöhlen war mir die Spitze des Küchenmessers abgebrochen. Da stellte ich das Räucherkerzel eben auf eine dahintergesetzte umgestülpte Kaffeetasse.
Bei dem großen Bergmann, den ich aus einem armdicken Fichtenast erschaffen hatte, war mir der Kopf zu groß geraten. Ich hatte das durch einen besonders hohen Sockel ausgeglichen. Außerdem trug er in seiner Erzmulde echtes taubes Gestein auf der Schulter. Ich hatte mit dem Hammer Glimmerschiefer zerkleinert und in die Mulde gelegt. Und er hatte ein echtes Arschleder um! Ich hatte es vom Walther-Schuster-Heinz gegen einen Satz verfallener und verbotener Hitlerbriefmarken bekommen. Der Engel hatte zwar die Taille ziemlich weit oben. Auch sah er im Gesicht dem Merschner Otto ähnlich, obwohl ich beim Schnitzen gar nicht an ihn gedacht hatte. Aber der Otto hatte eben ein Gesicht, das wie aus Holz geschnitzt war. Dafür waren die Flügel ein Meisterstück erzgebirgischer Erfindungs- und Bastelkunst. Sie bestanden aus echten Hühnerfedern, die ich in die angeklebte Wellpappe gesteckt hatte. So waren die Flügelfedern sogar auswechselbar. Die Federn hatte ich mit Leim bestrichen und mit Glasflimmer bestreut. Mit diesen Prachtflügeln sah der Engel aus, als ob er sich jeden Augenblick in die himmlischen Lüfte erheben wolle.
Mein absolutes Meisterstück aber war der Nussknacker. Seine riesigen Zähne waren zwar bloß auf den Holzklotz aufgemalt. Aber wir hatten ja sowieso keine Nüsse zu knacken - jedenfalls keine, die uns ein Nussknacker hätte aufbeißen können. Dafür waren seine Augen echte, kunstvolle Intarsienarbeit. Sie bestanden aus zwei Kieselsteinen, auf die ich blau die Iris und schwarz die Pupillen aufgemalt und die ich in die mit Großmutters Handbohrer vorgebohrten Augenhöhlen eingesetzt hatte. Die wilden, buschigen Augenbrauen, Schnauz- und Kinnbart und Kopfhaar stammten von dem Fell des »Kuhhasen«, des Karnickels, das zu Weihnachten geschlachtet wurde. Auch die überdimensionale Hakennase hatte ich extra eingesetzt. Eigentlich sah er einem furchterregenden Götzenbild von den Osterinseln ähnlicher als einem weihnachtlichen erzgebirgischen Nussknacker. Mir fuhr selber der Schreck durch alle Glieder, als mein Blick in der Abenddämmerung unversehens auf ihn fiel.
Als mein kleiner Bruder ihn am Heiligen Abend plötzlich auf dem Schrank oben entdeckte, schrie er auf und verkroch sich unter dem Tisch. Viel gutes Zureden war nötig, damit er wieder heraufkam. Er hatte den Nussknacker für den »Plooggeist«, den Plagegeist, den Popanz oder Schwarzen Mann gehalten, mit dem man den Kindern drohte, wenn man ihrer nicht Herr wurde.
Niemals im Leben werde ich auch vergessen, was darauf beim Heiligabend-Essen passiert ist. Andächtig saßen wir bei Tisch und ließen uns das »Neunerlei« schmecken, das die Mutter trotz aller Alltagssorgen und -nöte mit mehr Liebe und Fantasie als mit den nötigen Zutaten gekocht und serviert hatte. Kein Wort wurde geredet. Das Heiligabendessen war eine heilige Handlung, jeden Bissen ließen wir auf der Zunge zergehen, gab es doch Speisen, die wir uns in der Vorweihnachtszeit vom Mund abgedarbt hatten. Das Heiligabendlicht brannte auf der Mitte des Tisches, und auch ringsum waren Kerzen angezündet, wenn auch bei Weitem nicht so viele, wie wir es von den bisherigen Festen gewohnt waren. Meine selbergeschnitzten Figuren standen auf Schrank und Fensterbrett und sahen uns freundlich zu. Selbst der Nussknacker sah nicht ganz so furchterregend mehr aus.