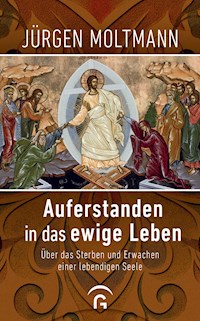Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jürgen Moltmann hat die Aufbruchsstimmung der 1960er-Jahre maßgeblich mitgeprägt. Jetzt ergreift er das Wort in einer Zeit, in der jeder Reformwille dem Verlangen nach Sicherheit gewichen ist. Dennoch: Eine andere Welt ist möglich. Wo Hoffnung das Denken beherrscht, wird das Denken zum Transzendieren. Das feste Land der Wirklichkeit ist immer umgeben von einem Meer der Möglichkeiten. Das sehr persönliche Fazit eines großen theologischen Denkers: Wer auf Gott hofft, rechnet auch mit den Möglichkeiten Gottes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Bedford-Strohm
in Freundschaft
Inhalt
Cover
Titel
Vorwort
Die unvollendete Reformation
Ungelöste Probleme – ökumenische Antworten
„Lebendiger Gott: Erneure uns!“
Kirche in der Kraft des Geistes
Die versammelte Gemeinde
Ökologie mit Liebe zur Erde
Von der Weltherrschaft zur kosmischen Liebe
Die Zukunft der Theologie
Anmerkungen
Impressum
Autor
Vorwort
Diese Vorträge sind rund um das ökumenisch gefeierte Reformationsjahr 2017 gehalten worden. Ich nehme damit die reformerischen Impulse der Reformation von Kirche und Gesellschaft für heute und morgen auf. Es kann doch nicht sein, dass wir ein ganzes Jahr lang „Reformation“ gefeiert haben und das war es dann! Aus der Freude am Evangelium entsteht der Reformwille auf verschiedenen Gebieten. Hoffnung ist die Vorfreude auf das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und seinen Frieden, seine Wahrheit und Schönheit.
Ich komme aus der Aufbruchsstimmung der 1960er-Jahre. Wir haben das Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 1965 erlebt und unsere katholischen Freunde darum beneidet. Wir haben im stalinistischen Ostblock den „Sozialismus mit dem menschlichen Gesicht“ gesehen und waren mit seinen tschechischen Vertretern im intensiven Dialog. Wir waren begeistert von der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und dem „dream“ von Martin Luther King in Washington 1963. In der Bundesrepublik Deutschland wollten wir mit Willy Brandt „mehr Demokratie wagen“. Mit meiner Theologie der Hoffnung habe ich 1964 daran teilgenommen.
Heute ist diese Aufbruchsbereitschaft dem Verlangen nach Sicherheit gewichen. Wer nach Sicherheit verlangt, ist unsicher und hat Angst. Doch Angst ist kein guter Reformimpuls. Es kann eigentlich „alles nur schlechter werden“, darum erschrecken uns alle die Negativschlagzeilen. Wir sind nicht mehr mit Ernst Bloch ins Gelingen verliebt, sondern starren mehr trübselig in den Niedergang. Die Hoffnung ist kleinlaut geworden.
„Geh aus von Deinen Beständen und nicht von dem, was Du nicht bist, aber sein sollst.“ Die Forderungen nach Reformen nützen den Reformen nicht und das Schuldbewusstsein ist kein guter Ratgeber. Die Freude des Glaubens lässt uns die Möglichkeiten zu Reformen erkennen und das Gottvertrauen lässt uns sie ergreifen.
Ich habe gelegentliche Wiederholungen stehen gelassen, um den Zusammenhang der einzelnen Beiträge zu bewahren.
Ich widme dieses Buch in Freundschaft dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm.
Tübingen, im Juli 2018
Jürgen Moltmann
Die unvollendete Reformation1
Ungelöste Probleme – ökumenische Antworten
Von Disputation zum Dialog
Als ich 1948 in Göttingen Theologie studierte, herrschte noch die Kirchenkampfgeneration. Hans-Joachim Iwand, Ernst Wolf und Ernst Käsemann vertraten die „reformatorische Theologie“ und ich war ihr glühender Anhänger. Wir lernten Theologie im Konfliktmodus und der Barmer Theologischen Erklärung der Bekennenden Kirche von 1934: „Wir bekennen“ und „wir verwerfen“. Es hat meines Wissens keine „Dialoge“ zwischen den nationalsozialistischen „Deutschen Christen“ und der Bekennenden Kirche gegeben. Im Gefolge des deutschen Kirchenkampfes dachten wir in „Freund-Feind-Kategorien“ und sangen: „Heiß oder kalt, Ja oder Nein, niemals wollen wir lauwarm sein.“ Meine Lehrer waren mit Entschlossenheit begabt, aber nicht mit Gesprächsbereitschaft, weil sie jeden Kompromiss mit Luther für „faul“ hielten. Sie folgten der reformatorischen Streitkultur.
In meiner Generation wollten viele aus dieser Binnenkirchlichkeit, die nach dem Streit steril zu werden drohte, ausbrechen und eine „Theologie mit dem Gesicht zur Welt“ (Johann Baptist Metz) versuchen. So gerieten wir mit einer Politischen Theologie in Streit mit den politischen Ideologien der „Welt“. Ein Disput wurde dann notwendig, wenn eine konkrete Not vorlag. Das waren die „christlich-marxistischen Dialoge“ in den 60er-Jahren in Salzburg, Herrenchiemsee, Marienbad, an denen sich unter anderem Karl Rahner, Ernst Bloch, Roger Garaudy, Machovec und Gardarsky, Metz und ich beteiligten. „Wenn wir jetzt nicht miteinander sprechen, werden wir einmal aufeinander schießen.“ In der geteilten Welt des Kalten Krieges gab die äußere Situation die Notwendigkeit zum Dialog. Und es war ein gefährlicher Dialog: Im August 1968 beendeten sowjetische Panzer in Prag den „Sozialismus mit dem menschlichen Gesicht“. Alle unsere tschechischen Dialogpartner wurden verfolgt. 21 Jahre später war die Sowjetunion am Ende.
Der andere „Dialog“ wurde notwendig „nach Auschwitz“. Es ging im jüdisch-christlichen Dialog um die Überwindung des jahrhundertealten christlichen Antijudaismus der Kirchen und der christlichen Staaten. Dieser Dialog begann mit US-Holocaust-Konferenzen, setzte sich fort in Bibelarbeiten auf den deutschen Kirchen- und Katholikentagen und heute in Erklärungen der EKD und der katholischen Bischofskonferenz über die bleibende Erwählung Israels.
Heute haben wir es mit einer Dialoginflation zu tun. Man will mit jedem und möglichst allen „ins Gespräch kommen“. Theologie muss relational und kommunikativ sein. Der Gegenstand, über den wir sprechen, ist nicht so wichtig, die Beziehung, die wir im Dialog eingehen, ist wichtiger. Der Dialog unserer Tage dient nicht der Wahrheit, sondern der Gemeinschaft. Diese gemeinschaftssuchenden Dialoge gehen von einer Kirchengemeinschaft zur anderen, von einer Religionsgemeinschaft zur anderen. Zugleich entstehen wahrheitssuchende Dispute in allen Kirchen und in allen Religionen zwischen Konservativen und Progressiven, zwischen Fundamentalisten und Modernisten. Warum sind die gemeinschaftssuchenden Dialoge und die wahrheitssuchenden Dispute getrennt? Warum gehen Gemeinschaft und Wahrheit nicht zusammen?
In der Reformationszeit gab es öffentliche theologische Disputationen, danach entschied der Magistrat einer Stadt oder der Fürst des Landes über den neuen oder den alten Glauben, meistens für den neuen Glauben. In Parlamenten gibt es Diskussionen, danach folgt die Abstimmung. Ein Plädoyer gehört in eine Gerichtsverhandlung, am Ende fällt der Richter ein Urteil. Eine Besprechung dient der Übereinkunft, eine Verabredung dem gemeinsamen Tun. Nur in modernen „Dialogen“ gibt es kein Ziel, der Weg ist Ziel genug, und in modernen TV-Talkshows redet jede und jeder aneinander vorbei, fällt sich gegenseitig ins Wort oder hält das Wort möglichst lange fest. Ein Ergebnis ist nicht beabsichtigt.
Es gibt einen flachen Witz über die moderne Philosophie der Kommunikation: Ein Reisender ist in einer fremden Stadt. Er fragt einen, der ihm begegnet: „Wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht?“ Der antwortet: „Das weiß ich auch nicht, aber ich freue mich, dass wir ins Gespräch gekommen sind.“ Es ist kein Wunder, dass es in der Theologie still geworden ist. Ich erinnere noch die heftigen Dispute über „Entmythologisierung“ oder „feministische Theologie“, um nur zwei zu nennen. Heute sind Theologen friedlich geworden. Es gibt kaum noch Streit. Die Öffentlichkeit nimmt kaum noch Notiz. „Wissenschaftliche Theologie“ hat die Kirchen verlassen und konzentriert sich auf Anerkennung im Haus der Wissenschaften. Dogmatik geht zur Religionsphilosophie über. In früheren Zeiten klagten die Leute über die Streitlust der Theologen, die rabies theologorum. Heute ist Theologie eine harmlose Angelegenheit geworden. Ist das nicht gut so?
Nein! Wir müssen wieder lernen, Ja oder Nein zu sagen. Ein Streit kann mehr Wahrheit enthalten als ein toleranter Dialog. Wir brauchen eine theologische Streitkultur mit Entschlossenheit und Respekt. Warum? Um der Wahrheit Gottes willen! Oder wie es der Weltkirchenrat 1948 in Amsterdam ausdrückte:
„Wir wollen Gott bitten, dass er uns miteinander lehre, ein echtes Nein und ein echtes Ja zu sprechen. Ein Nein zu allem, was der Liebe Christi zuwider ist. Ein Ja zu allem, was mit der Liebe Christi zusammenstimmt, zu allen Menschen, die das Recht aufrichten, zu allen Menschen, die Frieden schaffen, zu allen Menschen, die sich ausstrecken nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt.“
Die Einheit der Kirche2
Die Kirchen der Reformation sagten sich von Rom los, weil sie von Rom verbannt wurden, und wurden Staatskirchen. Luther verbrannte die römische Bannbulle außerhalb der Tore von Wittenberg. Staatskirche war Staatsreligion: cuius regio, eius religio. Nach ihren bösen Erfahrungen mit dem deutschen Nazistaat änderten die protestantischen Kirchen 1945 ihren Namen: Sie verstanden sich nicht mehr als „Deutsche Evangelische Kirche“ (DEK), sondern als „Evangelische Kirche in Deutschland“ (EKD). Das war ein großer Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit der evangelischen Kirche: Deutsch war nicht mehr das Vorzeichen, sondern der Ort, wo die Eine weltweite Kirche existiert. Zuerst kommt das Evangelium, dann die Kirche, dann Deutschland. Aber wo bleibt in der evangelischen Kirche „der Dienst an der Einheit“? Schließlich glauben wir mit dem nizänischen Bekenntnis „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“.
„Einheit“ ist eine Gabe und Aufgabe jeder Kirche im Namen des Dreieinigen Gottes. Seit Martin Luther haben evangelische Theologen das „allgemeine“ – oder wie ich lieber sagen würde: das gemeinsame „Priestertum aller Gläubigen“ gelehrt. „Was aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester und Papst geweihet“, hatte Luther erklärt. Es ist darum an der Zeit, das allgemeine Papsttum aller Gläubigen zu verwirklichen. Der „Dienst an der Einheit“ der Kirche ist die Aufgabe jedes Glaubenden und jeder Kirche. Trotz der weiteren Diversifizierung und Pluralisierung der nicht römisch-katholischen Kirchen in zahlreiche Denominationen glauben wir doch die „eine Kirche Christi“ und vergegenwärtigen uns in der Ökumenischen Bewegung das Hohepriesterliche Gebet Jesu: „Dass alle eins seien“ (Joh 17,21). Evangelische Kirchen sind auch die „eine, katholische Kirche“. Wir glauben das, aber wir handeln nicht so, weil wir uns abgrenzen. Die Reformation war theologisch beabsichtigt als Erneuerung der ganzen, einen, katholischen Kirche aus ihrem Ursprung heraus. Es war eine katholische Reformation. Erst als sich die Fürsten 1530 in Augsburg ihre Kirchen zu eigen machten, wurde es eine „protestantische Reformation“. Die ökumenische Bewegung unserer Tage erinnert uns „Protestanten“ an unseren katholischen Charakter.
Die politische Seite des römischen Papsttums – Staatsoberhaupt des Vatikanstaats – gehört nur historisch, nicht wesentlich zum „Dienst der Einheit“. Nicht nur evangelische Christen wünschen eine Rückkehr zum Papsttum in vorkonstantinischer Zeit. Dann könnten auch evangelische Kirchen den „Dienst der Einheit“ des Bischofs von Rom akzeptieren. Wichtiger aber ist der allgemeine und gemeinschaftliche „Dienst der Einheit“ in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, in jeder Familie. Schließlich sind die römisch-katholischen Kirchen und Gemeinden auch Kirchen und Gemeinden des Evangeliums, also erkennen wir sie an als „evangelische Kirchen“. „Wir sind die Kirche!“ Wie wirkt das? In der Ökumenischen Bewegung haben wir alle dieselbe Erfahrung gemacht: „Je näher wir zu Christus kommen, desto näher kommen wir zueinander.“
Wie sind die Einheit und die Katholizität der Kirche aufeinander bezogen? Sind sie dasselbe? Ich denke nicht. Sie sind verschiedene Qualitäten der Kirche Christi. Wenn wir über die „Einheit“ sprechen, meinen wir die innere Einheit der Kirche, während die Katholizität der Kirche ihren äußeren universalen Horizont in den Blick fasst. Das Wort katholisch, kat-holon, bedeutet „allumfassend“. Allumfassend ist aber erst das Reich Gottes, noch nicht die Kirche Christi. Daraus ergibt sich das Selbstverständnis der Kirche als Antizipation und Anfang des Reiches Gottes in dieser Welt. Die Kirche anerkennt, dass Israel die erste Antizipation des Reiches in der Geschichte ist. Ganz Israel ist nicht ein Kirchenvolk der Völkerkirche, sondern ein Reichsvolk des messianischen Reiches. Daraus ergibt sich: keine Judenmission, aber Anreizen des Judentums zum „Prinzip Hoffnung“ seiner großen Propheten.
Das Wort „katholisch“ kann heute auch einen anderen Sinn haben, einen ökologischen Sinn: „Auf dass alles zusammengefasst werde in Christus, im Himmel wie auf Erden“ (Eph 1,10). Instaurare omnia in Christo – das ist die universale Hoffnung des christlichen Glaubens auf den versöhnten Kosmos: Christus ist jedoch nicht nur Haupt seines Leibes, der Kirche, sondern auch Haupt des versöhnten Kosmos.
Um der „Einheit“ willen, an die wir glauben, ist es richtig, das 500-jährige Reformationsgedenken nicht nur im lutherischen Geist, sondern vor allem im ökumenischen Geist zu feiern und nicht wie 1817 und 1917 Martin Luther, „den Deutschen“, im politisch-nationalistischen (Un-)Geist zu verherrlichen. Der 31. Oktober ist weder Luthers Geburts- noch Todestag, sondern der Reformationstag der „einen und katholischen Kirche“.
Reformation „allein aus Glauben“: Die Täufer3
Wer waren die „Täufer“ und warum wurden sie von Katholiken und Protestanten grausam verfolgt? Luther nannte sie „Schwärmer“, Historiker sprechen vom „linken Flügel der Reformation“, ich denke, sie waren die einzige Reformationsbewegung „allein aus Glauben“. Sie nannten sich selbst „Kinder Gottes“. Dabei meine ich hier die friedlichen Täufer, nicht den Kampf um Münster von 1534.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: