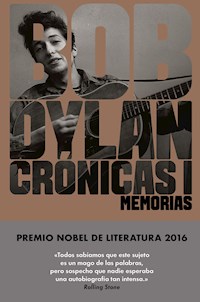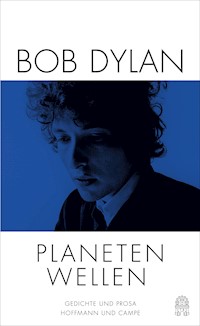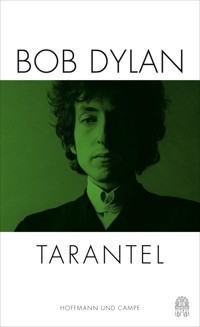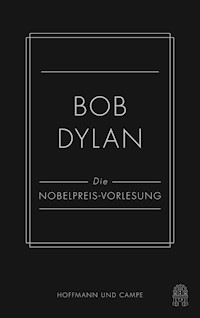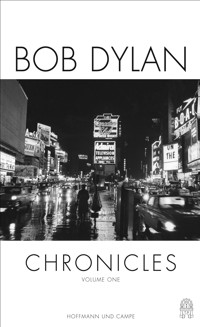
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Wenn du so ein Buch schreibst, musst du die Wahrheit sagen." (Bob Dylan) Die Autobiographie des Literaturnobelpreisträgers 2016! Bob Dylan räumt auf mit den Mythen und Legenden, die sich um sein Leben und Werk ranken, und erzählt seine Geschichte selbst. Wie er Anfang der sechziger Jahre nach New York kam, wo seine Karriere in den Folkclubs begann. Wie er zur Zeit der großen Unruhen in Amerika um seine künstlerische Identität kämpfen und seine Familie vor der Öffentlichkeit schützen musste. Wie ihm ein alter Jazzsänger 1987 half, eine große musikalische Krise zu überwinden. Er blickt auf seine Kindheit zurück und schreibt leidenschaftlich über seine Musik, auch über die Einflüsse, die ihn geprägt haben, von Woody Guthrie bis hin zur "Dreigroschenoper". (Chronicles. Volume 2 und 3 sind bis dato nicht erschienen.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bob Dylan
Chronicles
Volume One
Deutsch von Kathrin Passig und Gerhard Henschel
Hoffmann und Campe
1.Markin’ Up the Score
Lou Levy, der Boss der Plattenfirma Leeds Music, fuhr mit mir im Taxi zum Pythian Temple an der West 70th Street, um mir das winzige Tonstudio zu zeigen, in dem Bill Haley and His Comets »Rock Around the Clock« aufgenommen hatten – dann weiter zu Jack Dempseys Restaurant Ecke 58th und Broadway, wo wir uns in eine Nische mit roten Lederpolstern und Blick aus dem Fenster setzten.
Lou stellte mir Jack Dempsey vor, den berühmten Boxer. Jack drohte mir mit der Faust.
»Du siehst zu leicht aus für ein Schwergewicht, du mußt ein paar Pfund zulegen. Und dich ein bißchen besser anziehen, bißchen mehr aus dir machen – auch wenn du im Ring nicht viele Klamotten brauchst. Und du darfst keine Angst haben, daß du den anderen zu hart erwischst.«
»Er ist kein Boxer, Jack, er ist ein Songwriter, und wir bringen seine Songs raus.«
»Ach so, na, die höre ich dann ja hoffentlich bald mal. Viel Glück, Junge.«
Draußen riß der Wind Wolkenfetzen auf, Schnee wirbelte durch die Straßen mit ihren roten Laternen, eingemummte Stadtmenschen schlurften umher, Straßenverkäufer mit Ohrenschützern aus Kaninchenfell boten Schnickschnack und heiße Maroni feil, aus den Gullydeckeln stieg Dampf auf.
Das alles erschien mir unwichtig. Ich hatte gerade einen Vertrag mit Leeds Music unterschrieben, der sie zur Veröffentlichung meiner Songs berechtigte – nicht daß es davon sonderlich viele gegeben hätte. Ich hatte erst wenige geschrieben. Lou hatte mir bei Vertragsabschluß hundert Dollar Vorschuß auf die künftigen Tantiemen gezahlt, und damit war ich zufrieden.
John Hammond, durch den ich zu Columbia Records gekommen war, hatte mich Lou vorgestellt und ihn gebeten, sich um mich zu kümmern. Hammond kannte nur zwei meiner eigenen Stücke, aber er ahnte, daß es mehr werden sollten.
In Lous Büro öffnete ich meinen Gitarrenkoffer, nahm die Gitarre heraus und zupfte an den Saiten. Das Zimmer war vollgestopft – gestapelte Kartons mit Noten, Pinnwände mit den Aufnahmeterminen von Musikern, schwarzglänzende Scheiben, verstreute Azetatplatten mit weißen Labels, signierte Fotos von Entertainern, Hochglanzporträts, Jerry Vale, Al Martino, The Andrews Sisters (Lou war mit einer von ihnen verheiratet), Nat King Cole, Patti Page, The Crew Cuts, ein paar große Tonbandgeräte, ein großer Schreibtisch aus dunkelbraunem Holz, voller Krimskrams. Lou stellte ein Mikrofon vor mich auf den Tisch, schloß es an einen der Recorder an und kaute dabei unablässig auf einem dicken, exotischen Stumpen.
»John setzt große Hoffnungen in dich«, sagte er.
John war John Hammond, der bekannte Talentscout und Entdecker großer Musiker, imposanter Persönlichkeiten in der Geschichte der Musik auf Schallplatte – unter anderem Billie Holiday, Teddy Wilson, Charlie Christian, Cab Calloway, Benny Goodman, Count Basie und Lionel Hampton; Künstler, deren Musik im Leben Amerikas widerhallte. Und er hatte den Blick der Öffentlichkeit auf sie gelenkt. Hammond hatte sogar die letzten Aufnahmesessions von Bessie Smith geleitet. Er war eine Legende, echte amerikanische Aristokratie, seine Mutter eine Original-Vanderbilt. John war in allem Komfort als Oberschichtkind aufgewachsen. Aber das stellte ihn nicht zufrieden, und er folgte seiner eigentlichen Liebe, der Musik, vorzugsweise Spirituals, Blues und den vibrierenden Rhythmen des Hot Jazz – Musik, die er verehrte und die er mit seinem Leben verteidigt hätte. Er war nicht zu bremsen, und er hatte keine Zeit zu verlieren. In seinem Büro hatte ich kaum glauben können, daß ich nicht träumte, so unfaßbar war es, daß er mich bei Columbia Records unter Vertrag nahm. Es klang wie erfunden.
Columbia war eines der allerersten Labels im Lande, und daß ich dort einen Fuß in die Tür bekommen hatte, war ein Ereignis. Zum einen galt Folk als Schund und zweite Wahl und wurde nur von kleinen Labels veröffentlicht. Große Plattenfirmen waren einzig und allein der Elite mit ihrer desinfizierten und pasteurisierten Musik vorbehalten. Leuten wie mir gewährte man dort nur unter außergewöhnlichen Umständen Einlaß. Aber John war ein außergewöhnlicher Mann. Er machte keine Platten für Schuljungen oder mit Schuljungen als Künstlern. Er war umsichtig und vorausschauend, er hatte mich gesehen und gehört, er hatte Gespür und vertraute auf die Zukunft. Er erklärte, daß er mich in einer langen Tradition stehen sehe, der Tradition von Blues, Jazz und Folk, und nicht als neumodisches Wunderkind oder große Innovation. Nicht daß es irgendwo große Innovationen gegeben hätte. In den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren ging es in der amerikanischen Musikszene reichlich verschlafen zu. Die populären Radiosender traten mehr oder weniger auf der Stelle und dudelten nichtssagenden Kitsch. Es sollte noch Jahre dauern, bis die Beatles, The Who oder die Rolling Stones wieder für Spannung sorgten und der Szene neues Leben einhauchten. Ich spielte damals gestrenge Folksongs mit einer Portion Feuer und Schwefel, und man brauchte keine Marktforschung, um zu merken, daß sie nicht ins Radioprogramm paßten und schwer zu vermarkten waren. Aber John sagte, das sei ihm nicht besonders wichtig. Er verstand, was es mit meiner Musik auf sich hatte.
»Ehrlichkeit versteh ich«, sagte er. John hatte eine ziemlich direkte, ungehobelte Art, aber er zwinkerte dabei anerkennend.
Vor kurzem hatte er Pete Seeger unter Vertrag genommen; entdeckt hatte er ihn allerdings nicht. Pete war schon seit Jahren im Geschäft. Er war Mitglied der bekannten Folkband The Weavers gewesen, hatte in der McCarthy-Ära auf der Schwarzen Liste gestanden und es nicht leicht gehabt, aber seine Arbeit nie unterbrochen. Hammond geriet in Rage, als er über Seeger sprach, und er erzählte, Petes Vorfahren seien auf der Mayflower nach Amerika gekommen, und seine Verwandten hätten in der Schlacht am Bunker Hill gekämpft, Herrgott noch mal. »Und diese Arschlöcher haben ihn auf die Schwarze Liste gesetzt, kannst du dir das vorstellen? Teeren und federn sollte man die.«
»Ich geb’s dir schwarz auf weiß«, sagte er zu mir, »du bist ein talentierter junger Mann. Wenn du dein Talent gezielt einsetzt und beherrschst, kommst du schon zurecht. Ich hol dich ins Boot, und wir nehmen was auf. Dann sehen wir weiter.«
Und das genügte mir vollkommen. Er legte mir einen Vertrag vor, den Standardvertrag, und ich unterschrieb auf der Stelle, ohne mich mit den Details aufzuhalten – ich brauchte keinen Anwalt, keinen Berater, niemanden, der mir über die Schulter sah. Ich hätte mit Freuden alles unterschrieben, was er mir vorlegte.
Er sah auf den Kalender, entschied sich für einen Termin, an dem ich mit den Aufnahmen beginnen sollte, deutete darauf und malte einen Kreis um das Datum, sagte mir, wann ich mich einfinden solle und daß ich mir überlegen müsse, was ich spielen wolle. Dann rief er Billy James herein, den Chef der Presseabteilung, und wies ihn an, einen PR-Text über mich zu schreiben, Angaben zur Person für eine Pressemeldung.
Billy war mittelgroß mit krausem schwarzem Haar und wie ein Yale-Absolvent gekleidet. Er sah aus, als sei er noch nie in seinem Leben stoned oder in Schwierigkeiten gewesen. Ich schlenderte in sein Büro und setzte mich vor seinen Schreibtisch, wo er mir ein paar Fakten aus der Nase zu ziehen versuchte, offenbar in der Annahme, daß ich jetzt auszupacken hätte. Er holte Block und Stift heraus und fragte, wo ich herkäme. Aus Illinois, sagte ich, und er schrieb es auf. Er fragte, ob ich schon andere Jobs gehabt hätte, und ich sagte, ich hätte schon ein Dutzend Jobs gehabt, unter anderem als Auslieferungsfahrer für eine Bäckerei. Das schrieb er auf und fragte mich nach anderen Jobs. Ich sagte, ich hätte auf dem Bau gearbeitet, und er wollte wissen, wo.
»Detroit.«
»Bist du rumgereist?«
»So isses.«
Er fragte nach meiner Familie, wo die wohne. Keine Ahnung, sagte ich, wir hätten längst den Kontakt zueinander verloren.
»Wie war’s bei dir zu Hause?«
Ich sagte, ich sei rausgeflogen.
»Was war dein Vater von Beruf?«
»’lektriker.«
»Und deine Mutter, was hat die gemacht?«
»Hausfrau.«
»Was für Musik spielst du?«
»Folk.«
»Was ist das für Musik?«
Überlieferte Songs, sagte ich. Ich konnte diese Fragen nicht leiden. Ich dachte, ich könnte ihnen ausweichen. Billy schien nicht genau zu wissen, wo er mich einordnen sollte, und das paßte mir ganz gut. Ich hatte sowieso keine Lust, seine Fragen zu beantworten, kein Bedürfnis, irgendwem irgendwas zu erklären.
»Wie bist du hierher gekommen?« fragte er mich.
»Mit einem Güterzug.«
»Du meinst, mit einem Personenzug?«
»Nein, mit dem Güterzug.«
»Also so was wie ein Güterwaggon?«
»Ja, so was wie ein Güterwaggon. So was wie ein Güterzug.«
»Okay, ein Güterzug.«
Ich blickte an Billy vorbei, durch das Fenster hinter seinem Sessel in ein Bürogebäude auf der anderen Straßenseite, wo ich eine geschäftige Sekretärin sehen konnte, die tief in ihre Arbeit versunken war – in meditativer Versunkenheit kritzelte sie eifrig vor sich hin. Daran war gar nichts Komisches. Ich hätte gern ein Fernrohr gehabt. Billy fragte mich, mit wem ich mich in der aktuellen Musikszene identifizierte. Mit niemandem, sagte ich. Das stimmte sogar, ich erkannte mich wirklich in niemandem wieder. Der Rest war allerdings reiner Blödsinn – Kiffergerede.
Ich war gar nicht mit einem Güterzug angereist. Ich war in einem viertürigen 57er Chevy Impala quer durchs Land gefahren – raus aus Chicago, als sei der Teufel hinter mir her – mit Höchstgeschwindigkeit in einer Tour durch die verqualmten Städte, über gewundene Straßen, an grünen und schneebedeckten Feldern vorbei und weiter nach Osten über die Staatsgrenzen, Ohio, Indiana, Pennsylvania, vierundzwanzig Stunden lang, die meiste Zeit hatte ich auf dem Rücksitz verdöst oder Smalltalk gemacht. Ich hing meinen eigenen Gedanken nach, bis wir schließlich die George Washington Bridge überquerten.
Der große Wagen kam auf der anderen Seite zum Stehen, und ich stieg aus. Ich schlug die Tür hinter mir zu, winkte zum Abschied und stapfte durch den harten Schnee. Beißender Wind fuhr mir ins Gesicht. Endlich war ich angekommen, in New York City, einem Stadtgebilde, das zu undurchdringlich ist, als daß man es durchschauen könnte. Und das wollte ich auch gar nicht versuchen.
Ich wollte hier die Sänger finden, deren Platten ich gehört hatte – Dave Van Ronk, Peggy Seeger, Ed McCurdy, Brownie McGhee und Sonny Terry, Josh White, The New Lost City Ramblers, Reverend Gary Davis und noch ein paar andere – aber vor allem wollte ich Woody Guthrie ausfindig machen. New York City, die Stadt, die mein Schicksal bestimmen sollte. Das moderne Gomorrha. Ich stand ganz am Anfang, aber ich war keineswegs ein unbeleckter Neuling.
Ich war im tiefsten Winter eingetroffen. Die Kälte war brutal, und der Schnee verstopfte alle Arterien der Stadt, aber ich kam aus dem frostgeplagten Norden, aus einer Gegend, in der man sich von dunklen, erstarrten Wäldern und eisglatten Straßen nicht schrecken läßt. Über solche Widrigkeiten konnte ich leicht hinwegkommen. Ich suchte nicht nach Geld oder Liebe. Ich hatte geschärfte Sinne und feste Gewohnheiten, ich war unpraktisch und obendrein ein Visionär. Ich hatte einen klaren Kopf und brauchte keinen Fleischbeschauerstempel. Ich kannte keine Menschenseele in dieser dunklen, frostigen Metropole, aber das sollte sich ändern – und zwar bald.
Das Café Wha? war ein Club in der MacDougal Street mitten in Greenwich Village. Es war eine schummrige, unterirdische Höhle ohne Alkoholausschank und wirkte mit seiner niedrigen Decke wie ein großer Speisesaal mit Stühlen und Tischen. Es öffnete mittags und schloß um vier Uhr morgens. Jemand hatte mir geraten, hinzugehen und nach einem Sänger namens Freddy Neil zu fragen, der tagsüber die Auftritte im Wha? moderierte.
Ich fand den Laden, und man teilte mir mit, Freddy sei unten im Keller, wo man Mäntel und Hüte abgeben konnte. Dort traf ich ihn auch an. Neil war der MC des Schuppens und der für alle Entertainer zuständige Impresario. Er war die Freundlichkeit in Person. Er wollte wissen, was ich machte, und ich antwortete, daß ich sang und Gitarre und Mundharmonika spielte. Er bat mich, ihm etwas vorzuspielen. Nach einer guten Minute sagte er, ich könne ihn bei seinen Auftritten auf der Mundharmonika begleiten. Ich war im siebten Himmel. Jetzt mußte ich schon mal nicht mehr draußen frieren. Das war gut.
Fred spielte ungefähr zwanzig Minuten lang und kündigte dann den Rest des Programms an. Später kam er zurück und spielte weiter, wenn er Lust hatte und der Laden voll war. Die Auftritte waren zusammenhanglos und unbeholfen wie in Ted Macks Amateur Hour, einer populären Fernsehshow. Das Publikum bestand überwiegend aus Collegestudenten, Vorstädtern, Sekretärinnen in der Mittagspause, Matrosen und Touristen. Alle Auftritte dauerten zehn bis fünfzehn Minuten. Fred spielte immer, solange er Lust hatte und sich inspiriert fühlte. Freddy wußte, wo es langging, er kleidete sich konservativ, war düster und grüblerisch und hatte einen undurchdringlichen Blick, Pfirsichhaut, lockiges Haar und eine zornige, kräftige Baritonstimme, mit der er die Blue Notes traf und bis unters Dach schmetterte, mit oder ohne Mikro. Er war der König des Clubs und hatte sogar seinen eigenen Harem, sein Gefolge. Er herrschte unangefochten. Alles drehte sich um ihn. Jahre später sollte er den Hit »Everybody’s Talkin’« schreiben. Ich spielte nie eigene Sets. Ich begleitete nur Neil, und so kam ich zu regelmäßigen Auftritten in New York.
Die Nachmittagsshow im Café Wha? war ein wildes Sammelsurium – es gab einen Komiker, einen Bauchredner, eine Steeldrum-Band, einen Dichter, einen Frauendarsteller, ein Duo, das Broadway-Stücke sang, einen Zauberer mit Kaninchen im Hut, einen Typen mit Turban, der Leute aus dem Publikum hypnotisierte, einen Menschen, dessen ganze Nummer aus Gesichtsakrobatik bestand – jeder, der einen Fuß in die Tür des Showbusiness bekommen wollte, konnte hier mitmachen. Es war nichts dabei, was einen dazu brachte, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Freds Job hätte ich auf keinen Fall haben wollen.
Gegen acht Uhr abends war Schluß mit der Tagesroutine. Dann begann die professionelle Show. Komiker wie Richard Pryor, Woody Allen, Joan Rivers, Lenny Bruce und kommerzielle Folkbands wie die Journeymen übernahmen die Bühne. Wer tagsüber aufgetreten war, packte seine Sachen und verschwand. Nachmittags trat unter anderem Tiny Tim auf, der im Falsett sprach. Er spielte Ukulele und sang mit Mädchenstimme Evergreens aus den Zwanzigern. Ich hatte mich ab und zu mit ihm unterhalten und ihn gefragt, wo man hier sonst noch arbeiten könne, und er hatte erwähnt, daß er hin und wieder am Times Square in einem Club namens Hubert’s Flea Circus Museum auftrat. Den Laden sollte ich später noch näher kennenlernen.
Fred wurde ständig von irgendwelchen Knallköpfen behelligt und unter Druck gesetzt, die bei ihm auftreten wollten. Die traurigste Gestalt war ein Typ namens Billy the Butcher. Er sah aus, als sei er einem Alptraum entsprungen. Er spielte nur einen einzigen Song – »High-Heel Sneakers« –, nach dem er süchtig war wie nach einer Droge. Fred ließ ihn normalerweise irgendwann im Laufe des Tages auf die Bühne, meistens dann, wenn der Laden leer war. Billy kündigte seinen Song jedesmal mit den Worten an: »Der ist für euch, Mädels.« Der Butcher trug einen Mantel, der ihm zu klein war und über der zugeknöpften Brust spannte. Billy war ruhelos. Er hatte früher irgendwann in Bellevue in einer Zwangsjacke gesteckt und auch schon mal in einer Gefängniszelle die Matratze angezündet. Er hatte jede Menge Pech gehabt und stand mit der gesamten Menschheit auf Kriegsfuß. Den einen Song sang er aber ganz gut.
Ein anderer beliebter Typ trug eine Priesterkutte und rote Stiefel mit Glöckchen und gab verdrehte Bibelgeschichten zum besten. Auch Moondog trat hier unten auf. Moondog war ein blinder Dichter und meistens obdachlos. Sein Kostüm bestand aus einer Decke, einem Wikingerhelm und hohen Pelzstiefeln. Moondog hielt Monologe und spielte auf Bambusflöten und Pfeifen. Meistens trat er auf der 42nd Street auf.
Meine Lieblingssängerin in diesem Laden war Karen Dalton. Sie war eine hochaufgeschossene weiße Bluessängerin und Gitarristin, funky, schlaksig und temperamentvoll. Wir kannten uns sogar schon; ich war ihr im letzten Sommer in einer Kleinstadt an einem Gebirgspaß bei Denver in einem Folkclub über den Weg gelaufen. Karen hatte eine Stimme wie Billie Holiday, spielte Gitarre wie Jimmy Reed und zog ihr Programm konsequent durch. Ich trat ein paarmal mit ihr zusammen auf.
Fred versuchte grundsätzlich, möglichst viele Künstler unterzubringen, und er war dabei so diplomatisch wie irgend möglich. Manchmal war der Club unerklärlich leer, manchmal halbvoll, und dann platzte er aus unerfindlichen Gründen plötzlich aus allen Nähten, so daß die Leute auf der Straße Schlange stehen mußten. Fred war die Zugnummer hier unten, die Hauptattraktion, und sein Name stand draußen angeschrieben, also kam womöglich ein Großteil der Besucher seinetwegen. Ich weiß es nicht. Er spielte eine große Dreadnought-Gitarre, sehr perkussiv, mit einem durchdringenden, drängenden Rhythmus – er war eine Ein-Mann-Band mit einer Stimme wie ein Tritt in die Fresse. Er trug wilde Bearbeitungen von Sträflingsliedern vor und brachte das Publikum zur Raserei. Ich hatte einiges über ihn gehört, er war angeblich ein heimatloser Matrose, hatte eine Jolle vor Florida liegen, war ehemaliger Undercoverbulle, hatte Huren als Freundinnen gehabt und insgesamt eine recht zwielichtige Vergangenheit. Er fuhr nach Nashville, lieferte dort Songs ab, die er geschrieben hatte, und machte sich dann auf den Weg nach New York, wo er sich nicht von der Stelle rührte und darauf wartete, daß ihm irgend etwas passierte, was ihm die Taschen mit Zaster füllte. Egal, womit er sein Geld verdiente – viel war es jedenfalls nicht. Ihm fehlte offenbar jeglicher Ehrgeiz. Wir paßten gut zusammen und sprachen nie über Persönliches. Er war mir sehr ähnlich, höflich, aber nicht übermäßig freundlich. Wenn der Club seine Pforten schloß, gab er mir Kleingeld und sagte: »Hier … damit du nicht in Schwierigkeiten kommst.«
Der größte Vorteil an der Zusammenarbeit mit ihm war aber rein gastronomischer Natur – es gab so viele Pommes und Hamburger, wie ich essen konnte. Im Laufe des Tages tauchten Tiny Tim und ich in der Küche auf und hingen dort ab. Norbert, der Koch, hatte meistens einen fettigen Burger für uns übrig, oder wir durften uns eine Dose Schweinefleisch mit Bohnen oder Spaghetti in die Pfanne kippen. Norbert war eine Marke für sich. Er hatte eine Schürze mit Tomatenflecken um, ein feistes, mitgenommenes Gesicht mit Pausbacken und Narben wie von Krallenspuren. Er hielt sich für einen Frauenhelden und sparte für eine Reise nach Verona, wo er das Grab von Romeo und Julia besichtigen wollte. Die Küche war wie eine Höhle unter einer Klippe.
Eines Nachmittags goß ich mir dort gerade ein Glas Cola aus einem Milchkrug ein, als eine coole Stimme aus dem Radio an mein Ohr drang. Ricky Nelson sang seinen neuen Song »Travelin’ Man«. Ricky hatte etwas Geschmeidiges, er sang gefühlvoll, schnell und rhythmisch mit einer eigenwilligen Intonation. Er war anders als die anderen Teenie-Idole, und er hatte einen geilen Gitarristen, der wie eine Mischung aus Honky-Tonk-Hero und Bauernhochzeitsgeiger spielte. Nelson hatte nie mutig Neuland beschritten wie die frühen Sänger, die gesungen hatten, als stünden sie am Steuer eines brennenden Schiffs. Er sang nicht verzweifelt, richtete nicht viel Schaden an und trat nicht auf wie ein Schamane. Man hatte nicht das Gefühl, daß seine Belastbarkeit je auf eine harte Probe gestellt wurde, aber das machte nichts. Er sang seine Lieder ruhig und gleichmütig wie im Auge des Sturms, der alle anderen fortfegt. Seine Stimme hatte etwas Geheimnisvolles und versetzte einen in eine besondere Stimmung.
Ich war früher ein großer Fan von Ricky gewesen und mochte ihn immer noch, aber diese Art Musik war auf dem absteigenden Ast. Sie hatte keine Chance, irgendeine Bedeutung zu entwickeln. In der Zukunft hatte so was keine Zukunft. Es war alles ein Irrtum. Kein Irrtum war der Schatten von Billy Lyons, rootin’ the mountain down, standing ’round in East Cairo, Black Betty bam be lam. Das war kein Fehler. Hier spielte jetzt die Musik. Das war der Stoff, der einen in Frage stellen ließ, was man immer hingenommen hatte, der Stoff, der von einem kraftvollen Geist beseelt war und gebrochene Herzen am Straßenrand zurückließ. Wie immer sang Ricky abgegriffene Texte, die ihm wahrscheinlich auf den Leib geschrieben worden waren. Trotzdem hatte ich mich ihm immer nahe gefühlt. Wir waren ungefähr gleich alt, hatten vermutlich die gleichen Vorlieben und stammten aus derselben Generation, auch wenn unsere Lebenserfahrung sehr unterschiedlich war; er hatte im Westen in einer TV-Familienshow seiner Eltern angefangen. Es war, als sei er am Walden Pond aufgewachsen, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen war, während ich aus dem finsteren Dämonenwald kam. Die gleiche Gegend, aber aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Rickys Kunst erschloß sich mir problemlos. Ich fand, daß wir viel gemeinsam hatten. Wenige Jahre später sollte er ein paar Songs von mir aufnehmen, die klangen, als stammten sie von ihm, als habe er sie selbst geschrieben. Schließlich schrieb er auch selbst einen und erwähnte meinen Namen darin. Ungefähr zehn Jahre danach sollte Ricky sogar auf der Bühne ausgebuht werden, weil er musikalisch eine neue Richtung einschlug. Es stellte sich heraus, daß wir tatsächlich viel gemeinsam hatten.
Das konnte ich nicht wissen, als ich in der Küche des Café Wha? stand und seinem sanften, eintönigen Singsang lauschte. Die Sache war die, daß Ricky immer noch Platten aufnahm, und das wollte ich auch. Ich sah mich schon bei Folkways Records unter Vertrag. Das war das Label, zu dem ich hinwollte. Es war das Label, bei dem die ganzen großartigen Platten herauskamen.
Als Rickys Song zu Ende ging, gab ich meine restlichen Pommes Tiny Tim und ging zurück in den Vorraum, um zu sehen, was Fred gerade machte. Ich hatte Fred einmal gefragt, ob es Platten von ihm gebe, und er hatte gesagt: »Das ist nicht mein Ding.« Er verwendete Düsterkeit als eine musikalische Waffe, aber so begabt und so stark er auch war, auf der Bühne fehlte ihm irgend etwas. Ich kam nicht dahinter, was es war. Erst als ich Dave Van Ronk sah, wußte ich Bescheid.
Van Ronk trat im Gaslight auf, einem geheimnisvollen Club, der die Straße dominierte und mehr Prestige besaß als alle anderen Läden. Es strahlte einen besonderen Zauber aus, hatte ein großes buntes Banner an der Fassade und zahlte Wochengagen. Es lag im Parterre neben einer Bar namens Kettle of Fish und hatte keine Genehmigung zum Alkoholausschank, aber man konnte sich eine Flasche in einer Papiertüte mitbringen. Tagsüber hatte der Schuppen geschlossen und öffnete erst am frühen Abend, rund ein halbes Dutzend Musiker, die sich die ganze Nacht lang abwechselten, ein exklusiver Kreis, in den Unbekannte nicht eindringen konnten. Gelegenheiten zum Vorspielen gab es nicht. In diesem Club wollte ich, mußte ich auftreten.
Van Ronk trat dort auf. Ich hatte Van Ronks Platten schon damals im Mittleren Westen gehört, ihn ziemlich großartig gefunden und manche Aufnahmen bis ins Detail nachgeahmt. Er hatte Leidenschaft und Biß – er sang wie ein Glücksritter, und man hörte, daß er sein Lehrgeld bezahlt hatte. Van Ronk konnte heulen und flüstern, aus Blues Balladen machen und aus Balladen Blues. Ich war begeistert von seinem Stil. Das waren die Leute, die New York ausmachten. In Greenwich Village war Van Ronk der König der Straße, ein souveräner Alleinherrscher.
An einem kalten Wintertag, in einem leichten Schneegestöber, als das matte Sonnenlicht sich seinen Weg durch den Dunst bahnte, kam er mir nicht weit von der Ecke Thompson und 3rd in eisigem Schweigen entgegen. Es sah aus, als wehe der Wind ihn auf mich zu. Ich wollte ihn ansprechen, aber irgend etwas stimmte nicht. Ich sah ihn vorübergehen, sah seine Augen aufblitzen. Es war ein flüchtiger Moment, und ich hatte ihn verpatzt. Ich wollte aber für Van Ronk spielen. Genaugenommen wollte ich für jeden spielen. Ich hatte noch nie in meinem Zimmer sitzen und nur für mich selbst spielen können. Ich mußte für andere spielen, und zwar immer. Man kann sagen, daß ich öffentlich übte, daß mein ganzes Leben zu einer öffentlichen Probe wurde. Ich hatte es weiter auf das Gaslight abgesehen. Wie denn auch nicht? Verglichen mit dem Gaslight waren die anderen Clubs in der Gegend namenlose Kaschemmen, billige Basket Houses, wo die Musiker sich die Einnahmen aus einem herumgegebenen Korb teilten, oder kleine Cafés, wo der Musiker mit dem Hut herumging. Ich spielte aber in möglichst vielen davon. Ich hatte keine Wahl. Sie drängten sich in den schmalen Gassen und waren von ganz unterschiedlichem Format, aber alle klein, lärmig und auf den Geschmack der Touristen zugeschnitten, die nachts durch die Straßen zogen. Alles ging als Club durch – Saloons mit Flügeltüren, Ladengeschäfte, Kneipen im zweiten Stock, Kneipen im Keller, jedes noch so winzige Loch.
Es gab eine ungewöhnliche Bier- und Weinkneipe in der 3rd Street, vormals Aaron Burrs Mietstall, jetzt das Café Bizarre. Es wurde vor allem von Arbeitern besucht, die herumsaßen, lachten, fluchten, Fleisch aßen und sich Fickgeschichten erzählten. Hinten gab es eine kleine Bühne, wo ich ein-, zweimal auftrat. Ich schätze, ich bin früher oder später überall mal aufgetreten. Die meisten Lokale hatten bis Tagesanbruch geöffnet, im Licht der Petroleumlampen, Sägemehl auf dem Fußboden, manche hatten Holzbänke, einen Rausschmeißer an der Tür, es wurde kein Eintritt verlangt, und die Inhaber versuchten, die Gäste bis zum Anschlag mit Kaffee abzufüllen. Beim Auftritt saß oder stand man beim Fenster, so daß man von der Straße aus zu sehen war, oder man wurde ans andere Ende der Kneipe dirigiert, gegenüber dem Eingang, und man sang, so laut man konnte. Mikrofone gab es nicht.
Talentsucher verirrten sich nicht in solche Löcher. Sie waren dunkel und schäbig und die Atmosphäre war chaotisch. Wer auftrat, sang und ließ den Hut herumgehen oder sah beim Spielen den vorbeiziehenden Touristen zu und hoffte, daß sie ein paar Münzen in einen Brotkorb oder den Gitarrenkoffer warfen. Wenn man am Wochenende die ganze Nacht hindurch in den Kneipen auftrat, verdiente man um die zwanzig Dollar. An Werktagen war es ganz unterschiedlich. Manchmal kriegte man nur wenig, weil die Konkurrenz so groß war. Man mußte ein paar Tricks draufhaben, wenn man sich durchschlagen wollte.
Ein Sänger, dem ich oft über den Weg lief, Richie Havens, hatte immer ein hübsches Mädchen dabei, das den Hut herumreichte, und ich merkte, daß sein Geschäft gut lief. Manchmal ließ das Mädchen gleich zwei Hüte durchs Publikum wandern. Wenn man keinen dieser Kniffe kannte, war man praktisch Luft für die Leute, was nicht gut war. Ein paarmal tat ich mich mit einem Mädchen zusammen, das ich aus dem Café Wha? kannte, einer attraktiven Kellnerin. Wir zogen herum, ich spielte, und sie sammelte, wobei sie ein komisches Häubchen, dickes schwarzes Mascara und eine tief ausgeschnittene Spitzenbluse trug. Vom Nabel aufwärts wirkte sie unter ihrem umhangartigen Mantel fast nackt. Danach teilten wir uns das Geld, aber als Dauerlösung war das zu umständlich. Jedenfalls verdiente ich in ihrer Begleitung mehr, als wenn ich allein unterwegs war.
Was mich damals wirklich von den anderen unterschied, war mein Repertoire. Es war umfangreicher als das der anderen Kaffeehausmusiker und bestand aus Hardcore-Folksongs, die ich mit unermüdlichem lautem Geschrammel begleitete. Entweder vergraulte ich damit die Leute oder sie kamen näher und wollten wissen, was da vor sich ging. Nur diese beiden Reaktionen, dazwischen gab es nichts. Es gab viele bessere Sänger und Musiker in der Gegend, aber keiner machte etwas Ähnliches wie ich. Durch Folksongs erforschte ich das Universum, sie waren Bilder, und die Bilder waren wertvoller als alle meine Worte. Ich hatte den Kern der Sache erfaßt. Es fiel mir leicht, die Einzelteile zusammenzufügen. Ich konnte locker Stücke wie »Columbus Stockade«, »Pastures of Plenty«, »Brother in Korea« und »If I Lose, Let Me Lose« hintereinander herunterreißen wie einen einzigen, langen Song. Die meisten Performer nahmen sich selbst wichtiger als ihre Songs, aber das lag mir nicht. Mir ging es nur um den Song.
Nachmittags ging ich nicht mehr ins Café Wha? Ich setzte keinen Fuß mehr hinein. Auch Freddy Neil verlor ich aus den Augen. Statt dessen verbrachte ich meine Zeit jetzt im Folklore Center, der Hochburg des amerikanischen Folk. Es lag ebenfalls in der MacDougal Street, zwischen Bleecker und 3rd. Der kleine Laden im ersten Stock war auf charmante Weise altmodisch. Er wirkte wie eine uralte Kapelle, eine altehrwürdige Einrichtung im Schuhschachtelformat. Das Folklore Center verkaufte und verbreitete alles, was mit Folk zu tun hatte. Es hatte ein großes Schaufenster, wo Platten und Instrumente ausgestellt wurden.
Eines Nachmittags stieg ich die Treppe hinauf und trat ein. Ich stöberte herum und begegnete Izzy Young, dem Besitzer. Young war ein sardonischer Folk-Enthusiast der alten Schule mit einer dicken Hornbrille. Er sprach mit einem schweren Brooklyn-Akzent und trug weite Wollhosen mit einem schmalen Gürtel und Arbeitsstiefel; die Krawatte saß nachlässig schief. Er hatte eine Stimme wie ein Bulldozer, viel zu laut für den kleinen Raum. Aus dem einen oder anderen Grund war Izzy immer ein bißchen aufgeregt über irgend etwas. Er war ein gutmütiger Kauz, im Grunde ein Romantiker. Für ihn war Folk ein glitzernder Goldschatz. Das ging mir genauso. Der Laden war ein Dreh- und Angelpunkt für alle möglichen Folkaktivitäten, und man konnte dort jederzeit eingefleischte Folksänger treffen. Manche Leute ließen sich ihre Post dorthin schicken.
Young veranstaltete gelegentlich Folkkonzerte mit unverwechselbar authentischen Folk- und Bluesmusikern. Er lud sie von außerhalb ein, in der Town Hall oder einer Universität aufzutreten. Dann und wann sah ich Clarence Ashley, Gus Cannon, Mance Lipscomb, Tom Paley oder Erik Darling im Laden. Es gab auch jede Menge entlegener Folkplatten, die ich alle gern hören wollte, Manuskripte vergessener Songs aller Arten – Seemannslieder, Songs aus dem Bürgerkrieg, Cowboysongs, Klagelieder, Kirchenlieder, Anti-Jim-Crow-Songs, Gewerkschaftslieder, steinalte Bücher mit Volkssagen, Zeitschriften der Wobblies, Propagandaheftchen über alle möglichen Themen, von Frauenrechten bis zu den Gefahren der Trunksucht, sogar eines von Daniel Defoe, dem Verfasser von Moll Flanders. Ein paar Instrumente standen zum Verkauf, Dulcimer, fünfsaitige Banjos, Kazoos, Penny Whistles, Akustikgitarren, Mandolinen. Wenn man herausfinden wollte, worum es beim Folk eigentlich ging, dann war dies der Ort, an dem man mehr als eine schwache Ahnung davon bekommen konnte.
Izzy hatte ein Hinterzimmer mit einem bauchigen Holzofen, schief aufgehängten Bildern und wackeligen Stühlen. Alte Patrioten und Helden an der Wand, Tongefäße mit Kreuzstichmustern, schwarzlackierte Kerzenhalter … viel Kunsthandwerk. Das kleine Zimmer enthielt Unmengen amerikanischer Platten und einen Plattenspieler. Izzy ließ mich hinten sitzen und Musik hören. Ich hörte mir an, soviel ich konnte, und blätterte sogar einen Großteil seiner vorsintflutlichen Folk-Rollbilder durch. Die irrsinnig komplizierte moderne Welt interessierte mich wenig. Sie hatte keine Bedeutung, kein Gewicht. Sie konnte mich nicht verführen. Für mich waren andere Themen fesselnd, aktuell und angesagt – der Untergang der Titanic, die Flut von Galveston, John Henry, der Schienenleger, der es mit bloßer Muskelkraft mit einem Dampfhammer aufnahm, oder John Hardy, der an der West Virginia Line einen Mann erschossen hatte. Das alles war gegenwärtig und lag offen zutage. Das waren die Nachrichten, die mich interessierten, die ich verfolgte und im Auge behielt.
Um seinerseits die Dinge im Auge zu behalten, führte Izzy Tagebuch. Es war eine Art Hauptbuch, das offen auf seinem Schreibtisch lag. Er stellte mir immer wieder Fragen, etwa, wo ich aufgewachsen sei und woher mein Interesse am Folk rühre, wo ich den Folk entdeckt hätte und so weiter. Dann trug er Notizen über mich in sein Tagebuch ein. Ich konnte mir nicht vorstellen, wozu das gut sein sollte. Seine Fragen gingen mir auf die Nerven, aber ich mochte ihn, weil er freundlich zu mir war, und ich versuchte, rücksichtsvoll und entgegenkommend zu sein. Wenn ich mit Fremden sprach, war ich immer sehr vorsichtig, aber Izzy war okay, und ich beantwortete seine Fragen offen und ehrlich.
Er fragte nach meiner Familie. Ich erzählte ihm von meiner Großmutter mütterlicherseits, die bei uns wohnte. Sie war gutherzig und voller Würde und hatte mir einmal erklärt, daß das Glück nicht irgendwo am Wegrand liege. Der Weg selbst sei das Glück. Sie hatte mir auch aufgetragen, immer nett zu sein, weil jeder, dem man begegne, seine eigenen Kämpfe auszutragen habe.
Ich konnte mir nicht vorstellen, welche Kämpfe Izzy zu bestehen hatte. Innere, äußere, wer weiß? Young befaßte sich mit sozialer Ungerechtigkeit, Hunger und Obdachlosigkeit und hielt damit nicht hinterm Berg. Seine Helden waren Abraham Lincoln und Frederick Douglass. Moby-Dick, das ultimative Anglerlatein, war sein Lieblingsschmöker. Young wurde von Geldeintreibern und seinem Vermieter bedrängt. Ständig waren irgendwelche Leute wegen offener Rechnungen hinter ihm her, aber das machte ihm offenbar nicht viel aus. Er besaß ein dickes Fell und hatte sogar der Stadtverwaltung das Zugeständnis abgerungen, daß im Washington Square Park Folkkonzerte gestattet wurden. Alle waren auf seiner Seite.
Er suchte Platten für mich aus. Er gab mir eine Platte von den Country Gentlemen, damit ich mir »Girl Behind the Bar« anhören konnte. Er spielte mir »White House Blues« von Charlie Poole vor, sagte, das passe perfekt zu mir, und wies mich darauf hin, daß die Ramblers genau diese Version gespielt hatten. Er spielte mir Big Bill Broonzys Song »Somebody’s Got to Go« vor, der auch ganz nach meinem Geschmack war. Ich war gern bei Izzy. Bei ihm knisterte immer das Feuer.
An einem Wintertag betrat ein großer, stämmiger Kerl den Laden. Er sah aus, als komme er direkt aus der russischen Botschaft, schüttelte sich den Schnee von den Ärmeln, zog die Handschuhe aus, legte sie auf den Tresen und wollte eine Gibson-Gitarre sehen, die an der Wand hing. Es war Dave Van Ronk. Er war schroff, struppig und von arroganter Gleichgültigkeit – ein selbstbewußter Jäger. Meine Gedanken überstürzten sich. Jetzt stand nichts zwischen uns. Izzy nahm die Gitarre herunter und reichte sie ihm. Dave zupfte die Saiten an, spielte eine jazzige Walzermelodie und legte die Gitarre auf den Tresen zurück. In dem Moment trat ich zu ihm, griff nach der Gitarre und fragte gleichzeitig, wie man an einen Auftritt im Gaslight komme und wen man dazu kennen müsse. Ich wollte mich nicht an ihn ranmachen, ich wollte es nur wissen.
Van Ronk sah mich verwundert an und fragte mich kurz angebunden und bärbeißig, ob ich im Gaslight putzen wolle.
Ich sagte, nein, das könne er vergessen, aber ob ich ihm was vorspielen dürfe? »Klar«, sagte er.
Ich spielte »Nobody Knows You When You’re Down and Out« für ihn. Das gefiel Dave, und er fragte mich nach meinem Namen und wie lange ich schon in der Stadt sei. Dann sagte er, ich könne um acht oder neun Uhr abends kommen und bei seinem Auftritt ein paar Songs spielen. So lernte ich Dave Van Ronk kennen.
Ich verließ das Folklore Center und ging wieder hinaus in den klirrenden Frost. Gegen Abend fand ich mich in der Mills Tavern an der Bleecker Street ein, wo die Musiker aus den Basket Houses zusammenhockten, palaverten und abhingen. Mein Freund Juan Moreno, der Flamencogitarre spielte, erzählte mir von einem neuen Café namens Outré, das gerade in der 3rd Street eröffnet worden sei, aber ich hörte kaum hin. Juans Lippen bewegten sich fast lautlos. Ich würde nie im Outré spielen, denn das hatte ich nicht nötig. Bald würde ich im Gaslight anheuern und die Basket Houses nie wieder betreten. Draußen waren die Temperaturen unter zwanzig Grad minus gefallen. Mein Atem gefror in der Luft, aber ich spürte die Kälte nicht. Ich war unterwegs zu den Sternen. Kein Zweifel. Oder gab ich mich einer Illusion hin? Wohl kaum. Ich glaube nicht, daß ich genug Phantasie aufbrachte, um mir Illusionen zu machen, und ich hegte auch keine falschen Hoffnungen. Ich hatte einen weiten Weg hinter mir, und ich hatte ganz unten angefangen. Aber jetzt sollte sich mein Schicksal erfüllen. Ich spürte, wie es mir zuwinkte – mir allein.
2.The Lost Land
Ich setzte mich im Bett auf und sah mich um. Das Bett war ein Sofa im Wohnzimmer, und heißer Dampf stieg aus dem gußeisernen Heizkörper auf. Über dem Kamin starrte mich das gerahmte Porträt eines Kolonialherrn mit Perücke an, neben dem Sofa standen ein hölzernes Schränkchen auf kannelierten Beinen, ein ovaler Tisch mit abgerundeten Schubladen, ein schubkarrenartiger Sessel, ein kleiner, königsholzfurnierter Schreibtisch mit Klappfächern, eine Couch aus einem Autorücksitz mit Federkernpolsterung, ein niedriger Stuhl mit runder Lehne und volutierten Armlehnen; ein dicker französischer Teppich lag auf dem Boden. Silbernes Licht fiel durch die Jalousien, gestrichene Balken betonten die Linien des Dachstuhls.
Das Zimmer roch nach Gin Tonic, Fusel und Blumen. Die Wohnung hatte keinen Aufzug und lag im Dachgeschoß eines Gebäudes im Federal Style nahe der Vestry Street unterhalb der Canal Street, nicht weit vom Hudson River entfernt. Im gleichen Block befand sich auch das Bull’s Head, eine Kellerkneipe, wo John Wilkes Booth, der amerikanische Brutus, zu trinken pflegte. Ich war einmal dort gewesen und hatte seinen Geist im Spiegel gesehen – einen bösen Geist. Mit Ray Gooch und Chloe Kiel, die in dieser Wohnung lebten, hatte mich Paul Clayton bekannt gemacht, ein Folksänger und Freund von Van Ronk, gutmütig, einsam und melancholisch; er hatte mindestens dreißig Platten veröffentlicht, war der amerikanischen Öffentlichkeit aber unbekannt – ein Intellektueller mit enzyklopädischen Kenntnissen der Balladenkunst. Ich ging zum Fenster, sah auf die grauweißen Straßen hinaus und ließ meinen Blick zum Fluß schweifen. Die Luft war bitter kalt, das Thermometer zeigte nie über fünfzehn Grad minus, aber mein inneres Feuer ging niemals aus, wie eine Wetterfahne, die sich ständig drehte. Es war mitten am Nachmittag, und Ray und Chloe hatten beide die Wohnung verlassen.
Ray, ungefähr zehn Jahre älter als ich, kam aus Virginia und war wie ein alter Wolf, hager und narbig. Er entstammte einer langen Ahnenreihe von Bischöfen und Generälen; sogar ein Kolonialgouverneur kam darin vor. Er war ein Nonkonformist, ein Einzelgänger und ein Südstaaten-Nationalist. Chloe und er lebten in dieser Wohnung wie in einem Versteck. Ray ähnelte den Figuren in manchen meiner Songs, er hatte das Leben gesehen, sich eingemischt und Herzen gebrochen – er hatte sich umhertreiben lassen und ein umfassendes Verständnis von diesem Land und seinen Lebensbedingungen entwickelt. Obwohl sich die Umwälzungen bereits ankündigten, unter denen Amerikas Städte in wenigen Jahren erzittern sollten, interessierte sich Ray kaum dafür. »Nur im Kongo«, sagte er, sei wirklich was los.
Chloe hatte rotgoldenes Haar, braune Augen, ein rätselhaftes Lächeln, ein Gesicht wie eine Puppe und eine Figur, auf die Puppen hätten neidisch werden können. Ihre Fingernägel waren schwarzlackiert. Sie arbeitete an der Garderobe im Egyptian Gardens, einem Bauchtanzrestaurant an der 8th Avenue, und nebenbei als Model für die Zeitschrift Cavalier. »Ich hab mein Leben lang gearbeitet«, sagte sie. Ray und Chloe lebten zusammen wie Mann und Frau oder Bruder und Schwester, Cousin und Cousine, schwer zu sagen, sie wohnten dort einfach, und das war’s. Chloe hatte ihre eigene schlichte Weltsicht und redete immer verrücktes Zeug, das mir auf unerklärliche Weise einleuchtete; einmal sagte sie mir, ich solle Lidschatten tragen, das schütze vor dem bösen Blick. Vor wessen bösem Blick, fragte ich, und sie sagte: »Joe Blows oder Joe Schmoes.« Ihrer Ansicht nach regierte Dracula die Welt, und er war der Sohn von Gutenberg, dem Typen, der die Druckerpresse erfunden hatte.
Als Erbe der Kultur der vierziger und fünfziger Jahre hatte ich nichts gegen solches Gerede. Der alte Gutenberg hätte ohne weiteres aus einem alten Folksong stammen können. Die Kultur der Fünfziger war wie ein Richter, der seine letzten Tage im Gericht absitzt. Sie sollte bald abdanken und nach zehn Jahren Kampf um ihre Stellung endgültig zusammenbrechen. Dank der Folksongs, die in mein Empfinden und Denken eingebettet waren wie eine Religion, berührte mich das nicht. Folksongs führten über die Kultur der Gegenwart hinaus.
Bevor ich in eine eigene Wohnung zog, hatte ich schon fast überall im Village mal gewohnt. Manchmal nur für eine Nacht oder zwei, manchmal mehrere Wochen oder länger. Oft wohnte ich bei Van Ronk. In der Vestry Street blieb ich insgesamt wahrscheinlich länger als irgendwo sonst. Es gefiel mir bei Ray und Chloe. Ich fühlte mich wohl bei ihnen. Ray kam aus den besten Kreisen und war sogar an der Camden Military Academy in South Carolina eingeschrieben gewesen, der er »mit heftigem und ehrlichem Haß« den Rücken gekehrt hatte. Auch aus der Wake Forest Divinity School, einem religiösen College, war er »dankbar rausgeflogen«. Er konnte ganze Passagen aus Byrons Don Juan auswendig aufsagen – wie auch ein paar schöne Verse aus Longfellows Gedicht »Evangeline«. Er arbeitete in einer Werkzeugbaufirma in Brooklyn, hatte aber vorher schon dieses und jenes gemacht – er hatte im Studebaker-Werk in South Bend und auf einem Schlachthof in Omaha im Schlachtraum gearbeitet. Ich fragte ihn einmal, wie es dort gewesen sei. »Schon mal von Auschwitz gehört?« Selbstverständlich, wer hatte das nicht? Es war ein Vernichtungslager der Nazis, und Adolf Eichmann, der hauptverantwortliche SS-Offizier, der die Deportationen dorthin organisiert hatte, war vor kurzem in Jerusalem vor Gericht gestellt worden. Nach dem Krieg war er geflohen und später von den Israelis an einer Bushaltestelle in Argentinien geschnappt worden. Sein Prozeß hatte viel Aufsehen erregt. Im Zeugenstand behauptete Eichmann, er habe lediglich Befehle befolgt, aber es fiel der Anklage nicht schwer zu beweisen, daß er seine Mission mit monströsem Eifer ausgeführt hatte. Eichmann war verurteilt worden, und nun wurde über sein Schicksal entschieden. Es war viel davon die Rede, daß man ihn mit dem Leben davonkommen lassen und womöglich sogar nach Argentinien zurückschicken solle, aber das wäre schwachsinnig gewesen. Selbst in Freiheit hätte er wahrscheinlich keine Stunde überlebt. Der Staat Israel beanspruchte für sich das Recht, als Erbe und Vollstrecker derer aufzutreten, die durch die »Endlösung« umgekommen waren. Das Verfahren führte der ganzen Welt noch einmal vor Augen, warum der Staat Israel gegründet worden war.
Ich kam im Frühjahr 1941 zur Welt. In Europa wütete bereits der Zweite Weltkrieg, in den bald auch Amerika eintreten sollte. Die Welt war aus den Fugen geraten, und das Chaos schlug allen Neuankömmlingen entgegen. Wer um diese Zeit geboren wurde oder am Leben war, der konnte spüren, wie ein Zeitalter verging und ein neues anbrach. Als sei die Uhr bis zu dem Moment zurückgestellt worden, als aus v.Chr. n.Chr. wurde. Alle, die um mein Geburtsjahr herum auf die Welt kamen, gehörten beiden Zeitaltern an. Hitler, Churchill, Mussolini, Stalin, Roosevelt – hoch aufragende Gestalten, wie die Menschheit sie kein zweites Mal kennenlernen würde, Männer, die sich auf ihre eigene Entschlossenheit verließen, komme, was da wolle. Sie waren alle bereit, einsame Entscheidungen zu treffen, ob sie Zustimmung fänden oder nicht. Reichtum oder Liebe waren ihnen gleichgültig, sie bestimmten über das Schicksal der Menschheit und schlugen die Welt in Stücke. Als Nachfahren von Alexander, Julius Cäsar, Dschingis Khan, Karl dem Großen und Napoleon teilten sie die Welt unter sich auf wie einen Festtagsbraten. Ob sie Mittelscheitel trugen oder Wikingerhelm, sie setzten sich durch und ließen nicht mit sich reden – rohe Barbaren, die den Erdball überrannten und ihm ihre eigenen Vorstellungen von Geographie aufzwangen.
Mein Vater litt an den Folgen einer Kinderlähmung und wurde ausgemustert, aber meine Onkel waren alle in den Krieg gezogen und heil zurückgekehrt. Onkel Paul, Onkel Maurice, Jack, Max, Louis, Vernon und andere waren auf den Philippinen, in Anzio, Sizilien, Nordafrika, Frankreich und Belgien gewesen. Sie hatten Souvenirs mitgebracht – ein japanisches Zigarettenetui aus Stroh, einen deutschen Brotbeutel, eine britische Emailletasse, eine deutsche Staubbrille, ein britisches Kampfmesser, eine deutsche Luger – einen Haufen Ramsch. Sie kehrten ins Zivilleben zurück, als wäre nichts gewesen, und ließen nie ein Wort darüber fallen, was sie getan oder gesehen hatten.
1951 ging ich in die Grundschule. Wir lernten unter anderem, wie man unter dem Schultisch in Deckung ging, wenn die Sirene zum Luftalarm aufheulte, weil die Russen uns mit Bomben angreifen könnten. Man erzählte uns auch, die Russen könnten jederzeit über unserer Stadt Fallschirmjäger absetzen. Die gleichen Russen, an deren Seite meine Onkel nur wenige Jahre zuvor gekämpft hatten, waren jetzt zu Monstern geworden, die kommen würden, um uns die Kehle durchzuschneiden und uns zu verbrennen. Das war doch seltsam. Ein Kind, das unter einer solchen Wolke der Furcht aufwachsen muß, verliert seinen Lebensmut. Sich vor einer nicht ganz realen Bedrohung zu fürchten ist etwas anderes als Angst zu haben, weil jemand eine Schrotflinte auf einen gerichtet hält. Trotzdem gab es viele Leute, die diese Bedrohung ernst nahmen, und das färbte ab. Man konnte solchen abwegigen Phantasien leicht zum Opfer fallen. Ich hatte dieselben Lehrer wie meine Mutter. Zu deren Schulzeit waren sie jünger gewesen, zu meiner inzwischen in die Jahre gekommen. In Amerikanischer Geschichte lernten wir, daß die Kommunisten die Vereinigten Staaten nicht einfach mit Waffen oder Bomben zerstören konnten, sondern daß sie auch die Verfassung vernichten müßten, die Gründungsurkunde unseres Landes. Darauf kam es aber gar nicht an. Wenn der Probealarm ertönte, mußte man sich mit dem Gesicht nach unten unter den Tisch legen, sich totstellen, und man durfte keinen Laut von sich geben. Als ob das irgendeinen Schutz vor abgeworfenen Bomben geboten hätte. Die Drohung, daß wir vernichtet werden sollten, machte uns angst. Wir wußten nicht, womit wir diese Leute so gegen uns aufgebracht hatten. Die Roten seien überall, hörten wir, und sie lechzten nach Blut. Wo waren meine Onkel, die Landesverteidiger? Sie hatten genug mit ihrer Arbeit zu tun, kratzten Geld zusammen und streckten sich nach der Decke. Woher sollten sie wissen, was in den Schulen vor sich ging und welche Ängste dort geschürt wurden?
Das war jetzt alles vorbei. Ich lebte in New York City, Kommunisten hin oder her. Wahrscheinlich liefen sie hier rudelweise herum, genau wie die Faschisten. Massenweise linke und rechte Möchtegerndiktatoren, Radikale jeder Couleur. Es hieß, mit dem Zweiten Weltkrieg sei das Zeitalter der Aufklärung zu Ende gegangen, aber davon hatte ich nichts mitbekommen. Ich lebte immer noch mittendrin. Ich konnte mich noch einigermaßen an ihr Licht erinnern, ihr fernes Feuer spüren. Ich hatte das ganze Zeug gelesen. Voltaire, Rousseau, John Locke, Montesquieu, Martin Luther – Visionäre, Revolutionäre … sie waren wie alte Freunde, als hätten sie gleich nebenan gewohnt.
Ich ging durch das Zimmer zum Fenster mit seinen cremefarbenen Gardinen und zog die Jalousie hoch. Von hier aus konnte man die verschneiten Straßen sehen. Die Möbel waren schön, zum Teil sogar handgefertigt. Auch das war schön – Frisierkommoden mit Intarsien, stilisierten Schnitzereien und verschnörkelten Griffen, verzierte Bücherregale, die bis zur Decke reichten, ein langer, schmaler rechteckiger Tisch mit Metallelementen, deren Geometrie ihren eigenen Regeln zu folgen schien, und noch ein witziges Möbelstück, ein organisch geformter Abstelltisch, der einer großen Zehe glich. Es gab raffiniert in Schrankfächer eingelassene Kochplatten. Die kleine Küche war wie ein Wald. Küchenkräuterdosen mit Frauenminze, Waldmeister, Fliederblättern und anderem Zeugs. Chloe, ein Südstaatenmädchen mit ein paar Vorfahren aus dem Norden, wußte, wie man Wäscheleinen im Badezimmer anbringt. Manchmal sah ich eines meiner Hemden dort hängen. Meistens kam ich kurz vor dem Morgengrauen zurück und ließ mich im Wohnzimmer, das eine hohe Decke und Stützbalken hatte, aufs Ausziehsofa fallen. Oft schlief ich zu den Geräuschen des Nachtzugs ein, der sich rumpelnd und grummelnd seinen Weg durch Jersey bahnte, das eiserne Pferd mit Dampf in den Adern statt Blut.
Seit meiner frühesten Kindheit hatte ich Züge gesehen und gehört und mich bei ihrem Anblick und ihren Geräuschen immer geborgen gefühlt. Die großen Güterwaggons, die Eisenerztransporte, Passagierzüge, Schlafwagen. In meiner Heimatstadt kam man nirgendwohin, ohne ständig an Bahnübergängen darauf warten zu müssen, daß die langen Züge vorüberfuhren. Die Gleise liefen neben den Landstraßen her oder kreuzten sie. Beim Rattern ferner Züge fühlte ich mich mehr oder weniger zu Hause, als ob es mir an nichts mangele, als ob ich auf der sicheren Seite sei, wo mir keine besondere Gefahr drohte und sich alles ineinanderfügte.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand eine Kirche mit Glockenturm. Auch das Läuten der Glocken vermittelte mir ein Gefühl der Geborgenheit. Ich hatte ihnen schon immer gern gelauscht. Eisernen Glocken, Messingglocken, Silberglocken – die Glocken sangen. Zum Sonntagsgottesdienst, an Feiertagen. Sie erklangen, wenn jemand Wichtiges starb und wenn geheiratet wurde. Bei allen besonderen Anlässen läuteten die Glocken. Es war ein schönes Gefühl, sie zu hören. Ich mochte sogar Türglocken und die NBC-Glockenmelodie im Radio. Ich sah durch das Bleiglasfenster zur Kirche hinüber. Jetzt schwiegen die Glocken, und von den Dächern stob Schnee. Ein Blizzard hatte die Stadt im Griff, das Leben drehte sich träge im Kreis. Eisige Kälte.
Auf der anderen Straßenseite kratzte ein Mann in einer Lederjacke den Reif von der Windschutzscheibe eines schneebedeckten schwarzen Mercury Montclair. Hinter ihm lief ein Priester in einem purpurnen Gewand über den Hof der Kirche und durch ein offenes Tor, unterwegs zu irgendeiner heiligen Pflicht. Ein Stück weiter schleppte sich eine barhäuptige Frau in Stiefeln mit einem Wäschesack ab. Eine Million Geschichten gingen vor sich, alltägliche New Yorker Angelegenheiten, falls man den Blick auf sie richten wollte. Man hatte das ganze Durcheinander immer unmittelbar vor Augen, und wenn man irgend etwas davon begreifen wollte, mußte man es erst zerlegen. Valentinstag, der Tag der Liebenden, war gekommen und gegangen, ohne daß ich es bemerkt hatte. Mir blieb keine Zeit für Romanzen. Ich wandte mich vom Fenster und der Wintersonne ab, ging zum Herd und machte mir eine Tasse heiße Schokolade, und dann stellte ich das Radio an.
Im Radio war ich immer auf der Suche. Wie Züge und Glocken gehörte auch das Radio zum Soundtrack meines Lebens. Ich drehte den Regler auf auf und ab, und Roy Orbisons Stimme schmetterte aus den kleinen Lautsprechern. Sein neuer Song »Running Scared« brachte die Wände zum Wackeln. In letzter Zeit hatte ich nach Songs mit Folkanklängen gesucht. Es hatte schon einige gegeben: »Big Bad John«, »Michael Row the Boat Ashore«, »A Hundred Pounds of Clay«. Brook Benton hatte »Boll Weevil« zum modernen Hit gemacht. Auch das Kingston Trio und Brothers Four wurden im Radio gespielt. Ich mochte das Kingston Trio. Obwohl ihr Stil geschniegelt und eher was für Collegestudenten war, gefielen mir die meisten ihrer Stücke. Songs wie »Getaway John«, »Remember the Alamo« oder »Long Black Rifle«. Immer wieder gelang einem Song mit Folkeinschlag der Durchbruch. Selbst »Endless Sleep«, das Lied von Jodie Reynolds, mit dem sie vor Jahren Erfolg gehabt hatte, war auf seine Weise eine Art Folk gewesen. Orbison aber hatte alle Genres transzendiert … Folk, Country, Rock’n’Roll, einfach alles. In seinen Stücken vermischten sich sämtliche Stile, sogar einige, die noch gar nicht erfunden waren. Er konnte im einen Moment fies und gemein klingen und im nächsten mit einer Falsettstimme wie Frankie Valli singen. Bei Roy wußte man nie, ob man gerade Mariachi oder Oper hörte. Er hielt einen immer in Atem. Bei ihm ging’s immer ums Ganze. Er hörte sich an wie jemand, der von einem olympischen Gipfel herab singt, und es war ihm ernst. Mit einem seiner frühen Songs, »Ooby Dooby«, hatte er einen Hit gelandet, aber der neue Song war vollkommen anders. »Ooby Dooby« war von trügerischer Schlichtheit gewesen, aber Roy hatte sich weiterentwickelt. Er sang seine Kompositionen jetzt über drei oder vier Oktaven, so daß man sich mit dem Auto von der nächsten Klippe stürzen wollte. Er sang wie ein Berufsverbrecher. Gewöhnlich fing er auf einer tiefen, kaum vernehmbaren Ebene an und hielt sich dort eine Weile, und dann steigerte er sich auf einmal in eine überraschende Theatralik. Seine Stimme konnte Tote zum Leben erwecken und entlockte einem unwillkürlich ein gemurmeltes »Mann, ich glaub’s nicht« oder etwas in der Art. Seine Songs enthielten Songs in Songs. Sie sprangen ohne jede Logik von Dur nach Moll. Orbison meinte es todernst – er war kein Gimpel und kein Grünschnabel. Es gab niemand im Radio, der sich mit ihm hätte messen können. Ich wartete auf mehr, aber neben Roy war alles, was sonst noch lief, öder Schrott … feige und schlapp. Das war alles was für Gehirnamputierte. Vielleicht mit Ausnahme von George Jones vielleicht mochte ich auch keine Countrymusik. Bei Jim Reeves und Eddy Arnold war ohnehin schwer zu verstehen, was daran Country sein sollte. Die Countrymusik hatte ihre ganze Wildheit und Verrücktheit eingebüßt. Auch Elvis Presley hörte keiner mehr. Es war Jahre her, daß er mit den Hüften gewackelt und Songs wie Raketen in den Himmel hatte steigen lassen. Ich machte trotzdem immer wieder das Radio an, wahrscheinlich vor allem aus gedankenloser Gewohnheit. Leider beschäftigte sich das ganze Programm nur mit Zuckerwasser und nicht mit den eigentlichen Jekyll-und-Hyde-Themen der Zeit. Den von der Straße geprägten Geist von Kerouacs Unterwegs, Ginsbergs Geheul und Gregory Corsos Gasoline, der eine neue Lebensweise verhieß, gab es hier nicht, aber was hätte man auch anderes erwarten sollen? Für so etwas war auf Singles kein Platz.
Ich dachte ständig über eine eigene Platte nach, aber ich hätte keine Singles aufnehmen wollen, keine 45er, keine Songs von der Sorte, die im Radio lief. Folksänger, Jazzkünstler und klassische Musiker nahmen LPs auf, Langspielplatten voller Songs in den Rillen – mit LPs konnte man sich eine neue Identität zulegen; sie brachten mehr auf die Waage und zeigten einen größeren Ausschnitt von der Welt. LPs waren wie die Schwerkraft. Sie hatten ein Cover mit einer Vorder- und einer Rückseite, die man stundenlang betrachten konnte. Im Vergleich dazu waren 45