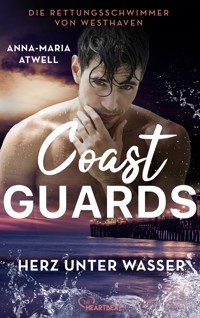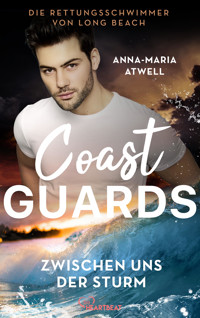
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rettungsschwimmer von Westhaven
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Es gibt kaum einen Ort, an dem sich Rettungsschwimmerin Callie so wohl fühlt wie auf dem Meer. Doch aufgrund eines Unfalls muss sie die Coast Guard in Long Beach verlassen. Zwei Jahre später wagt sie einen Neustart bei der Küstenwache in L.A. und rettet zwei reiche Unternehmersöhne von ihrer in Seenot geratenen Yacht. Sofort funkt es zwischen ihr und Julien, dem jüngeren der Brüder. Aber dann findet Callie heraus, dass Julien ausgerechnet der Sohn des Mannes ist, mit dem ihre Familie seit Jahren verfeindet ist - und gegen den die Coast Guard wegen Drogenschmuggels ermittelt. Callie hat lange auf die Chance gewartet, in den aktiven Dienst bei der Coast Guard zurückzukehren und sich zu beweisen. Sie kann sich keine Fehltritte erlauben. Und sie darf Julien auf keinen Fall wiedersehen ...
Der zweite Band der gefühlvollen und dramatischen Reihe um die Rettungsschwimmer von Westhaven.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1: Callie
Kapitel 2: Callie
Kapitel 3: Julien
Kapitel 4: Callie
Kapitel 5: Julien
Kapitel 6: Callie
Kapitel 7: Julien
Kapitel 8: Callie
Kapitel 9: Julien
Kapitel 10: Callie
Kapitel 11: Julien
Kapitel 12: Callie
Kapitel 13: Julien
Kapitel 14: Callie
Kapitel 15: Julien
Kapitel 16: Callie
Kapitel 17: Julien
Kapitel 18: Callie
Kapitel 19: Julien
Kapitel 20: Callie
Kapitel 21: Julien
Kapitel 22: Callie
Kapitel 23: Julien
Kapitel 24: Callie
Kapitel 25: Callie
Kapitel 26: Julien
Kapitel 27: Callie
Kapitel 28: Callie
Kapitel 29: Julien
Kapitel 30: Callie
Kapitel 31: Julien
Kapitel 32: Julien
Kapitel 33: Callie
Kapitel 34: Julien
Kapitel 35: Callie
Kapitel 36: Julien
Kapitel 37: Julien
Kapitel 38: Callie
Kapitel 39: Callie
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Es gibt kaum einen Ort, an dem sich Rettungsschwimmerin Callie so wohlfühlt wie auf dem Meer. Doch aufgrund eines Unfalls muss sie die Coast Guard in Long Beach verlassen. Zwei Jahre später wagt sie einen Neustart bei der Küstenwache in L. A. und rettet zwei reiche Unternehmersöhne von ihrer in Seenot geratenen Jacht. Sofort funkt es zwischen ihr und Julien, dem jüngeren der Brüder. Aber dann findet Callie heraus, dass Julien ausgerechnet der Sohn des Mannes ist, mit dem ihre Familie seit Jahren verfeindet ist – und gegen den die Coast Guard wegen Drogenschmuggels ermittelt. Callie hat lange auf die Chance gewartet, in den aktiven Dienst bei der Coast Guard zurückzukehren und sich zu beweisen. Sie kann sich keine Fehltritte erlauben. Und sie darf Julien auf keinen Fall wiedersehen ...
Der zweite Band der gefühlvollen und dramatischen Reihe um die Rettungsschwimmer von Westhaven.
Anna-Maria Atwell
Coast Guards – Zwischen uns der Sturm
Roman
Kapitel 1: Callie
Mayday.
Wir sinken.
Die Nacht war tiefschwarz, der Himmel von Wolken bedeckt.
Unter uns glitt das Licht der Suchscheinwerfer über die aufgewühlte Wasseroberfläche, während der Wind den Hubschrauber hin und her warf.
»Fünfundzwanzig Fuß sind die Wellen hoch«, sagte Jeff vom Sitz des Co-Piloten aus. Ich verstand ihn kaum über das Rattern der Rotoren hinweg. »Das wird nicht einfach. Das gefällt mir nicht.«
»Wenn wir die Leute nicht evakuieren, sterben sie.«
Er brummte. »Eines Tages wird deine Todessehnsucht erfüllt werden, Vasquez.« Das sagte Mom auch immer. Wir können niemanden retten, Calista, nur uns selbst. Dann trat jedes Mal dieser unversöhnliche Ausdruck in ihre Augen, der mir das Gefühl gab, ganz weit weg von ihr zu sein.
»Unregelmäßiger Funkkontakt«, meldete Jeff, während Finlay den Hubschrauber tiefer sinken ließ und die Scheinwerfer neu ausrichtete. »Jesus Maria. Wir haben fast zehn Knoten Windgeschwindigkeit.«
»Ich werde runtergehen«, sagte ich.
Jeff drehte sich zu mir, wobei er sich fast in seinem Headset verhedderte. »Die Lage ist zu unübersichtlich. Das ist dumm.«
»Habe ich je behauptet, dass ich schlau bin?«
Erneut versuchte Jeff, das Schiff anzufunken. Wieder erhielt er nur unzusammenhängendes Nuscheln zur Antwort. Über das Knacken hinweg verstand man kaum etwas. »Helicopter Jerry für Glory Patricia, kommen. Wie viele Personen sind an Bord?«
Ein Knacken, einmal mehr dieses Nuscheln.
»Coast Guard Helicopter Jerry für Glory Patricia, kommen. Wie viele Personen haben Sie an Bord? Gibt es Verletzte?«, fragte Jeff.
»Wir sinken.«
»Ja, verdammt, das haben wir verstanden! Wie viele Personen haben Sie an Bord?«
Mein Herz wummerte mit jeder Sekunde lauter. Egal, was geschieht, ich gehe da runter.
Aus dem Funkgerät ertönte ein weiteres Knacken. »Operations Duty Officer Clarke für USCG Helicopter Jerry, ihr müsst nach Süden drehen. Die Strömung treibt die Glory Patricia nach Südosten.«
»Verstanden«, antwortete Jeff.
»Und ich soll euch liebe Grüße von Pat bestellen. Wenn ihr da fertig seid, gibt es gebratene Nudeln vom Asia Palace. Easton Montgomery gibt zum Einstand einen aus. Juchhu!«
Jeff fluchte. »Ordnung im Funkverkehr, meine Fresse noch mal. Keine Privatgespräche. Warst du während deiner Funkausbildung die ganze Zeit Kaffee holen?«
»Das macht einen Dollar für den Fluch-Fisch«, sagte Clarke. »Damit bist du bei siebzehn diese Woche und hast Vasquez knapp überholt.«
Trotz meiner Nervosität grinste ich. Ein weiterer Operationsadministrator mischte sich ein und forderte mit genervter Stimme die Einhaltung der Funkdisziplin.
Jeff gab die neuen Koordinaten ins Navigationssystem ein, und Finlay lenkte den Hubschrauber nach Süden. Immer wieder trafen uns Windböen aus Südwest, rüttelten an der Maschine. Ich rieb mir mit beiden Händen über die Knie und versuchte, mich zu fokussieren.
In diesem Augenblick erhellte ein Blitz die Nacht und die tiefschwarzen Wellen unter uns. Und kurz glaubte ich, in der Ferne die Küste zu sehen. Ein Licht auf einer Anhöhe ... Dann war es wieder dunkel. Für den Bruchteil einer Sekunde streifte mich etwas. Der Geruch von Lilien, Sonnenlicht auf meiner Haut ... irgendwo das Platschen von Wasser und Moms Stimme, leise und doch ganz nah ...
Der Donner krachte, diesmal direkt über uns, und eine Windböe hob den Helikopter an wie eine unsichtbare Hand. Hastig schüttelte ich den Kopf, um die eigenartigen Bilder loszuwerden. Konzentrier dich, Callie.
»Da sind sie!«
In dem Moment sah ich es auch. Die Lichter inmitten der aufgewühlten See. Trotz der Dunkelheit erkannte ich, dass die Glory Patricia zu tief in den Wellen lag, sich gefährlich zur Seite neigte. Wasser hatte das Deck überspült.
In dieser Sekunde rauschte es aus dem Funkgerät. »Hola? Ayuda. Ayuda por favor ...« Es war eine andere Stimme als zuvor, die da um Hilfe rief.
Jeff fluchte erneut. »Ich spreche kein Spanisch, das ist doch ...«
»Gib mir das Funkgerät«, sagte ich.
Grummelnd tat er, wie geheißen.
»Hola? Wie ist die Lage bei Ihnen?«, fragte ich auf Spanisch.
Es rauschte so sehr, dass ich ihn kaum verstehen konnte. »Ayuda ... Por favor, überall ist Wasser!«
»Wie viele Personen sind an Bord?«
»Äh ... alles legal. Wir haben ... alles ... alles legal.« Ich runzelte die Stirn. Ja, sicher. Wieder ein Krachen im Hintergrund. Dann knackte es, und der Funkkontakt brach zusammen.
Wir versuchten, das Schiff erneut anzufunken – aber nichts geschah. Von der Glory Patricia kam kein weiteres Signal.
»Scheiße verdammt«, murmelte ich und tauschte einen Blick mit Connor, der soeben den Seilzug kontrollierte. Seit er die Crew als Flugmechaniker verstärkte, hatte ich ihn nie mehr als einen Satz auf einmal sagen hören. Auch jetzt zog er nur einen Mundwinkel hoch, als wollte er sagen: »Wird schon schiefgehen.«
»Zwei Dollar, Vasquez«, erwiderte Jeff. »Damit liegst du wieder in Führung.«
Ich winkte ab. Währenddessen ließ Finlay den Heli langsam tiefer sinken. Mit jedem Meter rüttelte der Sturm stärker an der Maschine.
Als Finlay den Hubschrauber über der Glory Patricia in Position brachte, zog ich mir meine Neoprenhaube und dann den Helm über den Kopf, legte Handschuhe an, ließ mich von Conor einklinken. »Mach die Trage bereit«, sagte ich. »Ich verschaffe mir erst einen Überblick über die Lage ... aber da unten sind vielleicht Verletzte.«
Er nickte, rüttelte noch einmal an den Karabinern, dann an dem Funkgerät, das an meiner Weste befestigt war, nickte mir zu.
»Du gehst kein Risiko ein!«, rief Jeff mir zu, als sich die Luke öffnete. Kalter Wind und Gischt schlugen mir entgegen, der Lärm der Rotoren wurde ohrenbetäubend. »Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, gibst du Bescheid und kommst wieder hoch. Keine Experimente!«
Äußerlich vollkommen ruhig ließ ich mich am Rand der Luke auf den Hintern sinken, sodass meine Beine in der Luft hingen. Das Licht der Scheinwerfer zuckte über die Glory Patricia und die finsteren Wellenberge, die das Schiff im Sekundentakt überspülten.
Es dauerte quälend lange, bis Finlay den Helikopter über dem Kutter stabilisiert hatte. Mein Atem ging mit jeder Sekunde schneller.
»Springer bereit?«, rief Finlay.
Conor blickte zu mir, und ich zeigte ihm den erhobenen Daumen.
Dann kam der Befehl zum Abseilen ... und eine Sekunde später war ich in der Luft. Der Sturm brüllte mir entgegen, raubte mir kurz den Atem. Obwohl es am Abend noch sommerlich warm gewesen war, war die Luft jetzt eisig. Ebenso wie das Wasser, das mein Gesicht benetzte.
Dann setzte ich einen Fuß auf das überschwemmte Deck. Ich klinkte mich aus und sah mich um. Die Glory Patricia schwankte und ächzte unter meinen Füßen. Das Deck war menschenleer. Immer wieder trafen mich starke Windböen. Das Licht kam von einem Scheinwerfer, der über einer Metallluke angebracht war.
Im Wind schwankend lief ich dorthin. Mit einem Ruck entriegelte ich die Luke und zog sie auf. Angespannt spähte ich in die Dunkelheit dahinter. »Hallo? Ist da irgendjemand? USCG!« Keine Reaktion. Ich rief noch einmal, wartete ... aber wieder geschah nichts.
Ein Schwall Wasser traf mich. Fluchend trat ich durch die Luke. Der Wind schlug sie hinter mir zu. Mit klopfendem Herzen schaltete ich meine Stirnlampe ein und blinzelte in die Dunkelheit. Ein Haufen Seile auf dem nassen Boden, angelaufene Metallkisten ... zu meinen Füßen lag ein feuchtes Stück Papier. Darauf war ein eigenartiges blaues Logo aufgemalt. War das eine nach oben zeigende Mondsichel? Ich hob das Papier auf, aber es zerfiel schon zwischen meinen Fingern. Den feuchten Klumpen warf ich weg.
Aus dem Funkgerät erklang ein Knacken, gefolgt von Jeffs Stimme: »Mach hin, Vasquez! Das Ding legt sich immer weiter auf die Seite und ...!«
Den Rest seiner Worte hörte ich nicht. Eine Gestalt tauchte vor mir auf – ein junger Mann. Er hob die Hände und redete auf Spanisch auf mich ein. »Wir haben nichts Illegales gemacht. Alles legal. Das Schiff geht unter. Das Schiff geht unter!«
Schnell unterbrach ich seinen Redeschwall. »Wie viele Leute sind an Bord?«
Er jammerte weiter.
Hinter ihm entdeckte ich eine grüne Metalltreppe, die ein Stück nach unten führte.
Ohne weiter auf sein Lamentieren zu achten, schob ich den jungen Mann beiseite, spähte die Stufen hinab – und erstarrte. Da lagen dicke schwarze Päckchen auf dem Boden ... und auf einem rosafarbenen Schlafsack saßen zwei Jungen, die nicht älter als dreizehn sein konnten. Beide schauten mich aus großen Augen an. Scheiße. Sofort betätigte ich den Sprechknopf an meinem Funkgerät. »ATS Calista Vasquez für Coast Guard Helicopter Jerry. Das hier ist ein Schmugglerboot. Und es sind zwei Kinder an Bord.«
»Verstanden. Wir fordern Verstärkung an.«
Ein weiteres Krachen erschütterte das Schiff. Ich stolperte, prallte mit der Schulter gegen die Wand. Einer der Jungen gab ein Wimmern von sich. Irgendwo aus dem Inneren des Schiffes erklang ein metallisches Knarzen.
Das Funkgerät an meiner Weste knackte erneut. »Vasquez, zieh dich zurück. Das Ding sinkt in dieser Sekunde!«
Ich wandte mich an die Kinder. »Bleibt ruhig, ja? Mein Name ist Callie, ich bin von der U.S. Coast Guard. Ihr ...«
Ein tiefes Knarren erklang, und die Glory Patricia legte sich noch stärker auf die Seite. Ein Schwall Wasser floss über die Treppe.
»Kommt her!« Ich winkte die Jungen zu mir. Erst, als ich meine Worte wiederholte, kam Bewegung in die beiden.
Auf einmal stieg mir ein eigenartiger Geruch in die Nase. Riecht es hier unten verschmort?
Die nächste Erschütterung warf mich beinahe von den Füßen. Schnell nahm ich die Jungen bei der Hand, polterte die Treppe hinauf und drängelte den jungen Mann beiseite, der versuchte, uns aufzuhalten.
Dabei redete er unablässig. »Ich kann doch gar kein Schiff steuern. Ich hab denen gesagt, trinkt nicht so viel. Ich sagte, das ist nicht legal, scheiß auf das Geld. Bitte glauben Sie mir ...«
Ich stieß die Luke auf.
Brüllender Wind schlug mir entgegen. Nur ein Stück noch. Wenigstens die Kinder kann ich hier wegbringen. Wenigstens ...
Die Explosion hörte ich nicht.
Doch auf einmal war die Dunkelheit in flammenden Schein getaucht.
Da waren nur noch Feuer, Metallteile, die durch die Luft flogen, und dahinter nichts als Schwärze.
Die Wucht der Explosion warf mich gegen die Reling ... und die Welt verschwand.
Als ich die Augen aufschlug, war es still um mich herum. Wobei ... Nein, da war ein Plätschern. Ein ganz leises Plätschern.
Und es war hell. Fahles Licht fiel auf mich herab, stach mir in die Augen. Angestrengt blinzelte ich. Was war geschehen?
Da waren nur wirre Bilder in meinem Kopf. Sich türmende, schwarze Wellen, das Licht eines Scheinwerfers ... Mom, die mir über die Wange streichelte. Komm, Calista, wir gehen.
Wasser leckte an meinem Gesicht.
Mit einem Stöhnen schloss ich die Augen.
Als ich sie wieder öffnete, war da immer noch Wasser um mich herum.
Aber auch etwas Festes, unter mir. Sand?
Träge blickte ich mich um. Da drüben war die Küste – verschwommen und dunkel am Horizont. Und um mich herum war Wasser, viel Wasser, in dem sich die Morgensonne fing. Ich kniff die Augen zusammen. Eine Sandbank. Offenbar war ich auf eine Sandbank gespült worden. Als ich mir über die Lippen leckte, waren sie rissig vom Salz. Mein Magen hob sich, und ich drehte mich auf die Seite, um das Meerwasser zu erbrechen.
Dann blickte ich mich erneut um. Da lag noch etwas anderes auf der Sandbank, nicht weit von mir entfernt. Ein regloses Bündel, halb eingewickelt in einen durchnässten, rosafarbenen Schlafsack. Daneben entdeckte ich ein glänzendes schwarzes Päckchen. Ich blinzelte, aber der Schleier vor meinen Augen wollte nicht verschwinden. Ich muss aufstehen. Mit einem leisen Stöhnen stemmte ich mich auf die Knie.
Doch sofort sackte mein rechtes Bein unter mir weg. Erneut versuchte ich, mich aufzurappeln. Es gelang mir nicht. Mit hämmerndem Herzen blickte ich an mir hinunter. Mein rechtes Bein stand in einem merkwürdigen Winkel von meinem Körper ab. Ich versuchte, meine Zehen zu bewegen, aber ich spürte sie nicht. Übelkeit stieg in mir hoch. Aber es tut doch gar nicht weh.
Als ich mir das Wasser aus den Augen wischte und auf meine blasse Hand hinabsah, erkannte ich, dass es gar kein Wasser war. Jetzt dröhnte mein eigener Pulsschlag so laut in meinen Ohren, dass ich das Plätschern der Wellen nicht mehr hören konnte. Zugleich verstärkte sich das Gefühl, irgendwie losgelöst zu sein. Weit weg, als wäre mein Schädel mit Helium gefüllt.
Zitternd kroch ich zu dem Bündel, das nur wenige Schritte von mir entfernt im Sand lag, umspült von sanften Wellen. Ich zog den Schlafsack weg und drehte es auf die Seite.
Dann begann ich zu schreien.
Kapitel 2: Callie
Zwei Jahre später
Kurbelgehäuse, Kurbeltrieb, Zylinderkopf.
Drei.
Ich fing noch einmal an. Kurbelgehäuse. Kurbeltrieb, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Kolben.
Fünf! Immerhin.
Die Bezeichnungen der übrigen Bestandteile des Motors wollten mir allerdings nicht einfallen. Dabei kannte ich sie doch.
Nur wenige, flammende Sonnenstrahlen durchbrachen noch die Wolkendecke, die über dem Pazifik hing. Sie fielen auf das blau lackierte Motorboot und den Steg, an dem es vertäut lag. Beide hatten definitiv schon bessere Tage gesehen. »Dritter Versuch.« Entschlossen ließ ich den Motor ins Wasser und zog an der Leine des Außenbordmotors. Der Motor knatterte, ich hielt den Atem an.
Dann erstarb er.
Mir entwich ein Seufzen.
Es war Dads Idee gewesen, meinen Verstand zu trainieren, indem ich an seinem kaputten Boot herumwerkelte. »Eigentlich gehört der alte Kahn längst auf den Schrott«, hatte er gesagt. »Vor deiner Geburt hat deine Mutter ja manchmal mit mir Ausfahrten unternommen, aber später dann ... Na ja, ich sah jedenfalls keinen Grund, es zu reparieren, als der Motor mich im Stich ließ. Aber beim Rehabilitationsprogramm hat man dir doch regelmäßige Gedächtnistrainings verordnet. Dann ist das hier doch perfekt für dich! Du kannst versuchen, den Motor auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen. Wer weiß, vielleicht findest du ja sogar den Grund, wieso es nicht mehr funktioniert.«
Und ich hatte den Fehler tatsächlich entdeckt. Die Kolbenringe waren defekt gewesen. In den vergangenen Monaten hatte ich den Motor Stück für Stück auseinandergenommen, jedes Bauteil überprüft und gesäubert, und schließlich einen neuen Kolben in den Zylinder eingesetzt. Eigentlich sollte es jetzt klappen. Wieso funktionierte es also nicht?
Ein weiteres Mal versuchte ich, den Motor zu starten. Wieder röhrte er, begann, lebendig zu werden – und verstummte.
So ein Mist!
Nach kurzem Nachdenken griff ich nach der dunklen Sporttasche zu meinen Füßen und wühlte darin herum, bis ich das Bremsspray fand. Etwas fester als nötig schüttelte ich die Dose, bevor ich in die Luftöffnungen des Motors sprühte. Dann zog ich ein drittes Mal an der Leine. Die Maschine gab ein Gluckern von sich, und dann ein lautes Röhren, bei dem ich das Gesicht verzog. Doch sie stellte die Arbeit nicht sofort wieder ein.
Mein Herz machte einen kleinen Satz. Hatte ich es wirklich geschafft?
Obwohl es hinter meinen Schläfen ein wenig pochte, machte ich die Leinen los und steuerte das Boot vorsichtig aus dem Hafen. Vorbei an den im Dämmerlicht liegenden Stegen, den Segelbooten, die am nächsten Tag schon wieder ablegen würden.
Oft fuhren in der Ferne die beeindruckenden Luxusschiffe, die Jachten, Kreuzfahrtschiffe und Party-Boote, wenn ich an Dads altem Kahn werkelte. Aber heute waren da nur die winzigen Lichter von Los Angeles in der Ferne, die Strände, an denen es tagsüber von Surfern wimmelte und die sich jetzt allmählich leerten, die im Wind wogenden Palmen unter dem dunkler werdenden Himmel. Ein anderes Schiff war nicht zu sehen.
Als ich den Hafen hinter mir ließ, holte ich die Fender ein und warf einen Blick auf den Motor. Auch jetzt gab er ein Gluckern von sich, das mich nicht allzu optimistisch stimmte. Vermutlich wäre es klüger, wieder in den Hafen zu fahren. Andererseits jedoch ... Wenigstens ein Mal könnte ich beschleunigen und schauen, ob der Motor durchhielt. Wenn er mich im Stich ließ, blieb mir ja immer noch das Paddel. Das ist sicher eine dumme Idee.
Kurz entschlossen drückte ich den Steuerhebel nach vorn. Salziger Wind peitschte mir ins Gesicht, als die Irina über das Wasser glitt. Mit jeder Sekunde schienen die Wellen höher zu werden und der Himmel dunkler. Und auch die Böen, die mir entgegenschlugen, gewannen an Kraft.
Sonnenuntergang um acht.
Dauer eines Tages: dreizehn Stunden.
Das Pochen hinter meinen Schläfen wurde stärker.
Punkt acht Uhr ... So spät war es gewesen, als ich vor einigen Monaten an Kommandant Montgomerys Tür geklopft hatte. Die Sonne war gerade untergegangen.
»Es ist schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Vasquez«, hatte er gesagt.
»Danke, Sir.«
Genau zwei Sekunden lang hatte ich auf ein Wunder gehofft – genau zwei Sekunden, bevor er wieder zu sprechen angesetzt hatte.
»Es tut mir leid ... Sie wissen, ich habe das nicht entschieden. Sie wurden als nicht tauglich für eine Wiederaufnahme des Dienstes in einem unserer Helicopter Rescue Teams eingestuft.«
»Die Ärzte haben gesagt, ich würde vielleicht nie wieder laufen. Jetzt sehen Sie mich an. Alles, was ich brauche, ist Zeit ...«
Ein Donnergrollen riss mich zurück ins Jetzt. Regentropfen fielen auf mein erhitztes Gesicht. Vor mir türmte sich eine finstere Wolkenwand. Zurück, dachte ich. Zurück mit den Erinnerungen, zurück nach Hause.
Und dann sah ich es:
Das Licht auf dem Wasser. Ein Scheinwerfer? Mein Puls beschleunigte sich. Der Lichtschein verschwand nicht. War es Einbildung? Ich blinzelte. Nein. Es war wirklich dort.
Der Wind nahm weiter Fahrt auf. Regentropfen fielen auf mich herab, und ich rieb mir die Arme. Es dauerte nicht lange, bis mein T-Shirt und meine löchrigen Jeansshorts durchnässt waren. Das Licht leuchtete noch immer, dort auf dem offenen Pazifik. Es war zu weit weg, um zu erkennen, wozu es gehörte. Vielleicht war es ein Schiff. Aber wieso bewegt es sich nicht von der Stelle?
Nach kurzem Zögern drückte ich den Steuerhebel nach vorn. Der Motor röhrte, und das Boot nahm Fahrt auf. Schon bald regnete es in Strömen, und ich musste die Augen verengen, um überhaupt noch etwas zu sehen. Das Licht war weiter entfernt, als ich zunächst vermutet hatte. Die Wellen türmten sich höher. Gischt spritzte auf, und Wasser schwappte ins Boot, während der Himmel über mir immer finsterer wurde, die Wolken immer näher zu kommen schienen. Während der Donner lauter grollte, ganz nah jetzt. Ich fuhr direkt ins Unwetter hinein. Scheiße.
Endlich schälten sich die Umrisse einer kleinen Jacht vor mir aus dem strömenden Regen. Das Schiff schaukelte hin und her wie ein Spielzeugboot. Das Licht, das ich gesehen hatte, gehörte tatsächlich zu einem Scheinwerfer. Ansonsten jedoch war alles finster. Vorsichtig lenkte ich die Irina näher heran.
Als ich die Jacht erreicht hatte, drosselte ich den Motor, kramte eine Taschenlampe aus der durchnässten Sporttasche und schaltete sie ein. Der Lichtstrahl traf auf eine glänzend schwarze Bordwand, verdunkelte Fenster ... Es war, als wäre ein Raumschiff auf dem Pazifik gelandet. So eine Jacht hatte ich bisher nur einmal gesehen, im Internet.
Ein Schwarzer Schwan.
»Hallo! Brauchen Sie Hilfe?« Der Wind riss mir die Worte von den Lippen, und ich rief noch einmal, lauter. »He! Sie müssen Ihr Schiff in einen Hafen bringen!« Auch dieses Mal erhielt ich keine Antwort. Hastig tastete ich nach meinem Handy. Nicht in meiner Hosentasche. Auch in der Sporttasche fand ich es nicht. Hatte ich es etwa in der Wohnung liegen gelassen?
Mit einem Fluch legte ich die Taschenlampe auf der Steuerbank ab und suchte nach einer Stelle, an der ich andocken konnte. Da, eine glänzende Metallstrebe an der Bordwand der Jacht. Dorthin lenkte ich das Boot. Drei Anläufe brauchte ich, um die Irina und das Raumschiff-Boot miteinander zu vertäuen. Als ich es geschafft hatte, waren meine Finger nass und eiskalt. Kurz entschlossen nahm ich die Taschenlampe zwischen die Zähne und kletterte umständlich über die Reling auf die fremde Jacht.
Als ich über die Metallstrebe stieg, rutschte ich aus. Ein stechender Schmerz fuhr durch mein Bein, ich keuchte. Die Taschenlampe rutschte mir aus den Zähnen, prallte von der Bordwand ab und platschte ins Wasser. In der gleichen Sekunde erlosch der Scheinwerfer.
Na toll.
»Hallo?«, rief ich gegen den Wind. »Ist da jemand?«
Niemand antwortete. Die Wellen und der Wind tosten so laut um mich herum, dass mich vermutlich ohnehin niemand hören konnte. Mit dem Handrücken wischte ich mir Regenwasser und salzige Gischt aus den Augen. Auf einem Tisch glänzten die Umrisse leerer Gläser. Feuchte Sitzbänke, umgekippte Sonnenliegen ... War das ein Whirlpool?
Langsam schob ich mich über das schaukelnde Deck, vorbei am Achtercockpit, auf der Suche nach irgendetwas ... irgendjemandem.
Auch am Heck des Schiffes brannte Licht. Eine flackernde Lampe beschien einen weiteren Pool, Sonnenliegen, eine schwarz glänzende Badeplattform und ...
Schritte erklangen hinter mir. Ich fuhr zusammen, drehte mich um – und schaute in das Gesicht eines Mannes. Dunkle Augen, verhärteter Kiefer ... Ein Blitz zuckte über den Himmel, ich stolperte zurück. Im gleichen Augenblick packte er mich am Arm und zog mich mit einem Ruck zu sich. So nah, dass ich den Alkohol in seinem Atem riechen konnte.
»Wer sind Sie?«
Mit aller Kraft versuchte ich, ihn abzuschütteln. Vergeblich. Sein Griff wurde nur fester. »Lassen Sie mich los!«
»Ben.« Eine weitere Stimme erklang – und hinter dem Kerl, der mich am Arm gepackt hielt, tauchte noch jemand auf. Ein zweiter Mann.
Als das Licht auf sein Gesicht fiel, atmete ich stockend ein. Er sah aus wie der Kerl, der mich festhielt. Beinahe jedenfalls. Seine Augen waren heller. Seine Miene freundlicher. Wenigstens ein bisschen. »Lass sie los«, sagte er.
Der andere zögerte. Dann brummte er und löste die Hand um meinen Arm.
Ein Donnerschlag krachte über uns, und ich wandte mich an den zweiten Mann – den mit den hellen Augen, der mich immer noch ansah. »Sie sollten Ihr Schiff an Land bringen. Haben Sie nicht bemerkt, dass Sie in einen Sturm geraten sind?«
»Wie sind Sie hierhergekommen?«, fragte der Mann, der offenbar Ben hieß. »Ein blinder Passagier? Dann haben Sie sich den falschen Tag ausgesucht, um sich an Bord zu schleichen.«
Ja, offensichtlich. Allerdings gäbe es wohl überhaupt keinen richtigen Tag, um mich in Gegenwart dieses Mannes aufzuhalten.
Gerade wollte ich erklären, dass ich das wie führerlos treibende Schiff gesehen und beschlossen hatte, nachzusehen, ob seine Besatzung Hilfe benötigte. Und dass ich das inzwischen bereute. Da traf eine Welle die Jacht, und ich verlor das Gleichgewicht. Im letzten Moment hielt ich mich an einer der Metallstreben fest, die das Deck umfassten.
Der Mann mit den hellen Augen taumelte zu mir und streckte eine Hand nach mir aus. Sofort warf ich ihm einen warnenden Blick zu. Er ließ den Arm sinken. »Ich wollte Ihnen nur helfen.«
Darauf antwortete ich, indem ich eine Augenbraue hochzog.
Er lächelte. »Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Auch wenn mein Bruder sich Mühe gibt, allen Menschen Angst einzujagen.«
»Und Sie tun das nicht?«
Sein Lächeln vertiefte sich. »Nicht doch. Ich habe andere Methoden.«
Toll.
Eine Sekunde zu spät deutete ich in die Richtung, in der die Irina vertäut lag. »Schön, ich ... ich werde jetzt wieder in mein Boot klettern und verschwinden. Schnell, bevor dieses Unwetter noch schlimmer wird. Eigentlich wollte ich nachsehen, ob Sie Hilfe brauchen. Das Licht, ich ...« Konzentrier dich. »Also, machen Sie’s gut.«
Als ich mich an ihm vorbeischieben wollte, stellte er sich mir in den Weg. »Warten Sie.«
»Sie gehen besser zur Seite«, sagte ich.
Ein Anflug von Belustigung trat in seine Augen. »Ich kann Sie auf keinen Fall allein durch dieses Unwetter fahren lassen. Das ist zu gefährlich.«
Beinahe hätte ich gelacht. »Gefährlich, ja?« Mein Blick wanderte zu der letzten brennenden Lampe, die jetzt immer stärker flackerte. »Sieht so aus, als wäre ein Großteil Ihrer Bordelektronik ausgefallen. Besser, ich frage gar nicht, wie Sie das hinbekommen haben. Ist dieses Schiff überhaupt noch manövrierfähig?«
Ein verlegenes Lächeln breitete sich auf seinen Lippen aus. »Na ja, anscheinend hatten wir etwas Pech.«
»Etwas?«
»Sagen wir, etwas mehr.«
Ein weiterer Donnerschlag krachte, direkt über uns. Wir zuckten zusammen – und auch die letzte Lampe an Bord erlosch.
Kapitel 3: Julien
Sogar im Dunkeln konnte ich ihre Augen sehen. Schwarz und ohne jeden Grund. Eine weitere Welle traf das Schiff. Auch jetzt bemerkte ich, dass sie Schwierigkeiten hatte, das Gleichgewicht wiederzufinden. Doch als ich Anstalten machte, sie festzuhalten, warf sie mir einen bösen Blick zu. Zum zweiten Mal, seit sie auf Bens Jacht aufgetaucht war. Also hob ich die Hände und lächelte ihr zu. »Schon gut. Ich hab’s verstanden.«
»Das bezweifele ich.«
Ohne mein Zutun wurde mein Lächeln breiter. Es hatte seine Wirkung bis heute nie verfehlt, aber sie schien es nur noch misstrauischer zu machen.
Ich hielt ihr die Hand entgegen. »Ich bin übrigens Julien.«
»Ist mir egal. Wir müssen weg hier.« Sie strich sich über das nasse Shirt – War das ein Alien, der darauf abgedruckt war? – und deutete zum Bug. »Mein Boot ist da vorn. Es ist nicht so hübsch wie Ihres, aber es ist wenigstens fahrtüchtig.« Sie zögerte. »Hoffe ich jedenfalls. Ist noch jemand an Bord?«
Ich deutete ein Kopfschütteln an. »Nur wir. Es sei denn, es haben sich noch mehr schöne Frauen an Bord geschlichen.«
Erneut bedachte sie mich mit einem skeptischen Blick, als fragte sie sich, ob ich den Verstand verloren hatte.
Gut möglich. Ich bin herrlich betrunken, auf einem manövrierunfähigen Schiff mitten auf dem Pazifik. Und vor mir steht eine ebenso verschlossene wie schöne Fremde, die das hässlichste T-Shirt trägt, das ich je gesehen habe. Das sind mehr als genug Gründe, den Verstand zu verlieren.
»In Ordnung.« Sie holte tief Luft. »Ihr Schiff können Sie fürs Erste vergessen. Am besten, wir rufen die Küstenwache, sobald wir an Land sind ... Das heißt, falls wir es an Land schaffen.« Ein Seufzen. »Kommen Sie schon. Ich bringe Sie zum nächsten Hafen.«
Ben trat zu uns. Das Gesicht hatte er missbilligend verzogen, und er sah aus, als wollte er etwas sehr Unfreundliches sagen. Ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Untersteh dich.
»Dann wollen Sie uns also mitnehmen?«, fragte ich, als sie sich an mir vorbeischob und zur Vorderseite des Schiffes lief.
Sie zuckte mit den Schultern. »Es sei denn, Sie möchten warten, bis das Wetter ihre Jacht zerlegt hat und Sie nach Hause schwimmen können.«
Ich grinste. »Nein, danke.«
Das Deck war rutschig, und als wir uns zum Bug vorgearbeitet hatten, traf uns eine starke Windböe. Sie glitt aus, fiel gegen mich. Ich schlang die Hände um ihre Taille und hielt sie fest. Für eine Sekunde war sie mir ganz nah. Sie roch nach Motoröl und Salz und ... Abrupt machte sie sich los und lief weiter.
Jetzt entdeckte ich das kleine Motorboot, das an der Jacht vertäut war. Im Gegensatz zu Bens Schwan wirkte es wie eine Nussschale. Oder wie ein Spielzeugboot, das jeden Moment in den hohen Wellen versinken würde.
»Ich nehme an, das war ein Danke«, sagte ich, als sie in ihr Boot kletterte. Dieses Mal widerstand ich dem Drang, ihr zu helfen. Stattdessen beobachtete ich sie. Den Schwung ihrer Hüften, dieses grässliche, völlig durchnässte Shirt, das vom Wind zerzauste schwarze Haar, das ihr über den Rücken fiel.
»Nehmen Sie an, was Sie wollen.« Sie blickte zum Himmel, während sie sprach. Die Wolken hingen so tief, als wollten sie die Wellen berühren.
Ich schaute zu Ben, der uns schweigend gefolgt war.
»Komm, wir fahren raus und lassen uns volllaufen«, hatte er gesagt.
»Gute Idee«, hatte ich erwidert – schon etwas angesäuselt und nicht mehr zu hundert Prozent zurechnungsfähig. Jetzt unterdrückte ich ein Seufzen. Ich wusste schon, wieso ich mich für gewöhnlich vom Meer fernhielt.
Etwas Gutes hatte die ganze Sache allerdings: die junge Frau, die wie aus dem Nichts aufgetaucht und auf Bens Jacht geklettert war. Das war definitiv eine erfreuliche Wendung der Ereignisse.
»Gibt es nicht normalerweise Personal auf Schiffen wie diesen?«, fragte sie, als sie mir eine Hand reichte. Ihre Finger waren kalt.
»Wir wollten für uns bleiben«, antwortete Ben.
»Wieso?«
»Ich wüsste nicht, was Sie das anginge. Bringen Sie uns einfach von hier weg.«
Erneut zuckte sie mit den Schultern. Während sie mir ins Boot half, versuchte ich, ihren Blick aufzufangen – vollkommen vergeblich allerdings. Sie schien mir absichtlich auszuweichen. Auch meine Hand ließ sie viel zu schnell los. Abrupt wandte sie sich Ben zu und reichte auch ihm die Hand, um ihm an Bord zu helfen. Ich hob die Augenbrauen, als er sie ergriff. Er musste wirklich sternhagelvoll sein.
»Wie heißen Sie?«, fragte ich, als sie die Leinen löste und den Motor ins Wasser ließ.
Sie warf mir einen kurzen Blick zu. »Callie.«
»Ein schöner Name. Fast so schön wie Sie.«
»Schleimen Sie bloß nicht rum.«
Ich grinste, und sie startete den Motor. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Ben die Augen verdrehte.
Während der Sturm weiter Fahrt aufnahm, drückte Callie den Schalthebel nach vorn, ein Ruck ging durch das Boot – und wir ließen den Schwarzen Schwan hinter uns.
»Fahren Sie nach Süden!«, rief ich.
»Wieso?«
Als sie mich fragend anschaute, deutete ich in die Richtung, in der das Anwesen unserer Familie lag. Der »Familiensitz«, wie Dad gern sagte. Ein Blitz erhellte den wolkenverhangenen Himmel, und kurz erblickte ich die im Sturm wogenden Palmen am Ufer. Von dort aus waren wir aufgebrochen, und es war viel näher als jeder der umliegenden Häfen. »Sehen Sie die Felsen dort? Da liegt eine geschützte Bucht mit einer Anlegestelle.«
Sie schaute dorthin. Es schien, als zögerte sie, als wollte sie den Kopf schütteln ... Dann jedoch straffte sie sich, drückte den Schalthebel nach vorn und rief: »Festhalten!«
Das Boot hüpfte über die hohen Wellen, und der Motor gluckerte und röhrte. Hoffentlich ließ uns Callies Nussschale nicht im Stich. Die Geräusche waren jedenfalls nicht allzu vertrauenerweckend. Ich warf Ben einen Blick zu. Er sah geradeaus, eine Hand um die Reling gekrallt, die andere zur Faust geballt. Seit wir den Schwan auf dem Ozean zurückgelassen hatten, hatte er kein Wort mehr gesagt. Jetzt starrte er abwechselnd auf die hohen Wellen und auf Callies schmalen Rücken.
Ironisch, nicht?, hätte ich am liebsten gefragt. Dass wir ausgerechnet heute in Seenot geraten und gerettet werden.
Das Boot hielt durch. Als Callie es in die Bucht lenkte, atmete ich auf. Hier war das Wasser ruhig, und der Regen prasselte nicht mehr ganz so stark auf uns herab. Kalt war es dennoch – während es bei unserem Aufbruch noch drückend warm gewesen war, schienen die Temperaturen jetzt um mehrere Grad gefallen zu sein. Die Wolkendecke riss auf, und das rote Abendlicht fiel auf die tiefen Narben an Callies rechtem Bein. Es sah aus, als wäre ihr Körper an dieser Stelle zersplittert und in mühevoller Kleinarbeit wieder zusammengesetzt worden. Woher hat sie wohl solche Wunden?
Als hätte sie meinen Blick bemerkt, schaute sie über die Schulter zu mir. Ich lächelte – und sie wandte sich wieder ab. Schweigend manövrierte sie die Nussschale zu dem breiten Anlegesteg, an dem Dads Jacht und außerdem zwei Jetskis vertäut lagen. Ben hatte sie im letzten Frühjahr gekauft – einer Laune folgend, die ich nicht begriff. Wie konnte er das Meer so lieben, dass er jede freie Minute dort verbrachte? Es hatte uns so viel genommen.
Ich bemerkte, dass Callie zu der Villa schaute. Hinter sämtlichen Fenstern brannte Licht. Sie erschauderte sichtlich. Wieso? War es die Kälte, der Regen? Oder war es der Anblick des »Familiensitzes«? Jedenfalls wandte sie schnell den Blick ab und kletterte auf den feuchten Steg, um das Boot dort zu vertäuen. »Endstation.«
Als wir an Land standen, wandte ich mich an Callie, öffnete den Mund ... Doch bevor ich sie fragen konnte, ob ich sie zum Dank für unsere Rettung auf einen Drink einladen durfte, schob sie sich an mir vorbei und sprang ins Boot. Dabei knickte sie um und gab ein leises Zischen von sich.
Mit gerunzelter Stirn beobachtete ich, wie sie die Leinen löste. »Was wird das?«
»Wonach sieht es denn aus?«
Ich beugte mich zu ihr und legte eine Hand über ihre. »Das kann ich nicht zulassen.«
Sie erstarrte, blickte zu mir auf. Für eine Sekunde regte sich keiner von uns. Ich erlaubte mir, ihre Hand noch eine Spur nachdrücklicher zu umfassen. Es regnete auch jetzt noch – und jenseits der Bucht stürmte es. Wohin auch immer sie fahren wollte, sie würde sich dabei umbringen. »Sie können jetzt nicht da raus.«
Meine Worte schienen sie aus ihrer Starre zu reißen. Sie entzog mir ihre Hand. »Ich muss nach Hause.«
»Aber nicht jetzt. Und nicht so. Ich lasse Sie nicht fahren. Schon gar nicht in diesem alten Kahn.«
Sie hob das Kinn, und mein Herzschlag beschleunigte sich. Schön und misstrauisch. Selbst, wenn gerade kein Unwetter auf dem Pazifik wüten würde, würde ich einiges auf mich nehmen, um sie kennenzulernen. »Kommen Sie schon.« Ich reichte ihr die Hand. »Sie sind nass. Und Ihnen muss kalt sein. Wärmen Sie sich wenigstens auf, bevor Sie sich wieder ins Abenteuer stürzen.«
Sie zögerte. Lange. Aber ich gab nicht nach. Ich hielt ihren Blick fest, und ich ließ auch meine Hand nicht sinken. Errötete sie etwa? Es war nicht so leicht zu sagen, aber ... Doch. Doch, sie wurde rot. Sieh an. Schließlich seufzte sie, legte die Hand in meine und ließ sich auf den Steg helfen.
»Sehen Sie«, sagte ich, als sie vor mir stand. »Gar nicht so schwer.«
»Ihre Arroganz können Sie sich sonst wohin schieben.«
Ich lachte. »Sind Sie immer so bissig?«
»Nur, wenn man mir Grund dazu gibt.«
Ich fing Bens Blick auf. Mit finsterer Miene sah er von mir zu Callie. Dann wandte er sich ab und marschierte zur Villa. »Machen Sie sich keine Gedanken«, sagte ich, als sie ihm mit gerunzelter Stirn nachschaute. »Er mag keine Gäste. So ist er eben. Nicht halb so liebenswürdig wie ich. Aber netter, als er durchscheinen lässt. Meistens jedenfalls.«
Ihrer Miene nach zu urteilen, glaubte sie mir kein Wort. »Ihr Bruder?«
»Der ältere. Fast zehn Jahre.« Ich machte eine einladende Handbewegung. »Kommen Sie schon. Gehen wir ins Haus.«
»Wieso waren Sie beide da draußen?«, fragte sie, als wir den steilen, von Palmen gesäumten Weg erklommen, der zur Villa führte. »Haben Sie nicht gesehen, wie schlecht das Wetter war? Wenn es so bewölkt und stürmisch ist, sollte man jedenfalls nicht betrunken auf dem Pazifik herumschippern.«
»Sie waren doch auch dort.«
»Ich bin nüchtern. Und ich weiß, was ich tue.«
»Ihr Boot ist ein Relikt. Genauso gut hätten Sie mit einem Papierschiffchen über den Ozean segeln können.«
»Ich wäre schon viel früher zurück im Hafen gewesen, wenn ich Ihre Jacht nicht gesehen hätte«, sagte sie. »Dann wäre ich nicht ins Unwetter gefahren.«
Abrupt blieb ich stehen. »Sie sind in den Sturm hineingefahren?«
Auch sie hielt inne. Ein Anflug von Unsicherheit huschte über ihr Gesicht. Aber schon im nächsten Augenblick war ihre Miene so hart wie zuvor. »Da war ein Licht auf dem Wasser. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt.«
»Sie haben sich in Gefahr gebracht.« Und sie hatte es wieder tun wollen. »Sie hätten sich umbringen können.« Ich machte einen Schritt auf sie zu, bis ich ihr wieder so nah war wie vorhin, als ich ihr auf den Steg geholfen hatte. Ihre Augen weiteten sich, und mein Blick senkte sich auf ihre Lippen. Meine schöne, misstrauische Retterin. Doch dann streifte uns eine Windböe, Callie fröstelte – und ich erinnerte mich daran, dass ich sie unbedingt ins Warme bringen musste. »Kommen Sie. Lassen Sie zu, dass ich mich um meine Retterin kümmere.«
»Ein einfaches Danke würde reichen.«
Ich verkniff mir ein Grinsen. »Das finde ich nicht.«
Vielleicht kann diese Nacht ja doch noch angenehm werden.
Kapitel 4: Callie
Als wir die Villa betraten, wollte ich mich am liebsten umdrehen und flüchten. Zurück in den Regen, zurück zu der kleinen Bucht, in der die Irina vertäut lag. Zurück in den Sturm.
Alles in diesem Haus war zu viel: das Licht, das von überallher zu kommen schien, die leise Musik, die irgendwo im Obergeschoss erklang, während draußen der Sturm an den Fenstern rüttelte. Und der Mann, der nicht von meiner Seite wich. Julien.
Als er meinen Blick auffing, lächelte er mir zu. Schnell wandte ich mich ab und schaute mich in der weitläufigen Eingangshalle um.
Stechpalmen wuchsen aus unglaublich großen Blumenkübeln. In den polierten Fliesen konnte ich unsere Spiegelbilder betrachten. Eine breite Treppe führte in den ersten Stock, und auf den Bildern an den Wänden waren kleine, chaotisch angeordnete Farbkleckse und überdimensionale Vierecke abgebildet.
Ich schlang die Arme um mich. Mir war eiskalt, und ich konnte meine Zähne nur mit sehr großer Anstrengung vom Klappern abhalten. Und dieses Haus war ... einschüchternd. Schon während wir darauf zugefahren waren, hatte mich ein eigenartiges Gefühl überkommen – so als wäre dieser Ort mir irgendwie vertraut. Was für ein Unsinn.
»Keine Sorge«, sagte Julien auf einmal. »Wir beißen nicht.«
Jetzt sah ich ihn doch wieder an. »Wie beruhigend.«
Ein Funkeln trat in seinen Blick. Genau wie vorhin, als ich kurz geglaubt hatte, er ... Er hob eine Hand und strich mir eine feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht. Ein Zittern durchlief mich. Dieses Mal hatte es nichts damit zu tun, dass ich erbärmlich fror. Was war das hier?
»Ach du liebes bisschen!« Der Ausruf ließ uns beide zusammenzucken.
Julien nahm die Hand herunter. Ich ließ den angehaltenen Atem entweichen und schaute ihn strafend an. Er schenkte mir ein Lächeln. Dann sah er zu der älteren Frau, die soeben die Treppe heruntereilte.
»Sie sind ja klatschnass!«, sagte sie. »Und Sie haben mir ein Unwetter ins Haus gebracht.«
Julien fuhr sich durch das nasse Haar. »Wir sind in den Sturm geraten.«
»Das sehe ich.« Ihr Blick richtete sich auf mich. »Und wer ist Ihre Freundin? Sie kommen mir bekannt vor, Kind.«
»Callie«, sagte ich. »Mein Name ist Callie.« Ein eigenartiges Kribbeln durchlief mich. Kannte ich sie irgendwoher? Diese wässrigen Augen, hatte ich sie schon einmal gesehen? Für eine Sekunde war es mir, als ... Nein, ich bekam den Gedanken nicht zu fassen. »Wir kennen uns nicht. Und ich müsste eigentlich nur ...«
»Ein Handtuch«, meinte Julien. »Callie braucht ein Handtuch und etwas Trockenes zum Anziehen.« Er musterte mich kurz – und sehr eingehend. »Mrs. Falkner, Seien Sie so gut und bringen Sie sie in meine Räumlichkeiten.« Er zwinkerte mir zu. »Ich bestehe immer auf warme Räume, wenn ich hier bin. ›Verwöhnte Extravaganzen‹ nennt mein Vater das, aber in diesem alten Kasten ist es ständig kalt. Und in den anderen Bädern ist die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet. Ich will schließlich nicht, dass Sie mir erfrieren.«
Mit diesen Worten wandte er sich wieder an Mrs. Falkner. »Auf dem Schreibtisch liegen einige Kleidungsstücke. Das Abendkleid vielleicht nicht ... Am besten, Sie nehmen das schwarze Spitzenoberteil und die Seidenhose.« Er runzelte die Stirn. »Eigentlich hatte ich Betty versprochen, den Sachen das gewisse Extra zu verleihen, für die Feier am Samstag. Aber Schwarz steht ihr ohnehin nicht. Ich werde mir etwas Passenderes für sie überlegen.« Wieder musterte er mich. »Sie hingegen werden darin zum Niederknien aussehen.«
Ich wollte erwidern, dass ich überhaupt nicht »zum Niederknien« aussehen wollte. Und dass er mich nicht so ansehen durfte ... so, als würde ich irgendwie zu ihm gehören. Doch bevor ich das tun konnte, sagte er zu Mrs. Falkner: »Wenn Sie sich um Callie gekümmert haben, bringen Sie mir doch bitte etwas Trockenes zum Anziehen ins Gästezimmer.«
Mrs. Falkner nickte, hakte mich ohne ein weiteres Wort unter und bugsierte mich zur Treppe. Im Weggehen warf ich Julien einen Hilfe suchenden Blick zu. Doch er lächelte nur und verschwand dann durch eine Seitentür.
»Simone Falkner.« Meine Begleiterin schob mich die Treppe hinauf und durch einen dunklen Flur. »So heiße ich. Haushälterin, wie meine Mutter vor mir. Der Teufel sei ihrer Seele gnädig. Schreckliche Frau ...« Sie musterte mich. »Sind Sie sicher, dass wir uns nicht kennen? Ich habe Sie bestimmt schon einmal gesehen.«
Wieder durchfuhr mich dieses eigenartige Kribbeln. »Wir sind uns nie begegnet.« Oder? Mein Gedächtnis spielte mir immer noch hin und wieder Streiche ...
»Nun.« Mrs. Falkner winkte ab. »Vielleicht ist es unwichtig. Eigentlich bringt der junge Mr. Dean seine Frauen ja nicht hierher. Wie unpassend Ihre Anwesenheit ist, ist Ihnen nicht klar, schätze ich?«
Erneut kam ich nicht mit. »Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»Natürlich nicht. Na. Ein hübscher Zeitvertreib sind Sie wohl.«
Mit diesen Worten stieß sie eine Tür auf der linken Seite des Flurs auf und schob mich hindurch. Der Raum dahinter war riesig, hell erleuchtet – und sehr warm, wie Julien gesagt hatte. Sofort ließ mein Zittern etwas nach. Das Zimmer wirkte modern und unpersönlich: Dunkle Schränke nahmen die Wände ein, das wuchtige Bett schien unberührt. Eine angelehnte Tür führte offenbar in ein Badezimmer. Einzig der Schreibtisch vor den Fenstern ließ Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Mannes zu, dessen intensiven Blick ich sogar jetzt noch auf mir spüren konnte: Darauf lagen ein aufgeschlagenes Skizzenbuch, Kohlestifte, schimmernde Stoffe. Auf einem Beistelltisch daneben entdeckte ich eine gut ausgestattete Hausbar.
Erst jetzt wurde mir bewusst, was Mrs. Falkner soeben gesagt hatte. Mit brennenden Wangen sah ich sie an. »Das bin ich sicher nicht. Ein hübscher Zeitvertreib.«
»Kind, ich kenne den jungen Mr. Dean seit vielen Jahren. So, wie er Sie angesehen hat ... Warten Sie’s nur ab.« Sie zupfte an meinem nassen T-Shirt. »Er wird wissen, was er tut. Vielleicht.«
Mit diesen Worten trat sie zum Schreibtisch und zog ein schwarzes Oberteil mit sehr viel Spitze und eine seidig schimmernde Hose aus dem Wust an Stoffen, zupfte etwas daraus hervor, was nach Nadel und Faden aussah, und drückte mir die Sachen in die Hand.
»Es ist wie jedes Jahr.« Während sie sprach, lief sie zu einem der hohen Schränke und zog einige sorgfältig gefaltete, dunkle Kleidungsstücke daraus hervor. »Der junge Mr. Dean arbeitet lieber, als Zeit mit seinem Vater zu verbringen, und sein Bruder ist kaum besser. Nicht sehr respektvoll, wenn Sie mich fragen. Aber mich fragt ja nie jemand ...« Sie deutete auf die angelehnte Tür auf der rückwärtigen Seite des Zimmers. »Im Bad finden Sie frische Handtücher. Fassen Sie hier sonst nichts an.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, verließ sie das Zimmer und warf die Tür hinter sich zu.
Und ich war allein.
Nachdem ich einige Sekunden lang nur reglos in der Mitte des Raumes gestanden hatte, betrat ich das Bad und tastete an der Wand nach dem Lichtschalter. Draußen donnerte es. In dieser Sekunde traf mich eine Erinnerung. Ein anderes Unwetter, eine andere Dunkelheit, leuchtend rote Flammen über dem Pazifik. Zwei Kinder. Und dann ... nichts als Stille ...
Ich schnappte nach Luft und schaltete das Licht ein. Nein. Zurück mit euch. Lasst mich in Ruhe!
Fröstelnd schälte ich mich aus meiner Kleidung und trocknete mich mit einem der flauschigen Handtücher ab, die auf einem Badezimmerschränkchen bereitlagen. Der Boden war angenehm warm unter meinen Füßen. Ich zögerte, bevor ich das filigrane Spitzenoberteil und die fließende Seidenhose überstreifte. Diese Kleidung war zu elegant für mich – und sie gehörte mir auch nicht.
Meine Gedanken wanderten zu Julien. Zu seinem Lächeln und der Art, wie er mich angesehen, wie er mich berührt hatte. Wieso klopfte mein Herz so sehr bei der Erinnerung? Ich kannte ihn nicht. Und etwas sagte mir, dass ich mich besser von ihm fernhielt. Von seiner geschliffenen Eleganz, seinem wohldosierten Charme.
Mit großen Schritten verließ ich das Bad, durchquerte das Schlafzimmer. Besser, ich verschwand von hier und vergaß diesen eigenartigen Abend und diese beiden Männer so schnell wie möglich. Sicher hatte Mom schon hundert Mal versucht, mich zu erreichen. Verdammt noch mal. Noch mehr Kummer kann ich Mom und Dad nicht machen.
In dieser Sekunde schwang die Tür auf.
Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Vor mir stand Juliens Bruder. Ben. Er trat ins Zimmer und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Offenbar hatte er sich nicht umgezogen. Aus seiner dunklen Kleidung tropfte Wasser auf den Fußboden. »Hier sind Sie also«, sagte er.
Unter seinem grimmigen Blick straffte ich mich. »Was wollen Sie?«
Er musterte mich. »Wie ist Ihr Name?«
Verwirrt schaute ich ihn an. »Callie.«
»Und weiter?« Während er sprach, kam er näher. Obwohl es sehr warm im Zimmer war, erschauderte ich. Aber ich zwang mich, nicht vor ihm zurückzuweichen.
»Wieso wollen Sie das wissen?«
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Doch in seinem Blick lag nicht der winzigste Funke Belustigung. »Sie stellen hier keine Fragen.«
»Sie haben eine merkwürdige Art, sich zu bedanken«, erwiderte ich. »Wäre ich nicht gewesen, würden Sie noch immer auf Ihrer Jacht hocken und hoffen, die Nacht zu überleben.«
Seine Miene verhärtete sich. »Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ihren vollständigen Namen.«
Angespannt schaute ich ihn an. Wieso war ihm das wichtig? Sein Blick ging mir durch und durch. Und wie schon auf der Jacht konnte ich den Alkohol an ihm riechen. Da war etwas Unberechenbares an ihm – etwas, das mich davor warnte, dieses Gespräch fortzusetzen. »Eigentlich wollte ich gerade gehen«, sagte ich.
Er gab ein hartes Lachen von sich. »Sie gehen nirgendwo hin. Nicht, bevor Sie meine Frage nicht beantwortet haben. Wer sind Sie?«
Mein Puls beschleunigte sich. Nein, sein Verhalten gefiel mir nicht. Wie er mich ansah, gefiel mir nicht. Was war hier los?
Als ich nicht antwortete, machte er einen weiteren Schritt auf mich zu. Ich fuhr zurück.
Einige Sekunden lang starrten wir uns nur an. Bevor er noch ein Wort sagen konnte, schob ich mich an ihm vorbei, öffnete die Tür und schlüpfte in den Flur.