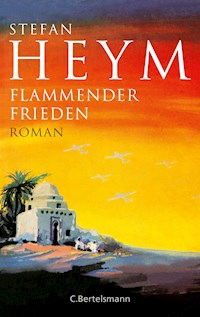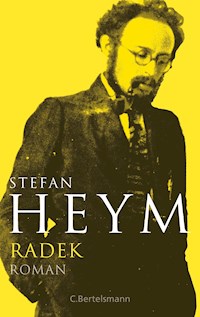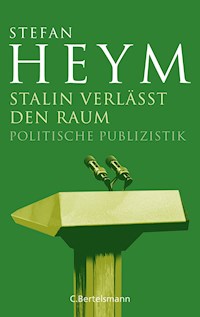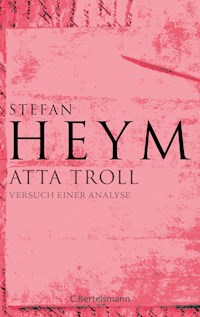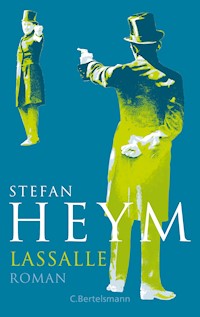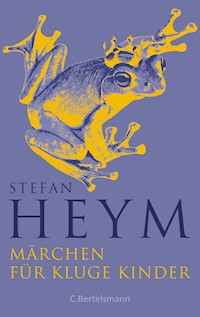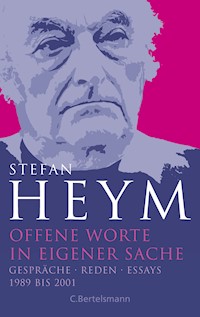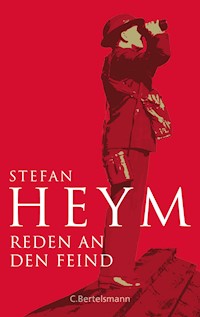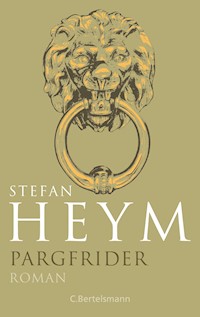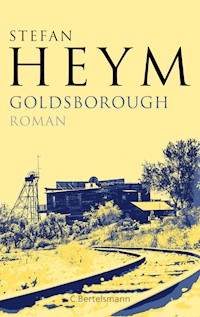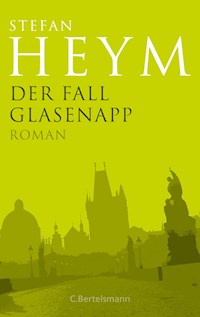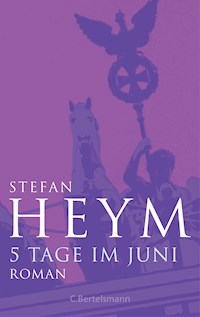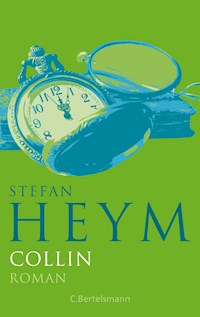
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Romane
- Sprache: Deutsch
Eine provokanter und hellsichtiger Roman und eine Abrechnung mit der stalinistischen Vergangheit der DDR
Zwei sterbenskranke Männer haben miteinander gewettet, wer von ihnen seine Krankheit überstehen und den Widersacher überdauern wird. Der eine, Schriftsteller und Staatspreisträger, will überleben, um seine Memoiren zu schreiben und eine alte Schuld zu tilgen, die schwer auf ihm lastet. Der andere, ein Stasi-Funktionär, will das Erscheinen dieser Memoiren verhindern, weil darin etwas über ihn offenbart würde, was er lieber im Dunkeln weiß. Stefan Heym inszeniert in »Collin« eine rückhaltlose »Suche nach dem Verlorenen, den Leichen im Keller, den von den Planierraupen der Parteiräson Zermalmten, nach den ›Sünden der Väter‹.« Der SPIEGEL
Heyms provokantester und hellsichtigster Roman über die Nachwirkungen des Stalinismus macht deutlich, warum die DDR ein Jahrzehnt später scheitern musste. Bei C. Bertelsmann erstmals 1979 erschienen und mit Curd Jürgens in der Titelrolle verfilmt, endlich wieder lieferbar als Penguin-Taschenbuch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Zwei sterbenskranke Männer haben miteinander gewettet, wer von ihnen seine Krankheit überstehen und den Widersacher überdauern wird. Der eine, Schriftsteller und Staatspreisträger, will überleben, um seine Memoiren zu schreiben und eine alte Schuld zu tilgen, die schwer auf ihm lastet. Der andere, ein Stasifunktionär, will das Erscheinen dieser Memoiren verhindern, weil darin etwas über ihn offenbart würde, was er lieber im Dunkel weiß. Stefan Heym inszeniert in Collin eine rückhaltlose »Suche nach dem Verlorenen, den Leichen im Keller, den von den Planierraupen der Parteiräson Zermalmten, nach den ›Sünden der Väter‹.« Der SPIEGEL
Heyms provokantester und hellsichtigster Roman über die Nachwirkungen des Stalinismus macht deutlich, warum die DDR ein Jahrzehnt später scheitern musste. Bei C. Bertelsmann erstmals 1979 erschienen, nun Teil der digitalen Werkausgabe.
»Hier sitzt jedes Wort und weist den Autor als einen glänzenden Beobachter und unbestechlichen Zeugen der Zeitgeschichte aus.«Die Welt
»Eine Geschichte der DDR vom einstigen Gulag-Sozialismus bis zum Intershop-Sozialismus ist von einem in der DDR lebenden Autor in dieser Schärfe bislang noch nicht geschrieben worden.« Der Spiegel, 1979
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1953 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Collin
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1979 by Inge Heym
Copyright © alle deutschsprachigen Rechte 1979 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München
Umschlagmotiv: © photomaster / Shutterstock.com
Satz: Buchwerkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27841-0V001
www.cbertelsmann.de
1
Infarkt, dachte er. Wenn ich jetzt die Besinnung verliere, ist es aus.
Und dann diese Dunkelheit, nicht einmal das Nachtlicht brannte; wozu liege ich hier, wenn sie einen allein lassen gerade in einem solchen Moment. Dabei habe ich der Doktor Roth noch gesagt, gestern abend: ich gefalle mir nicht, ich weiß nicht wieso, aber ich gefalle mir nicht.
Der Schmerz drang bis in die Fingerspitzen. Collin zwang sich, den linken Arm zu heben, tastete nach der Klingel an der schwenkbaren Bettlampe, fand den Knopf. Über der Tür leuchteten Buchstaben auf, BITTESPRECHEN.
Es geht mir nicht gut. Aber die Worte blieben heiseres Geflüster. Es war schon wie Tod, vielleicht versuchten auch die Toten noch zu sprechen, doch es hörte sie keiner. Er hatte den Planeten gesehen, auf dem er lebte, Satellitenphoto, ein blau schimmernder Stern, weiß umwölkt, ein Juwel Gottes, einmalig. Alles Existierende war einmalig und unwiederbringlich; nein, nicht sterben, jetzt nicht, jetzt noch nicht.
»Es – geht – mir – nicht – gut.«
Die eigene Stimme, endlich, aber wie sehr verändert, kaum erkennbar. Darauf, aus den Wänden, elektronischer Trost: »Sofort, Herr Collin.«
Der Schmerz hatte ein eigenes Wesen, war wie ein Krake, der seine Fangarme durch die Arterien schob. Der Vorgang war im Grunde einfach: Koronarokklusion, kein Sauerstoff mehr für den Muskel, Halleluja; Luise schon war daran gestorben, der Pathologe hatte ihm die Sache erklärt, wie hieß er doch, ein großer, ruhiger Mann; aber Luise hatte lange gelegen und gelitten, während bei ihm alles so plötzlich gekommen war, auf dem Botschaftsempfang, er hatte mit Botschaftsrat Nitschkin gesprochen, ich interessiere mich sehr für Literatur, Genosse Collin, hatte Nitschkin gesagt, da auf einmal dieses Flattern in der Brust und die Schwäche, er hatte sich hinsetzen müssen, ist Ihnen schlecht, Genosse Collin, hatte Nitschkin gesagt.
Warum kam die Doktor Roth nicht, oder irgendein anderer Arzt. Sofort, Herr Collin; das nannten sie sofort, in der besten Klinik des Landes, mit den modernsten Einrichtungen, hier wurde nicht gespart, dafür sorgte Gerlinger, der auch zu den Größten gerufen wurde; wenn einer abkratzte von denen, stand Gerlingers Name mit unter dem Bulletin. Solange ich mich noch ärgere, lebe ich, dachte er, und dann: atmen, tief durchatmen, und dann war ihm, als schnitte ihm einer die Luft ab.
Jeder trägt einen Film mit sich herum, Bilder, die sich eingeprägt haben, regellos aneinandergereiht. Dieses Bild, das wußte Christine, würde bleiben: das graue Gesicht auf dem weißen Kissen, die Lippen fahl, die Stirn schweißnaß, die Augen weit aufgerissen.
»Sauerstoff«, ordnete sie an.
Schwester Gundula verschwand eilig.
Das Herz schlug hastig, mit geringen Unregelmäßigkeiten; der Atem kam in kurzen Stößen. Der Blutdruck war eigentlich nicht beängstigend hoch. Christine hielt die Spritze gegen das Licht, ließ ein Tröpfchen aus der Kanüle perlen.
Seine Lippen bewegten sich. »Infarkt?«
»Sehr schöne Venen haben Sie«, sagte Christine.
Collin verzog das Gesicht.
»Ich gebe Ihnen etwas Extrafeines«, versprach sie.
Er versuchte, das Extrafeine in der Spritze zu sehen. Mit Spritzen waren sie dann immer bei der Hand, dachte er, aber die Aufgabe wäre doch wohl gewesen, die Sache vorher zu verhüten; er hatte sich nicht zu Gerlinger in die Klinik gelegt, um abzuwarten, bis der Infarkt käme, das hätte er auch zu Hause haben können. Er lag zu flach, um erkennen zu können, was für Zeug und wieviel davon sie ihm in die Ader spritzte, und er wagte nicht, den Kopf zu heben; er sah nur ihr Gesicht, die Haarsträhne, die sich gelöst hatte und ihr über die Stirn fiel, den konzentrierten Blick der grauen Augen und den Mund, der, halb geöffnet, einen fast kindlichen Ausdruck hatte.
»Infarkt?« flüsterte er.
Sie zog die Nadel heraus, betupfte die Einstichstelle, bog ihm fürsorglich den Unterarm nach oben. »Wir werden ein EKG schreiben.«
»Ich will« – dies überraschend laut – »den Professor!«
»Der Professor ist bereits benachrichtigt«, log sie. »Und jetzt muß ich Ihnen den Mund stopfen.« Damit stülpte sie ihm die Maske des Sauerstoffgeräts, das Schwester Gundula ins Zimmer gerollt hatte, über Mund und Nase. »Ruhig atmen jetzt, Herr Collin, ganz ruhig.«
Sie prüfte die Skalen, adjustierte den Druck, beobachtete die grau behaarte Brust des Patienten, die sich jetzt kräftiger hob. Die stark Behaarten, behauptete Leo Kuschke, haben es kaum je mit der Leber, die Hormone spielen da möglicherweise eine Rolle – eine von Leos oberärztlichen Theorien, die er ihr eines Nachts mit Hinweis auf die eigene Wolle anvertraut hatte. Schwester Gundula war bereits wieder unterwegs, holte das EKG-Gerät, bei wie vielen Infarkten hatte Schwester Gundula schon assistiert; doch war dies mit ziemlicher Sicherheit kein Infarkt, dachte Christine, oder wenn, dann ein nur minimaler.
Sie spürte den Blick Collins, der über die Maske hinweg auf sie gerichtet war. Die Todesangst, die in seinen Augen sichtbar gewesen war, als sie ins Zimmer trat und das Licht anknipste, schien geschwunden zu sein; der sie da ansah, bekundete Interesse am Diesseits. Christine lächelte ihm zu. Ihr Lächeln, das hatte ihr mehr als einer versichert, habe etwas Eigenes, das sich nur schwer in Worte fassen ließ; bei dir, hatte Andreas ihr gesagt, zeigt sich die Seele im Lächeln. Seele, dachte sie mit ein wenig Selbstironie, Einfluß der Seele auf die Physis; das haben wir studiert, soweit es sich studieren läßt; darum auch ihre Zweifel an dem Infarkt, die Seele des Dr. h. c. Collin, Nationalpreisträger, erschien ihr zur Zeit nicht infarktträchtig.
Schwester Gundula kehrte zurück mit dem EKG-Gerät und half ihr, die Elektroden anzulegen. Die Maschine begann zu schreiben, feines, fast unmerkliches Geräusch; das bläulich gemusterte Papier mit den Zacken der Aufzeichnung faltete sich in das metallene Körbchen hinein.
Collin mümmelte etwas in die Maske. Christine nickte beruhigend, betrachtete die Kurven. Die zeigten nichts Auffälliges, aber man würde vergleichen müssen, das hier war nur ein erster Test, grobmaschig. Collins Blick hatte sich wieder verändert, war bittend geworden: ich geb mich in deine Hand. Mein Gott, dachte sie plötzlich, und wenn ich mich doch irre? Was weiß ich denn schon von der Seele des Mannes Collin … Sie ging hinüber zum Waschbecken, befeuchtete seinen Gesichtslappen, trat zurück an die Seite des Bettes und tupfte ihm den halbgetrockneten Schweiß von der Stirn. Er griff nach ihrer Hand.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte sie. »Schwester Gundula bleibt so lange bei Ihnen.«
Im Dienstzimmer brannte die Schreibtischlampe. Christine suchte die Mappe Collins heraus, überflog die dürftigen Angaben: Collin, Hans, geboren 1915, Schriftsteller; Ehefrau Nina C., Schauspielerin, zwei Telephonnummern, Frau Nina C. besaß ein eigenes Telephon. Aufnahme war erfolgt am 13.; also vor drei Tagen; da war sie zu Hause gewesen, Dr. Lommel hatte Dienst gehabt. Größe des Patienten 1,78 m, Körpergewicht 85,5 kg, chronische Erkrankungen keine. Tonsillektomie, Appendektomie, Blutdruck am Aufnahmetag 200/110, dann abnehmend, gestern wieder höher. Sie verglich das soeben geschriebene EKG mit dem von vorgestern, fand keine gravierenden Unterschiede. Ein Radiokardiogramm lag noch nicht vor, das Elektroencephalogramm war für morgen vorgesehen. Wichtig war das dicke, mit Blaustift eingetragene Kreuz neben dem Namen Collin außen auf der Mappe, es bedeutete, daß Professor Gerlinger im Falle von Komplikationen, sei es Tag- oder Nachtzeit, gerufen zu werden wünschte – der Professor wohnte zehn Minuten von der Klinik in einem Waldstück; das Haus war vor einigen Monaten erst fertiggestellt worden; sie war auch eingeladen gewesen zu der Housewarming Party – Gerlinger liebte Anglizismen –, es war viel Prominenz gekommen, das Ehepaar Collin, der Minister, der Präsident der Akademie, die namhafteren unter den leitenden Herren an den führenden Krankenhäusern, eine Menge Schauspieler, Maler und Musiker, und sogar der Genosse Urack, begleitet von seinen Sicherheitsleuten.
Gerlinger meldete sich schläfrig, nachdem sie eine Weile gewartet hatte, den Telephonhörer ans Ohr geklemmt. »Doktor Roth, Herr Professor«, wiederholte sie.
»Roth … Ah ja, Roth. Ist was?«
»Es handelt sich um den Patienten Collin. Eine Herzattacke. Infarkt möglich, aber nicht wahrscheinlich.«
Auf einmal stellte Gerlinger präzise Fragen, billigte ihre vorläufigen Maßnahmen und lobte am Ende, daß sie ihn sofort gerufen. »Die Republik kann sich nicht leisten, einen Collin zu verlieren«, sagte er, als spräche er zugleich für die Öffentlichkeit. »Ein Klassiker, meine Liebe. Ich komme.«
War nun auch Ehefrau Nina zu benachrichtigen? überlegte sie; doch diese Entscheidung überließ man besser dem Professor. Sie fühlte sich müde. Ein Klassiker, die Lehrer ließen Aufsätze über ihn schreiben, seine Unsterblichkeit war gesichert; aber was besagte das.
Sie seufzte und machte sich auf den Weg, zurück zu ihrem Patienten. Der hielt jetzt, als sie ins Zimmer trat, die Augen geschlossen und reagierte auch nicht, als sie ihm den Puls fühlte. Der Puls hatte sich spürbar verstärkt. Dann aber machte er doch mit der freien Hand eine fahrige Bewegung in Richtung der Maske; er wollte sprechen. Sie nahm ihm die Maske ab.
»Dr. Roth?«
»Bitte nur kurz, Herr Collin. Wir werden noch reichlich Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.«
Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, redete stockend. »Sollte … mir etwas … zustoßen …«
»Der Herr Professor wird jeden Moment hier sein«, sagte sie. »Machen Sie sich keine Sorgen.«
Collin öffnete die Augen. Sie hatte ihn mißverstanden. Oder er hatte sich getäuscht; das Gesicht hatte ihn getäuscht, obwohl er sich da selten irrte, er konnte Menschlichkeit wohl unterscheiden von betulichem Gehabe. Sie verstand nicht, daß es ihm nicht um sein kostbares Leben zu tun war, nicht in dieser Minute. Aber das konnte er ihr nicht erklären, dazu reichte die Kraft nicht, vielleicht war auch etwas in der Spritze gewesen, das die Gedanken im Kopf verschwimmen ließ.
»Nein«, sagte sie, »Sie sollten sich wirklich nicht quälen, wir sind doch da für Sie«, und entsann sich jetzt auch einer Andeutung Dr. Lommels, als der ihr die Station übergeben hatte: Collin habe da Schwierigkeiten gehabt, schöpferischer Natur – schöpferisch war Dr. Lommels Ausdruck gewesen –, typische Streß-Situation, der Professor wisse wohl mehr davon. Schwierigkeiten, dachte sie. Es war stiller geworden um Collin, man müßte doch einmal wieder etwas von ihm lesen, bestimmt hatten wir Bücher von ihm, aber Andreas wird sie mitgenommen haben bei der Trennung.
»Guten Morgen!«
Der Ton des Grußes genau abgewogen, nicht zu laut und dennoch autoritativ genug, um den neuen Tag zu verkündigen, die neue Hoffnung. Schwester Gundula zog den schweren Vorhang am Fenster zur Seite; selbst in dem Halblicht der Dämmerung ließ sich der Ausdruck dienstbeflissener Aufmerksamkeit erkennen, der sich bei der guten Schwester wie bei so vielen Mitarbeitern der Klinik in Anwesenheit von Professor Gerlinger automatisch einstellte und den zu zeigen Christine peinlich vermied. Gerlinger nahte dem Bett; er schien zu schweben, ein Effekt, der durch seine raschen, kurzen Schritte bei konstant ruhendem Oberkörper erzeugt wurde und der durchaus im Einklang stand mit den leuchtenden Augen und der majestätischen Stirn, über der er das schlohweiße Haar, kurz geschnitten, nach vorn gebürstet trug.
Collin setzte zum Sprechen an. Gerlinger hob beschwörend die Hand, allem Einhalt gebietend: den Ängsten des Kranken, jeder Bewegung im Raum. Befriedigt dann mit der Wirkung der Geste, nahm er eine kurze, schonende Untersuchung vor, jede Berührung des Kranken ein Trost, Versicherung an die furchtsame Seele: die Rettung naht, Heilung ist in Sicht; glaube, und es werden Wunder geschehen.
Christine beobachtete ihren Chef: so hatten vor Tausenden von Jahren schon die Schamanen ihr Werk getan, und mit kaum schlechteren Resultaten als ihre Nachfolger heute; wieviel trugen gerade bei Herz- und Kreislauferkrankungen der Wille des Patienten und seine Phantasie zu einer Besserung des Zustands bei; wie oft hatte sie festgestellt, daß die gleichen Medikamente, von ihr verordnet, nicht die Hälfte der Wirkung hatten, die Gerlinger erzielte.
Nachdem er auch noch die Kurven des EKG mit geübtem Blick geprüft, zupfte Gerlinger die Decke über Collins Leib zurecht und erklärte, wiederum sehr milde: »Die Krise, deren Ursprung uns sehr bald klar sein wird, scheint vorbei. Sie werden jetzt müde sein, lieber Collin, und schlafen wollen; wir, Frau Doktor Roth und ich, werden uns also zurückziehen, aber eine Schwester wird ständig bei Ihnen wachen. Sie arrangieren das bitte, Doktor Roth, ich möchte nicht, daß der Patient zu irgendeiner Zeit allein gelassen wird.« Und schon im Hinausgehen, mit einer letzten Rückwendung zu dem Patienten: »Ich kann Ihnen eine ganz ausgezeichnete Prognose stellen.«
Selbst die Art, wie der Professor die Tür hinter sich schloß, leise und doch energisch, war auf Wirkung berechnet: wer so den Raum verließ, der wachte auch aus der Ferne. Im Korridor gab Gerlinger die Pose auf. Sein Schritt wurde müde; er legte den Arm um Christines Schulter, als bedürfte er der Stütze, und sagte: »Sie kommen doch mit? Ein Kaffee täte uns beiden gut.«
Was will er, dachte sie, menschliche Beziehungen pflegen? Sie würde Frau Zink anrufen müssen, die alte Frau aus dem Schlaf schrecken, damit sie hinüberginge zu Wölfchen, das Kind weckte und fertig machte für die Schule; die Dauer von Gesprächen mit Gerlinger ließ sich nicht absehen.
In seinem Zimmer dann streifte er den weißen Kittel ab, ließ sich in den nächsten Sessel fallen, schloß die Augen und rieb sich die Stirn.
Sie wartete, fragte endlich: »Soll ich Kaffee machen?«
»Ah, ja.« Er blickte auf, als sei er überrascht über ihre Anwesenheit. »Das wäre sehr freundlich von Ihnen, Christine. Sie finden alles in dem Wandschrank dort.«
Sie nahm den Elektrotopf aus dem Fach, das Meißener Kaffeegeschirr, den Nescafé. Christine, dachte sie. Die Anredeformen wechselten im Umgang mit Gerlinger: in Parteiversammlungen war er Genosse Professor und sie die Genossin Roth, und man duzte sich; im Dienst, vor Patienten, Schwestern, Pflegern, Labortechnikern, bestand er auf dem unbedingten Herr Professor, während sie Dr. Roth, Frau Dr. Roth, mitunter auch nur Frau Roth hieß; und jetzt Christine.
»War es sehr schwierig, mit Collin?«
Also ein Fachgespräch, das konnte man kurz halten. Sie berichtete noch einmal, Dinge, die er eigentlich schon wußte, ihre Maßnahmen, Reaktion des Patienten, überlegte, ob sie den Vorfall vom gestrigen Vormittag erwähnen sollte, entschied: ein andermal vielleicht, ließ sich denn mit Sicherheit sagen, ob da wirklich Zusammenhänge bestanden? Das Wasser kochte im Kessel.
»Im Falle Collin«, er offerierte ihr das Kaffeepulver, dann tranken sie, »im Falle Collin möchte ich doch sehr vorsichtig vorgehen. Sie leiten zunächst die nötigen Tests ein, besprechen Sie das auch mit Dr. Lommel. Sollte wider Erwarten ein Mini-Infarkt vorliegen, behandeln wir entsprechend; sonst, würde ich meinen, fahren wir fort wie bisher, allerdings bei strenger Bettruhe.«
»Ich veranlasse das.«
Aber er machte keine Anstalten, sie zu entlassen. Seine Augen ruhten wohlgefällig prüfend auf ihr, er lächelte, eine Unzahl von Fältchen trat zutage auf seinem Gesicht, wie eine Hautkrankheit, der Anruf würde sich nicht umgehen lassen.
»Möchten Sie Bücher schreiben heutzutage?«
Die menschliche Seite nun doch, auf dem Umweg über den Patienten Collin. Vielleicht sollte sie sich geschmeichelt fühlen, der große Professor und die kleine Stationsärztin, aber sie war abgekämpft nach dieser Nacht. »Bücher«, fragte sie zurück, »zu welchem Thema?«
»Collin hat mir einmal gesagt, im Grunde schreibt jeder nur über sich selbst.«
Sie quittierte das, wie er zu erwarten schien, mit einem verständnisvollen Nicken; bat ihn dann aber, kurz telephonieren zu dürfen, es sei ihr unangenehm, dieses für sie und wohl auch für den Fall Collin wichtige und interessante Gespräch unterbrechen zu müssen, sie müsse jedoch verschiedenes regeln, Haus und Kind betreffend.
Gerlinger winkte großzügig, doch bemerkte sie aus der Art, wie er sich bemühte, nicht hinzuhören, während sie Frau Zink Instruktionen bezüglich Wölfchens gab, daß er doch ein wenig indigniert war: Gedanken, die man zu lange festhält, verlieren an Schärfe. Er kehrte auch nicht etwa sofort zu seinem Sujet zurück, sondern bemerkte seufzend, so hätte jeder seine Sorgen, eine Frau allein ganz besonders; sie war geneigt, ihn zu fragen, warum er sie dann nicht nach Hause fahren lasse, tat es aber doch nicht, einmal, weil sie fürchtete, ihn vor den Kopf zu stoßen, zum andern aber auch, weil sie trotz ihrer Müdigkeit neugierig zu werden begann: irgend etwas bedrückte ihn, und er wollte wohl testen, ob sie die Person war, bei der er es abladen konnte.
Zunächst aber, über einer zweiten Tasse Kaffee, nörgelte er nur: der Doktor Andreas Roth, der nicht habe sehen wollen, was er an ihr hatte, sei ein Dummkopf gewesen; sie selbst sei jedoch nicht ganz ohne Schuld, wie oft habe er ihr geraten, das Haar nicht gar so streng und andere Schuhe mit anderen Absätzen zu tragen, bei einer Frau wirkten die Proportionen, und sie habe sehr gute; außerdem stelle sie viel zu hohe Ansprüche an die Männer und verbreite überhaupt Unruhe, moralische und seelische Unruhe, seine Klinik werde sie ihm aber nicht durcheinanderbringen, das werde er zu verhüten wissen; im übrigen könne solche Unruhe auch durchaus befruchtend sein, wo wären wir ohne Menschen, die die Dinge in Frage stellten?
Er schien sich bewußt zu werden, daß er auf einen Boden geraten war, den zu betreten er gar nicht beabsichtigt hatte. Christine hatte das Gefühl, daß das Gerede um ihre Person überhaupt nur als Aufhänger dienen sollte für die Äußerung von mehr oder weniger vagen Befürchtungen, die er hegte und die irgendwie mit dem Herzanfall Collins zusammenhingen. Tatsächlich wandte er sich dem Komplex jetzt auch wieder zu. Er wies auf seinen Schreibtisch und sagte, »Dort liegt ein Buch von Collin, er hat es mir mitgebracht – mit Widmung.«
»Haben Sie es schon gelesen, Herr Professor?«
»Ich habe es durchgeblättert. Interessiert es Sie?«
»Ja. Wenn im Grunde jeder nur über sich selbst schreibt, könnte man sich durchaus ein Urteil bilden über den Autor – möglicher Beitrag zu einer Diagnose.«
»Und wenn Collin mehr verdeckte, als er berichtet?« fragte er.
»So wäre auch das eine Indikation.«
Gerlinger strich sich übers Haar, von hinten nach vorn, so als schöbe er all seine Bedenken in den vorderen Teil des Großhirns. »Es ist ja nicht leicht, sich Klarheit zu geben über sich selber. Mitunter ist es nicht einmal ratsam. Weiß denn einer, wie tief er gehen kann, ohne in der eigenen Psyche Zerstörungen anzurichten, die sich gar nicht wiedergutmachen lassen?«
»Aber sollten wir nicht –«
»Ich habe Ihnen doch gesagt: Vorsicht«, unterbrach er mit einem Anflug von Ärger. »Im Falle Collin behandeln wir konservativ und vermeiden alle Risiken; let sleeping dogs lie.«
Christine stand auf, trat zum Schreibtisch, nahm das Buch zur Hand, eine ältere Ausgabe, grelle Sonne über dürrer Landschaft auf dem Schutzumschlag, und kehrte zurück zu ihrem Kaffee. »Die schlafenden Hunde nicht stören … Aber haben Sie, Herr Professor, nicht selber hier an unsrer Klinik Beweise erbracht für die Zusammenhänge zwischen Streß und physiologischen Veränderungen besonders des Kreislaufsystems? Das Risiko zugegeben, das die Suche nach den Ursachen des Streß mit sich bringt – Sie haben uns gelehrt: Will man die Ursachen beseitigen, muß man nach ihnen suchen.«
»Also nehmen Sie das Buch meinetwegen mit.« Ein milder Blick. »Doch was die Ursachen betrifft, die Sie so gern beseitigen möchten, Frau Roth: lassen sie sich denn beseitigen? In der Welt, in der wir leben?«
Was engagiere ich mich, dachte Christine. Aber dann fiel ihr der Vater ihres Ex-Mannes ein, Genosse Michael Roth, der, trotz der Jahre im Zuchthaus, ihr eingeschärft hatte, daß der Mensch veränderbar war und somit die Welt, in der er lebte, und sie sagte: »Wäre nicht schon viel getan, wenn wir erreichten, daß der Patient die Ursachen wenigstens erkennt? Ein Gespenst, bei Licht betrachtet, fällt in sich zusammen.«
»Und wenn wir zu tief schneiden bei der Suche nach der Erkenntnis, Frau Doktor Roth, zuviel Gewebe zerstören? Operation erfolgreich, Patient tot?«
»So daß die Krankheit also gnädiger sein könnte als die Heilung?«
»Unter Umständen.« Und fiel wieder zurück in den gütig belehrenden Ton: »Sie werden doch selbst schon die Erfahrung gemacht haben, Christine, daß es gelegentlich besser ist, eine Sache nicht bis in ihre letzten Konsequenzen zu durchdenken.«
»Besser?« Sie suchte sich gegen die weiche, warme Stimme, die sie einzuhüllen schien, zu wehren. »Auf jeden Fall bequemer.«
»Verbreiten Sie wieder moralische Unruhe?« Er lachte. »Also bitte, Ursachen: der Patient Collin hatte, wie ich höre, schöpferische Schwierigkeiten.« Er stand auf. »Wer hat keine?«
»Also bitte, Ursachen«, wiederholte sie; sollte Gerlinger seine Unruhe haben. »Der Patient Collin hatte gestern einen Streit mit dem Patienten Urack.«
»Was?« Gerlinger drückte auf den Lichtschalter; statt der Unschärfen im Raum waren da plötzlich die kalten, klaren Linien. »Woher wissen Sie das?«
»Von Schwester Gundula.«
Eine ungeduldige Handbewegung.
»Schwester Gundula befand sich in der Wäschekammer. Sie hatte die Tür offengelassen und –«
»Zur Sache bitte, Doktor Roth.«
»Die Wäschekammer liegt in Hörweite des Männeraufenthaltsraums. Es stritten da zwei Stimmen.«
»Worüber?«
»Schwester Gundula hat nur gehört, daß gestritten wurde und wer beteiligt war an dem Streit, nicht worum es dabei ging.«
»Wie will sie die Stimmen erkannt haben?«
»Schwester Gundula war neugierig und hat hineingeschaut.«
»Christine«, Gerlinger trat zu ihr, wieder ganz Wohlwollen, und legte ihr die Hand auf die Schulter, »ein guter Rat, Christine: Alles, was den Genossen Urack betrifft, vergessen wir, ja?«
Dieses Ja? kannte sie. Es war Bestandteil der Terminologie sämtlicher Ämter und Parteistellen. Es erheischte Gehorsam.
2
(Aus den Notizen des Kritikers Theodor Pollock)
… hat mir der Gerlinger Photos geschickt, von seiner Housewarming Party, darunter eines von mir, Großaufnahme, en face. Im eigentlichen Sinn häßlich bin ich nicht, doch kann ich verstehen, daß ich bei vielen Abneigung errege. Die an den Enden nach oben weisenden Brauen, die breiten Nasenflügel, die spöttisch gewölbten Lippen ergeben im Ensemble eine Physiognomie, die, noch dazu akzentuiert durch den graumelierten gestutzten Bart, schon ein wenig beängstigend wirken kann; kein Wunder also, daß die bulgarische Kinderamme, die sich die Frau des Werkleiters von VEB Plastewaren wegen des Personalmangels in unserer Republik aus Nessebar mitgebracht hat, regelmäßig ein Kreuz schlägt, wenn sie mir vor dem Haus ihrer Dienstherrschaft am Ende unsrer sogenannten Intelligenzsiedlung begegnet.
Dabei, das darf ich ruhigen Gewissens sagen, will ich immer nur das Gute. Ich fördere junge Autoren und empfehle sie für Stipendien und Studienreisen und ziehe meine Hand auch dann nicht von ihnen ab, wenn sie hinter meinem Rücken verbreiten, ich wäre arrogant, prinzipienlos oder gar feige. In der Einsicht, daß unerfüllter Ehrgeiz gerade die Dummen gefährlich macht, unterstütze ich die Aufnahme selbst völliger Hohlköpfe in die Akademie. Wo Lob verlangt wird, stimme ich ein in den Chor, wähle dabei jedoch Worte, deren ich mich später nicht allzu sehr schämen muß; aber auch da, wo ich verdammen könnte, halte ich mich zurück. So kommt man, im Land der Abhängigen, in den Ruf eines unabhängigen Geistes.
Das Gute, wer will es nicht? Doch ein Rad, einmal in Bewegung gesetzt, läßt sich nicht mehr aufhalten; man kann seinen Lauf nur mit mehr oder weniger Unbehagen verfolgen. Dieses Unbehagen, das bei anderen Kopfschmerz oder Durchfall erzeugt oder zu Wutanfällen gegenüber Untergebenen oder Familienangehörigen führt, verursacht bei mir ein infernalisches Jucken der Narbe an meiner rechten Wade, Resultat meiner Kriegsverwundung, wenn man diese so bezeichnen kann, denn ich erhielt sie nach Abschluß der Kampfhandlungen, als ich, im Siegesjubel über die Nachricht von der Kapitulation der Wehrmacht, das Magazin meiner amerikanischen Armeepistole, einer Colt 45, leerschoß: eins der Geschosse prallte ab am Fenstersims der vornehmen Pension in Bad Nauheim, in der ich damals einquartiert war, schlug mir in die Wade und streifte den Knöchel. Das Jucken, meint Christine, sei ein psychosomatisches Phänomen; sie kenne noch viel merkwürdigere.
Die Wade begann sofort zu jucken, als Christine mir am Telephon sagte: Ein Herzanfall, vielleicht ein Mini-Infarkt. Man wünscht das keinem, einem Nachbarn und Freunde erst recht nicht. Ich bin sein Freund, mit allen Vorbehalten, die mir eigen, und obwohl es schwierig ist, einen Menschen um sich zu dulden, der einem auf den Arm boxt, wünscht er etwas zu betonen. Er selbst hat meines Wissens keinen außer mir, dem er sich enger angeschlossen hätte; innerlich unsicher und mißtrauisch, weiß er bei mir wenigstens, daß ich nichts von ihm fordere, und so hört er gelegentlich auf meinen Rat und sagt mir bei unseren Hundegesprächen Dinge, darunter Ansichten über die Obrigkeit, die er sonst niemandem anvertrauen würde, selbst der eigenen Frau nicht, ihr schon gar nicht. Ich habe diese Ehe gestiftet, das darf ich mir anrechnen. Ich war damals mit ihm auf einer Lesereise nach Dresden, und ich war es, der ihn auf Nina Bertram aufmerksam machte; er hätte sie wohl kaum bemerkt, so sehr war er mit dem eigenen Erfolg beschäftigt. Ich war es, der das Verhältnis vorantrieb; das war insofern nicht leicht, als er eine Art Totenkult betrieb: Luise, älter als er und ihm intellektuell wohl auch überlegen, hatte ihn gelenkt und beherrscht, und seine Ressentiments ihr gegenüber schlugen um in verspätete Reue. Ich riet ihm, Nina zu heiraten; es wird dir gut tun, sagte ich, eine andere Rolle für dich, mit einer jungen, schönen, talentierten Frau, ein Mann wie du braucht auch einen Rahmen.
Ich glaube nicht, daß Frau Nina, trotz ihres überentwickelten Ichs und ihres fast totalen Mangels an Skrupeln, die Ursache seiner Krise ist; sie hat, schon um der eigenen Karriere willen, ihn im Gegenteil immer wieder aufgemuntert und hat für immer neue Anerkennung seiner Werke geworben, selbst als diese nur noch aus schwächlichen Aufgüssen von früher Geleistetem bestanden. Die Hundegespräche, wie er sie nannte, denn sie werden geführt, um Assmann von Assmannshausen, meinem schwarzen Pudel, seinen Auslauf zu gewähren, wurden immer bitterer. Er witterte Verschwörungen gegen sich. Aber er war ja kein Narr; wenn ihn die Erkenntnis seiner Schwäche überkam, ließ er ab von meinem Arm, den er bei der Aufzählung der Verschwörer und ihrer möglichen Ziele mit der Faust bearbeitet hatte, und meinte düster, er habe wohl seine Zeit bereits überlebt.
Ein Mann wie er, protestierte ich, auf der Höhe seines Ruhms und seiner geistigen und körperlichen Potenz, vielleicht fordere er sich nicht genügend, der Mensch lebe durch seine Aufgaben. Es müsse ja nicht ein neuer Roman sein, an dem er sich versuche. Es gäbe andere Formen, und wären es nur Notizen, die sich dann schon zu etwas Neuem, ihn selbst wahrscheinlich Überraschendem zusammenfügen würden.
Er zog mich, da Assmann seine Geschäfte verrichtet hatte, zur Terrasse seines Hauses, hieß mich Platz nehmen im Liegestuhl unter den Weinranken und servierte, Frau Nina und die Haushälterin waren beide abwesend, den Kognak und Kaffee selber. Ich nun begann die Idee zu entwickeln; ich pries sein enormes, bis ins Detail reichendes Gedächtnis, Beweis: seine bisherigen Bücher und unsere Hundegespräche. Ein Gehirn wie seines sei ein veritables Lagerhaus, dessen Tür man nur aufzustoßen brauche, um das Memoirenwerk, gewiß noch ein rechter Wust, aber reich an Lebendigem und vielerorts Unbekanntem, fertig vorzufinden; ein Skelett, auf dem man das alles anordnen könne, Anfang, Mitte, Ende, werde sich schon ergeben.
Memoiren, sagte er nachdenklich. Ich vermutete, er werde nun die Hemmnisse aufzählen, die einer solchen Arbeit entgegenstanden und die ihm, einem politischen Menschen, klar sein mußten. Aber er meinte nur, der Gedanke sei ihm in den letzten Jahren ja auch schon gekommen; er werde sich die Sache überlegen, da ich offensichtlich so sehr viel davon hielte. In den nächsten Wochen war er, der bei unsern Gesprächen meistens das Wort führte, eher schweigsam – bis er mir eines Tages eröffnete, ja, er sei dem Projekt nähergetreten, habe auch schon einiges aufgezeichnet, einen Zeitplan verfertigt, eine Liste von Personen und Ereignissen, und was dergleichen Vorarbeiten sind. Ich beglückwünschte ihn und erkundigte mich vorsichtig, ob er schon mit Nina darüber gesprochen habe oder mit irgendwem sonst, mit seinem Verlag etwa; er verneinte und sagte, ich wäre der erste, der davon erführe, da ich ja sozusagen der Pate sei des Kindes; ich meinerseits riet ihm, von dem Vorhaben anderen gegenüber zu schweigen, vorläufig wenigstens, er sei schließlich ein Autor von Rang und Gewicht.
Er verstand sofort.
Ein solches Werk, fuhr ich fort, das eigentlich nur ein Mann wie er zu bewältigen imstande sei, müsse eine Abrechnung werden mit seiner Zeit und zugleich Gültigkeit haben über diese Zeit hinaus; nichts Halbes dürfe es werden, wie es aus der Feder anderer gekommen sei; natürlich würden Probleme auftreten und Schwierigkeiten, aber ich stünde ihm zur Verfügung mit Rat bei der Organisierung des Materials und Tat bei der Redaktion desselben; dies sei ein Freundschaftsdienst, zu dem ich durch Begabung und Erfahrung mich befähigt fühlte; er müsse nur systematisch und regelmäßig an dem Unternehmen arbeiten und nichts auslassen, was wesentlich sei zum Verständnis unsrer Zeit und ihrer Menschen und seiner eignen Person, soweit diese ihm erkennbar.
Das, sagte er ohne Zögern, sei genau seine Absicht.
Und nun diese Erkrankung …
3
Sie hatten sich auseinandergelebt.
Wann fängt so etwas an und womit, und ist das Ende schon durch den Anfang gegeben? Zu große Erwartungen vielleicht, zu hohe Ansprüche? Lag es an ihm, an ihr?
Das erste böse Wort, die erste falsche Geste, eine Auseinandersetzung worüber, genau erinnerte Christine sich nicht, es war einer relegiert worden wegen irgendeiner falschen Äußerung, Andreas hätte aufstehen sollen in der FDJ-Leitung, für den Jungen eintreten, oder beim Dekan protestieren, ich bin kein Erzengel, hatte er gesagt, und sie, du denkst immer nur an dich, dein Vater hätte da ganz anders gehandelt, und er, ich bin aber nicht mein Vater, du hättest meinen Vater heiraten sollen. Was wollte sie, einen Ritter, der sie zu sich aufs Roß hob und mit ihr davonritt, die Drachen dieser Welt zu erschlagen? Die Zeit der Ritter war vorbei, sie war eine selbständige Person, die sich ihre selbständigen Gedanken machte, ihr zukünftiger Schwiegervater, der ihr Bürge gewesen war bei ihrem Eintritt in die Partei, hatte in seinem Brief geschrieben: Christine Neher stellt Fragen und prüft, setzt sich dann aber auch ein für das, was sie als richtig erkannt hat. Sie war eine selbständige Person, und sie hatte im Betrieb gearbeitet, pharmazeutische Produkte, sie kannte die abstumpfende Gleichförmigkeit der Bewegungen, den Schweißdunst, das Flirren vor den Augen, und erst dann war sie zum Studium delegiert worden, von ihrem Betrieb, es hieß, sie wäre begabt und zielstrebig, lauter schöne Eigenschaften, die ihr da bestätigt wurden.
Später bilden sich Verhaltensweisen, man weiß, wie der andere reagieren und wie man selber ihm erwidern wird; dazwischen liegen Perioden, jeweils immer kürzer werdend, in denen man versucht, versöhnlich zu wirken, auszugleichen, Gefühle von einst zu restaurieren; plötzlich dann, erschreckend, ein Ausbruch, mein Gott, klang das nicht schon wie Haß; und schließlich die obligate grundsätzliche Aussprache samt Analyse der Fehler, meiner, deiner, und dem festen Entschluß, auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse ein Neubeginnen. Aber da hat sich wohl schon zuviel angehäuft; Veränderungen sind eingetreten im Wesen des Mannes und im eigenen, was gestern noch wegwischbar war, hat sich heute eingefressen in die Seele.
Unerquicklich das Ganze, weil so alltäglich, und wir möchten doch glauben, ein jeder von uns, daß wir nicht zu den Alltäglichen gehören. Und dann hatte es sie doch berührt, wo sie nicht mehr berührt werden wollte: der graue Saal, der schlecht gewischte Fußboden, die trüben Fenster, die Bänke und Tische mit den Spuren der Jahre, und die Richterin, eine gütige Person, mahnend im Falle Roth gegen Roth, können Sie nicht doch, Herr Doktor Roth, Frau Doktor, denken Sie an das Kind. Er tat einen halben Schritt auf sie zu, und einen Moment lang sah sie den Mann, dessen nackte Haut sie gespürt hatte unter ihren Fingerspitzen.
Christine stellte den Nähkorb zur Seite, Wölfchens Jeans noch einmal geheilt, echte Jeans, echt verblichen, sein kostbarstes Kleidungsstück, da hatte er feste Meinungen. Gerade weil sie an den Jungen gedacht hatte, der nicht unter den Spannungen zwischen ihr und Andreas leiden, nicht mit gespaltenen Gefühlen aufwachsen sollte, hatte sie abgelehnt: es ist wohlüberlegt, hatte sie der Richterin erklärt, mein Mann wird es bestätigen, wir haben es abgesprochen, wir gehen ohne Streit auseinander, es sind nützliche Jahre gewesen, aber jetzt wünschen wir die Trennung, einen sauberen Schnitt, mein Mann ist Chirurg, es ist sein Ausdruck, jetzt, nicht später, jetzt sind wir noch in den Jahren, in denen man wieder anfangen kann, mein Mann war sehr großzügig, er hat sich einverstanden erklärt, daß das Kind mir bleibt und damit die Wohnung, selbstverständlich kann er Wölfchen besuchen kommen.
Sie sind intelligente Menschen, hatte die Richterin gesagt, Sie müssen wissen, was Sie tun. Christine lauschte den Schritten im Vorraum. Sie legte die geflickten Jeans zusammen, das blaugestreifte Nickihemd. Andreas klopfte. »Komm rein.«
Er trat ins Zimmer. »Ich will dir nur das Geld geben, für den Jungen, für die Miete, für den ganzen anteiligen Kram«, und legte ein paar Scheine auf den Tisch.
»Tee?«
»Immer.«
Sie goß ein. Er zog einen Stuhl heran, setzte sich ihr gegenüber, blies auf seinen Tee, betrachtete sie. »Nein, es ist noch immer nichts. Im Krankenhaus sagen sie, vielleicht nächstes Jahr.«
»Hör zu, mein Lieber, manchmal habe ich das Gefühl, du bemühst dich gar nicht. Du fühlst dich ganz behaglich hier, und jede Veränderung ist dir zuwider, das war schon immer so.«
»Sobald es wärmer ist, ziehe ich wieder an den Paetz-See. Aber du wirst nicht von mir erwarten, daß ich zu dieser Jahreszeit in einer Datsche hause, die nicht zu heizen ist.«
»Und was ist mit den Versprechungen deiner Kaderabteilung?«
»Der Seitenflügel wird gebaut, irgendwann. Aber wie soll ich mich stark machen wegen einer Dienstwohnung, solange die Patienten auf dem Korridor liegen. Es ist bei uns nicht so wie bei dem vornehmen Herrn Gerlinger, der einen Patienten pro Zimmer hat oder höchstens zwei.«
Sie biß sich auf die Lippe. Andreas Roth als Fürsprecher der Elenden und Unterdrückten; er hatte eine herrliche Art, sie ins Unrecht zu setzen. »Und das Wohnungsamt? Ärzte werden bevorzugt versorgt, heißt es, Ärzte werden gebraucht, Ärzte dürfen nicht verärgert werden.«
»Hinter der Fluchtwelle steckt eine Organisation, das weißt du.«
»Organisation, gewiß; aber warum gehen die Ärzte?«
»Was fragst du mich?«
»Du bist in der Parteileitung, du hast doch die Antworten.«
Er lachte, beugte sich über sie. Sie entzog sich ihm. »Ich bin dir doch wahrhaftig keine Last«, sagte er. »Ich mache mein Zimmer sauber, ich wasche selber ab, wenn ich mir was koche, und ich kümmere mich um den Jungen.«
»Eben«, sagte sie und dachte an Wölfchens unsichere Freude beim Wiedereinzug des Vaters; gerade hatte sie ihm mit großer Mühe klargemacht, was das ist, Scheidung, und warum und wieso; man kann doch die Gedanken und Gefühle eines Kindes nicht immerzu umpolen. Oder die eigenen. Da war die Nacht gewesen, man saß zusammen und redete, harmlos genug, aber Andreas trank und später auch sie, und sie zog sich doch wieder für ihn aus; er tat außerordentlich erregt, wie in den besten Zeiten, nur fror sie auf einmal und lag praktisch fühllos, bis er von ihr abließ. »Eben«, wiederholte sie, »du schaffst nur Konflikte.«
Er zuckte die Achseln und blickte sich um, worüber ließ sich noch sprechen, und bemerkte das Buch auf dem Tisch und fragte: »Collin? Liest du ihn wieder?«
»Ich habe angefangen.«
»Sie haben diesen Collin zu sehr hochgejubelt. Wenn einer zur Pflichtlektüre ernannt wird in den Schulen und seine Bücher als Prämien verteilt werden zusammen mit Blümchen und Urkunden mit geprägtem Siegel, ich weiß nicht. Ich hab nichts gegen ihn. Im Gegenteil, mich hat er immer beeindruckt, diese Berliner Arbeiter, die er geschildert hat, wie sie sich herumschlugen mit der SA, und Spanien dann, die Menschen dort, Guadalajara, Madrid du Wunderbare, und später die Sache mit dem Chemiewerk, Ost West, wie anders die Leute sich entwickeln, die Problematik hat er schon erfaßt, aber vielleicht doch ein bißchen einseitig das Ganze, manchmal meine ich, es ist nicht mehr unsere Welt.«
»Und wieso nicht?«
»Seine Welt ist in Ordnung, sein Schema stimmt noch. An den Niederlagen sind immer die anderen schuld. Er stellt nichts in Frage.«
»Und was stellst du in Frage?«
»Da ich keine Bücher schreibe, kann ich mir sparen, das jeweils Gültige anzuzweifeln.«
Sie betrachtete ihn, das verflachte Gesicht, die Züge ohne Prägnanz; was war aus dem Mann geworden, der einst so große Erwartungen in ihr erzeugt hatte. »In deiner Welt geht es nicht einmal um irgendeine Ordnung oder Unordnung«, sagte sie. »In deiner Welt strebt man nur danach, glatt über die Runden zu kommen. Das war auch, glaube ich, mein eigentlicher Scheidungsgrund. Die Weibergeschichten wären zu ertragen gewesen.«
»Das hast du von deinem Pollock?«
»Er ist nicht mein Pollock. Und deine Person war kaum je Gesprächsthema zwischen ihm und mir.«
»Was streiten wir uns?« Eine Handbewegung. »Und noch dazu wegen Collin. Woher überhaupt dein plötzliches Interesse an dem Mann?«
»Wir haben ihn in unsrer Klinik.«
»Infarkt?«
»Wie kommst du auf Infarkt?«
»Die, bei denen die Welt in Ordnung ist, verdecken zumeist nur das eigene Chaos. Ich kenne die Menschen, ich schneide sie auf. Sie haben im Innern alle das gleiche Gekröse.«
»Es war aber kein Infarkt.«
»Dann kommt er eben noch.«
Sie ärgerte sich. »Immerhin hat der Mann einmal gekämpft. Wirklich gekämpft, so wie dein Vater damals. Darum interessiert er mich. Und vielleicht weiß er sogar –«
»Weiß er was?«
»Ein paar Antworten auf ein paar von den Fragen.«
»Wenn er sie weiß, wird er sie dir nicht sagen. Vielleicht sagt er sie nicht einmal sich selber.« Er erhob sich. »Tschüs, Engel. Grüß Wölfchen von mir.«
»Willst du ihm nicht selbst gute Nacht sagen?«
»Du wolltest doch, daß ich Distanz halte.«
Sie blickte ihm nach, er hatte die Zimmertür offengelassen: er zog sich den Mantel an und trat vor den Garderobenspiegel, um den Seidenschal korrekt zu knoten. »Du besuchst Helma?« fragte sie.
Er lächelte.
Der elegante Herr Dr. Roth; seit der Scheidung pflegte er sein Äußeres noch mehr. »Ich möchte es nur wissen für den Fall, daß sie von deinem Krankenhaus anrufen.«
»Ich habe dort hinterlassen, wo ich erreichbar bin, danke.«
Wölfchen, der wohl seines Vaters Stimme im Vorraum gehört hatte, kam aus seinem Zimmer gesprungen. »Du gehst fort, Papa?«
»Ja, mein Sohn, ich muß.«
»Tschüs, Papa!« Wölfchen machte eine Bewegung auf seinen Vater zu, doch der hatte sich bereits von ihm abgewendet.
Der Junge blieb zurück, den Kopf gesenkt. Christine sah, wie er schluckte; sie brachte ihm seine Jeans und sein Hemd; er nahm die Sachen wortlos entgegen und zog sich rasch wieder in sein Zimmer zurück.
Christine stand im Vorraum, unschlüssig. Der ganze Zustand war unmöglich. Sie würde sich selber um die Wohnungsangelegenheit kümmern müssen, aber da brauchte man Beziehungen: Gerlinger vielleicht? Theodor Pollock?
Sie hatte es sich doch leichter vorgestellt, vor der Scheidung; hatte sie nicht alles, was man zu einem ausgefüllten, glücklichen Leben brauchte: Kind, Arbeit, Bücher, Musik, Freunde? Aber eine geschiedene Ehe war eben eine nicht geglückte Ehe, also eine Niederlage, und merkwürdigerweise immer eine Niederlage der Frau. Die helfenden Männerhände streckten sich ihr entgegen; das fing an mit Gerlinger, der ihr gute Ratschläge gab und versicherte, sie könne sich jederzeit an ihn wenden, und ging bis zu dem pausbäckigen Wachtmeister Liebermann, dem Abschnittsbevollmächtigten der Polizei im Wohnblock, der ihr die Hilfe der Behörde anbot, eine Frau allein, man könne nie wissen. Die Männer gaben sich väterlich beziehungsweise brüderlich, wenn nüchtern, und zeigten sich geil, wenn angeheitert; dafür verhielten die Frauen sich um so kühler, scheelen Blicks untereinander tuschelnd bewachten sie ihre Kerle, am giftigsten benahm sich Elvira Kuschke, die allerdings mit Grund.
Christine ging zum Telephon und wählte; Pollock hatte Bescheid haben wollen über Collins Befinden und hatte gebeten, ihn doch anzurufen, sobald die Testresultate vorlagen; aber er meldete sich nicht. Pollock war der einzige, in dessen Gesellschaft sie sich in der Zeit nach der Scheidung frei und unbefangen fühlte; er schien anders zu sein als die anderen, vielleicht weil er nicht zu dem Kreis gehörte, in dem das Ehepaar Roth verkehrt hatte, nur zu Gerlinger bestand eine Verbindung. Ob er, über Gerlinger, von ihrer Affäre mit Leo Kuschke wußte, war ihr nicht klar; jedenfalls war er die ganze Zeit unverändert freundlich und ging geduldig auf ihre Stimmungen ein, selbst als die Krise kam und die Sache mit einem Beinahe-Skandal endete: Elvira war zu Gerlinger gelaufen und hatte mit allem möglichen gedroht, und Gerlinger, der seinen Oberarzt nur ungern verloren hätte, ließ sich Leo kommen und sagte, Herr Kuschke, ich bin gewiß ein liberal denkender Mensch, aber ich wünsche keine Unruhe an meiner Klinik, schaffen Sie saubere Verhältnisse, es steht Ihnen ja frei, für welche der beiden Damen Sie sich entscheiden wollen, ich muß wohl nicht erst mit Frau Roth sprechen.
Derart Erlebnisse, dachte Christine, schärfen den Blick; die Zweifel, auch an den eigenen Denkschemata und Verhaltensweisen, wachsen in dem Maße, in dem der Boden schrumpft, auf dem man sich sicher fühlt. Schon immer hatte sie allergisch auf Phrasen reagiert, nun entdeckte sie Plattheiten auch, wo sie sie früher übersehen hatte; sehr autoritätsgläubig war sie nie gewesen, nun bröckelten auch die noch anerkannten Autoritäten; die Anstöße, die Pollock, ob absichtlich oder nicht, ihr gab, beschleunigten den Prozeß. Ob das nicht auch eine innere Verarmung bedeute, hatte sie ihn kürzlich gefragt; darauf hatte er gemeint, vielleicht bedürfe es anderer Wertvorstellungen als der bisherigen.
Sie raffte sich auf und ging hinein zu Wölfchen. Der war dabei, eins seiner Bilder zu malen, lebhafte Farben, irgendein großes Tier, das sonderbar steifbeinig und perspektivlos einen grünen Gipfel erklomm; fledermausartige Fabelwesen mit menschenähnlichen Gesichtern umflogen den Berg. Das Bild beunruhigte sie und noch mehr die Art, wie der Junge malte; mit einer Verbissenheit, die ihm nicht gestattete, Notiz von ihr zu nehmen: als müsse er etwas ausdrücken, tatsächlich aus-drücken, aus sich herausdrücken. »Deine eigene Idee?« fragte sie, Anerkennung im Ton. »Oder hast du das irgendwo gesehen?«
Wölfchen malte weiter.
Sie ärgerte sich über ihre Frage. Gab es denn da im Kopf von Kindern einen Unterschied, Erschautes und Erdachtes waren miteinander verwoben.
»Gesehen?« sagte er plötzlich, ohne den Pinsel beiseite zu legen oder auch nur aufzublicken. »Vielleicht ja. Doch. Im Traum.«
Das Bild, Traum-Bild, welche Assoziationen erzeugte so etwas? »Du hast dich gefürchtet? Vor was? Vor wem?«
Er zog die Stirn kraus. »In meinem Traum?«
Wölfchen sah, wenn er nachdachte wie jetzt, ihr ähnlicher als seinem Vater. Oft wünschte sie, der Junge wäre weniger sensibel, produzierte mehr Lärm, protestierte; er schluckte zuviel in sich hinein.
»Ich hab mich nicht gefürchtet.«
»Und wer sind die, die da um den Berg herumflattern?«
»Die sind von einem anderen Stern. Aber sie haben keine Landeerlaubnis.«
»Das hast du auch geträumt?«
Er antwortete nicht, fuhr fort zu malen. Er hatte schlanke, eigentlich unkindliche Hände, einen schön geformten Hinterkopf: Wolf Roth, dachte sie, das war aus ihrem Schoß gekommen, nun schon ein Mensch mit eigenen Unruhen und Träumen, und wie wenig davon konnte man steuern, man konnte nur, wenn man zu Hause war, den Prozeß zu beeinflussen suchen, durch den Denken und Phantasie sich formten. Liebte er sie? Wie oft war sie da, wenn er sie brauchte?
»Das Bild gefällt mir«, lobte sie. »Die Umrisse sind gut, und die Farben stimmen zueinander.«
»Ich träume auch von dir«, sagte er. »Du warst im Wasser, wie letztes Jahr im Sommer. Du hast mich gerufen: Komm, komm. Aber dann warst du nicht mehr da, nur die Welle, und ich dachte, ich muß ertrinken. Ich werde das später noch malen.«
Sie legte den Arm um ihn.
Das Telephon klingelte. Pollock, dachte sie, jetzt ruft er mich an. Aber es war nicht Pollock; es war auch nicht ihre Klinik oder Andreas’ Krankenhaus, eine Notoperation, Komplikationen, Sie werden gebraucht, Herr Oberarzt; es war Havelka. Ob er störe, ob er sich lieber ein andermal melden solle. Nein, sagte sie, er störe nicht. Ja, er könne durchaus vorbeikommen, sie habe nichts weiter vor. Eine kurze Zeit nur? Wie Sie wollen, Herr Havelka.
Havelka war auch einer von denen, durch die Pollock sich in ihr Leben hineinschob, wie Collin, wie der junge Urack, der sie immer wieder besuchen kam mit seiner Gitarre und seinen verrückten Platten und vor ihr auf dem Boden hockte und auf merkwürdig leere Art vor sich hinlächelte. Eines Nachts hatte Havelka an der Wohnungstür gestanden, ein hagerer Mann mit eingefallenen Wangen, und sich als Redaktionskollege Pollocks vorgestellt. Von diesem habe er erfahren, daß Frau Dr. Roth ganz in seiner Nähe wohne, eigentlich nur um die Ecke, seit anderthalb Stunden schon warteten er und seine Frau auf den Rettungsarzt, er bitte ungern um Hilfe, sicher habe Frau Dr. Roth den ganzen Tag über gearbeitet, vielleicht könne sie aber dennoch mitkommen, seine Frau fühle sich sehr, sehr schlecht, bekomme kaum Luft, beängstigend. Seither kümmerte sie sich um Dorothea Havelka, hatte ihr das Bett in der Klinik verschafft, Gerlinger zeigte sich großzügig, wie heißt der Mann, Havelka? Georg Havelka? Reden Sie mit der Oberin, Christine, das nächste Bett, das in der Frauenabteilung frei wird.
Wölfchen kam. »Wann essen wir?«
»Jetzt«, sagte sie und beeilte sich, den Reisbrei schmackhaft zu machen und die Brote zu belegen, wie der Junge sie mochte, und ihm das Gebräu aus Möhren und Bananen, das vitaminreiche, in einem Weinglas vorzusetzen, dann stellte er sich vor, es wäre wirklich Wein. Sie sprach von den Schularbeiten, die er nicht recht ernst nahm, er hatte die Gabe, alles rasch aufzufassen, zu rasch; er ließ sich nur schwer disziplinieren, sagte die Klassenlehrerin, eben wegen der großen Begabung, er muß lernen, sich ins Kollektiv einzufügen, Frau Doktor Roth, ja, jetzt schon, man kann nicht früh genug damit beginnen.
Sie war nicht recht bei der Sache, und Wölfchen merkte es, er verstummte und stocherte in seinem Reisbrei. Sie erschrak: da hat man schon mal die Stunde, sich seinem Kinde zu widmen, und läßt sie zerrinnen. »Am nächsten dienstfreien Sonntag, den ich habe«, versprach sie, »gehen wir zusammen in den Tierpark.«
»Mit dem Herrn Pollock?«
Das war die erste Begegnung gewesen, vor dem Affenkäfig; Pollock war grüßend auf sie zugetreten, behauptete, sie auf Gerlingers Housewarming Party kennengelernt zu haben, obwohl sie sich dessen nicht entsinnen konnte, zuviel Scotch, zu viele Leute; dann hatte er, zu Wölfchens Entzücken, die großen Affen, die bis dahin einander still gelaust hatten, durch ein ganz eigenartiges Schnalzen veranlaßt, die aufregendsten Fratzen zu ziehen, Kobolz zu schießen und an einem Arm hängend gewaltig zu schaukeln.
»Möchtest du, daß er mitkommt?« fragte sie.
Wölfchen nickte und erklärte, unaufgefordert, warum er Herrn Pollock möge: weil der vernünftig mit einem rede und weil er auch hinhöre, wenn man ihm etwas sage, und weil er zaubern könne, sicher habe er eine besondere Kraft, das mit den Affen sei ein Beispiel gewesen, oder die Blumen, die unter der Tischdecke wuchsen, und auch sie wäre anders, wenn Herr Pollock dabei sei, er könne nicht sagen wie, ganz anders eben.
»Ab in die Wanne«, sagte sie, und ein wenig später, als er ins Wasser stieg: »Und merk dir, alles auf der Welt geht mit natürlichen Dingen zu, auch wenn wir nicht immer genau wissen, wie etwas zustande kommt.« Während sie zusah, wie er sich wusch, hatte sie wieder das Gefühl von etwas Wunderbarem, das da aus ihrem Schoß gekommen war, dieser perfekte kleine Körper von außerordentlicher Beweglichkeit und mit sehr eigenem Willen; glatte warme Haut, die sie nun abrieb und trocknete. Wölfchen lachte, streckte sich ihr entgegen. Auf einmal empfand sie Angst: woher die erschreckenden Gesichter, die er da gemalt hatte, was waren das wirklich für Wesen, die er sah, und warum umflatterten sie mit ihren scheußlichen Flügeln das sonderbar steifbeinige Tier, das dem steilen Gipfel zustrebte, welchen Berges, welchen Phantasiebilds, wir kennen unsre eignen Kinder nicht, Gesellschaftswissenschaft ja, das wird gepaukt, als könnten die großen Kräfte, die am Wirken sind, transparent gemacht werden, solange die Kräfte in uns selbst schattenhaft bleiben und solange die Dichter immer noch mehr wissen von inneren Vorgängen als die Ärzte.
Sie küßte ihn zur Nacht. Er seufzte befriedigt, wandte den Kopf auf dem Kissen zur Seite, diesen schön geformten, schmalen Kopf: die Frauen würden ihm nachlaufen später einmal. Er zog den Teddybär zu sich, der abgeschabt und unansehnlich in der Ecke des Bettes saß, Freund schon ihrer Kindheit, nun an ihr Kind vererbt. Wölfchen hatte ein gespaltenes Verhältnis zu dem Teddy: einerseits war er, Wolf Roth, ins Alter zusammenfügbarer Modellflugzeuge und ferngesteuerter Mondlandegeräte aufgerückt, andererseits bedeutete der Bär immer noch Wärme, Wohlbefinden, Geborgenheit, war Vater- und Muttertier. Der Bär war es wohl auch, der auf Wölfchens Bild gipfelwärts tapste, unangefochten von den Geschöpfen der Unruhe; nicht ohne Rührung erkannte sie die Symbolik.
Dann hörte sie Schritte vor der Wohnungstür und beeilte sich zu öffnen, noch bevor der Besucher läuten konnte. Havelka überreichte dunkelrote Nelken – zu einer Jahreszeit, wo jede Schnittblume eine Rarität war. Ihren Dank wehrte er ab: er schulde ihr mehr als Blumen, die ihm übrigens der Kollege Pollock besorgt habe aus einer seiner Quellen. Pollock lasse grüßen, er habe kurzfristig verreisen müssen, eine Premiere in der Provinz.
»Ach so«, sagte sie und lächelte flüchtig. Dann führte sie den Gast ins Zimmer und arrangierte die Blumen, rotgekräuseltes Spitzenwerk, keineswegs Illusion, sondern dreidimensional und greifbar. »Mein kleiner Sohn meint, Herr Pollock könne zaubern.«
»Der Kollege Pollock hat eine Tante im Westen«, sagte Havelka, und da er Christines amüsierten Blick bemerkte: »Eine wirkliche Tante, Tante Cäcilie.«
»Finden Sie nicht, daß das irgendwie nicht zu ihm paßt«, sagte sie, »Verwandtschaft, Familie …«
»Es heißt, er habe eine Tochter gehabt. Das Kind kam in Auschwitz um.«
Sie füllte Wermut in die Gläser, mechanisch, und suchte sich vorzustellen, ein kleines mageres Mädchen, verschreckt, verständnislos, auf dem Weg ins Gas. »Und wo war er?«
»Nicht mehr im Lande.«
Nein, dachte sie, sie würde Pollock nicht fragen, sie würde warten, bis er selbst zu ihr von dem Kind sprach. Sie reichte Havelka das Glas; der akzeptierte, ein wenig feierlich, und hielt den Stiel zwischen den Fingern, breiten Fingern mit kurzgeschnittenen Nägeln. »Sehr zum Wohle«, sagte er dann und trank einen höflichen Schluck.
Sie betrachtete ihn, das weiße Hemd zum dunklen Anzug; er war seiner Frau wegen gekommen, das war klar. Aber er klammerte sich an das Thema Pollock. »Ihr kleiner Sohn hat in gewissem Sinne recht: Pollock hat einen unglaublichen Instinkt für Vorgänge und für Menschen; das erweckt den Eindruck, als folgten sie seiner Magie.«
»Also kein Zyniker?«
»Sagen wir, er weiß sich einzustellen.«
»Und Sie nicht?«
»Ich?« sagte er. »Ach Gott … Ich bin ein Arbeiterjunge aus dem Thüringischen und habe nur gelernt, geradeaus zu gehen, weshalb ich mir öfters den Kopf einrenne.«
Er war ein eher unscheinbarer Mensch; wer ihm auf der Straße begegnete, nahm ihn nur flüchtig wahr und vergaß ihn sofort; warum sollte sich ihm etwas in den Weg stellen, woran er sich den Kopf einrannte. Da waren allerdings die Augen, dachte sie, dunkle, wissende, ausdrucksvolle Augen, in denen aber auch eine Andeutung von Härte lag.
Jetzt sprach er von Vertrauen. Er vertraue ihr, und nicht etwa nur, weil sie es war, die Professor Gerlinger veranlaßt hatte, seine Frau in die Klinik aufzunehmen; sie möge nicht abwinken, so selbstverständlich sei das nicht gewesen, die Klinik sei eben doch ein Reservat für Privilegierte.
Und da er ihr vertraue, bitte er um die Wahrheit, die Wahrheit helfe ihm mehr als irgendwelche Ausflüchte, selbst die bestgemeinten.
Vertrauen, dachte sie; aber was wußte man im Grunde, man tastete sich heran an die Krankheit, es gab Erfahrungswerte, es gab Chemie und das Messer des Chirurgen, der Rest lag beim Patienten und dessen Verhältnis zum Arzt und, falls es ihn gab, beim lieben Gott. Sie verwarf den naheliegenden Gedanken, ihren Besucher an Gerlinger zu verweisen. Aber was ihm sagen, und wie es sagen; er war kein Kind, das man schonen mußte, und erschien dennoch verwundbar.
»Ich war sehr erschrocken, als ich Dorothea heute sah«, sagte er.
»Ihre Frau hat eine schwere Angina pectoris, das wissen Sie.«
»Also besteht wohl keine Hoffnung.«
Sie widersprach sofort. Hoffnung bestand immer. Da waren die Tests, die keine erkennbare Verschlechterung zeigten seit dem Tag der Aufnahme in die Klinik; gerade heute habe sie mit Oberarzt Kuschke gesprochen deswegen, der Oberarzt beurteile den Zustand der Patientin genauso wie sie; Frau Dorothea sei lebhaft und interessiert an allem, die Schmerzen, wenn sie aufträten, hielten sich in erträglichen Grenzen; man habe beschlossen, die Patientin gelegentlich aufstehen zu lassen, auch an die frische Luft dürfe sie, das lange Liegen mache nur debil.
Sie hielt inne. Hatte sie nicht zu hastig gesprochen, zu forsch, zu aufmunternd?
»Fast ein Menschenleben miteinander«, sagte er, »das bindet. Damals, als ich im Lager Le Vernet festsaß, hat sie den mexikanischen Konsul in Marseille bestochen und mir das rettende Visum verschafft. So haben wir uns kennengelernt.«
Christine horchte auf. »Le Vernet?«
»Le Vernet«, wiederholte er achtlos. »Dann kam die Emigrationszeit. Und danach wieder hier, in Deutschland, der Faschismus geschlagen, man glaubte, alles wird anders werden, Erschaffung einer neuen Welt« – er schwieg einen Moment – »und dann die schweren Jahre, in denen sie allein bleiben mußte …«
»Wieso?«
»Hat Ihnen Pollock das nicht erzählt?«
»Nein.«
»Es gehört auch nicht hierher«, sagte er abwehrend.
Sie drang nicht in ihn. Sie konnte ja, sollte der Punkt wichtig werden, sich bei Pollock erkundigen; Pollock hatte sie erst neulich wieder erinnert, in einem Nebensatz, daß in diesem Lande kaum einer von seiner Generation ohne dunkle Erlebnisse war, über die man sich ausschwieg; und schließlich war nicht Havelka der Patient, sondern seine Frau.
So kam sie, da Havelka immer noch auf ein entscheidendes Wort von ihr wartete, auf die Angina pectoris zurück, deutete an, wieviel beim Verlauf der Krankheit abhänge vom Psychischen, von der Atmosphäre, in der einer lebe, von der Perspektive, die einer sehe. Unter Umständen könne er seiner Frau da mehr helfen als sämtliche Ärzte mit ihren Tabletten und Spritzen …
»In dieser Zeit?« fragte er.
In der Welt, in der wir leben? – so hatte Gerlinger es formuliert.
Aber der Mann, der hier vor ihr saß, benahm sich nicht wie einer, der den Konsequenzen der eigenen Gedanken aus dem Weg zu gehen suchte.
»Ja, auch in dieser Zeit«, betonte sie. »War die Lage denn hoffnungsvoller in Le Vernet?«
»Aber wir waren naiver damals. Die Naivität ist eine große Kraft. Und der Glaube. Im übrigen glaubten wir damals nicht zu glauben. Wir glaubten zu wissen.«
Sie füllte sein Glas. »Und heute wissen wir so viel, daß wir nicht mehr glauben können. Das meinen Sie doch, oder?«
»Salud!« Er trank. »Aber komischerweise glaube ich immer noch, wenn auch differenzierter. Die Tatsache, daß die Revolution immer in den schwierigsten Ländern und zur schwierigsten Zeit kommt, besagt doch nichts gegen die Mehrheitstheorie.«
Er war klug, und offenbar wußte er vieles; es lohnte sich, mit ihm zu reden, seine Ansichten zu hören. Wenn nur nicht die Prognose wäre, die er von ihr verlangte und auf die er immer noch wartete …
»Was wissen Sie übrigens von Le Vernet, Frau Doktor?« fragte er.
»Ich lese gerade darüber.« Sie griff nach Collins Buch, das sie aufs Regal gelegt hatte, und schob es ihm hin. »Sie kennen den Autor?«
Er nickte.
»Persönlich?«
»O ja.« Der Ton deutete an: eine nicht unproblematische Beziehung. »Ich war sein Kommandeur in Spanien.«
Sie dachte nach: das Buch als Indikation, ein Mensch ist des anderen Krankheit.
Und dann fragte sie: »Unter welchem Namen erscheinen Sie da?«
»In Collins Buch?« Er lachte. »Unter gar keinem.«
»Aber wie kann er Sie zu erwähnen versäumen? Seinen Kommandeur? In einem Buch, das lange Passagen hindurch mehr Chronik ist als Roman?«
Havelka hob die Hände.
»Er mochte Sie nicht?«
»Wir waren beide sehr jung damals«, sagte er ausweichend. »Sein erstes Buch war herausgekommen, in Moskau gar, eine lange Novelle: Hans Collin, Das Flugblatt. Als Arbeiter hatte ich große Ehrfurcht vor dem Wort, ich habe sie heute noch, ich dachte also, der da muß weg von der Front, der muß erhalten bleiben für die Menschheit, ganz gleich, wie dieser Krieg ausgeht, und sagte ihm: Genosse Collin, du gehst zurück nach Albacete, Sonderauftrag.«
»Und er ging?«
»Nun, es war ein Befehl. Genosse Havelka, sagte er mir beim Abschied, wenn du mich je brauchen solltest, auf mich kannst du zählen.«
»Aber das war doch eine durchaus ehrenwerte Regung.«
Er nickte. »Ich bin überzeugt, daß Hans Collin viele ehrenwerte Regungen hat, und daß es ihm gar nicht leicht fällt, sie zu unterdrücken.«
»Mir erscheint er eigentlich wie ein Mensch, der gern gütig sein möchte, der aber nie sicher ist, wie ihm seine Güte bekommen könnte.«
»Das ist doch kein Widerspruch zu dem, was ich sagte.«
»Außerdem bedrückt ihn sicher manches; das spürt man.«
»Woher kennen Sie ihn denn so gut, Frau Doktor?«
»Er liegt bei mir auf Station.«
Der Ausdruck in den Augen, die Stimme plötzlich heiser: »Ja, so.« Und dann: »Ist es schlimm?«
»Er wird leben.«
Havelka stand auf, trat ans Fenster, blickte hinaus auf die Straße, fünfstöckige Reihenhäuser, die Fenster gelbliche Vierecke oder bläulich erhellt durch das flimmernde Licht der Fernsehgeräte. »Er ja …«
»Aber Herr Havelka, so dürfen Sie das nicht verstehen!« Sie war mit drei Schritten bei ihm. »Das läßt sich gar nicht vergleichen, die Fälle liegen völlig anders …«
Er nahm ihre Hand und sprach beruhigende Worte. Es sei unfair gewesen von ihm, sie zu überfallen und zu bedrängen. Und sie habe ihm ja auch sehr geholfen, denn nun werde er sich auf das Schlimmste einstellen können, ohne deshalb die Hoffnung zu verlieren. Und ihr Gespräch habe ihn, wenn er dessen nicht schon sicher gewesen wäre, noch einmal davon überzeugt, daß alles Menschenmögliche getan werde für seine Frau. Und wenn sie gestatte, käme er in der Klinik bei ihr vorbei, wenn er seine Frau nächstes Mal besuche.
Dann verabschiedete er sich rasch, er habe noch zu arbeiten. Sie war dankbar, daß er ging.
4
Daß er gehaßt wurde, nahm er in Kauf. Daß man ihn fürchtete, bereitete ihm, wenn nicht Genugtuung, so doch zumindest kein Unbehagen. Urack war der Überzeugung: das gehört zum Beruf, ich bin Revolutionär, die Welt umstülpen kann man nur mit Gewalt. Gewalt aber, das hatte er sehr bald gelernt, war nicht der einzelne Schuß, die einzelne Bombe. Einstmals vielleicht war es das noch gewesen, in Spanien, hinter den Franco-Linien, als der verrückte Amerikaner zu ihm stieß, der Journalist, der das mal kennenlernen wollte und der dann wohl auch ein Buch darüber schrieb, das war wenigstens einer, der trinken konnte; sie hatten die halbe Nacht zusammengehockt und geredet, gegen Morgen dann jagten sie die Brücke in die Luft. Gewalt, moderne Gewalt, war ein kunstvoll zusammengefügter Apparat, Informationen, Auswertung, Anordnung, Durchführung, und der diese Gewalt dann zu spüren kriegte, wußte oft nicht einmal, aus welcher Ecke sie kam. Gewalt war ein Wort, in ein Telephon gesprochen, worauf irgendwo die Erde sich auftat und der, der auf dem Fleck gestanden hatte, verschwand: Klappe zu, Affe tot.