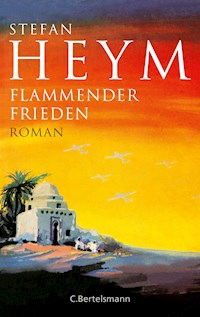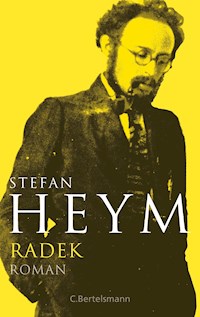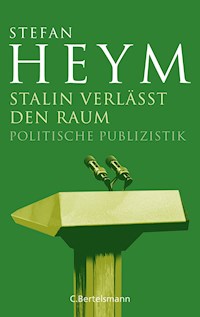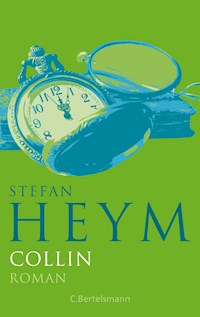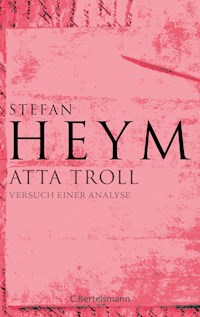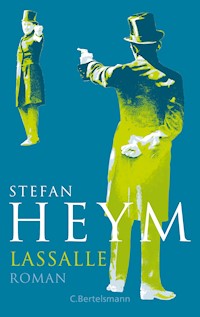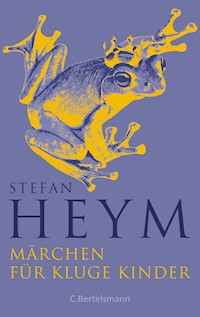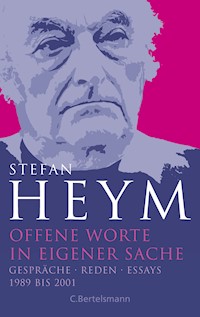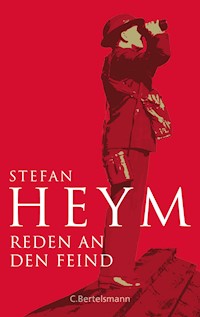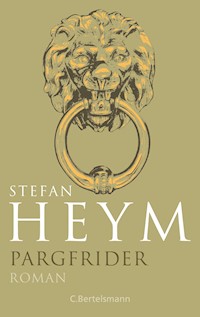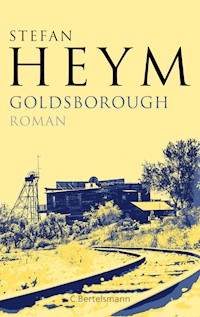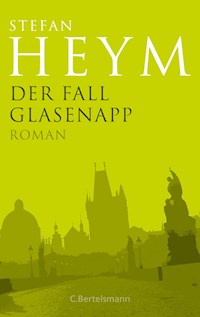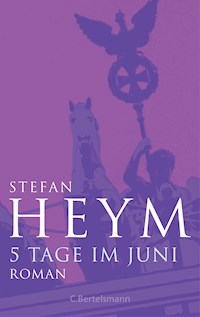14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Stefan-Heym-Werkausgabe, Erzählungen
- Sprache: Deutsch
Ein Querschnitt durch ein einzigartiges Schriftstellerleben
Diese Zusammenstellung der Erzählungen von Stefan Heym gibt einen repräsentativen Querschnitt durch ein einzigartiges Schriststellerleben. Wie kaum ein anderer mußte Heym Unrecht, diktatorische Gewaltanmaßung und Verfolgung erleben. Er floh vor den Nazis, vor McCarthy, und auch in der DDR war er den Machthabern immer unbehaglich. Die Erzählungen geben allein durch die Orte, an denen sie entstanden sind, ein Abbild seiner Biographie. Sie zeugen zudem von der Entwicklung des Autors Heym, eines Sich-Vergewisserns der schriftstellerischen Mittel. Und nicht zuletzt ist seinen Texten der menschliche Blick jenseits ideologischer Gewissheiten eigen, den Heym sich allen Widrigkeiten zum Trotz bewahrt hat.
Diese Ausgabe wurde um die bisher unveröffentlichten Erzählungen »Bericht über eine Literaturkonferenz« und »Der Urenkel« erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch:
Diese Zusammenstellung der Erzählungen von Stefan Heym spiegeln ein einzigartiges Schriftstellerleben. Wie kaum ein anderer mußte Heym Unrecht, diktatorische Gewaltanmaßung und Verfolgung erleben. Er floh vor den Nazis, vor McCarthy, und auch in der DDR war er den Machthabern immer unbehaglich. Die Erzählungen geben allein durch die Orte, an denen sie entstanden sind, ein Abbild seiner Biographie. Sie zeugen zudem von der Entwicklung des Autors Heym, eines Sich-Vergewisserns der schriftstellerischen Mittel. Und nicht zuletzt ist allen Texten der menschliche Blick jenseits ideologischer Gewißheiten eigen, den Heym sich allen Widrigkeiten zum Trotz bewahrt hat.
Stefan Heyms erzählerisches Werk als Spiegel des Lebens eines streitbaren jüdischen Kosmopoliten, bei C. Bertelsmann erstmals erschienen 1977, um die bisher unveröffentlichte Erzählung „Bericht über eine Literaturkonferenz“ erweitert, nun als Teil der digitalen Werkausgabe.
»Eine wichtige und eindringliche Stimme!« Nürnberger Nachrichten
Zum Autor:
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat New York schrieb er seine ersten Romane. In der McCarthy-Ära kehrte er nach Europa zurück und fand 1953 Zuflucht, aber auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausgezeichnet und international bekannt. Er gilt als Symbolfigur des aufrechten Gangs und ist einer der maßgeblichen Autoren der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001 in Israel.
Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook.
Stefan Heym
Gesammelte Erzählungen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
E-Book-Ausgabe 2021
Copyright © 1960, 1976, 1984, 2021 by Inge Heym
Copyright © 1977 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Penguin Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Kwauka, München
Umschlagmotiv: © privat
Satz: Buchwerkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-27843-4V002
www.cbertelsmann.de
Die Erzählungen der Jahre 1936 und 1945–1951 sind zuerst in englischer Sprache geschrieben worden und wurden vom Autor übersetzt.
EDITORISCHNOTIZ
In einigen der hier versammelten Erzählungen verwendet Stefan Heym die Bezeichnung „Neger“. Dies war zur Entstehungszeit der Texte gebräuchlich und keineswegs herabwürdigend, Menschen mit schwarzer Hautfarbe als „Neger“ zu bezeichnen. Aus dem Textzusammenhang ist unschwer zu erkennen, dass der Autor fern jeden Verdachts der Diskriminierung seiner Figuren steht.
C. Bertelsmann Verlag
Prag (1933–1935)
Zwei Diktatoren
Marius
Es ist ein halbdunkler Kellerraum. Durch ein kleines Loch in der Wand, Fenster genannt, fällt, je nachdem die Wolken draußen sich lichten oder zusammenballen, stärkeres oder schwach zitterndes Licht ein. Ein großer, für das niedere Gemach zu großer Mann geht darin auf und ab, manchmal rüttelt er an der Tür, sein Gesicht rötet sich, dick schwillt eine Ader auf seiner kurzen Stirn – dann flucht er, grob, bäurisch, und fährt sich mit eigenartig täppischer, Verzweiflung bedeutender Gebärde über sein glatt geschorenes, fast weißes Haar.
Seine Toga ist grau und befleckt, die Purpurstreifen des Consuls hat er abgetrennt vor seiner Flucht, aber man hat ihn natürlich doch erkannt und geschnappt – wer kennt ihn denn nicht, Marius, zum sechsten Male Consul gegen das Gesetz, Sieger über Jugurtha, den Neger, über die aufrührerischen Italiker, über Cimbern und Teutonen? Er sieht seine Hände durch den Dämmer schimmern – es war falsch, sagt er sich. Das sind nicht mehr Soldatenhände, weiß und weich sind sie geworden, Hände eines Politikers und doch zu ungeschickt für dieses lügenhaft-feine Spiel. Solange er General war, solange sie ihn brauchten mit seinen Legionen: in Afrika, in den Alpen, in Asien – so lange erkannten sie ihn an, die noblen Herren, denen er schon als Volkstribun erheblich auf die Finger geklopft hatte. Jedoch hinter seinem Rücken – oh, das hatte er immer gewußt, sollten sie nur nicht glauben, daß er so dumm sei –, hinter seinem Rücken rümpften sie die Nasen, ihre vornehmen, wenn er beim Essen sich gehen ließ, aufstieß und hochzog, schnalzte und schlürfte. Aber ins Gesicht waren sie fein devot, er war der Herr der Legionen, abgöttisch verehrten ihn die Soldaten – nun nicht mehr, nun nicht mehr, seit jener gekommen war, der immer dann auftauchte, wenn der Gipfel des Ruhms erreicht zu sein schien, der Zaunkönig, den er, Marius, der Adler, mit in die Höhe getragen hatte und der nun noch einen Meter höher flog und frech grinste, das listige Gigerl, das sich nicht anstrengte, dem alles in den Schoß fiel, der adrette Schleimer, der im Feldlager immer saubere Fingernägel und parfümierte Damen hatte, dieser Sulla …
Den haßt er, den und seine Freunde, die Nobiles, die adligen Gauner – einmal, zweimal hatte er sie geschröpft, Proskriptionslisten hatte er anschlagen lassen, wenn der Sulla nicht da war, in Afrika kommandierte oder Asien – aber flink war Sulla, plötzlich wieder vor Rom, mit unheimlicher Übermacht, das Gigerl war feiner, er konnte da nicht mit. Jetzt ist er sein Gefangener – oh, wie er ihn haßt!
Was waren die Cimbern und Teutonen dagegen! Die waren ihm eigentlich sympathisch gewesen, Riesen wie er, Soldaten wie er, mit großen, starkbusigen Weibern, wie er sie liebte – mit diesen Burschen konnte man sich herumschlagen, die waren zu fassen, bei Aquae Sextiae, bei Vercellae – der andere war eine Schlange, schoß plötzlich hervor, war nicht zu berechnen, schillernd, glatt; da war er machtlos, Marius, Bauernsohn, Prolet, General und Diktator, so oft es in Rom an allen Ecken brannte.
Wieder rüttelt er an der Tür. Es kann doch nicht sein, daß man ihn in diesem Loch verhungern läßt wie eine alte Katze!
Die Tür geht auf. Plötzlich ergießt sich Licht in den Raum, helles, fließendes Licht. Man sieht den Schmutz auf Marius, die eingefallenen Wangen, den verwahrlosten, stoppligen Bart.
Erst ist Marius geblendet. Dann erkennt er, daß eine Gestalt sich von der Tür löst, unerhört groß, riesenhafter noch als er selber, ein blitzendes Schwert in der Hand, die Ohrläppchen von einem Pfriemen durchbohrt, rötliches Haar – ein germanischer Sklave. Der Henker.
Marius fühlt nichts. Er erschrickt nicht, obzwar das Ende in Sekundennähe vor ihm steht. Er versinkt in eine Art Narkose, die aber nur das Gefühl, die Angst, nicht aber den Geist betäubt. Immer kam diese wohltätige Ruhe in entscheidenden Momenten.
»Zurück!« schreit er den Henker an.
Bei dieser Stimme fährt der Sklave zusammen. Alte Erinnerungen quellen aus dem Unterbewußten. Hänge der Alpen. Heranflutende, pelzbehängte Germanen. Und drüben die eisernen Kolonnen der Legionen. Und über ihnen, weiß mit roten Streifen, der General. Mit dieser Stimme. Der Stimme, die da rief: »Zurück!« und die tatsächlich die wilden, vorwärts gedrängten Scharen der Cimbern zusammenpreßte, erdrückte, erschlug.
Der Sklave und der Diktator starren sich an. Als mäßen sie Energien aneinander. Schließlich müssen sie lächeln. Das ist ein Gegner, denkt Marius, den man lieben kann. Das ist Kraft von meiner Kraft.
Dann verlassen sie den Kerker. Marius fährt nach Afrika, um noch einmal Rom zu erobern und Consul zu werden, zum siebenten Male …
Sulla
Bei Puteoli ist die Sonne mild. Die Pinien verbreiten Schatten und die Quellen Kühle. In einem Garten sitzt ein Mann, dessen Alter schwer zu erraten ist. Er kann dreißig sein oder auch fünfzig oder fünfundfünfzig. Er hat kalte graue Augen, und sein Körper ist von beinahe zierlichem Ebenmaß. Auf seinem Knie liegt ein Wachstäfelchen, die rechte Hand spielt mit dem Schreibgriffel.
Das ist Sulla, der Diktator in Pension, der einzige Herrscher der Weltgeschichte, der es fertigbrachte aufzuhören, als es am schönsten war.
Sulla starrt irgendwo ein Loch in die Luft. Am schönsten, ja. Kein Gegner war mehr da – die Parteien hatte er geknebelt, die Legionen gehörten ihm, Marius war gestorben am vierzehnten Tag seines siebenten Consulats, das sich der Bauer – wie Sulla ihn insgeheim nennt – erobert hat gleich einem Dieb, als er, Sulla, in Asien ein paar Königen Vernunft beibrachte, Vernunft und römische Polizei.
Puteoli ist schöner, Puteoli und das Schreiben. Was ist ein Soldat, was ist ein Politiker für die Ewigkeit? Aber ein Schriftsteller – das ist etwas Besseres. Bücher wird man lesen in hundert Jahren und, vielleicht, auch in tausend – Schlachten sind so schnell vergessen, nutzlos sind sie im Grunde …
Der Bauer mochte an den Ruhm der Schlachten glauben, der war primitiv, der kostete alles bis zu Ende, was er tat. Aber er, Sulla? Er ist zu intellektuell, zu sehr Gehirn – Marius war vielleicht glücklicher. Obwohl sich Sulla nichts mehr gewünscht hätte als einen Augenblick reinen Glücks. Sulla hatte als »Felix« triumphiert, als Glücklicher, nie war ihm eine Schlacht verlorengegangen, alles fiel ihm nur so zu, wenn er es vorher mit seinem scharfen Geist zerlegt hatte – aber er war deshalb noch nicht glücklich. Er sah die kriechenden Larven seiner Anhänger, er roch den unsagbar ekelhaften Geruch des Pöbels, der seinen Wagen schreiend umlagerte – war das Glück?
Je mehr er über sich nachdenkt, desto unklarer wird er sich. In seinen Memoirenbänden, an deren zweiundzwanzigstem er arbeitet, denkt er nur über sich nach und ist am Ende doch so klug wie am Anfang. War das alles Lüge, das ganze Leben, Lüge und zwecklos? Die Suche nach dem Glück, das sich dauernd ihm schenkte? Hatte er sich darum möglicherweise zu betäuben gesucht in dauerndem Kampfe? Im Kampfe mit Marius?
Wer war dieser Marius schon? War das ein Gegner für sein überlegenes Gehirn? Er verachtet den Bauern – er haßt ihn nicht, hat ihn nie gehaßt; aber er beneidet ihn, ganz, ganz tief im Herzen. Marius, der poltern konnte, schreien und schlagen, während er leise seines Weges ging, seine Schlachten acht Tage, bevor er sie schlug, fertig im Kopfe herumtragend –
Das erste Mal waren sie zusammengestoßen im Feldzug gegen Jugurtha. Damals war Sulla ein kleiner Quaestor, Adjutant, nicht einmal regulärer Truppenführer. Marius hetzte Jugurtha durch halb Nordafrika, aber er bekam ihn nicht. Er, Sulla, arbeitete still. Bestach ein paar Araberfürsten, dann nahm er Jugurtha mit einer Handvoll Leute fest – was war schon dabei? Marius schäumte.
Von da an kitzelte er Marius in jedem Krieg. Ob gegen Cimbern und Teutonen, ob gegen die italischen Bundesgenossen, die rebellierten, ob gegen Mithridates – Marius machte die Holzfällerarbeit, er, Sulla, schöpfte den Rahm ab.
Dann verjagten sie sich gegenseitig aus Rom. Sulla lächelt, stets war er aufgetaucht, wenn der andere sich gerade festnisten wollte. Es war ein hämisches Vergnügen, mit dem Riesen zu spielen. Der ärgerte sich so.
Nun war ihm der Bauer weggestorben. Alles machte keinen Spaß mehr. Mochten die Römer sich selber regieren – er setzte sich nach Puteoli, aß gut, schrieb einiges und nahm schöne Mädchen. Merkwürdig, auch darin hatte Marius keine Kultur. Sulla aber genießt – er hatte fünfmal geheiratet und noch verschiedenes nebenbei getrieben – alles mit der Miene des Grandseigneurs, nur zu einem Drittel oder Viertel innerlich beteiligt. Auch hier Glückspilz – die Frauen fliegen ihm zu – und doch lässig und unglücklich.
Und Sulla schreibt:
»Vielleicht hätte Marius verdient, Herr über Rom zu sein. Ich aber ließ ihn nicht dazu kommen, ich war gleichsam sein böser Geist. Aber nicht etwa im Ernste – er war mir gleichgültig. Sondern es reizte mich, ihn zu reizen, und sein Schaum vorm Munde entlockte mir nur einen mitleidigen Blick …
Ich war wie eine Frau, die einen Mann quält, um sich an seiner Verzweiflung, seinem Haß zu ergötzen. Und doch beneidet sie den Mann, der imstande ist, zu hassen oder zu verzweifeln, während sie kalt bleiben muß durch ein unseliges Schicksal.«
Don Juans Himmelfahrt
Don Juan war alt geworden. Er, der ewig Jugendliche, hatte wie mit einem Schlag alles verloren, was ihn zum Idol der Welt, besser: des weiblichen Teils der Welt, gemacht hatte. Eines Morgens nützten alle Schminktiegelchen, alle Tinkturen und Puder nichts mehr – Don Juan war alt, so alt. So setzte er sich in eine Postchaise und fuhr nach einer kleinen Stadt, zu einer seiner ehemaligen Geliebten, die längst dick und Familienmutter geworden war. Man quartierte ihn in einer kalten Mansarde ein – weniger aus Liebe und Mitleid, sondern weil man den Honoratioren zeigen konnte: »Sehen Sie – bei uns wohnt er, der alte Don Juan – wollen Sie ihn anschauen?« Und dann trappelte die Gesellschaft der Bäuche hinauf zu Don Juans Kammer – da saß er, der große Charmeur, der Schreck aller Ehegatten, zahnlos, ungefährlich, in einem zerschlissenen Lederfauteuil, und sagte müde den Besuchern: »Bonsoir, messieurs et mesdames.« Doch die Bäuche zogen sich schnell zurück vor diesem zerrissenen, hageren Gesicht, nur manchmal blieb ein Provinzdämchen länger oben, abgestoßen und doch zugleich angelockt von dem rätselhaften Flimmern der Augen Don Juans.
Als die Magd ihm eines Tags sein kärgliches Mahl in die Kammer brachte, fuhr sie mit einem Aufschrei zurück. Der da im Sessel saß, war wie ein Gerippe, unter den weißen Seidenstrümpfen die knochigen Beine des Todes. Don Juan aber flog auf, leicht abgetan alle irdische Trockenheit, zu den Himmeln.
Er kannte dieses Leichtsein; es war die alte Beschwingtheit seiner Liebesspiele – jenes Unerklärliche, das wie Ahnung die Frauen befiel, wenn sie ihn nur sahen. Die Wolken kamen wie reizende Balletteusen der Hofoper, und im Vorbeifahren strich er mit seiner langfingrigen Hand leicht über ihre platinblonden Locken. Die Pforten des obersten Himmels sprangen weit auf vor ihm – man hatte ihn lange erwartet und ließ ihn mit dem goldbestickten Rock bekleiden, den er vor den Königinnen getragen hatte. Man war sich wohl bewußt im Himmel, wie lächerlich Don Juan im engelhaften Nachthemd ausgesehen hätte.
Trotzdem gab es eine starke Opposition gegen ihn, ausgehend von der puritanischen Apostelpartei, man sprach in den himmlischen Caféhauszirkeln sogar davon, die Apostel hätten den lieben Gott gegen Don Juan beeinflußt. Don Juan wohnte provisorisch – bis zur Entscheidung über seine Zugehörigkeit zu Paradies oder Hölle – bei der heiligen Magdalena, und die beiden tauschten, wenn es Abend wurde und sie nicht die göttliche Komödie besuchten, ihre kleinen und großen Erlebnisse aus. Magdalena war sehr begeistert von Don Juan.
Inzwischen hatten die Puritaner nicht geruht, sie hatten dem himmlischen Generalstaatsanwalt das gesamte Material, das gegen Don Juan vorlag – und es war eine ganze Menge! –, zugeleitet, hatten eine Massenversammlung einberufen: Es wäre eine Schande, wenn eine so unmoralische Seele, wie Don Juan, ins Paradies käme … Und diese Resolution wurde dem lieben Gott auf den Frühstückstisch geschmuggelt.
So kam der Tag des Gerichts. Kleine, pausbäckige Engel bliesen in große Posaunen. Der Generalstaatsanwalt, der als einziger im Himmel eine hochgeschlossene Weste trug als Symbol seiner Integrität, erschien an der Spitze der Apostelpartei. Die Apostel, sämtlich ältere Herren, schüttelten mißbilligend ihre Bärte, als sie Don Juan, der dem Publikum vertraulich zulächelte, in seinem bunten Rock im Saal erscheinen sahen. Seine Verteidigung hatte die heilige Magdalena übernommen. Den Vorsitz führte der liebe Gott persönlich. Nach dreimaligem Posaunenstoß begann die Verhandlung. Don Juans Personalien wurden aufgenommen, ein genaues Register seiner Affären sowie seiner guten und bösen Taten verlesen – dann erhielt der Generalstaatsanwalt das Wort.
Er sprach ölig und salbungsvoll, mitunter vergrub er seine Daumen in den Ärmelausschnitten seiner Weste. Dieser Don Juan, sagte er, dieser Filou! Dieser Erzgauner, der nie im Leben auch nur einen Heller rechtmäßig erworben hatte! Der kalt und gefühllos die Herzen der Mädchen und Frauen brach und nahm und wieder wegwarf, als sei das alles – mit Verlaub – ein Dreck! Ein Ehebrecher par excellence! Der nie die Tränen sah, die er hinter sich ließ! Ein Mensch ohne Gewissen, ein Mörder und Kavalier! Der seine Kuckuckseier in die Nester löblicher Ehrenmänner legte, ihr Haupt mit Schande und ihr Haus mit Bastarden belastend! Ein Schmetterling, der küßte und davonflog; ein Gewissenloser, der göttliche Gesetze lächerlich machte und die Schranken der Sittsamkeit mit leichtem Fuß übertanzte!
Gott hielt die Waage der Gerechtigkeit spielerisch zwischen zwei Fingern. Die Schale Schuld senkte sich tief. Gott blickte auf Don Juan, und siehe – der zuckte die Achseln. Der liebe Gott gab der heiligen Magdalena das Wort.
»Ihr scheint«, sprach sie fast ironisch, »euer irdisches Sein längst vergessen zu haben. Was wißt ihr noch vom Glück der Menschen, von ihren Wünschen, Begierden, Sehnsüchten – und was wißt ihr von den Frauen? Ein einziges glückliches Lächeln einer Frau, die dieser geniale Mensch Don Juan einmal mit sich selbst erfüllt hat, das Lächeln einer Frau, die von einer Seligkeit gekostet hat, wie sie einmal in Jahrtausenden einem Wesen der Erde geschenkt wird – ein einziges solches Lächeln wiegt schwerer als sämtliche moraltriefenden Sätze des Generalstaatsanwalts. Und ist dieser Don Juan«, pathetisch hob sie den Arm, »ist dieser Don Juan zu verurteilen, weil er die Seligkeiten, die zu verschenken ihm unbeschränkt gegeben war, weil er dieses Glück mit vollen Händen und leichten Herzens ausschüttete?«
Der liebe Gott verzog lächelnd den Mund und ließ die Schale Schuld durch einen kleinen Druck des Fingers emporschnellen, daß alle Vorwürfe und Anklagen hinunterfielen ins Nichts. Das Urteil der höchsten Instanz war gesprochen. Man fragte Don Juan, wo er seinen himmlischen Sitz aufzuschlagen gedenke.
Und Don Juan, kurz entschlossen, stellte den schriftlichen Antrag, ins Paradies der Mohammedaner versetzt zu werden. Ihm sei weibliche Bedienung sympathischer, sagte er.
Männliche Gedanken
So – jetzt ist es ganz dunkel geworden. Nein – wenn ich den Mantel zur Seite schiebe, kommt durch einen Spalt ein wenig Licht. Früher, im Theater, konnte man lachen über so was. Der Herr Liebhaber im Schrank und draußen die gnädige Frau mit dem nichts ahnenden Gatten. Aber daß man nun selber in der gleichen Situation ist! Mir ist gar nicht zum Lachen. Im Gegenteil, ich verspüre einen sehr unangenehmen Druck im Bauch. Immer, wenn es brenzlig zu werden droht, hab ich das. Zu dumm.
Es wird heiß hier drin. Und diese lästigen Mäntel und Anzüge! Katja muß Mottenkugeln im Schrank haben – das beizt die Nasenschleimhaut. Aber den Motten soll es nichts schaden. Hätte sich Katja auch eher überlegen können, daß sie diesen Schrank als Aufbewahrungsort für ihre Freunde benutzen würde – hätte die verdammten Mottenkugeln – Herrgott! Ich möcht ihm die Mottenkugeln in seinen fetten Hals stecken, dem Idioten, dem Gustav!
Dabei war alles so sicher. »Jacques«, hat sie zu mir gesagt, »Gustav verreist heute abend. Wirst du kommen, Jacques?« Wenn ich das höre, diese süßen Töne – da kann ich natürlich nicht nein sagen. Und jetzt steh ich im Schrank und schwitze. Das hat man von der Liebe. Dabei kann man sich nicht mal aufrichten. Sofort stößt man mit dem Kopf an. Die Liebhaber auf der Bühne haben’s besser – ich glaube, die gehen hinten aus ihrem Schrank heraus. Ich werd mir den Kragen aufmachen. – Was sagt er draußen?
»Katja, liebes Herz – und kümmre dich ein bißchen um Jacques – ich weiß, er ist einsam …« Zerspringen soll er! Mitleid mit mir auch noch. Wenn er wüßte, was los ist, würde er schon aufhören, Mitleid zu haben. Warum ist er eigentlich zurückgekommen? Was hat der Mann zurückzukommen, nachdem er groß ankündigt, daß er verreist?! Das ist gegen die Spielregeln. Das ist direkt gemein.
»Katjakind, ich muß meinen Regenschirm haben. Ohne Regenschirm kann ich nicht verreisen. Wo war denn der Regenschirm?« – »In der Garderobe, vielleicht?« – Ich höre ihn abtrampeln. Daß der Mann auch immer so trampeln muß! Ich werde mal an die Tür klopfen. Soll sie dem Gustav schon den Regenschirm geben! Nur weg soll er gehen. Ich ersticke sonst. Ich kann mich nicht rühren, nicht einmal das Taschentuch herausholen. Der Schweiß brennt mir in den Augenwinkeln.
Gustav kommt wieder. »Nein, mein Kind, der Schirm muß im Schrank sein.« Im Schrank … Also bei mir. – Sonderbar, ich bin gar nicht mehr aufgeregt. In dreißig Sekunden spätestens wird Gustav mich entdecken. Und ich stehe wie eine Leiche im Schrank – der Kragen ist offen – ich muß ganz rot aussehen im Gesicht – eine fabelhaft männliche Gestalt – haha!
Aber er denkt ja gar nicht dran, den Schirm zu holen! Was macht er denn? Was kichert Katja so? »Also – mein Kind – nur zum Abschied – noch einen Kuß, ja?« Sie küssen sich. Und ich muß mir das anhören! Glänzend ist das – sie küssen sich! Ich denke, er wollte seinen Schirm holen? – Schöner Schirm das! Da ist er ja übrigens – neben mir steht er, dieser nette Schirm. Wenn ich jetzt den Schrank aufmachte und sagte: ›Da ist dein Schirm, lieber Gustav; nun mach, daß du fortkommst!‹? Das sind so die Wunschträume eines besseren Junggesellen. Außerdem hat Gustav keinen Humor, er bekäme einen Schlaganfall. Bestimmt, er bekäme ihn, und dann müßte ich Katja heiraten. Nein, zum Heiraten ist sie doch nicht ganz die Richtige. Eigentlich ulkig, daß Gustav es so lange mit ihr aushält. Ich könnte das nicht. Ich bin mehr ein Schmetterling, der die Tautropfen aus den Blumen trinkt. Poesie unter Mottenkugeln! Ich hab es mit den Insekten heute. – Wie lange poussieren sie noch da draußen? Ich frage: Muß das sein? Ist das vielleicht üblich zwischen Ehegatten? Übrigens zittern meine Knie; ich werde langsam alt. So fängt es an, und dann zittern die Hände und dann der Kopf, und dann ist es aus. Meine Hände zittern auch, aber ich glaube, vor Wut. Die Luft ist ausgesprochen schlecht und dick. Wie in einem Unterseeboot, das unter Wasser ein Leck bekommen hat – arme, verzweifelte Matrosen. Manchmal hab ich Angstträume, daß es mir auch so gehen könnte – jetzt geht es mir so. Ist das nicht lustig, wie die Gedanken ihre eigenen Wege ziehen? Man kann ihnen stundenlang zusehen und sich amüsieren. Wenn ich nur einmal durchatmen könnte!
»Also, du wirst mir treu sein – bestimmt, Katja?« Was der für eine Einbildungskraft hat! Ja – die Menschen leben von Illusionen. Ich möchte nur wissen, wer vor mir schon in diesem Schrank gesteckt hat. »Bestimmt bin ich dir treu. Wie kannst du nur vermuten!« Wie sie zwitschert! Frauen haben mitunter gräßlich unsympathische Töne in ihrer Stimme. Ich finde Katja einfach unsittlich. So eine Frechheit – dem eigenen Mann ins Gesicht zu lügen! Wo der Galan im Schrank steht, dicht daneben! Daß sie nicht einmal errötet! Aber vielleicht errötet sie, ich kann es ja nicht sehen. Jetzt küßt er sie wieder. Vermutlich streichelt er sie jetzt an allen möglichen Stellen. Ich hasse ihn! Ich möchte ihn …! – aber ich bin ja im Schrank. Machtlos, eingesperrt. Nicht einmal husten darf ich. Dabei möcht ich doch so gerne husten. Man möchte immer, wenn man unter keinen Umständen darf. Philosophie zwischen staubigen Mänteln. Das Blut steigt mir zu Kopf.
»Katja, liebst du mich?« Gustav wird den Zug verpassen, wenn er noch lange fragt. Und den Schirm will er auch haben. Wenn es doch schon endlich so weit wäre! Dann werden wir uns duellieren – Gustav hat immer für Ritterlichkeit geschwärmt. Wegen Katja werd ich mich noch erschießen lassen müssen. Peinlich, peinlich.
»Gusti – mein Einziger!« Ich habe meiner Meinung über diese Person bereits Ausdruck verliehen. Katja: Ehebrecherin! Lügnerin! – Ich ersticke. Er wird tatsächlich den Zug verpassen. Alles wegen seiner Frau! Man soll Frauen nicht so wichtig nehmen.
Da – er rückt mit dem Stuhl. »Und wenn ich wiederkomme, holst du mich von der Bahn ab, ja?!« Welch rührende Liebe! Wenn doch das ganze Haus zusammenstürzte! Samt diesem Schrank! Na endlich – er räuspert sich gründlich. Also will er gehen. »Weißt du, Katja – im Grunde ist es lächerlich, immerzu einen Schirm herumzutragen. Ich werde keinen Schirm mitnehmen.«
Das hat ihm Gott eingegeben. – Mit einem Male wird mir Gustav unerhört sympathisch. Was er für eine nette Knollennase hat! Ich sollte ihm seine Frau wirklich nicht – na, sagen wir: abnutzen.
»Auf Wiedersehen, Katja!« – »Viel Glück, Gusti! Bleib mir schön gesund!« Kindisches Getue. Er geht. Nein, er kommt noch einmal zurückgetrampelt. »Ich habe was vergessen.« Was denn schon wieder? Schrecklich vergeßlich ist er!
Er klopft! – Klopft hier an den Schrank!! Ich höre: »Auf Wiedersehen, Jacques!« … Ich lache. Ja, ich lache! … Der Schrank sinkt zusammen – – – alles um mich wird leer – – das nennt man also eine Ohnmacht …
Unterm Wagen
Damals saß ich im Untersuchungsgefängnis der Stadt Bismarck. Wegen einer Alkoholgeschichte, ich war so unvorsichtig gewesen, mir die Jacke auszuziehen, als gerade ein Wachmann neben mir stand. Ich sehe noch, wie er mit Kugelaugen auf meine Gesäßtasche starrt – instinktiv greife ich hin – irgendwie mußte meine Kognakflasche sich verschoben haben, und ehe ich sie zurück in die Tiefen der Tasche stoßen kann, legt mir der große, unangenehm kräftig aussehende Policeman seine schwere Hand auf die Schulter. »Komm mit, mein Junge!« sagte er.
Und so saß ich eben. Ich war sehr ruhig. Was konnte mir schon passieren? Mein Vater, der damals einer der reichsten Männer von Bismarck war, würde mich schon durch seinen Advokaten heraushauen lassen. Da hatte ich gar keine Angst. Ärgerlicher war schon, daß ich heute abend das Rendezvous mit Mabel verpassen würde. Mabel! – Ich war eben in die schönsten Träume vertieft, in denen Mabel die Hauptrolle spielte, da wurde die Tür aufgerissen und ein Mensch, das Gesicht voll Dreck, Schweiß und Blut, die Kleider zerfetzt, in die Zelle gestoßen. Keuchend lehnte er sich an die Wand. Er schien eben verprügelt worden zu sein – nichts Ungewöhnliches, wenn man die Schnelljustiz bei uns in Amerika kennt.
Nach einer Weile kroch er zur Pritsche und legte sich nieder. An seinem Atem, der jetzt langsamer ging, merkte ich, daß er sich etwas beruhigt hatte. »Was war denn los?« fragte ich vorsichtig. Er schwieg. Er schien, wenn ich in dem Halbdunkel der Zelle richtig sah, ein Tramp oder Landarbeiter oder etwas ähnliches zu sein.
Plötzlich begann er zu reden. Das heißt, zunächst fluchte er und schnorrte mich um eine Zigarette an. Dann fragte er mich: »Was ist das, wenn man einen Mann, der eben einen Mord begangen hat, einen Mord an meinem Kameraden, tötet?«
»Es kommt darauf an, wen du da erledigt hast«, gab ich zur Antwort. »Bei uns läuft ein Haufen Leute, von denen jeder mehr als einen Menschen auf dem Gewissen hat, in schönster Freiheit herum. Wenn es ein Beamter oder eine Standesperson oder ein reicher Mann war, den du in eine bessere Welt befördert hast, dann ist es Mord. War es ein weniger wichtiges Individuum, dann ist es eben nur Totschlag oder Notwehr oder weiß der Teufel was.«
»Ich werd dir die Sache erzählen«, sagte er. Er erzählte es natürlich nicht so glatt, wie ich es hier wiedergebe. Sondern er unterbrach sich immer wieder durch einen Fluch, ein Ausspucken oder die Bitte um eine neue Zigarette. Am Ende hatte er mein ganzes Etui leer geraucht. Aber es lohnte sich.
»Ich hatte einen Güterzug nach Bismarck genommen. Ein Freund hatte mir gesagt, in Bismarck werde es Arbeit geben«, fing er an. Er war also ein Tramp, ich hatte recht gehabt. »Es war ein angenehmer Zug, ziemlich schnell, und er hielt auch nicht auf jeder Drecksstation. Ich kannte die Linie, war schon oft drauf gefahren, und ich wußte, wenn man von einem Bremser erwischt wurde, mußte man unweigerlich fünfzig Cent zahlen. Fünfzig Cent sind viel und wenig, je nachdem. Wenn man nur noch sechzig Cent hat, sind fünfzig eben ein Vermögen. Ich fuhr in einem halb leeren Kohlenwagen. Wenn ich mich hinkauerte, konnte mich kein Bremser sehen. Ich war schon ein ganzes Stück vorwärts gekommen, wir hielten auf einer kleinen Station, da kroch ein Mann über den Rand des Wagens, mit vieler Mühe, und ließ sich auf die Kohlen fallen. Er war entweder betrunken oder krank, aber als ich mich näher zu ihm setzte, roch er absolut nicht nach Schnaps; und außerdem war er wirklich erschreckend blaß. Die Blässe stach kalkig ab von seinem schmutziggrauen Bart, er war, meiner Schätzung nach, ein Kumpel aus den Bergwerken der Umgebung.
Aber er mußte gesehen worden sein, als er in den Wagen kletterte, denn noch auf der Station kam ein Bremser und verlangte die fünfzig Cent. Der Bremser war ein großer, robuster Kerl mit einem Gorillagesicht, über der eingeboxten Nase und dem verbissenen Mund blinkten bösartig ein Paar kleine, grünlich schimmernde Augen. Ich wußte, daß es keinen Zweck haben würde, mit dem Bremser zu diskutieren. Diese Banditen sind so versessen auf ihr Geld, daß man mit Engelszungen reden könnte – sie schmissen einen doch unbarmherzig vom Zug. Also gab ich ihm die fünfzig Cent und ärgerte mich. Aber der Kumpel hatte gar kein Geld. Der Bremser schrie und warf mit seinen Riesenkräften den Alten vom Wagen hinunter. Ein Wunder, daß sich der Alte nicht sämtliche Knochen brach. Er raffte sich aber sofort auf und bat den Bremser, der höhnisch auf dem Wagen stand, er möchte ihn doch mitfahren lassen. Er habe eine kranke Frau in Bismarck und sei selber krank; er weinte und rutschte auf den Knien vor diesem Tier, daß es mich in der Kehle würgte – alles umsonst. Je jämmerlicher der Alte bettelte, desto lauter und höhnischer lachte der Bremser, er schlug sich auf die Schenkel vor Lachen, er brüllte und kreischte, es war geradezu widerlich. Ich habe es selten bereut, kein Geld zu haben; aber diesmal hätte ich etwas darum gegeben, dem Bremser fünfzig Cent ins Gesicht werfen zu können und den Alten auf den Wagen zu heben. Es war vollkommen aussichtslos. Der Bremser hatte die Macht. Wie ein Athlet stand er grinsend auf den Kohlen, und dann hatte er einen Revolver in der Tasche.
In diesem Augenblick fuhr der Zug ab. Auf dem Gesicht des Alten spiegelte sich hilfloseste Verzweiflung. Plötzlich aber sprang er auf, klammerte sich mit letzter Kraft an den Wagen und kroch auf die Stangen.
Die Stangen? – Ja, das sind lange Eisenbänder, die unter dem Wagen entlang laufen und die den Boden stützen. In der Mitte des Wagens ungefähr senken sie sich ein bißchen, so daß ein Mensch gerade darauf liegen kann.
Da also war der Alte hingekrochen, und der Bremser stand auf dem Wagen. ›Lach nicht so!‹ schrie er mich wütend an, aber ich mußte doch lachen. Gar nichts konnte er machen, der Bremser, solange der Zug fuhr. Und der Zug würde kaum mehr halten bis Bismarck. Da sah ich, wie ein Gedanke auf dem Gesicht des Gorillas auf blitzte, ein boshafter, gemeiner Gedanke. Mein Lachen gerann mir um den Mund, als ich zusehen mußte, wie der Bremser sich den Arm voll Kohlenstücke lud, faustgroße, schwere Klumpen, wie er sich auf die Kupplung zum nächsten Wagen stellte, sich mit der einen Hand festhielt und mit der andern den Alten auf den Stangen bombardierte. Durch eine Ritze im Boden des Wagens konnte ich das Drama von Anfang bis Ende beobachten. Die schwarzen Brocken flogen um den Kopf des blassen alten Mannes, er kroch auf den Stangen herum, um sich zu decken, aber es nützte ihm nichts – seelenruhig stand der Bremser auf der Kupplung und zielte nach dem Mann.
Noch hatte der Alte die Kraft, mit seinem Kopf den Würfen auszuweichen, aber es war nur eine Frage der Zeit, wann er zu erschöpft sein würde, um sich zu rühren. Unter den Stangen brausten in unendlicher Reihe die Schwellen dahin. Ich sah, wie die müden, alten Hände des Kranken sich um eine Stange krampften, ich sah die grauenhafte Angst in seinen Augen, ich sah, wie die Kohlenbrocken seinen Kopf umsausten, ich wollte schreien, aber mir war die Kehle wie zugeschnürt. Und dann kam das Ende.
Die Augen des Alten schlossen sich, ganz still lag er auf den Stangen, die Schienen glitten unter ihm fort ins Unendliche, dick und blau trat an seiner Schläfe eine Ader hervor – und da traf das erste Kohlenstück. Plötzlich war sein ganzes Gesicht voll Blut, Blut rann in den grauen Bart, schweres, dunkelrotes Blut. Noch hielten sich die Hände an den Stangen fest, aber ganz langsam, furchtbar langsam lockerten sie sich schon – ich weiß nicht, ob der Alte geschrien oder um Hilfe gerufen hat, es war nichts zu hören – und ebenso lautlos war mit einem Mal der Körper von den Stangen verschwunden.
Der Bremser hatte den Tod seines Opfers noch nicht bemerkt. Den Mund in sadistischer Freude verzogen, bombardierte er noch immer den leeren Raum auf den Stangen.
Nun ja – und da konnte ich mich nicht mehr halten. Ich sah rot vor den Augen, blutrot. Wahrscheinlich bin ich auf den Bremser zugesprungen und habe den Überraschten von seinem Stand auf der Kupplung hinuntergeworfen. Seinen letzten Schrei habe ich gehört. Und es ist mir leichter dabei geworden.«
Der Tramp warf die letzte Zigarette in die Ecke und trat sie aus.
Der Besuch
Aufgeschlagen lag das Buch auf dem Tisch, genau an der Stelle, wo Annette ihre Lektüre unterbrochen hatte, als der Besuch ins Zimmer getreten war. Aber das Gespräch wollte nicht richtig in Gang kommen. Der Schauspieler stand am Fenster und starrte auf das triste Vis-à-vis der Mietshäuser.
Wie langweilig ist das alles, dachte er. »Ich weiß nicht, ob ich offen sein kann«, sagte er nach einer Weile erdrückenden Schweigens. Schmerzlich verzog sich dabei seine Stirn. Seine Augen waren gerötet, als hätte er in den letzten Stunden viel und entscheidend nachgedacht.
Annette schlug die Beine übereinander und zog den Rock übers Knie. Dann nahm sie ihre Puderdose aus der Tasche und begann sich ein wenig herzurichten, die kleinen Fältchen um den Mund zu überdecken, den Glanz auf der Nase. Dann sah sie mit großen Augen auffordernd zu dem Schauspieler empor. »Sprechen Sie ruhig, Martin, Ihnen kann ich doch nichts übelnehmen …« Und sie legte eine gewisse Wärme in das »Ihnen«.
»Ich weiß nicht, ob ich offen sein kann«, wiederholte der Schauspieler. »Wenn man gleich so mit der Sprache herausrückt, klingt alles so plump, so roh, und man verdirbt damit mehr, als einem lieb ist.«
Annette war eigentlich erstaunt gewesen, als Martin so plötzlich kam. Sie kannte ihn schon einige Zeit, er war ihr bei einem ziemlich wilden Atelierfest vorgestellt worden, als sie gerade Mokka trinkend allein in einer Ecke saß. Und er hatte sich auch später eigentlich nicht sehr um sie bemüht. Um so auffälliger erschien ihr seine Verlegenheit jetzt.
»Sehen Sie – das Wort«, sagte Martin, »in meinem Beruf weiß man die Wirkung jedes Wortes bis in die letzte Nuance zu taxieren – und man wird dann sehr vorsichtig damit.« Sie ist doch schon mindestens neununddreißig, dachte er dabei, wenn sie auch aufgefärbtes Haar hat. Man sieht es an der lockeren Haut ihrer Hände und an den Falten am Hals.
Und sie dachte: Ich muß es ihm etwas erleichtern. Ob er mich zu heiraten verlangt? Nein, heiraten werde ich ihn bestimmt nicht. Er ist zu jung. Und dann hat er ein so finniges Gesicht und unangenehm breite, rauhe Hände. Aber ein wenig mit ihm leben? Vielleicht … Möglicherweise ist er ganz amüsant. »Ach – ich bin vieles gewöhnt«, sagte sie also, »man erfährt dieses und jenes im Leben und wird nachsichtig gegen kleine Fehler – besonders wenn man sieht, wie aufgeregt der Partner des Gespräches ist …« Und sie lächelte ihm aufmunternd zu.
Nein – jetzt philosophiert sie noch! dachte Martin wieder, wie monoton. Aber sie mag ganz reizvoll sein – nun ja, es gibt wenig Frauen ohne irgendeinen Reiz. Wenn sie mir nur nicht solche Avancen machte! Ich mag das gar nicht … »Sehen Sie, Annette«, begann er dann zu sprechen, »natürlich wäre es äußerst wirkungsvoll, wenn ich Ihnen jetzt zu Füßen fiele – aber das kann ich nicht! Kann ich einfach nicht! Ich bin nun einmal so ein Mensch, es widerstrebt mir. Kniefälle macht man ja auf der Bühne genug …« Wie sich das schleppt, schleppt! ärgerte er sich.
Doch, ich würde ihn sogar heiraten, dachte Annette. Trotz seiner Fehler. Sei doch ehrlich, Annette, in deinem Alter – kannst du da noch groß wählerisch sein? Wie er sich windet! Er scheint mich wirklich zu lieben – armer dummer Junge – Martin – Und sie kostete schon jetzt die Zärtlichkeit aus, die sie für ihn in diesen Namen hineinlegen wollte. »Sie müssen doch nicht knien vor mir, Martin – ach wo – wir leben doch in einer sachlichen Zeit. Und ich verzeihe Ihnen von vornherein alles. Alles! hören Sie? Und nun sagen Sie mir ganz ruhig, daß …«
Sie wartete. Die Ruhe im Zimmer wurde ganz schwer. Die kleine Uhr auf dem Schreibtisch tickte übermäßig laut.
»Also seien wir sachlich«, raffte sich der Schauspieler auf. »Können Sie mir zweihundert Kronen borgen? – Sehen Sie, es war mir ja unangenehm – man pumpt eine Dame nicht an – aber ich kenne Sie doch schon lange – und ich habe Geld verspielt – und Ultimo ist erst in acht Tagen – und in den Vorschüssen stecke ich auch tief genug drin … Sind Sie mir böse?«
Annette war rot geworden. Sie stand auf, um sich abwenden zu können. »Aber nein!« sagte sie gepreßt. Ging zum Schreibtisch, schloß auf und gab dem Mann das Geld.
Darauf wurde der Schauspieler lebhafter, direkt liebenswürdig, plauderte, erzählte Anekdötchen vom Theater, und nach zwanzig Minuten verabschiedete er sich.
So lächerlich es auch war, Annette begann zu rechnen. Pro Minute zehn Kronen, dachte sie. Und sie stützte den Kopf in die Hände.
Das leichtfüßige Mädchen
Heute ist Berndt weggegangen. Nein, ich glaube nicht endgültig. Das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben. So sah es nicht aus. Aber ich fühle doch, wie wir uns auseinanderleben. Die Wärme seines Händedrucks verschwindet, und wenn wir Tee trinken, schaut er gelangweilt auf die Wand. Ich bin ihm nicht böse. Ich werde so langsam welk. Ich bin ja nicht dumm genug, um mir’s nicht einzugestehen. Wenn ich auf der Bühne bin, sieht man’s nicht. Scheinwerfer verjüngen. »Wie leichtfüßig sie noch ist!« sagt der Intendant. Aber er sagt »noch«!
Spiegel können lügen. Mein Körper lügt nicht. Das Herzklopfen nach der Gavotte! Was ist schon eine Gavotte? Kein Tempo, keine Sprünge. Und doch das Herzklopfen. Sie merken es auch. Ferry wird rücksichtsvoller. Er unterstützt mich. Er läßt Kapriolen aus, die er mit der andern machen kann, der andern – Mara. Ferry zeigt für einen Solotänzer viel Gemüt. Aber er zeigt es. Gegen früher! Meine Pirouetten werden kürzer, schwindlig wird mir auch …
Wie soll das weitergehen? Morgen kann ich verbraucht sein. Weggeworfen. Dann werd ich vorm Bühnennachweis stehen, grell bemalt, werde lachen und lächeln, mich drehen und flehen – und man wird doch die müden Ringe unter den Augen sehen, die Krähenfüße, die Falten von Nase zu Mund. – Wie das weitergehen soll? Wofür hat man denn Mara engagiert? Sie kann nichts. Seele fehlt ihrem Tanz. Gestaltung. Aber sie hat schöne Beine, spitze Brust, die Männer heben den Kopf, wenn sie tanzt – neunzehn Jahre ist sie alt, hat ein Kinderlachen, ein richtiges Kinderlachen! Mich macht das Lachen nervös.
Ich hasse alles und alle. Obwohl mir keiner Grund zu diesem Hasse gibt. Der Intendant hat noch nicht von Kündigung gesprochen. Aber er hat mir Mara schon auf den Hals gesetzt. Die Kronprinzessin! Es ist, als ob jeder wüßte, wie verbraucht ich schon bin. Ob die Garderobière vom Whisky in meiner Garderobe geklatscht hat? Ich muß mich auf pulvern vor jedem Auftritt. Ich kann nur noch tanzen wie im Fieber.
Wahrscheinlich habe ich auch Fieber. Wer hält das aus, sich dauernd aufzupeitschen, sich aufzubrauchen bis ins Letzte?
Nein, ich trete nicht ab. Jetzt noch nicht. Wie alt ist die Pawlowa gewesen? Gut – ich bin nicht die Pawlowa, dieses Nest ist nicht Europa – es ist einfach unvorstellbar, Schluß zu machen. »Wie leichtfüßig sie noch ist!« Schluß? – Nein!
Verrückte Tage sind. Um Weihnachten. Nachmittags Kindermärchen, abends Oper – Sonntag drei Vorstellungen! Im Januar wird man ausruhen können. Vielleicht ein paar Tage wegfahren, um Ski zu laufen. Dies ist die dritte Pyramidon-Tablette. Ich darf nicht schlappmachen! Mara tanzt meinen Part – dieser Sperling! Ein Jahr von der Schule – und mich verdrängen? Ich muß lachen. Es klingt gekrampft, mein Lachen, sagt die Kontrolle in mir. Die Muskeln an den Beinen sind noch fest. Ich bin noch schlank. Überall dieses »Noch«! Wer sagt »noch«?
Herrgott, ich muß ins Theater.
Mir ist schwindlig. Wie scheinheilig der Portier grinst! Hinaufhasten, drei Etagen, bis zur Garderobe. Vor der Tür muß ich stehenbleiben. Atmen, ganz ruhig, langsam atmen. Blut pocht in den Schläfen. Kann ich nicht mal mehr drei Treppen steigen? Nein, ich bin schon wieder ruhig. »Guten Tag, Frau Schmidt. Ist es schon spät, Frau Schmidt? Ja? – Schnell schminken! Und legen Sie das Kostüm zurecht. Passen Sie auf, daß das Gemüse nicht abgeht.« Da sitz ich, junge Kräuterfee, im Märchen tanzen die Möhren um mich, Rettiche und Kohlrabis – was für eine Sinnlosigkeit! »Wie ich aussehe, Frau Schmidt? Was fragen Sie? Seh ich nicht gut aus? Totenblaß? Macht nichts, Frau Schmidt, ich bin ganz gesund. Heiße Hände? Na ja, bin gerannt. Ich sollte absagen? Sind Sie verrückt? Ich wäre krank? Ich bin nicht krank! Ich kann nicht absagen! Nein, heute nicht und überhaupt nicht! Das wäre lächerlich, wegen dieses blödsinnigen Märchens? Fräulein Mara würde für mich einspringen? – Natürlich ist das Märchen keine Prestigesache. Aber bin ich einmal schwach – Verstehen Sie denn nicht, liebe, gute Frau Schmidt – ich darf nicht absagen. Gerade weil Fräulein Mara einspringt! Verstehen Sie mich doch …« Sie versteht. Sie streichelt mir übers Haar. Wie gut das tut. Stumm sein und gestreichelt werden. Als ob man ein Kind wäre. Wie alt sie wohl ist, die Schmidt? Mindestens zwanzig Jahre älter als ich – bin ja noch jung!
»Legen Sie Rouge auf, viel Rouge. Silber auf die Lider, die blonde Perücke, lichtblond.«
Jetzt bin ich jung, ganz jung. Fee – zwar nur Kräuterfee – aber Fee! Schweben werde ich, werde ihnen zeigen, daß ich noch schweben kann, Mara und den andern! Sagte ich »noch«?
»Sie zittern ja!« sagt der Inspizient. Ich muß mich tatsächlich anlehnen. Dann schickt er mich hinaus.
Es geht ja gut, alles. Herrlich gut! Ferry ist Gärtnerbursche, er tanzt um mich, er begehrt mich – rot ziehen die Möhren auf, weiß die Rettiche, braun die Kohlrabis – ich beherrsche sie, ich, die Kräuterfee! Wie blöd! Aber es freut mich. Da ist Mara, nur eine Möhre. Ferry starrt mich an. Was starrt er mich so an? Mein Gott, ich müßte ja schon schweben! Kreisen, drehen, auf die Spitzen! Der Kapellmeister stockt, die Reihen stocken! – Was zittern die Knie?! Los! Das Publikum wird unruhig. Ich höre die Kinder sprechen. Überdeutlich sehe ich alles, rote Möhren, weiße Rettiche, braune Kohlrabis und das Publikum, hundertköpfig, lauernd – das rückt auf mich zu, das will mich erdrücken – ich bekomme keine Luft mehr – schweben muß ich! Schweben! Aber das hängt sich an mich, zieht mich hinab auf die Bretter, wie lange soll ich das aushalten, dieses Gewicht? Dick steigt das Blut zu Kopfe, die Beine werden schwach, ganz leicht und schwach – da – ich kreise doch! Wer kreist? Es kreist um mich, und ich schwebe endlich! Endlich!
Der Vorhang senkt sich oder die Nacht.
Als die Nacht sich hebt, sehe ich nur das Gesicht der Schmidt. Sie reibt mich mit Eau de Cologne. Dann der Arzt, der Intendant, Ferry, Mara. »Es ist nichts weiter«, sagt der Arzt.
»Ein wenig ausspannen, ein paar Tage Ruhe. Sie bekommen Urlaub«, sagt der Intendant. »Fräulein Mara übernimmt Ihren Part.«
Sie sehen sich an, es ist wie eine Verschwörung.
Mara lächelt.
»Nein!« sage ich. »Ich bleibe. Arbeite. Tanze.«
»Sie sind krank.«
»Ich bin nicht krank, Herr Doktor! Ich tanze.«
»Eine Störung ist genug«, sagt der Intendant. »Sie spannen aus.«
Er dreht sich um, geht. Alle gehen, bis auf Mara. Mara, die Möhre. Die Möhre setzt sich zu mir, spricht ein paar Worte, will trösten. Oh, ich kenne sie! Jetzt genießt sie meine Niederlage, feiert ihren Sieg! Sie soll gehen, denke ich. Hinaus, denke ich, sonst passiert etwas. Dieses Zinnoberrot reizt mich, diese Stimme reizt mich, dieser Trost reizt mich! Wie schön, denke ich, meine Hände um ihren Hals zu legen, diesen dünnen, glatten Hals, zuzudrücken, zu würgen, bis das Gesicht rot ist wie das Kostüm. Hinaus! Laß mich allein!
Aber ich lächle. Die Möhre Mara lächelt. Die Lüge lächelt.
»Den Whisky, Frau Schmidt!«
Die Frau, die ihren Schwiegervater kochte
»Und jetzt«, sagte Redakteur Bronstein, der in einem Korbsessel saß und die kanariengelbbeschuhten Füße auf den Schreibtisch gelegt hatte, »und jetzt schreiben Sie: Wie unser Korrespondent aus Bukarest meldet, hat sich die dortige Polizei mit einem geradezu schaurigen Kriminalfall zu beschäftigen. Im Abfallkasten eines Hauses, in dem die Witwe Cademea wohnt, fand der Portier menschliche Knochen. Er meldete den Fund der Polizei. Nach längeren Nachforschungen gelang es der Polizei, die Witwe Cademea zum Geständnis zu bringen, daß sie ihren Schwiegervater ermordet und sein Fleisch gekocht habe. Die Cademea lebte mit ihrem Schwiegervater, der gleichfalls Witwer war, zusammen. In der letzten Zeit trieb sich der beinah Sechzigjährige merkwürdig viel außer Haus herum, die Cademea fand heraus, daß er ein Verhältnis mit einer sehr übel beleumdeten Person begonnen hatte. In einem Anfall von Eifersucht, gestand die Cademea, habe sie das Furchtbare getan. Sie brach nach ihrem Geständnis vollkommen zusammen. Punkt.«
Die Sekretärin richtete ihre naiven himmelblauen Augen vom Stenogrammblock auf den Redakteur Bronstein. »Aber davon ist doch nicht ein Funken wahr?« fragte sie.
»Nein, mein Kind«, lächelte Bronstein.
»Und diesen Unsinn soll man den Warschauern gedruckt vorsetzen?«
»Warschau ist groß«, sagte Bronstein und streichelte seiner Sekretärin über die bräunlich gepuderten Wangen, »wieviel kann da geschehen! Und Bukarest ist groß, und die Welt ist noch größer als Warschau und Bukarest – was kann da in der Welt alles passieren! Sieh mal, Kleines, ich werde dafür bezahlt, daß ich die Rubrik ›Blick in die Welt‹ mache. Also mache ich sie eben! Außerdem«, und er senkte seine Stimme, als habe er der Sekretärin ein Geheimnis mitzuteilen, »es ist mir schon oft so gegangen: Ich bringe eine Meldung, schön frei erfunden – Erdbeben in Polynesien, vierhundert Tote, über dreitausend Verletzte – soll mir Polynesien dementieren, daß die Erde gar nicht daran gedacht hat zu beben! – und wirklich, zwei Tage später meldet die Telegraphenagentur, es war wirklich ein Erdbeben, zwar nicht in Polynesien, aber auf Formosa! Es ist, als zöge eine Falschmeldung in der Zeitung das richtige Geschehen nach sich – beinah gespenstisch, was?«
Die Sekretärin sagte nichts. Bronstein war als etwas sonderbar bekannt.
Als Herr Codreanu, Lokalredakteur in Bukarest, am anderen Morgen den »Warschauer Abendkurier« las, schlug er mit einem Mal heftig und blitzenden Auges auf den Tisch. »Donnerwetter«, rief er, »bei uns? Frau kocht eigenen Schwiegervater? Und davon weiß ich nichts? Ja, ist denn die Polizei vollkommen vertrottelt, mich bei so einer Sache aufsitzen lassen? Muß man sich von einem lumpigen polnischen Korrespondenten übertrumpfen lassen?!« Was tut ein Redakteur, wenn er sich ärgert und gerade keine freien Mitarbeiter zur Hand hat, um sich an ihnen auszutoben? Er telefoniert. »Hallo – dort Polizeipräsidium? Hier ›Nachmittag von Bukarest‹. Was ist mit der Frau Cademea, die ihren eigenen Schwiegervater ermordet und gekocht hat? Warum erfahre ich nichts? – Sie wissen von nichts, Herr Kriminalrat? Sie kennen gar keinen Fall Cademea? Fragen Sie doch noch mal nach, ich habe hier die Meldung eines Warschauer Blattes aus Bukarest. Nein? – Bestimmt nicht? – Ich danke Ihnen, entschuldigen Sie die Störung – vielleicht eine Verwechslung? Budapest, nicht Bukarest? – Möglich, möglich – besten Dank. Adieu.«
Herr Codreanu kaute an den Fingernägeln, was ein Zeichen war, daß er ausführlich nachdachte. Da die Meldung aber wirklich zu schön und zu sensationell war, um sie in dem riesigen Redaktionspapierkorb verschwinden zu lassen, verlegte Herr Codreanu den Tatort nach Budapest, aus der Schwiegertochter wurde eine Nichte, die ihre Tante umgebracht und gekocht hatte, nicht aus Eifersucht, sondern weil die Tante ihr gedroht hatte, sie zu enterben. Die Mörderin bekam den schönen Namen Krethony und ging als solche in die wahrheitsliebenden Spalten des »Nachmittags von Bukarest« ein.
Bei der Budapester »Stimme um Mitternacht« wurde der Tatort nach Paris verlegt, aus Frau Krethony wurde ein Herr Bonnet. Herr Bonnet hatte, laut »Stimme um Mitternacht«, seinen Großonkel umgebracht und gekocht, weil dieser Großonkel nicht großmütig genug gewesen war, die erheblichen Spielschulden des Herrn Bonnet stillschweigend zu decken. »Stimme um Mitternacht« hing außerdem noch einen moralischen Absatz an die Mordmeldung, in dem viel vom Verfall der Sitten in der heutigen Jugend die Rede war. »Gott sei Dank«, schrieb »Stimme um Mitternacht«, »kommen derartige Mordaffären in Ungarn nur höchst selten vor.«
»Paris-Soir« hingegen ließ, nach mehrmaliger Nachfrage auf der Polizeipräfektur, und nachdem man sich vergewissert hatte, daß der in Budapest kreierte Herr Bonnet mit dem Stawisky-Bonnet nichts zu tun haben könnte, die Bluttat in Wien geschehen. Die Überschrift, die »Paris-Soir« gab, hieß »Ödipus in Wien«, und der Täter hatte den schönen Namen Gerstlmayer. Herr Gerstlmayer ermordete und kochte seinen eigenen Sohn, weil dieser Sohn mit seiner eigenen Mutter, also mit der Frau des Mörders Gerstlmayer, und so weiter. Nicht zu Unrecht, glossierte »Paris-Soir«, sei Herr Professor Freud in Wien groß geworden …
In Wien nahm sich die »Neue Freie Presse« des Falles an, schrieb über die Meldung »Neue Freie Presse – Times Sonderdienst«, ließ die Tat wiederum in Bukarest geschehen, machte, in richtigem Gefühl für das Wahrscheinliche, aus dem blutgierigen Herrn Gerstlmayer eine Frau, die ihren verwitweten Schwiegervater aus Eifersucht um die Ecke gebracht hatte, und taufte die Mörderin auf den Namen Saderescu. Gekocht wurde die Leiche auch in der »Neuen Freien Presse«.
Es waren im ganzen noch nicht acht Tage verstrichen. Herr Bronstein in Warschau kam verschlafen in seine Redaktion. Blätterte die Zeitungen durch, suchte nach Meldungen für den »Blick in die Welt«. Was bringt Wien? gähnte er und schlug die »Neue Freie Presse« auf.
Wie elektrisiert fuhr er von seinem Korbsessel hoch, klingelte nach seiner Sekretärin. »Was hab ich Ihnen gesagt?« zeigte er triumphierend auf die Wiener Meldung. »Man muß nur etwas erfinden – sehen Sie, liebes Kind, die Presse macht das Schicksal! Lesen Sie – lesen Sie nur! Frau ermordet und kocht ihren Schwiegervater, mit dem sie zusammengelebt hat. Schwiegervater betrügt sie mit einer anrüchigen Person … haargenau, wie ich’s erfunden habe – nur daß die Mörderin nicht Cademea, sondern Saderescu heißt …«
Raffaela
»Ich kann Ihnen die Sache natürlich erzählen«, sagte der Bildhauer Felix Wengen und nippte an seinem Rotwein, »Sie haben ja Raffaela auch gekannt – nur wird es nicht sehr erquicklich sein …« Er verzog seinen schmalen Mund und kniff die Augen zu, als schmeckte ihm der Wein bitter – aber der Wein war sehr süß, Chianti.
»Erinnern Sie sich, wie wir am Achensee zusammen waren?« fuhr Wengen fort. »Dieses sonderbar türkisblaue Wasser. Manchmal segelten wir auch zusammen. Raffaela lag im Boot und hielt die Augen weit offen; so ein zartes, durchsichtiges Wesen war Raffaela, beinah unwirklich. Wir hatten alle nicht den Mut, uns ihr zu nähern, ich wenigstens hatte Angst, sie könnte nach irgendeiner Bewegung sich auflösen wie ein spinnwebfeines Traumbild. Ich schwärme nicht. Raffaela war so, Sie werden es wohl auch gespürt haben. Um so sonderbarer war es – Sie fuhren gerade ab, als Signor Giorgio kam –, daß Raffaela diesem Italiener eigentlich ohne weiteres folgte; dabei war Giorgio weder besonders schön noch sonst irgendwie reizvoll, er mochte schon nahe an die Fünfzig sein. Er stammte aus einer alten Patrizierfamilie, war der letzte des Geschlechts, etwas dekadent sehr Grandseigneur, und bewohnte einen alten Palazzo in Venedig Das erfuhren wir von Signor Giorgio, er war ein paarmal mit uns zusammen, trank mäßig, schwieg viel und strich mitunter mit gepflegter Hand über sein ebenso gepflegtes, dichtes graues Haar. Vielleicht hatte er Qualitäten, die Raffaela lockten, vielleicht zog sie die Ruhe und die generationenalte Abgeklärtheit Giorgios an, vielleicht war es Venedig und der alte Palazzo, die ihr eine Märchenwelt, gerade recht für dieses selbst so traumhafte Wesen, zu versprechen schienen – sie feierten ihre Verlobung noch am Achensee und fuhren dann, beide mit demselben etwas traurigen Lächeln, nach Venedig.«
Wengen faltete seine muskulösen Hände um den Kelch des Glases. »Es vergingen zwei Jahre fast, ich hörte nichts mehr von ihnen, es kamen ein paar große Aufträge für mich, ein paar schwere Geldverdiener ließen ihre unsterblichen Physiognomien in Stein hauen, und da ich sonst nicht allzu verschwenderisch bin, leistete ich mir eine Reise nach Italien. Wollte die Luft da wieder mal kosten, verstehen Sie, und die großen Plastiken besuchen, mich wieder erschüttern lassen von der Kunst der Meister. In Venedig sitze ich vor San Marco, die Touristen wimmeln um mich herum und verschandeln die Landschaft durch ihre Anwesenheit, ich will eben gehen – da klopft mir jemand auf die Schulter. Giorgio. Er war erstaunlich herzlich – schließlich war ich für ihn doch nur eine flüchtige Sommerbekanntschaft –, lud mich sofort ein, Raffaela werde sich ungeheuer freuen … Und sie freute sich offenbar auch, es ging wie ein Leuchten über ihr Gesicht, als sie mir die Hand gab. Raffaela sah nicht gut aus. Sie war noch zarter, noch durchscheinender geworden, ging mit langsamen, müden Schritten zwischen den schweren Mauern des Palazzo umher. Die Luft, verstehen Sie, diese etwas brackige Luft, die von den Kanälen aufsteigt, die dumpfe Atmosphäre, in allen Ecken lauert Vergangenheit, die dunklen Möbel und die dunklen Teppiche und der in diesem Rahmen unheimlich alt wirkende Mann – das mußte sich um ihre Brust legen wie ein Alp und Raffaela langsam erdrücken. Sie lebten wohl sehr einsam, die beiden … Giorgio führte mich in ein großes, gut gehaltenes Zimmer. Eine Tür führte zu einem Balkon, unten stand das schwarze Wasser eines Kanals, abends spiegelten sich still die Sterne. ›Sie werden mich doch nicht beleidigen wollen und, wenn Sie in Venedig sind, im Hotel wohnen?‹ Und dann ergab sich, daß verschiedenes an dem Palazzo reparaturbedürftig war, ein paar Figuren am Sims des Daches, im Treppenhaus eine sehr schöne Plastik des Frühbarock: Engel, die um eine gefallene Seele trauern – er hätte sowieso schon lange einen Bildhauer gesucht, der das alles in Ordnung bringen könnte, nun schneite ich ihm ins Haus, welches Glück! Ich blieb. Vor mir selbst hatte ich natürlich die Ausrede, ich hielte mich in diesem Haus meines Berufes wegen auf, so leichtes Geld verdiene man nicht alle Tage. Aber wenn ich ehrlich war – die alte, halb vergessene Geschichte in mir, die kleine, wehe Narbe war wieder aufgebrochen. Und wieder das gleiche Gefühl: Um Gottes willen, nicht anrühren diese zerbrechliche Frau! Und besonders jetzt, da sie, vielleicht schon lange, eine seelische Krise durchmacht. – Ich nehme, was sich mir bietet. Schade, sage ich mir, um jede Lust, die man sich entgehen ließ, die Gelegenheit kommt nicht wieder. Und doch – Sie kannten Raffaela, und Sie werden mich verstehen – diese Scheu. Wenn ich nüchtern dachte, überlegte ich mir: Giorgio nimmt sie doch auch, dann und wann – warum nicht ich? Denn daß es sein konnte, sah ich sehr bald. Man merkt das ja, an einer Berührung der Hand, einem Blick, und Raffaela hatte sehr ausdrucksvolle Augen. Dieser Giorgio muß eine große Enttäuschung gewesen sein, manchmal, wenn Raffaela neben mir ging oder stand, überfiel sie ein leichtes Zittern; aber sie schien doch an ihm zu hängen, wenn nicht ihn zu lieben, ihn oder die Versponnenheit ihres ganzen Lebens in dem Palazzo – sonst wäre Raffaela längst davongelaufen.
Ich hielt mich zurück. Ich empfand Scheu – und heute, wo ich das Ende weiß, glaube ich, auch eine gewisse dunkle Vorahnung gehabt zu haben – aber vielleicht sage ich das nur hinterher, um die Last, die auf mir liegt, mir noch schwerer zu machen …
Es war ein warmer Sommerabend, wie heute, ganz wie heute. Die Stickluft von Venedig war mit dem Dunkelwerden etwas leichter geworden, wir saßen zu dritt im großen Speisesaal, Giorgio las in einer alten Chronik, die er zu bearbeiten und herauszugeben gedachte, Raffaela träumte vor sich hin.
›Ja‹, sagte ich, ›nun bin ich bald fertig. Nur noch die trauernden Engel, das wird ungefähr acht Tage dauern, dann muß ich weiterfahren. Siena, Ravenna – ich will die großen Städte möglichst vermeiden.‹
›Sie wollen schon fort, Felix?‹ fragte Raffaela.
›Ich muß wohl …‹, sagte ich.
Dann ging ich hinaus, um irgend etwas aus meinem Zimmer zu holen. Ich trat auf den Balkon, er war ganz leer, der Mond schien hell und warf schwarze, scharfe Schatten. Auf der Treppe begegne ich plötzlich Raffaela. Ihre Haare glänzen. Wir stehen uns gegenüber, sekundenlang, stumm, ohne Bewegung. Und dann konnte es gar nicht anders sein, sie warf sich an meine Brust, und ich küßte ihren heißen Mund. Merkwürdig heiß war der Mund. Wie schlank sie doch war! Dann löste sie sich von mir, ganz zart, ihre Augen schwammen.
Sie würde kommen in der Nacht, das wußte ich. Ohne daß ein Wort darum gefallen wäre, aber man weiß das eben.
Und sie kam. Sie trug nur einen leichten Überwurf. Es ist sonderbar, in den Momenten größter Erregung sieht man plötzlich irgendeine völlig unwichtige Kleinigkeit mit beunruhigender Schärfe. Hellblau war der Überwurf, mit ein paar dunkelblauen, aus schweren Fäden gestickten Blumen.
Wir sprachen die törichten Worte, die man zu sprechen pflegt. Und jedes Mal scheinen sie einen besonderen, tiefen Inhalt zu haben … Raffaela weinte auch, ein wenig, sie war eben sehr sensibel. Ich sprach ihren lieben Namen sehr oft, es war wie ein Streicheln.
Schritte. Raffaela schrickt zusammen. Reißt den Überwurf um die Schultern, stürzt auf den Balkon.
Giorgio klopft und tritt gleich danach ein. ›Guten Abend‹, sagt er, ›ich konnte noch nicht schlafen, und ich hörte hier jemanden sprechen.‹ Er lächelt sein dekadentes Vergangenheitslächeln. ›Sie haben ein Mädchen da?‹ fragt er. »Wollen Sie es mir nicht vorstellen – ich kann doch nicht glauben, daß Sie Monologe halten …‹
»Sie müssen es schon glauben‹, erwidere ich heiser. »Es ist niemand außer uns beiden hier.‹
»Scherzen Sie doch nicht, Signor Wengen! Warum gönnen Sie mir kein Vergnügen …?‹ Und da, mit einem Male, schießt ihm der Verdacht durch den Kopf. Ich sehe trotz des Dunkels, wie blaß er wird. »Wo ist sie?‹ schreit er. Er geht suchend im Zimmer umher, naht sich dem Balkon – ich stelle mich vor die Tür.
»Lassen Sie mich durch!‹
»Nein.‹
»Warum nicht?‹ In seinen Augen glimmt es gefährlich auf.
»Ich – ich vertrage keine nächtliche Zugluft.‹
»Lächerlich!‹ Er stößt mich mit überraschender Kraft zur Seite, reißt die Tür auf, tritt auf den Balkon – als er wieder ins Zimmer kommt, lacht er schon. »Sie halten mich ja zum Besten, Signor Wengen. Sie Schäker!‹ Er klopft mir burschikos auf die Schulter. »Sie Schäker …!‹«
Golem anno 35
Professor G., der Röntgenologe, drehte sich aufatmend um und sagte zu seiner Assistentin: »Bitte, meine Liebe, reichen Sie mir doch die Zigaretten herüber.« Er zündete sich eine an. »So weit wären wir fertig mit dem Kerl. Die objektiven Voraussetzungen des Lebens sind da. Chemisch wenigstens. Die Zusammensetzung der Materie entspricht genau der der lebenden Zellen. Fehlt nur noch das Leben selbst …«
»Warum haben Sie eigentlich den Haufen Materie wie einen Menschen geformt?« fragte die Assistentin.
Der Professor blieb eine Weile stumm, dann sagte er heiser: »Ach – eigentlich unbewußt. Spielerei. Atavistische Erinnerungen.«
Die Assistentin lächelte. Sie wußte, es war mehr. Sie glaubte an die Genialität ihres Lehrers.
»Schalten Sie den Strom ein«, befahl der Professor übertrieben ruhig.
Sie spürte, er wollte, daß seine Ruhe sich auf sie übertrage. Trotzdem zitterten ihre Hände, als sie den Haupthebel nach unten drückte, als der Strom knisternd durch die Transformatoren fuhr und durch die gläserne Isolierschale, unter der der menschenähnliche Kloß gehäufter Chemikalien lag, ein dünnes bläuliches Strahlen zu sehen war.
Von irgendwoher schlug es elf Uhr. »Gehen Sie jetzt«, sagte Professor G. »Sie haben fünfzehn Stunden Arbeit hinter sich. Sie werden jetzt zwei Stunden schlafen, dann kommen Sie, mich abzulösen.« Er erwartete, daß sie sich fügen werde. Wortlos drehte er an einem Regulator. Das Licht unter dem Glase wurde rötlich. »Also, in zwei Stunden!«
Die Assistentin ging ins Nebenzimmer und warf sich aufs Sofa. Plötzlich spürte sie die Müdigkeit, die sich den ganzen spannenden Tag nicht bemerkbar gemacht hatte, wie ein schweres Gewicht auf ihrem Gehirn. Doch konnte sie nicht schlafen. Nebenan geschah vielleicht das Wunder! Dann zogen ihr allerhand Gedanken durch den Kopf. Der junge Schriftsteller Landau, der sie liebte und noch weniger Geld hatte als sie, weshalb sie so vernünftig war, ihm nein zu sagen. Der Professor, der seinem Lebenserfolg entgegenwartete – vielleicht fiel auch für sie etwas ab. Und dann … Nein, sie konnte nicht schlafen. Sie zählte die Minuten. Die Viertelstunden. Punkt eins öffnete sie die Tür zum Laboratorium.
Das Licht unter dem Glas war jetzt von grünlich-gelber Farbe, der Kloß schien dunkelrot zu glühen. Die Funken, die von Pol zu Pol sprangen, gaben ein ziehendes, sirrendes Geräusch von sich.
Der Professor sah gespannt auf sein Werk. »Noch nichts«, konstatierte er. »Wir haben jetzt achttausend Volt.«
Die Assistentin prüfte die Luft. Ein leichter Ätherdunst war zu spüren. »Was ist das?« fragte sie.
»Die Luft verändert sich bekanntlich ein wenig bei derart starken elektrischen Energien«, dozierte der Professor milde. »Nichts Beunruhigendes. Sie müssen aufpassen, daß die Farbe der Materie nicht noch heller wird. Dann beginnt der Verbrennungsprozeß. Sollte sich die Farbe also zu verändern anfangen, gehen Sie sofort mit dem Strom herunter. Im übrigen rufen Sie mich – Sie wissen schon, wann …«
Die Assistentin nickte. Das Wunder!
Sie saß im Stuhl und wartete. Der Ätherdunst war angenehm. Wie ein milder Rausch. Sie fühlte sich froh und leicht, zum Schweben leicht. Eben wollte sie, nur auf ein paar Sekunden, die Augen schließen, da rührte sich der Kloß. Plötzlich waren Augen da, kleine, stumpfe Augen. Hände, die nach irgend etwas tasteten. Ganz leicht hoben sie den gläsernen Sarg – das Lebewesen richtete sich auf, mit einer Handbewegung schob es die einhüllenden Strahlen beiseite, der Strom war unterbrochen, es wurde ganz still.